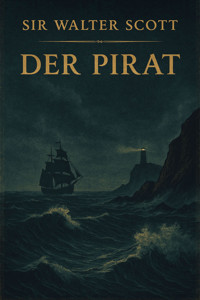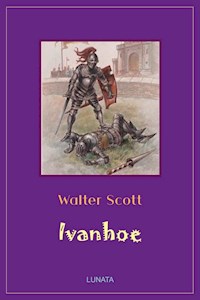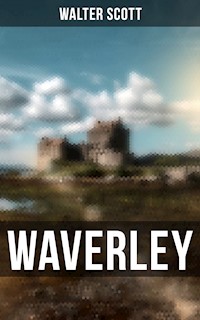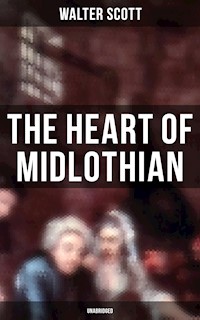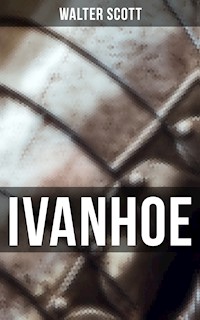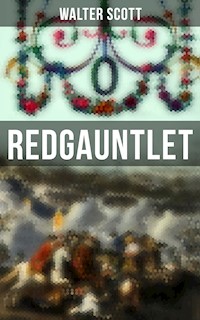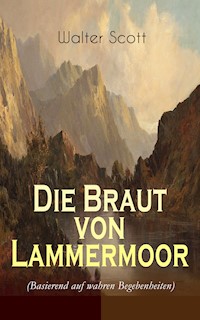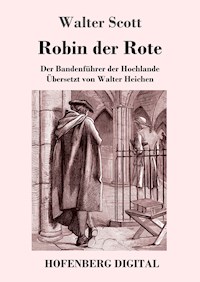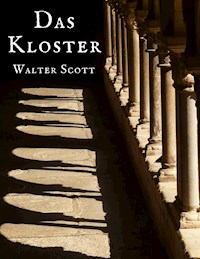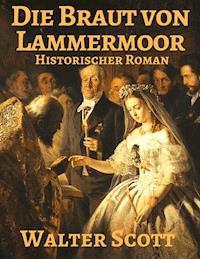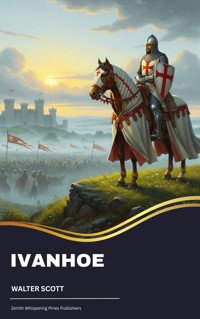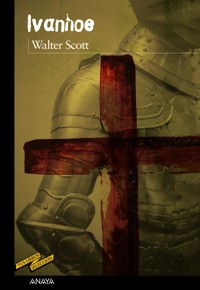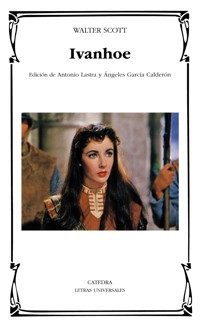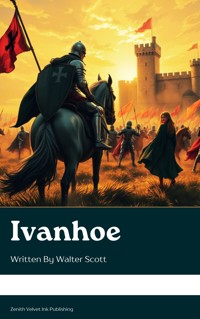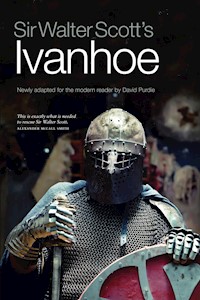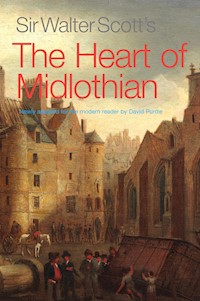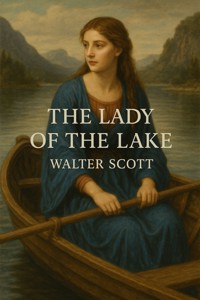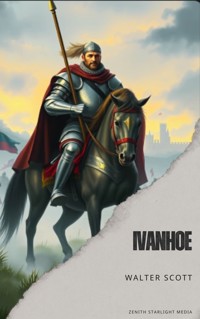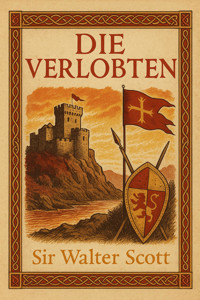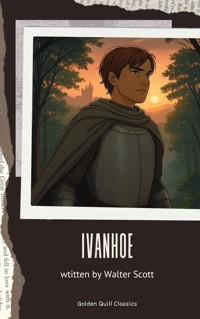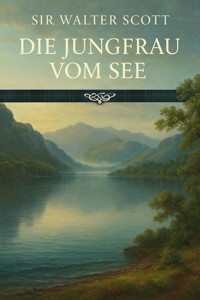Der Pirat
Sir Walter Scott
Impressum © 2025 Michael Pick
Alle Rechte vorbehaltenDie in diesem Buch dargestellten Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.CopyrightMichael PickImkenrade 15g23898
[email protected]Der Pirat
Sir Walter Scott
Einführung des Herausgebers
Die Umstände, unter denen „Der Pirat“ entstand, sind für den Herausgeber von besonderem Interesse. Er hat viele Male an der alten Kommode in Chiefswood herumgekritzelt, auf der Sir Walter an seinem Roman arbeitete, und saß bei Sommerwetter unter dem großen Baum auf dem Rasen, wo er Erskine, Lockhart und dessen Frau die neuen Kapitel vorlas, während der Fluss aus dem Rhymers Glen an ihnen vorbei murmelte. Das Häuschen von Chiefswood ist durch den Anbau eines Giebelflügels aus dem gleichen roten Stein wie der ältere Teil so kaum verändert, dass der Ort, im Schutz des Eildon Hill, so bezaubernd und ruhig bleibt, dass man dort die goldene Zeit leicht heraufbeschwören kann. Ich denke an den Tag zurück, als Mustard und Spice durch das schattige Tal liefen und die Ankunft des Sheriffs selbst ankündigten. Glückliche Stunden – vorbei, wie jener Sommer 1821, von dem Lockhart mit einer umso rührenderen Ergriffenheit spricht, weil er so selten war,
„... die erste von mehreren Staffeln, die mir als die glücklichste meines Lebens in Erinnerung bleiben wird. Wir waren nahe genug an Abbotsford, um oft an seiner glänzenden Gesellschaft teilzunehmen. Dennoch konnte ich dies tun, ohne der Sorge und Erschöpfung des Geistes ausgesetzt zu sein, die der tägliche Empfang neuer Besucher für die gesamte Gesellschaft mit Ausnahme von Sir Walter selbst mit sich brachte. Aber in Wahrheit war auch er nicht immer vor den Ermüdungen geschützt, die mit einer solchen Art offener Hausführung einhergingen. Sogar sein Temperament sank manchmal unter dem feierlichen Applaus gelehrter Dumpfheit, dem faden Entzücken geschminkter und mit Perücken bekleideter Witwen, der Gier, mit der schlecht erzogene Ausländer ihre Fragen auf ihn drängten, und dem pompösen Geflüster herablassender Magnaten. Wenn es ihm so schlecht ging, stellte er hin und wieder fest, dass er auf einem abgelegenen Teil seines Anwesens etwas ganz Besonderes zu erledigen hatte, und erschien zuvor in der Hütte im Tal. Die Bewohner waren am Morgen aufgeregt. Das Klappern von Sibyl Greys Hufen, das Jaulen von Mustard und Spice und sein eigener freudiger Weckruf unter unserem Fenster waren das Zeichen dafür, dass er seine Fesseln gesprengt hatte und vorhatte, es sich an diesem Tag in unserem Häuschen gemütlich zu machen. Nach dem Frühstück nahm er ein Zimmer im Obergeschoss in Besitz und schrieb ein Kapitel von „Der Pirat“; und dann, nachdem er sein Paket für Mr. Ballantyne zusammengestellt und abgeschickt hatte, machte er sich auf den Weg zu Purdie, wo die Förster bei der Arbeit waren. Die ständige und eifrige Freude, mit der Erskine den Fortschritt der Geschichte verfolgte, hat einen tiefen Eindruck in meiner Erinnerung hinterlassen. Tatsächlich hörte ich so viele seiner Kapitel zuerst von ihm aus dem Manuskript gelesen, dass ich das Buch jetzt nie aufschlagen kann, ohne zu denken, dass ich seine Stimme höre. Sir Walter gab ihm beim Frühstück die Seiten, die er am Morgen geschrieben hatte, und sehr häufig ging Erskine, während Scott wieder in seinem Arbeitszimmer arbeitete, nach Chiefswood, um das Vergnügen zu haben, sie meiner Frau und mir unter unserem Lieblingsbaum vorzulesen.[1]“
„Der Baum lebt noch!“ Dieses lange Zitat aus einem Buch, das im Allgemeinen zu wenig gelesen wird, rechtfertigt sich durch sein Interesse, da es sich auf die Komposition von „Der Pirat“ im Frühherbst 1821 bezieht. In „Der Pirat“ griff Scott auf seine Erinnerungen an den Pirat der Orcaden, den er bei einem Rundgang mit den Commissioners of Lighthouses im August 1814 sah, unmittelbar nach der Veröffentlichung von „Waverley“. Sie wurden von Mr. Stevenson begleitet, dem berühmten Ingenieur, „einem äußerst höflichen und bescheidenen Mann, der für seine wissenschaftlichen Fähigkeiten berühmt ist.“[2] Es versteht sich, dass Mr. Stevenson auch ein Tagebuch geführt hat, und dies wird von seinem angesehenen Enkel, Mr. Robert Louis Stevenson, Autor von „Kidnapped“, „The Master of Ballantrae“ und anderen Romanen, herausgegeben werden, in denen Scott ein besonderes Genie erkannt hätte.
Sir Walters Tagebuch, das zusammen mit „Der Pirat“ gelesen wird, bietet eine höchst bemerkenswerte Studie seiner Kompositionskunst. Man kann sagen, dass er in Shetland und Orkney kaum ein Naturmerkmal, ein Denkmal, einen Brauch, einen Aberglauben oder eine Legende wahrnahm, die er nicht in das magische Netz seiner Romanze einwob. Im Tagebuch erscheinen all diese Dinge als sehr gewöhnlich. In „Der Pirat“ werden sie im Licht der Fantasie verklärt. Scott erzählt die Geschichte von Gows Werdegang und seiner Verlobung mit einer Inseldame. Die Beobachtung zeigt ihm einige Landzungen, Piktenhäuser, zerstörte Türme und alte Steindenkmäler, und seine Figuren versammeln sich in rhythmischer Anordnung um diese herum, wie die Tänzer beim Schwerttanz. Wir können uns vorstellen, dass Cleveland, wie Gow, ursprünglich dem Tod zugedacht war und dass Minna, wie Margaret in der Ballade von Clerk Saunders, ihren Trost aus der Hand ihres toten Liebhabers wiedererlangen sollte. Aber sollte Scott das beabsichtigt haben, ließ er Milde walten und gab nach.
Wenn wir die Ereignisse im Tagebuch mit dem Roman in Verbindung bringen, finden wir auf der allerersten Seite von „Der Pirat“ die Erwähnung des Rastplatzes oder „Rosts“ von Sumburgh, des strudelnden Gezeitenstroms, den er so verabscheute, weil es ihn seekrank machte. „Alle Landsleute sind kränker als krank, und unser Vizekönig Stevenson ist unruhig. Es wird vorgeschlagen, ein Feuer auf Sumburgh Head zu errichten. Fitful Head ist höher, liegt jedoch im Westen, aus dem nur wenige Schiffe kommen. Was Sumburgh Head betrifft, so kletterte Scott hinauf, rollte einen Felsen vom Gipfel hinunter und fand es ‚eine schöne Szene, um eine Ode an das Genie von Sumburgh Head oder eine Elegie auf einen Kormoran zu verfassen – oder über Wahnsinn zu schreiben oder zu sprechen, in jeder Form, in Prosa wie in Poesie.‘ Aber ich machte meinen aufgeregten Gefühlen auf einfachere Weise Luft: Ich ließ mich sanft auf den steilen grünen Abhang hinabgleiten, der zum Strand führte, rutschte ein paar Hundert Fuß hinunter und empfand die Übung als völlig ausreichenden Ausweg für meine Begeisterung.
Sir Walter war sicherlich nicht das, was er Mrs. Hemans als „zu poetisch“ vorwarf.
Im ersten Kapitel sind seine Giffords, Scotts (aus Scotstarvet, dem Fifeshire-Haus, nicht aus dem Border-Clan) und Mouats eben jene Edelleute, die ihn auf seiner Reise bewirteten. Seine „Plantie Cruives“ im Roman sind im Tagebuch vermerkt. „Pate Stewart“, der unterdrückerische Earl, wird ausführlich im „Tagebuch“ beschrieben. „Sein riesiger Turm bleibt wild und verlassen – seine Kammern sind mit Sand gefüllt und seine eingerissenen Mauern und Zinnen ermöglichen ungehinderten Zugang zum tosenden Meereswind.“ So schrieb Scott in seiner letzten Rezension für das „Quarterly“ – einer Besprechung von Pitcairns „Scotch Criminal Trials“ (1831). Die Trows oder Drows, die Feenzwerge, deren Namen er mit „Dwerg“ verband, obwohl Trolle eher ihre spirituellen und sprachlichen Vorfahren zu sein scheinen. Die Affäre mit dem Geistlichen, der für einen Pecht (Pikten) gehalten wurde, ereignete sich tatsächlich auf der Reise, und Mr. Stevenson, der den armen Pecht schon einmal getroffen hatte, konnte seinen Charakter aufklären.[3] An derselben Stelle wird der Krake erwähnt: Er war seit beinahe zwei Wochen sichtbar, aber kein Seemann wagte es, sich ihm zu nähern.
Er lag vierzehn Tage oder länger in Sicht,Aber der Teufel hat einen Shetländer vom Ufer vertrieben.Wenn Eure Gnaden meinen, ich schreibe etwas, das nicht zutrifft,so könnt Ihr einen unserer Namensvetter, Mr. Scott, fragen:
Sir Walter schrieb an den Herzog von Buccleugh. Er stattete einer alten Dame einen Besuch ab, die, wie Norna und Æolus in der Odyssee, die Winde im Zaum hielt und sogar eine frische Brise zu verkaufen verstand. „Sie war eine erbärmliche Gestalt, über neunzig, wie sie mir sagte, und ausgetrocknet wie eine Mumie. Eine Art lehmfarbener Umhang, der über ihren Kopf gefaltet war, passte farblich zu ihrem leichenähnlichen Teint. Feine hellblaue Augen, Nase und Kinn, die sich fast trafen, und ein gespenstischer Ausdruck von List verliehen ihr den Eindruck von Hekate. Sie erzählte uns, dass sie sich an Gow, den Piraten, erinnerte, der mit einer Miss Gordon verlobt war – hier liegen also die Keime von Norna, Cleveland und Minna vor, alle in gutem Boden gesät, um in sieben Jahren (1814–1821) Früchte zu tragen. Triptolemus Yellowley ist vollständig aus dem Tagebuch abgeleitet und ein Anachronismus. Die Faktoren und Pflüge der Lowland Scots waren gerade erst im Kommen, als Scott auf den Inseln war. Er selbst sah die absurden kleinen Mühlen und den einen Stelzenpflug, für den zwei Frauen nötig waren, um die Furchen zu ziehen, ein schwächeres Gerät als die virgilianischen Exemplare, die man in der Toskana noch immer sieht. „Als diese kostbare Maschine in Bewegung war, wurde sie von vier kleinen Ochsen gezogen, die nebeneinander angespannt waren, und ebenso vielen Ponys, die mit Seilen und Riemen aus rohem Fell an den Pflug gespannt, ja vielmehr daran festgebunden waren. Ein Altertumsforscher könnte meinen, dies sei genau das Modell des ursprünglichen Pfluges gewesen, den Triptolemos erfunden hatte, der Sohn des eleusinischen Königs, der Demeter auf ihren Wanderungen beherbergte. Der Schwerttanz wurde nicht zu Scotts Unterhaltung getanzt, aber er hörte von den Pupa-Tänzern, bekam eine Kopie des dazugehörigen Gesangs und ließ sich Beispiele der Feuerstein- und Bronzekelten präsentieren, die Norna schätzte. Überall auf der Welt, wie in Shetland, galten sie als „Donnersteine“. Die Verlobung von Norna, bei der die Hände durch Odins Steinring gefaltet wurden, galt noch immer als eine Form der Verlobung. Einige Inselbewohner wurden, wie von Magnus Troil, als „arme Schleicher“ verachtet, die Napfschnecken aßen, „die letzte menschliche Gemeinheit“. Auch die „Brunnen“ oder sanften Wellenströmungen wurden erwähnt, und über die Girlande der Walfänger wurde in der Geschichte mehrfach berichtet. Die Steine von Stennis wurden besucht, ebenso der Zwergenstein von Hoy, wo Norna, wie ein Eskimo-Angekok, ihren vertrauten Dämon traf. Scott vertrat die Auffassung, dass der Stein „wahrscheinlich als Tempel einer nördlichen Ausgabe der dii Manes gedacht war.“ Man glaube, dass man den Zwerg manchmal an der Tür seines Wohnsitzes sitzen sieht, doch bei Annäherung verschwinde er.“ Die Wohnung von Norna, einem Piktenhaus mit einem überhängenden Stockwerk, „in der Form eines Würfelkastens“, ist die alte Burg von Mousa.[4] Auch die seltsame Beschwörung von Norna, das Tropfen von geschmolzenem Blei ins Wasser, wird beschrieben. Normalerweise wurde das Blei durch die Schutzzauber eines Schlüssels gegossen. Bei Herzerkrankungen wie der von Minna wurde üblicherweise ein dreieckiger Stein, wahrscheinlich eine neolithische Pfeilspitze, als Amulett verwendet. Sogar die Geschichte der unverschämten Antwort des Piraten an den Provost basiert auf einem kürzlichen Vorfall. Zwei Walfänger wurden beschuldigt, ein Schaf gestohlen zu haben. Der erste bestritt die Anklage, sagte aber, er habe gesehen, wie das Tier von „einem Kerl mit einer roten Nase und einer schwarzen Perücke“ weggetragen wurde. „Glaubst du nicht, dass er Euer Ehren ähnlich sah, Tom?“ – „Bei Gott, Jack, ich glaube, es war genau dieser Mann.“ Es ist kein Wunder, dass die Orkadier sofort seine Urheberschaft erkannten. Vor Kurzem wurde eine kleine Anekdote der Kreuzfahrt bekannt: Scott schenkte einer Dame auf den Inseln ein Klavier, das offenbar immer noch in der Lage ist, eine melancholische, klingelnde Melodie zu erzeugen.[5]
Lockhart sagt über die Rezeption von „The Pirate“ (Dezember 1821): „Die wilde Frische der Atmosphäre dieser großartigen Romane, der schöne Kontrast von Minna und Brenda und die exquisit gezeichnete Figur von Captain Cleveland fanden großen Anklang.“ ‚Die wilde Frische der Atmosphäre‘ ist in der Tat wie magisch durchdrungen und atmet über die Seiten, während sie über den Fitful Head, die Schären, die trostlosen Moore und die Ebene der Standing Stones von Stenness weht. Die Luft ist frisch, salzig und duftet nach Meer. Doch Sydney Smith war hingegen sehr enttäuscht. „Ich fürchte, dieser Roman wird vom früheren Ruf des Autors abhängen und nichts dazu beitragen. Es kann verkauft werden, und ein anderer kann sich halb verkaufen, aber das ist alles. Ich gebe ihm nicht die Schuld. Wenn das Heimatland Schottland keine weiteren Szenen und Charaktere liefern wird, denn in Schottland ist er immer der Beste, obwohl er in England zu der Zeit, als er dort war, sehr gut war; aber bitte, wo auch immer die Szene spielt, keine Meg Merrilies und Dominie Sampsons mehr – beim ersten und zweiten Mal sehr gut, aber jetzt reichlich abgenutzt.“
Es war jedoch Smiths Grammatik, die hier versagte: Sein Satz blieb ohne Apodosis. Scott konnte sich nicht „ausschreiben“, bevor sein Geist von Krankheit befallen wurde. Wäre sein Leben bei voller Gesundheit wundersam verlängert worden, hätte man niemals sagen können, „alle Geschichten seien erzählt“, und er hätte die Menschheit unablässig erfreut.
Scott selbst war nicht wenig verärgert über die Kritik an Norna als Nachbildung von Meg Merrilies. Sie ist in der Tat „etwas anderes als die Meg aus Dumfriesshire“ – in Wahrheit ähnelt sie eher der Ulrica aus „Ivanhoe“. Wie jene wird auch sie von der Erinnerung an ein schreckliches Verbrechen heimgesucht – der wahnsinnigen Verzerrung eines bloßen Unfalls. Wie sie ist sie eine Anhängerin der toten Götter der älteren Welt, Thor und Odin, und der Geister des Sturms. Scotts Fantasie lebte so sehr in der Vergangenheit, dass ihn die alten Glaubensbekenntnisse immer von Neuem faszinierten: Wie Heine verspürte er die Faszination der verbannten nordischen Gottheiten, nicht die Griechenlands. So haust Norna, wahnsinnig geworden durch ihr schreckliches Unglück, unter ihnen; sie verehrt den Rotbart – als fernen Nachkommen der Asen –, behält aber dennoch eine gewisse Treue zu ihrem alten, ungeheuren Pantheon. Sogar Minna behält in ihrer mädchenhaften Begeisterung einen Hauch von Freydís in der Sage von Erik dem Roten: Für sie sind die alten Götter wie die alten Jahre nicht gänzlich verbannt noch machtlos. All dies ist höchst charakteristisch für den Altertumsforscher und Dichter Scott, der liebevoll bei dem verweilt, was war, und die letzten schwachen Gluten verloschener Feuer anfacht. Das passt zu dem harmlosen Jakobitismus seiner Gelage, als sie sangen:
Auf den König, Jungs!Ihr wisst, was ich meine, Jungs.
Unter den besonders schwachen, provinziellen Vulgaritäten, die Borrow im Anhang zu „Lavengro“ gegen Scotts Andenken ausstößt, ist der Vorwurf einer Wiederbelebung des Katholizismus der bitterste. Dieser lautstarke Evangelist hätte Scott genauso gut den Wunsch vorwerfen können, die Verehrung Odins wiederherzustellen und Menschen auf dem Steinaltar von Stenness zu opfern. Auf den Orkney-Inseln sah er die zerstörten Bildnisse der nordischen Götter, wie in Melrose die der Jungfrau; und sein treues Herz fühlte mit allem, was alt und verloren war – mit allem, worin Menschen ihr Herz und ihren Glauben niedergelegt hatten, das sie in der weltlichen Suche nach dem Göttlichen geschaffen hatten. Wie ein späterer Dichter hätte er sagen können:
Nicht als ihr Freund oder Kind spreche ich,Aber wie an einem fernen nördlichen Strand,An seine eigenen Götter denkend, ein GriecheIn Mitleid und trauriger Ehrfurcht könnte es bestehenNeben einigen gefallenen Runensteinen,Denn beide waren Götter, und beide sind verschwunden.
Und gewiss ist kein Bekenntnis grausamer – und des Untergangs würdiger – als Borrows Glaube an einen Gott, der „wusste, wo er zuschlagen musste“ und Scott absichtlich traf, indem er Robinson zum Hopfenspekulanten machte und so Scotts Edinburgher Verleger Constable zu Fall brachte. Mit ihm Sir Walter. Dies war die Religion, die Borrow in dem Tonfall eines viertklassigen Provinzblattes verkündete. Mag man da nicht lieber das offenherzige Heidentum des Rotbarts der Religion des Autors von „Die Bibel in Spanien“ vorziehen?
Es lässt sich nicht leugnen, dass Scotts Fantasie eine bestimmte romantische Form annahm, in die seine Einfälle, wenn er am natürlichsten und vor allem zu seinem eigenen Vergnügen schrieb, leicht einströmten. Einer der Reize von „Der Pirat“ besteht darin, dass Scott hier offenkundig für sein eigenes Vergnügen schreibt – mit einem jungenhaften Eifer. Wenn wir nur die Handlung einer jener Geschichten wüssten, die er als Knabe seinem Freund Irving erzählte, erkannten wir wohl, dass es sich regelmäßig um ein romantisches Geheimnis handelte – um einen Hinweis in den Händen einer Hexe oder weisen Frau, um jene Gestalt, die stets rechtzeitig um die Ecke erscheint, sobald es etwas zu lauschen gibt. Dies ist ein charakteristisches Merkmal dieser Geschichten: Bald ist es Edie Ochiltree, bald Flibbertigibbet, bald Meg Merrilies, bald Norna, die den roten Faden der Handlung in der Hand behalten; und doch sind diese Figuren klar voneinander abgesetzt. Auch hier zogen ihn bestimmte Typen an – vor allem der pedantische –, doch sie sind so unterschiedlich wie Yellowley und Dugald Dalgetty, der Antiquar und Dominie Sampson. Yellowley ist zurückhaltender als einige von Scotts Langweilern. Doch er ist nicht der einzige Langweiler, denn Claud Halcro ist trotz all seiner Verdienste ein bekennender Prosaist. Swift hat diesen Typus, den episodischen Erzähler, in einer Parallele zu Theophrast treffend beschrieben. In einem Brief an Morritt sagt Scott (November 1818): „Ich habe Mitgefühl mit Euch für das Leid, das Ihr unter den Folgen Eures ehrlichen Prosaisten erleidet. Von allen langweiligen Maschinen, die jemals erfunden wurden, ist Euer regelmäßiger und entschlossener Geschichtenerzähler der gebieterischste und kraftvollste in seinen Handlungen.“
„Mit welch vollkommener Gelassenheit ließ er es zu, sich selbst von Langeweile ersten Ranges zu langweilen!“ sagt Lockhart. Diese Gattung können wir alle auf vielfältige Weise studieren; und man wird zugeben müssen, dass Scott seine Studien über Langweiler mit einer gewissen Selbstgefälligkeit betrieb. Dennoch sind sie alle unterschiedliche Langweiler, und der fröhliche, freundliche Halcro ist ganz anders als Master Mumblasen oder Dominie Sampson.
Als Helden darf man Mordaunt durchaus als lebhaft und eigenwillig bezeichnen. Sein geheimnisvoller Vater erinnert bisweilen an Byron, bisweilen an Mrs. Radcliffe. Der Udaller ist so eigen und genial wie Dandie Dinmont – oder, wenn man will, der Cedric von Thule –, nur den meisten Lesern weit sympathischer. Seine Zuneigung zu seinen Töchtern ist bezeichnend. Seit Minna und Brenda sind uns in der Literatur viele Schwesternpaare – blond und braun – begegnet; doch keines reicht an sie heran, und wie Mordaunt in jungen Jahren wissen auch wir nicht, welcher von beiden unser Herz zufällt. Sie sind das „L’Allegro“ und „Il Penseroso“ des Nordens; wahrscheinlich verliebten sich alle Männer in Minna, um – wenn sie könnten – am Ende Brenda zu heiraten. Minna verkörpert die ideale Jugend der Poesie, Brenda die des praktischen Lebens. Minnas unschuldige Illusionen, ihre Liebe zum Alten, ihr Eintreten für die verlorene Sache; ihre Schönheit, Zärtlichkeit und Wahrhaftigkeit, ihre leidenschaftliche Unberechenbarkeit des Kummers – all das macht sie zu einer von Scotts eigenständigsten und hinreißendsten Heldinnen. Sie glaubt – und zittert nicht, anders als Bertram in „Rokeby“. Brenda zittert, glaubt jedoch nicht an Nornas Magie und an die Geister der alten Sage. Was Cleveland betrifft, so vermied Scott den byronischen Lara-Piraten und schuf einen Freibeuter, der so sympathisch ist, wie es ein hostis humani generis nur sein kann; „Frederick Altamont“ (Thackeray entlehnte den Namen für seinen romantischen Kreuzkehrer) nimmt seinen Platz unter den Marischals und Bucklaws der Romantik ein. Scotts eingehende Dryden-Studien befruchten seine lokalen Beobachtungen; so spinnt sich aus eher unscheinbarem Material und aus dem Kontrast zwischen Lowlander und Orcadian die Liebesgeschichte. Die „psychologische Analyse“, die den Autor wahrscheinlich am meisten interessierte, ist das Doppelbewusstsein von Norna und die gelegentlichen Eingriffe des rationalen Selbst in ihre Träume von übernatürlichen Kräften. Dieses doppelte Bewusstsein existiert in uns allen: Bisweilen hat das Selbst, an das wir glauben, eine Vision des wirklichen, darunter liegenden Selbst und schaudert vor dem Anblick – wie das Paar, „das sich selbst traf“, in der berühmten Zeichnung.
„Der Pirat“ gehört zwar kaum in die vorderste Reihe von Scotts Romanen, nimmt aber einen hohen, eigenen Rang in der zweiten ein und wird wohl immer zu den Lieblingsbüchern jener zählen, die das Glück hatten, ihn in der Jugend unkritisch zu lesen.
Scotts Romane erschienen zu dieser Zeit so häufig, dass die schwerfälligen „Quarterlies“ mit ihnen nicht Schritt halten konnten. Sie beschlossen daher, die Bände en bloc zu rezensieren, und im „Quarterly“ – man könnte sagen – sei „The Pirate“ schlichtweg übergangen worden. Ungefähr gleichzeitig begann Gifford einzusehen, dass wer von einem „dunklen Dialekt des Anglified Erse“ sprach, kaum ein kompetenter Kritiker sein konnte, und Mr. Senior behandelte einige der Geschichten mit größerer Umsicht. Was „Der Pirat“ betrifft, befand die „Edinburgh Review“, dass „die Figur und die Geschichte von Mertoun zugleich alltäglich und extravagant“ seien. Über Cleveland heißt es, er „enttäusche, indem er so viel besser ausfällt, als wir erwartet hatten, und doch im Wesentlichen so schlecht.“ „Nichts kann schöner sein als die Beschreibung der Schwestern.“ „Norna ist eine neue Inkarnation von Meg Merrilies und dem Geist nach greifbar gleich, steht jedoch weit über dem Rang einer lediglich nachgeahmten oder geliehenen Figur.“ „Im Großen und Ganzen eröffnet das Werk unserer Neugier eine neue Welt und ist ein weiterer Beweis für die außerordentliche Geschmeidigkeit und Kraft des Genies des Autors.“
Andrew Lang.
August 1893.
[1] Erskine starb vor Scott, getötet durch einen albernen Schlag, und Mr. Skene sagt: „Ich habe Sir Walter noch nie so sehr von irgendeinem Ereignis berührt gesehen, und bei der Beerdigung, an der er teilnahm, war er völlig außerstande, seine Gefühle zu unterdrücken. Er weinte wie ein Kind.“ Seine Korrespondenz mit Scott fiel in die Hände einer Dame, die, als sie sah, dass sie das Geheimnis von Scotts Autorschaft enthüllte, alle Briefe verbrannte.
[2] Scotts Tagebuch, 29. Juli 1814.
[3] Siehe Anmerkung des Autors Nr. I.
[4] Tagebuch.
[5] „Atalanta“, Dezember 1892.
Einführung zu „Der Pirat“
„Er sagte: Es war ein Schiff.“
Dieses kurze Vorwort könnte – wie die Geschichte vom alten Seemann – beginnen; denn an Bord eben jenes Schiffes eignete sich der Autor jenes bescheidene Maß an Ortskenntnis sowie Kenntnis von Menschen und Landschaften an, das er in der Romanze des „Piraten“ zu verkörpern suchte.
Im Sommer und Herbst 1814 wurde der Autor eingeladen, sich einer Gruppe von Kommissaren des Northern Lighthouse Service anzuschließen, die eine Reise um die schottische Küste und durch die Inselgruppen planten, um den Zustand der unter ihrer Aufsicht stehenden Leuchttürme zu prüfen – Gebäude von höchster Bedeutung, ob man sie nun als wohltätige oder als staatliche Institutionen betrachtet.
Von Amts wegen hat der Sheriff jeder schottischen Küstengrafschaft einen Sitz in diesem Board. Diese Herren wirken in jeder Hinsicht unentgeltlich, verfügen bei ihren Inspektionen jedoch über eine bewaffnete, seetüchtige und gut ausgerüstete Yacht.
Dem Vorstand ist ein ausgezeichneter Ingenieur beigeordnet – Mr. Robert Stevenson –, der ihn mit fachlichem Rat unterstützt.
Der Autor schloss sich dieser Fahrt als Gast an; denn Selkirkshire, obgleich es ihn zum Sheriff ernannt hatte, besitzt – gleich dem Königreich Böhmen in Corporal Trims Geschichte – keinen Seehafen im Kreis; folglich hatte sein Magistrat selbstverständlich keinen Sitz im Board of Commissioners – ein Umstand, der dort kaum ins Gewicht fiel.
Alle Teilnehmer waren alte, enge Freunde desselben Berufsstandes und bereit, einander in jeder erdenklichen Weise entgegenzukommen.
Die Natur des wichtigen Geschäfts, das den Hauptzweck der Reise bildete, verband sich auf das Angenehmste mit der Lust, die Neugier des Reisenden zu stillen; denn das wilde Kap oder die gewaltige Klippe, die eines Leuchtturms bedarf, liegt gewöhnlich nicht fern von den prächtigsten Szenerien aus Felsen, Grotten und Brandung.
Auch die Zeit stand uns frei: Da die meisten von uns Süßwassersegler waren, konnten wir jederzeit aus schlechtem Wind guten machen, vor dem Sturm ablaufen und irgendeinem merkwürdigen Gegenstand nachsetzen, der unter unserem Lee lag.
Mit diesen Zwecken – öffentlichem Nutzen und einem Quäntchen persönlicher Freude – verließen wir am 26. Juli 1814 den Hafen von Leith, folgten der Ostküste Schottlands, besichtigten allerlei Merkwürdigkeiten und machten Station auf Shetland und Orkney, wo uns die Wunder eines uns so neuen Landes eine Weile festhielten.
Nachdem wir das Sonderbare der Ultima Thule der Alten gesehen hatten, wo die Sonne es kaum der Mühe wert fand, zu Bett zu gehen, rundeten wir das äußerste Nordkap Schottlands und erkundeten die Hebriden, wo wir manch liebenswürdige Bekanntschaft machten.
Damit es unserer kleinen Expedition nicht an der Würde der Gefahr fehlte, wurde uns dort der ferne Anblick eines angeblichen amerikanischen Kreuzers vergönnt; wir hatten Anlass zu bedenken, welch hübsche Figur wir gemacht hätten, wäre unsere Fahrt in amerikanischer Gefangenschaft geendet.
Nachdem wir die romantischen Küsten von Morven und die Gegend um Oban besucht hatten, nahmen wir Kurs auf Irland und besuchten den Giant’s Causeway, um ihn mit Staffa zu vergleichen, das wir zuvor auf unserer Route gesehen hatten.
Schließlich, um die Mitte des September, endete unsere Reise im Clyde, im Hafen von Greenock.
Und damit endete unsere angenehme Tour, die uns dank unserer Ausrüstung ungewöhnlich leicht fiel, weil die Mannschaft stets eine kräftige Bootsmannschaft stellen konnte, ohne die Wache an Bord zu schwächen; so hatten wir die Freiheit, anzulanden, wohin immer uns die Neugier trug. Lasst mich, da ich einen sonnigen Abschnitt meines Lebens kurz Revue passieren lasse, hinzufügen, dass unter den sechs oder sieben Freunden, die diese Reise gemeinsam unternahmen, bei aller Verschiedenheit von Geschmack und Beschäftigung und trotz mehrerer Wochen auf engem Raum nie der geringste Streit aufkam; jeder war bemüht, seine besonderen Wünsche denen der Freunde unterzuordnen. Dank dieser wechselseitigen Rücksicht wurden alle Ziele unserer kleinen Expedition erreicht, und wir hätten für eine Weile die Zeilen aus Allan Cunninghams schönem Seelied zu unserem Wahlspruch machen können.
„Die Welt der Gewässer war unsere Heimat,Und fröhliche Männer waren wir!“
Doch Trauer mischt sich in die Erinnerung an das Vergnügen. Als ich von der Reise zurückkam, die sich als so erfreulich erwiesen hatte, erfuhr ich, dass das Schicksal diesem Land ganz unerwartet eine Dame entrissen hatte, die ihres hohen Ranges würdig war und an deren Freundschaft ich seit Langem teilhaben durfte. Auch der Verlust eines meiner Gefährten – meines engsten Freundes auf Erden – warf einen Schatten auf Erinnerungen, die ohne diese Bitternis ungetrübt erfreulich geblieben wären.
Ich möchte kurz anmerken, dass meine Aufgabe auf dieser Reise – sofern ich überhaupt eine hatte – darin bestand, einige Orte aufzuspüren, die dem „Herrn der Inseln“, einem Gedicht, an dem ich unterwegs arbeitete, von Nutzen sein könnten. Später entließ ich es in die Öffentlichkeit; es wurde gedruckt, jedoch ohne bemerkenswerten Erfolg. Als jedoch zeitgleich der anonyme Roman „Waverley“ immer größeren Anklang fand, witterte ich bereits die Möglichkeit eines zweiten Versuchs in diesem Feld der Literatur. Auf den wilden Inseln der Orkneys und Shetlands sah ich vieles, das – so schien mir – höchst interessant wäre, sollten diese Inseln je zum Schauplatz einer fiktiven Erzählung werden. Die Geschichte Gows, des Piraten, vernahm ich aus dem Mund einer alten Sibylle, deren Haupterwerb im Handel mit günstigen Winden bestand – sie verkaufte sie den Seeleuten von Stromness. Nicht minder eindrucksvoll war die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Herren von Shetland; sie rührte mich umso mehr, als einige von ihnen Freunde und Korrespondenten meines Vaters gewesen waren.
Um die Züge des alten norwegischen Udallers nachzeichnen zu können, sah ich mich veranlasst, ein oder zwei Generationen weiter zurückzugehen; denn der schottische Adel war im Allgemeinen an die Stelle dieser ursprünglichen Schicht getreten und hatte Sprache wie Eigenheiten überformt. Der einzige Unterschied, der heute zwischen dem Adel dieser Inseln und dem Schottlands im Ganzen ins Auge fällt, liegt in der gleichmäßigeren Verteilung von Vermögen und Besitz: Unter den ansässigen Eigentümern finden sich keine Männer von übergroßem Reichtum, deren zur Schau gestellter Luxus die Übrigen ihr eigenes Los beneiden ließe. Aus demselben Grund – der allgemeinen Gleichheit der Vermögen und der daraus folgenden Billigkeit des Lebens – traf ich die Offiziere eines Veteranenregiments, das in Fort Charlotte zu Lerwick garnisonierte, am 17. Januar 1940 in eigentümlicher Verlegenheit. Die Vorstellung, aus einem Land abberufen zu werden, in dem ihr Sold – so unzureichend er den Ausgaben einer Hauptstadt entsprach – ihren Bedürfnissen vollkommen genügte, war derart ungewohnt, dass selbst die Söhne des „fröhlichen Englands“ ihre bevorstehende Abreise von den melancholischen Inseln der Ultima Thule bedauerten.
Dies sind die eher beiläufigen Einzelheiten der Entstehung dieser Schrift, die erst mehrere Jahre nach jener angenehmen Reise erschien, der sie ihre Anregung verdankt. Der Zustand der Sitten, den ich im Roman geschildert habe, musste zu einem guten Teil imaginär sein, stützt sich jedoch in gewissem Maße auf kleine Hinweise, die – indem sie zeigten, was ist – einen plausiblen Fingerzeig darauf gaben, was einst der Ton dieser Gesellschaft auf jenen entlegenen, doch anziehenden Inseln gewesen sein mochte.
In einem Punkt, fürchte ich, hat man mich vorschnell beurteilt, als Kritiker die Norna bloß als Kopie der Meg Merrilees erklärten. Dass ich hinter dem zurückblieb, was ich zu gestalten wünschte, bestreite ich nicht; anders ließe sich das verfehlte Ziel kaum erklären. Dennoch vermag ich mir kaum vorzustellen, dass ein aufmerksamer Leser im „Piraten“ nicht in Norna – dem Opfer von Reue und Wahnsinn, der Betrogenen ihrer eigenen Betrügerei, deren Geist von der wilden Literatur und dem extravaganten Aberglauben des Nordens überschwemmt ist – etwas grundlegend anderes erkennt als die Meg Merrilees aus Dumfriesshire, deren Ansprüche auf Übernatürliches kaum über die einer Norwood-Prophetin hinausreichen. Die Grundlagen eines solchen Charakters lassen sich wohl nachzeichnen; dass der notwendige Überbau nicht in jeder Hinsicht gelang, ist zu wahr – sonst wären diese Einlassungen überflüssig. Unwahrscheinlich bleibt auch, dass Norna jene Macht besäße, anderen jenen Glauben an ihre übernatürlichen Gaben einzupflanzen, der ihren eigenen Geist in Unordnung brachte. Erstaunlich jedoch ist, wie erfolgreich ein Betrüger, der zugleich Enthusiast ist, inmitten einer sehr leichtgläubigen und unwissenden Bevölkerung wirken kann. Es gemahnt an das Reimpaar, das uns versichert:
„Die Freude ist genauso großIndem man betrogen wird, um zu betrügen.“
Wie ich andernorts bemerkt habe, zeigt die vermeintliche Auflösung einer Geschichte, in der Erscheinungen oder Begebenheiten übernatürlicher Art auf natürliche Ursachen zurückgeführt werden, am Ende nicht selten einen Grad von Unwahrscheinlichkeit, der einem Kobold kaum nachsteht. Selbst das Genie von Mrs. Radcliffe vermochte diese Schwierigkeit nicht immer zu überwinden.
Abbotsford, 1. Mai 1831.
Der Zweck der nachfolgenden Erzählung ist es, einen möglichst genauen, detaillierten Bericht über gewisse bemerkenswerte Vorfälle auf den Orkney-Inseln zu geben – Begebenheiten, zu denen die unzulänglichen Überlieferungen und Aufzeichnungen des Landes nur die folgenden irreführenden Einzelheiten liefern:
Im Januar 1724/25 lief ein Schiff namens Revenge – mit zwanzig schweren und sechs kleineren Kanonen bewaffnet – unter dem Kommando von John Gow (auch Goffe oder Smith) bei den Orkney-Inseln ein und gab sich durch verschiedene Schurkereien der Mannschaft als Pirat zu erkennen. Eine Zeitlang blieben die Seeräuber im Vorteil, denn die Bewohner dieser entlegenen Inseln verfügten weder über Waffen noch über wirksame Mittel des Widerstands. Der Kapitän dieser Bande war so kühn, dass er nicht nur an Land ging und im Dorf Stromness Gesellschaften gab, sondern – ehe sein wahrer Charakter erkannt wurde – die Zuneigung einer jungen Dame gewann und sie gar durch Zuwendungen aus seinem „Eigentum“ zu trösten suchte. Ein Patriot, James Fea, der jüngere von Clestron, ersann daraufhin den Plan, den Freibeuter festzusetzen, und führte ihn mit einer Mischung aus Mut und Gewandtheit aus – begünstigt vor allem dadurch, dass Gows Schiff nahe dem Hafen von Calfsound gestrandet war. Dies geschah bei Eda, unweit eines Hauses, das Mr. Fea damals bewohnte. Bei den vielfältigen Listen, mit denen es Fea – unter Lebensgefahr, denn die Männer waren gut bewaffnet und verzweifelt – schließlich gelang, die gesamte Piratenbande in seine Gewalt zu bringen, wurde er von Mr. James Laing nach Kräften unterstützt; Mr. Laing war der Großvater von Malcolm Laing, Esq., dem scharfsinnigen und geistreichen Historiker Schottlands im 17. Jahrhundert.
Gow und mehrere seiner Leute erlitten sodann vor dem Obersten Admiralitätsgericht die Strafe, die ihre Verbrechen längst verdient hatten. Vor Gericht zeigte er große Kühnheit. Nach dem Bericht eines Augenzeugen scheint er zudem ungewöhnlichen Härten ausgesetzt gewesen zu sein, um ihn zum Plädieren zu zwingen. Der Wortlaut lautet wie folgt: „John Gow wollte nicht plädieren; darauf wurde er in die Anwaltskammer gebracht, und der Richter befahl, seine Daumen von zwei Männern mit einer Peitschenschnur so lange zu quetschen, bis die Schnur riss; sodann solle sie doppelt gelegt werden, bis sie abermals brach, hernach dreifach, und die Henker sollten mit aller Kraft ziehen; was Gow mit großer Unerschrockenheit ertrug.“ Am folgenden Morgen (27. Mai 1725), als er die schrecklichen Vorbereitungen zu seiner Hinrichtung erblickte, ließ sein Mut nach, und er erklärte dem Hofmarschall, er hätte sich andernfalls nicht so sehr bemüht, nicht in Ketten aufgehängt zu werden. Daraufhin wurde er – zusammen mit anderen seiner Mannschaft – vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet.
Man erzählt, die Dame, deren Zuneigung Gow erregt hatte, sei vor seiner Hinrichtung nach London gereist, um ihn zu sehen; da sie jedoch zu spät kam, habe sie den Mut besessen, einen Blick auf den Leichnam zu erbitten. Indem sie die Hand des Toten berührte, bekräftigte sie feierlich die Treue, die sie ihm einst gelobt hatte. Ohne diese Zeremonie, so der Landesaberglaube, hätte sie dem Besuch des Geistes ihres verstorbenen Liebsten nicht entgehen können, sollte sie einem Lebenden dieselbe Treue schenken, die sie dem Toten gelobt hatte. Dieser Teil der Legende ließe sich als eigentümlicher Kommentar zu jener schönen schottischen Ballade lesen, die so beginnt:
„Da kam ein Geist an Margarets Tür“ usw. [6]
Ferner heißt es, Mr. Fea – jener tatkräftige Mann, durch dessen Einsatz Gows unrechtmäßige Laufbahn beendet wurde – sei von einer staatlichen Belohnung so weit entfernt gewesen, dass er nicht einmal die nötigen Mittel aufbringen konnte, sich gegen eine Flut von Scheinklagen zu schützen, die Newgate-Anwälte im Namen Gows und anderer Mitglieder der Piratencrew gegen ihn erhoben. Die vielfältigen Kosten, Prozesse und sonstigen rechtlichen Folgen, in die ihn seine beherzte Tat verwickelte, ruinierten sein Vermögen und das seiner Familie vollends. So wurde sein Andenken zum warnenden Beispiel für alle, die künftig Piraten auf eigene Faust festnehmen wollen.
Der Gerechtigkeit halber gegenüber der Regierung Georgs I. ist jedoch anzunehmen, dass jener letzte Umstand sowie manche Daten und andere Details der geläufigen Geschichte ungenau sind; sie stehen im offenkundigen Widerspruch zur nachfolgenden, wahrheitsgetreuen Darstellung – zusammengestellt aus Materialien, zu denen allein der Verfasser Zugang hatte –, vom Autor von „Waverley“.
[6] Siehe die Anmerkungen des Herausgebers am Ende des Bandes; wo immer ein ähnlicher Hinweis erscheint, gilt dieselbe Verweisung.
Der Pirat
Kapitel 1
Der Sturm hatte sein winterliches Getöse verstummen lassen,heiser schlugen die Wogen des Meeres;doch wer an Thules wüster Küsterief: „Habe ich meine Harfe für dich verbrannt?“Macneil
Diese lange, schmale und unregelmäßige Insel – gemeinhin als Festland von Shetland bezeichnet, weil sie bei weitem die größte des Archipels ist – endet, wie den Seefahrern wohlbekannt, die die stürmischen Meere um das Thule der Antike befahren, in einer Klippe von ungeheurer Höhe namens Sumburgh Head. Sie bietet ihre nackte Stirn und kahlen Flanken der Wucht der gewaltigen Brandung dar und bildet den äußersten Südostpunkt der Insel. Dieses hohe Vorgebirge ist unablässig dem Zug einer starken, wilden Gezeitenströmung ausgesetzt, die sich zwischen den Orkney- und Shetland-Inseln bildet und an Kraft nur dem Pentland Firth nachsteht. Nach der genannten Landspitze trägt sie den Namen Roost of Sumburgh; „Roost“ ist auf diesen Inseln der gebräuchliche Ausdruck für Gezeitenströme dieser Art.
Auf der Landseite ist das Kap von kurzem Gras überzogen und fällt jäh zu einer schmalen Landenge ab, in die sich, von beiden Seiten vordringend, Meeresrinnen gefressen haben. Es scheint, als würden sie sich in absehbarer Zeit verbinden und Sumburgh Head gänzlich isolieren, sodass das heutige Kap zu einer einsamen Felseninsel würde – getrennt vom Festland, dessen äußerstes Ende es gegenwärtig bildet.
Der Mensch hat dies freilich nicht immer für fern oder unwahrscheinlich gehalten; denn ein norwegischer Häuptling aus alter Zeit – oder, wie andere berichten und wie der Name Jarlshof nahelegt, ein früher Graf der Orkneys – wählte diese Landzunge einst zum Ort eines Herrenhauses. Lange lag es völlig verlassen, und die Überreste sind nur schwer auszumachen; losgerissener Sand, von den Stürmen dieser rauen Gegend herangeweht, hat die Trümmer überflutet und fast verschüttet. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts jedoch war ein Teil des gräflichen Hauses noch intakt und bewohnbar: ein schlichter Bau aus unbehauenem Stein, ohne irgendetwas, das das Auge erfreute oder die Phantasie anregte. Am ehesten stelle man sich ein großes, altmodisches, schmales Haus vor, mit sehr steilem, von grauen Sandsteinplatten gedecktem Dach. Wenige, sehr kleine Fenster standen ohne jede Rücksicht auf Regelmäßigkeit im Mauerwerk verstreut. An das Hauptgebäude schlossen einst niedrigere Flügel an – Wirtschafts- und Gesinderäume –, doch diese waren verfallen; die Sparren hatte man zu Brennholz oder anderem Bedarf abgetragen, an vielen Stellen gaben die Mauern bereits nach. Um das Bild der Verwüstung zu vollenden, wanderte der Sand unter die Ruinen und füllte die früheren Gemächer bis zu einer Tiefe von zwei bis drei Fuß.
Mitten in dieser Trostlosigkeit war es den Bewohnern von Jarlshof durch stete Arbeit und Sorge gelungen, einige schmale Landstreifen in Ordnung zu halten: wie ein Garten eingefriedet und durch die Hausmauern selbst vor der Unbarmherzigkeit der Winde geschützt. Der Seewind ließ nur das gedeihen, was das Klima hergab – oder, genauer gesagt, was die Stürme verschonten; denn auf diesen Inseln ist die Kälte zwar weniger streng als auf dem schottischen Festland, doch ohne Mauerschutz ist es kaum möglich, selbst das gewöhnlichste Küchengemüse zu ziehen. Von Sträuchern oder gar Bäumen kann keine Rede sein – so groß ist die Wucht des stets fegenden Meereswinds.
In kurzer Entfernung vom Herrenhaus und nahe dem Meeresufer, genau dort, wo der Bach eine Art unvollkommenen Hafen bildete, in dem drei oder vier Fischerboote lagen, standen ein paar äußerst ärmliche Hütten für die Bewohner und Pächter der Gemeinde Jarlshof, die den gesamten Bezirk des Grundbesitzers zu Bedingungen innehatten, wie sie Leuten ihrer Art damals üblicherweise gewährt wurden – und die naturgemäß hart genug waren. Der Grundbesitzer selbst wohnte auf einem günstiger gelegenen Anwesen in einem anderen Teil der Insel und begab sich nur selten auf seine Besitzungen am Sumburgh Head. Er war ein schlichter, rechtschaffener Shetland-Gentleman, mit bisweilen hitzigem Temperament – wohl unvermeidlich, da er von Angehörigen und Abhängigen umgeben war – und in seinen Gewohnheiten etwas übermäßig gesellig, was man vielleicht einer allzu reich bemessenen Muße zuschreiben darf; doch offenmütig und großzügig gegen sein Volk, freundlich und gastfrei gegenüber Fremden. Er stammte zudem aus einer alten, adligen norwegischen Linie – ein Umstand, der ihn den niederen Ständen, von denen die meisten derselben Herkunft waren, besonders angenehm machte; während die Lairds, die Eigentümer im Allgemeinen, schottischer Abstammung waren und zu jener frühen Zeit noch als Fremde und Eindringlinge galten. Magnus Troil, der seine Abstammung auf jenen Grafen zurückführte, der Jarlshof gegründet haben soll, vertrat diese Auffassung mit besonderem Nachdruck.
Die jetzigen Bewohner von Jarlshof hatten mehrfach die Freundlichkeit und den guten Willen des Besitzers erfahren. Als Mr. Mertoun – so hieß der jetzige Bewohner des alten Herrenhauses – einige Jahre vor Beginn der Geschichte zum ersten Mal in Shetland ankam, empfing ihn Mr. Troil in seinem Hause mit jener warmen, herzlichen Gastfreundschaft, für die die Inseln bekannt sind. Niemand fragte, woher er kam, wohin er ging, zu welchem Zweck er einen so abgelegenen Winkel des Reiches aufsuchte oder wie lange sein Aufenthalt währen sollte. Er kam als vollkommener Fremder, wurde aber sogleich von einer Reihe von Einladungen überhäuft; in jedem Haus, das er betrat, fand er eine Heimstatt, solange er sie anzunehmen beliebte, und lebte – gleich einem Familienmitglied – unauffällig, bis er es für angezeigt hielt, in eine andere Wohnung zu wechseln. Diese scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber Rang, Charakter und Eigenarten ihres Gastes entsprang nicht etwa Apathie seitens der freundlichen Gastgeber, denn die Inselbewohner hatten ihren vollen Anteil an natürlicher Neugier; doch ihr Taktgefühl erachtete es als Verstoß gegen die Gesetze der Gastfreundschaft, Fragen zu stellen, deren Beantwortung dem Gast beschwerlich oder unangenehm hätte sein können. Anstatt sich, wie es in anderen Ländern üblich ist, zu bemühen, Mr. Mertoun durch beharrliches Fragen zu Mitteilungen zu veranlassen, deren Zurückhaltung er vorzog, begnügten sich die rücksichtsvollen Shetländer damit, mit Eifer jene Fetzen von Auskunft aufzusammeln, die sich aus den Unterhaltungen nebenbei gewinnen ließen.
Doch der Fels in einer arabischen Wüste zögerte nicht weniger, Wasser zu spenden, als Basil Mertoun – selbst im Vorübergehen – sein Vertrauen zu gewähren; und gewiß wurde die Höflichkeit der Adeligen von Thule nie härter erprobt, als in dem Bewusstsein, dass gute Erziehung ihnen gebot, von Nachforschungen über die Lage einer so rätselhaften Person Abstand zu nehmen.
Alles, was tatsächlich über ihn bekannt war, ließ sich knapp zusammenfassen: Mr. Mertoun traf auf einem holländischen Schiff in Lerwick ein – einem Ort von wachsender Bedeutung, wenn auch noch nicht als Hauptstadt der Insel anerkannt – und zwar nur in Begleitung seines Sohnes, eines hübschen Knaben von etwa vierzehn Jahren. Er selbst mochte über vierzig Jahre alt sein. Der niederländische Kapitän stellte ihn einigen bewährten Freunden vor, mit denen er Gin und Lebkuchen gegen kleine Shetland-Ochsen, geräucherte Gänse und Strümpfe aus Lammwolle tauschte; und obwohl Meinheer nur sagen konnte: „Meinheer Mertoun hatte seinen Bass wie ein Gentleman und spendierte der Mannschaft einen Kreitz-Dollar dazu“, verschaffte diese Einführung dem Passagier rasch einen achtbaren Bekanntenkreis, der sich allmählich erweiterte, da der Fremde sich als Mann nicht geringer Fähigkeiten erwies.
Diese Entdeckung ergab sich beinahe wider Willen; denn Mertoun war so wenig geneigt, über allgemeine Themen zu sprechen, wie über seine eigenen Angelegenheiten. Mitunter geriet er jedoch in Diskussionen, die, gleichsam gegen seine Absicht, offenbarten, dass er sowohl Gelehrter als auch Weltmann war; und zu anderen Zeiten schien er sich – als Gegengabe für die erfahrene Gastfreundschaft – trotz seiner festen Natur zu zwingen, in die Gesellschaft seiner Mitmenschen einzutreten, zumal wenn diese einen ernsten, melancholischen oder satirischen Ton annahm, der seiner eigenen Gemütslage am ehesten entsprach. Bei solchen Gelegenheiten meinten die Shetländer übereinstimmend, er müsse eine ausgezeichnete Bildung genossen haben, die nur in einer bemerkenswerten Eigenheit Lücken zeigte: Mr. Mertoun kannte den Bug eines Schiffes kaum vom Heck zu unterscheiden. Und was die Führung eines Bootes betraf, hätte eine Kuh kaum unwissender sein können. Erstaunlich schien, dass neben seinen sonstigen Errungenschaften eine so große Unwissenheit gerade in jener Kunst bestand, die auf den Shetlands für das tägliche Leben die notwendigste ist; doch so war es.
Sofern er nicht in der oben beschriebenen Weise hervortrat, waren die Gewohnheiten Basil Mertouns zurückgezogen und düster. Vor ausgelassener Heiterkeit floh er unverzüglich; und selbst die maßvolle Fröhlichkeit einer freundlichen Gesellschaft senkte ihn unfehlbar in eine noch tiefere Niedergeschlagenheit, als es selbst sein gewöhnliches Wesen hätte vermuten lassen.
Frauen bemühen sich naturgemäß besonders, Geheimnisse zu ergründen und Melancholie zu lindern, zumal wenn beide in der Person eines gutaussehenden Mannes in der Blüte seiner Jahre zusammentreffen. Möglich also, dass dieser geheimnisvolle, sinntiefe Fremde unter den blonden und blauäugigen Töchtern von Thule leicht eine gefunden hätte, die die Trösterrolle übernommen hätte, wäre er geneigt gewesen, sie zuzulassen. Stattdessen mied er offenbar sogar die bloße Anwesenheit des Geschlechts, bei dem wir gewöhnlich in seelischen oder körperlichen Nöten Mitleid und Beistand suchen.
Zu diesen Besonderheiten fügte Mr. Mertoun noch eine weitere, die seinem Gastgeber und Hauptpatron, Magnus Troil, besonders zuwider war. Dieser Magnat von Shetland, der — wie bereits erwähnt — väterlicherseits auf eine dänische Dame aus alter norwegischer Familie zurückging, hing der strengen Lehre an, eine Tasse Genfer oder Nantz sei allen Sorgen ein sicheres Gegengift. Auf solche Mittel verfiel Mr. Mertoun jedoch nie. Sein Getränk war Wasser, und nur Wasser; weder Überredung noch Bitte vermochten ihn zu bewegen, etwas Stärkeres als die reine Quelle zu kosten. Das konnte Magnus Troil schwerlich ertragen. Darin sah er eine Missachtung der alten nordischen Gesetze der Geselligkeit, die er seinerseits so strikt beobachtete, dass er zwar zu behaupten pflegte, nie betrunken zu Bett gegangen zu sein, doch kaum je hätte bewiesen werden können, dass er sich in einem Zustand vollkommener Nüchternheit zur Ruhe gelegt habe. Man könnte daher fragen: Was brachte dieser Fremde in die Gesellschaft, um den Unmut aufzuwiegen, den seine strengen, enthaltsamen Gewohnheiten erregten? Erstens besaß er das Auftreten und die Selbstgewissheit, die einen Mann von Bedeutung auszeichnen. Und obwohl man argwöhnen mochte, dass er nicht reich sei, ließ sich aus seinen Ausgaben immerhin erkennen, dass er keineswegs völlig arm war. Überdies verfügte er — wenn er, wie angedeutet, dazu Willens war — über ein beachtliches Gesprächstalent; und seine Menschenferne, seine Abneigung gegen Geschäft und Verkehr des gewöhnlichen Lebens, kleidete sich nicht selten in antithetische Wendungen, die als Witz galten, wenn sie es auch kaum waren. Vor allem aber war das Geheimnis des Mr. Mertoun undurchdringlich; seine Gegenwart besaß jenen Reiz des Rätsels, das man wieder und wieder liest, weil sich sein Sinn nicht vollends preisgibt.
Trotz dieser Empfehlungen unterschied sich Mertoun in so vielen wesentlichen Punkten von seinem Gastgeber, dass Magnus Troil, nachdem Mertoun einige Zeit Gast auf seinem Hauptwohnsitz gewesen war, nicht wenig überrascht war, als der Gast eines Abends, nachdem beide zwei Stunden lang schweigend gesessen und Brandy und Wasser getrunken hatten – das heißt, Magnus trank den Alkohol und Mertoun das Element –, um Erlaubnis bat, als Pächter das verlassene Herrenhaus Jarlshof am äußersten Ende des Gebiets namens Dunrossness zu beziehen, das unmittelbar unterhalb von Sumburgh Head liegt. „Ich werde ihn endlich loswerden“, sagte Magnus zu sich selbst, „und sein mörderisches Gesicht wird den Umlauf der Flasche nie wieder aufhalten. Sein Abschied wird mich eher erfreuen, denn sein bloßer Blick reichte völlig aus, um einen ganzen Ozean Punsch sauer zu machen.“
Doch der gutherzige Shetlander gab Mr. Mertoun zu bedenken die Einsamkeit und die Unannehmlichkeiten, denen er sich nun aussetzen würde. „Im alten Haus gab es kaum“, sagte er, „nicht einmal die notwendigsten Möbelstücke – im Umkreis von vielen Kilometern gab es keine Gesellschaft – für den Proviant waren Sauergrasmücken das Hauptnahrungsmittel, und Euer einziger Umgang waren Möwen und Tölpel.“
„Mein guter Freund“, antwortete Mertoun, „wenn Ihr einen Umstand hättet nennen können, der diese Residenz mir vor allen anderen geeigneter erschiene, so den, dass es in der Nähe meines Rückzugsortes weder menschlichen Luxus noch menschliche Gesellschaft gäbe. Ein Schutz vor dem Wetter für meinen eigenen Kopf und den des Jungen ist alles, was ich suche. Nennt also die Pacht, Mr. Troil, und lasst mich Euer Pächter auf dem Jarlshof sein.“
„Pacht!“ antwortete der Shetländer, „nun, keine große Pacht für ein altes Haus, in dem seit der Zeit meiner Mutter niemand mehr gelebt hat – Gott schenke ihr Ruhe! – und was den Schutz betrifft, sind die alten Mauern dick genug und werden noch manchen Sturm aushalten. Aber der Himmel behüte Euch, Mr. Mertoun, denkt darüber nach, was Ihr vorhabt. Für einen von uns wäre es schon ein wilder Plan, auf dem Jarlshof zu wohnen; aber Ihr, die Ihr aus einem anderen Land kommt, ob Engländer, Schotte oder Ire, das kann niemand sagen“ –
„Es tut auch nichts zur Sache“, sagte Mertoun kurz.
„Keine Heringsschuppe“, antwortete der Laird. „Nur, dass ich Euch umso mehr mag, weil Ihr kein Schotte seid, da ich darauf vertraue, dass Ihr keiner seid. Hierher sind sie gekommen wie die Klackgänse – jeder Kammerdiener hat eine Herde mit seinem eigenen Namen und seiner eigenen Brut herübergebracht, soweit ich weiß, und hier bleiben sie für immer – fangt sie ein, wenn jemals einer ins eigene karge Hoch- oder Tiefland zurückkehrt, wenn sie einmal unser Shetland-Rindfleisch probiert und unsere hübschen Voes und Lochs gesehen haben. Nein, Sir“ (hier ging Magnus mit großer Lebhaftigkeit vor und nippte von Zeit zu Zeit an dem halbverdünnten Geist, der gleichzeitig seinen Groll gegen die Eindringlinge weckte und ihm half, die demütigende Überlegung zu ertragen, die seine Worte hervorriefen) – „Nein, Sir, die alten Zeiten und die echten Sitten dieser Inseln gibt es nicht mehr; denn unsere alten Besitzer – unsere Patersons, unsere Feas, unsere Thorbiorns – haben Giffords, Scotts, Mouats Platz gemacht, Männern, deren Namen auf sie oder ihre Vorfahren weisen, die dem Boden, den wir, die Troils, bewohnen, fremd waren, lange vor den Tagen des Turf-Einar, der diesen Inseln zuerst das Geheimnis des Torfverbrennens als Brennstoff lehrte und dessen Name der dankbaren Nachwelt noch die Entdeckung bezeugt.“
Dies war ein Thema, zu dem der Potentat von Jarlshof normalerweise sehr weitschweifig war, und Mertoun sah, zufrieden, dass er sich mit Vergnügen darauf einließ, im sicheren Wissen, nicht zum Gespräch gedrängt zu werden, und so seinem eigenen finsteren Humor frönen konnte, während der norwegische Shetländer über den Wandel von Zeiten und Bewohnern deklamierte. Doch gerade als Magnus zu der traurigen Schlussfolgerung gekommen war, „wie wahrscheinlich es sein mochte, dass in einem weiteren Jahrhundert nur noch ein knappes Stück Land im Besitz der nordischen Bewohner sein würde, der wahren Udaller[7] von Shetland“, erinnerte er sich an die Umstände seines Gastes und hielt plötzlich inne. „Ich sage das alles nicht“, fügte er hinzu und unterbrach sich selbst, „als ob ich nicht willens wäre, Euch aufzunehmen, Mr. Mertoun – aber was Jarlshof angeht – der Ort ist wild – woher Ihr auch kommt, ich zweifle nicht, dass Ihr wie alle Reisenden versichern werdet, dass Ihr aus einem besseren Klima als unserem kommt, denn das sagen sie alle. Und doch denkt Ihr an einen Rückzugsort, vor dem selbst die Einheimischen zurückscheuen. Wollt Ihr wirklich nicht Euer Glas nehmen?“ – (Das war als Interjektion zu verstehen) – „Nun denn, hier ist es für Euch.“
„Mein guter Herr“, antwortete Mertoun, „das Klima ist mir gleichgültig. Wenn nur Luft genug ist, um meine Lungen zu füllen, ist es mir egal, ob er der Atem Arabiens oder Lapplands ist.“
„Vielleicht habt Ihr genug Luft“, antwortete Magnus, „daran mangelt es nicht – etwas feucht, behaupten Fremde, aber wir kennen ein Korrektiv dafür – hier ist es für Euch, Mr. Mertoun – Ihr müsst wissen, was zu tun ist: eine Pfeife rauchen; und dann werdet Ihr, wie Ihr sagt, feststellen, dass die Luft von Shetland der von Arabien gleichkommt. Aber habt Ihr Jarlshof gesehen?“
Der Fremde verneinte.
„Dann, antwortete Magnus, habt Ihr keine rechte Vorstellung von Eurem Vorhaben. Wenn Ihr denkt, dass es dort eine bequeme Reede wie diese gäbe, mit dem Haus an der Seite eines landeinschneidenden Salzwassersees[8], der die Heringe bis vor Eure Tür bringt, so irrt Ihr euch gewaltig. In Jarlshof werdet Ihr nichts anderes sehen als die wilden Wellen, die auf die kahlen Felsen schlagen, und den Roost von Sumburgh, der mit einer Geschwindigkeit von fünfzehn Knoten pro Stunde läuft.“
„Ich werde zumindest nichts von der Strömung menschlicher Leidenschaften sehen“, antwortete Mertoun.
„Vom Tagesanbruch bis zum Sonnenuntergang werdet Ihr nichts als das Klirren und Schreien von Scarts, Sturzseen und Möwen hören.“
„Ich werde komponieren, mein Freund“, antwortete der Fremde, „damit ich das Geschwätz der Frauenzungen nicht höre.“
„Ah“, sagte der Nordmann, „das liegt daran, dass Ihr gerade meine kleine Minna und Brenda mit Eurem Mordaunt im Garten singen hört. Lieber lausche ich ihren kleinen Stimmen als der Feldlerche, die ich einst in Caithness hörte, oder der Nachtigall, von der ich gelesen habe. – Was werden die Mädchen tun, wenn ihnen ihr Spielkamerad Mordaunt fehlt?“
„Sie werden sich schon zu helfen wissen“, antwortete Mertoun. „Ob jünger oder älter, finden sie sich neue Spielgefährten. – Aber die Frage ist, Mr. Troil, verpachtet Ihr mir als Eurem Pächter dieses alte Herrenhaus von Jarlshof?“
„Gern, denn Ihr wählt selbst, an einem so verlassenen Ort zu leben.“
„Und was die Pacht betrifft?“ fuhr Mertoun fort.
„Die Pacht?“ antwortete Magnus: „Hm – nun, Ihr müsst das Stück Plantie-Cruive haben,[9] das sie einst einen Garten nannten, und ein Recht auf den Scathold und einen Sixpenny-Mark-Land, damit die Pächter für Euch fischen können; – acht Lispund[10] Butter und acht Schilling Sterling im Jahr – ist das zu viel?“
Mr. Mertoun willigte in diese maßvollen Bedingungen ein und wohnte fortan vornehmlich in dem einsamen Herrenhaus, das wir eingangs dieses Kapitels beschrieben haben; er fügte sich nicht nur klaglos, sondern – so schien es – mit mürrischer Freude den Entbehrungen einer so wilden und trostlosen Lage, wie sie ihrem Bewohner unvermeidlich auferlegt werden.
[7] Die Udaller sind die Allodialbesitzer Shetlands; sie verwalten ihren Besitz nach altem norwegischem Recht, nicht nach den aus Schottland eingeführten Feudalregeln.
[8] Salzwassersee.
[9] Ein Stück Land für Gemüse. Der liberale Landesbrauch erlaubt jedem, der Gelegenheit dazu hat, aus dem nicht eingezäunten Moor ein kleines Stück zu wählen, es mit einer Trockenmauer zu umgeben und als Kailyard zu bebauen, bis der Boden durch den Anbau erschöpft ist; dann lässt man es liegen und schließt ein anderes ein. Diese Freiheit bedeutet keineswegs einen Eingriff in Rechte von Eigentümer oder Pächter; vielmehr bringt ein Shetlander einem habgierigen Mann die äußerste Verachtung entgegen, wenn er sagt, er würde kein Plantie-Cruive von ihm halten.[10] Ein Lispund entspricht etwa dreißig englischen Pfund Gewicht; Dr. Edmonston schätzt den Wert auf zehn Schilling Sterling.
Kapitel 2
Es ist nicht nur die Szene – der Mann, Anselmo,
Der Mann findet Sympathien in dieser wilden Einöde,
Und grob taumelnde Meere, die schönere Ausblicke bieten
Und sanftere Wellen verweigern ihn.
Altes Arama
Die wenigen Bewohner der Gemeinde von Jarlshof hatten zunächst mit Bestürzung gehört, dass eine Person höheren Ranges gekommen sei, um in dem verfallenen Haus zu wohnen, das sie noch immer „das Schloss“ nannten. In jenen Tagen (denn die heutigen Zeiten haben sich stark zum Besseren verändert) war die Anwesenheit eines Vorgesetzten in einer solchen Lage mit ziemlicher Sicherheit mit zusätzlichen Belastungen und Anforderungen verbunden, für die die feudalen Bräuche stets Vorwände und tausend Entschuldigungen bereithielten. Auf diese Weise wurde ein Teil der hart erkämpften und prekären Gewinne der Pächter abgezweigt für die Nutzung durch ihren mächtigen Nachbarn und Vorgesetzten, den Tacksman, wie er genannt wurde. Bald jedoch merkten die Unterpächter, dass unter Basil Mertoun keine Unterdrückung dieser Art zu befürchten war. Seine eigenen Mittel – ob groß oder klein – reichten allemal aus, um seine Ausgaben zu decken, die, was seine Lebensführung anbelangte, überaus bescheiden waren. Der Luxus einiger Bücher und einiger philosophischer Geräte, mit denen er von Zeit zu Zeit aus London beliefert wurde, schien einen auf diesen Inseln ungewohnten Wohlstand zu ahnen; doch überstiegen weder Tisch noch Unterkunft im Jarlshof das Niveau dessen, was ein Shetland-Besitzer der niedrigsten Art für sich in Anspruch nehmen konnte.
Die Bewohner des Weilers kümmerten sich kaum noch um die Qualität ihres Vorgesetzten, sobald sie feststellten, dass ihre Lage durch seine Anwesenheit eher verbessert als verschlechtert würde; und nachdem sie sich von der Befürchtung befreit hatten, dass er sie tyrannisieren würde, steckten sie die Köpfe zusammen, um mit allerlei kleinen Übervorteilungen das Beste aus ihm herauszuholen, denen der Fremde zunächst mit stoischer Gelassenheit nachgab. Ein Vorfall jedoch stellte seinen Charakter in ein neues Licht und machte alle künftigen Bemühungen um überzogene Forderungen mit einem Schlag zunichte.
In der Schlossküche kam es zu einem Streit zwischen einer alten Gouvernante, die Mr. Mertoun den Haushalt führte, und Sweyn Erickson, einem braven Shetländer, der ein Boot zum Haaf-Fischen ruderte;[11] wie so oft wurde er mit wachsender Hitze und lautem Geschrei ausgetragen, bis er zu den Ohren des „Meisters“ (wie er genannt wurde) drang. Dieser, zurückgezogen in einem einsamen Turmzimmer und vertieft in die Prüfung eines lang ersehnten Bücherpakets, das nach mancher Verzögerung über Hull mit einem Walfänger nach Lerwick und von dort weiter nach Jarlshof gelangt war, fühlte mehr als den gewöhnlichen Schauder der Empörung, wie ihn träge Naturen verspüren, wenn sie unsanft zum Handeln gerufen werden, und begab sich zum Schauplatz des Streits. So plötzlich, energisch und streng erkundigte er sich nach der Ursache, dass die Parteien – trotz aller Ausflüchte – nicht verbergen konnten, worum es ging: um widerstreitende Interessen der ehrlichen Gouvernante und des nicht minder ehrlichen Fischers, konkret um einen Aufschlag von rund hundert Prozent bei einem Tauschhandel mit Kabeljau, den Erstere vom Letzteren für den Bedarf der Familie im Jarlshof gekauft hatte.
Als dies vollständig festgestellt und eingestanden war, stand Mr. Mertoun da und maß die Übeltäter mit einem Blick, in dem größte Verachtung und erwachende Leidenschaft miteinander zu ringen schienen. „Horch, du alte Hexe“, sagte er schließlich zur Haushälterin, „meide sofort mein Haus! Und wisse, dass ich dich entlasse, nicht weil du eine Lügnerin, eine Diebin und ein undankbarer Schurke bist – denn diese Eigenschaften stehen dir ebenso zu wie der Name einer Frau –, sondern weil du es gewagt hast, in meinem Hause lautstark zu zetern. – Und du, du Schlingel, der glaubst, du könntest einen Fremden betrügen, als schrecktest du einen Wal zurück[12], wisse, dass ich mit den Rechten bestens vertraut bin, die ich im Auftrag deines Herrn, Magnus Troil, ausüben kann. Provoziere mich nur weiter, und du wirst erfahren, dass ich deine Ruhe ebenso leicht stören kann, wie du die meine unterbrichst. Ich kenne die Bedeutung von ‚scat‘ und ‚wattle‘ und ‚hawkhen‘ und ‚hagalef‘(b) sowie jeder anderen Forderung, mit der deine Herren in alten und modernen Tagen deinen Widerrist zerrissen haben. Und keiner von euch würde den Tag nicht bereuen, an dem er sich nicht damit begnügte, mir nur das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern obendrein mit seinem rauen nördlichen Geschrei in meine Muße einbricht – ein Lärm, der es in Misstönigkeit mit dem Gekreisch eines arktischen Schwarms Möwen aufnehmen kann.“
Auf diese Strafpredigt fiel Sweyn nichts Besseres ein, als bescheiden zu bitten, Seine Ehren möge den Kabeljau unbezahlt behalten und weiter nichts über die Angelegenheit verlieren.
Aber da hatte Mr. Mertoun seine Erregung bereits zur zügellosen Wut gesteigert; mit der einen Hand schleuderte er dem Fischer das Geld an den Kopf, mit der anderen warf er ihn samt seinem eigenen Fisch zur Tür hinaus.
Das Verhalten des Fremden war derart furchteinflößend, ja tyrannisch, dass Sweyn weder innehielt, das Geld aufzusammeln, noch seine Ware zurücknahm, sondern eilig in das kleine Dörfchen floh, um seinen Kameraden zu melden, dass, reizte man ihn weiter, Meister Mertoun sich als ein vollkommener Pate Stewart[13] erweisen und ohne Urteil oder Gnade Köpfe rollen lassen würde.
Auch die Haushälterin kam herbei, um mit ihren Nachbarn und Verwandten (denn auch sie stammte aus dem Dorf) zu beraten, wie sie die begehrte Stellung zurückgewinnen könne, aus der man sie so plötzlich vertrieben hatte. Der alte Ranzellaar des Dorfes, der bei den Beratungen der Gemeinde das meiste Gewicht hatte, erklärte, nachdem er alles gehört hatte, dass Sweyn Erickson zu weit gegangen sei, indem er Mr. Mertoun einen überhöhten Preis aufgedrängt habe; und dass, welchen Vorwand der Tacksman auch immer vorschieben mochte, der eigentliche Anlass des Zorns darin bestanden haben müsse, dass er den Kabeljau mit einem Penny statt einem halben Penny je Pfund berechnet habe. Er ermahnte daher die gesamte Gemeinde, ihre Forderungen in Zukunft nie über das Verhältnis von drei Pence auf den Schilling (also drei von zwölf) zu erhöhen, da von ihrem Herrn im Schloss vernünftigerweise nicht zu erwarten sei, dass er dagegen murrte. Obwohl er ihnen keinen Schaden zufügte, sei es doch anzunehmen, dass er – in Maßen – nichts dagegen habe, ihnen Gutes zu tun. „Und drei von zwölf“, sagte der erfahrene Ranzellaar, „ist ein anständiger und mäßiger Gewinn und wird den Segen Gottes und des Heiligen Ronald nach sich ziehen.“
Indem sie den klug empfohlenen Tarif einhielten, betrogen die Einwohner von Jarlshof Mertoun fortan nur noch in einem mäßigen Ausmaß von fünfundzwanzig Prozent; ein Satz, dem sich alle Nabobs, Heeresunternehmer, Fondsspekulanten und andere Emporkömmlinge, denen der jüngste rasche Erfolg die großräumige Niederlassung auf dem Lande ermöglicht hat, als sehr angemessene Behandlung durch ihre Pächter unterwerfen sollten. Zumindest schien Mertoun so zu denken; um die Haushaltsausgaben kümmerte er sich fortan nicht weiter.
Nachdem die Bewohner von Jarlshof ihre eigenen Angelegenheiten geklärt hatten, nahmen sie sich als Nächstes des Falls Swertha an, der verbannten Matrone, die aus dem Schloss vertrieben worden war und die sie als erfahrene und nützliche Bundesgenossin unbedingt zurückhaben wollten. Doch als ihre Klugheit hier versagte, nahm Swertha in ihrer Verzweiflung Zuflucht zu den guten Diensten von Mordaunt Mertoun, bei dem sie sich durch ihr Wissen über alte norwegische Balladen und düstere Geschichten über die Trows oder Drows (die Zwerge), über Skalden – mit deren Hilfe abergläubische Ackerleute viele einsame Höhlen und braune Täler in Dunrossness, wie in jedem anderen Bezirk Shetlands, bevölkert zu haben meinten – einige Gunst erworben hatte. „Swertha“, sagte der Junge, „ich kann wenig für dich tun, doch du kannst etwas für dich selbst tun. Die Leidenschaft meines Vaters gleicht dem Zorn jener alten Recken, der Berserkar, von denen ihr singt.“
„Ja, ja, Fisch meines Herzens“, antwortete die alte Frau mit einem kläglichen Winseln; „Die Berserkars waren Helden, die vor den gesegneten Tagen des Heiligen Olave lebten und, wie von Sinnen, mit Schwertern, Speeren, Harpunen und Musketen über die Leute herfielen, sie alle in Stücke schlugen – wie die Finnen durch ein Heringsnetz gehen[14] –, und wenn die Wut verflogen war, so schwach und wankelmütig waren wie Wasser.“[15]