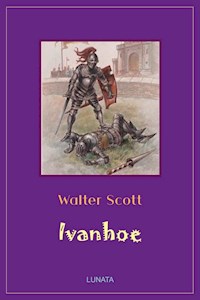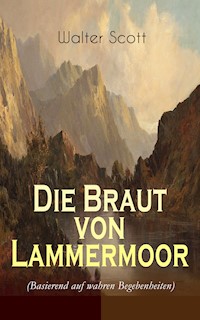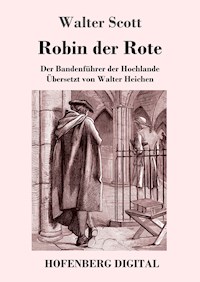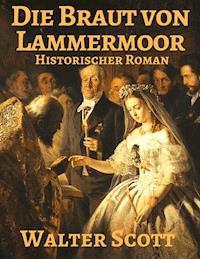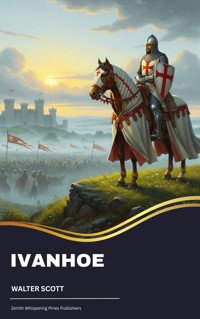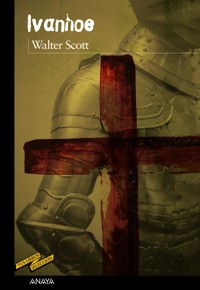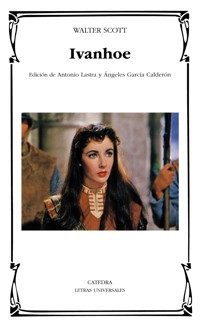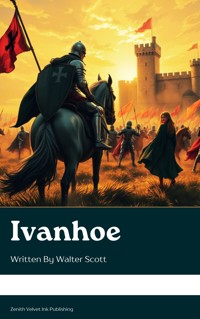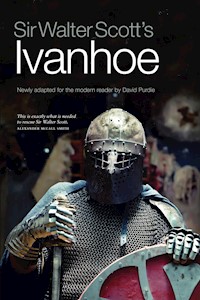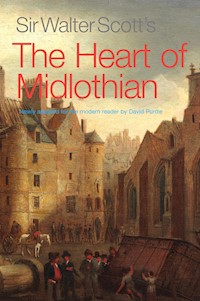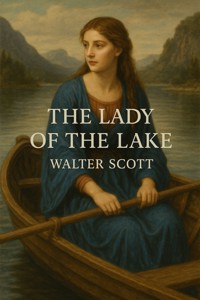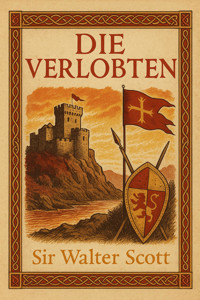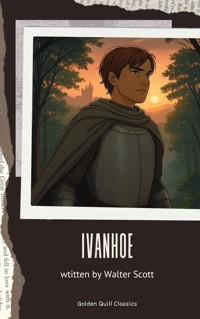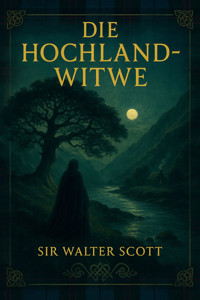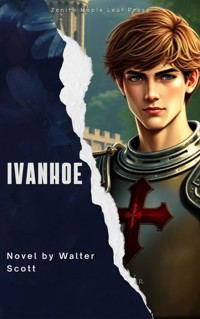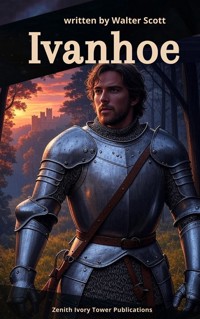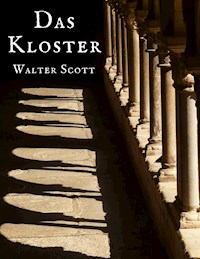
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Walter Scotts historischer Roman Das Kloster erzählt von Geschehnissen im schottischen Kloster Kennaqhueir um das Jahr 1550. Die fortschreitende Reformation versetzt das katholische Kloster in Aufruhr. Der Protestantismus gewinnt immer weiter an Boden. Walter Scott schildert die Folgen des Glaubenskriegs für das Leben einzelner Charaktere im Umfeld des Klosters. Auch ein Liebespaar gerät in die Dynamik des Konflikts. Eine weiße Fee greift steuernd in den Geschichtsverlauf ein. Der Roman Das Kloster erschien erstmals 1820. Vorbild für das Kloster Kennaqhueir war vermutlich Melrose Abbey. Die häufig erscheinende weiße Fee spricht in Reimen. Der Übersetzer Erich Walter hat die zahlreichen Verse einfühlsam ins Deutsche übertragen. Insofern kommen bei Walter Scotts Roman Das Kloster insbesondere Freunde der Lyrik auf ihre Kosten. Der schottische Schriftsteller und Bestseller-Autor Walter Scott lebte von 1771 bis 1832. Er war einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Viele Werke von Walter Scott sind Klassiker der Weltliteratur geworden und dienen als Vorlage für Schauspiele, Opern und Filme. Walter Scott gilt als einer der Gründer der Literaturgattung Historienroman. Von früher Jugend an begeisterte er sich für schottische Geschichte und setzte sein Wissen als Schriftsteller in Romanhandlungen um. Die erfolgreichsten Bestseller Walter Scotts sind neben Die Braut von Lammermoor die Romane Waverly, Die Presbyterianer, Das Herz von Midlothian und Ivanhoe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Kloster
Walter Scott Das Kloster Band 1 Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Siebentes Kapitel Achtes Kapitel Neuntes Kapitel Zehntes Kapitel Elftes Kapitel Zwölftes Kapitel Dreizehntes Kapitel Vierzehntes Kapitel Fünfzehntes Kapitel Sechzehntes Kapitel Siebzehntes Kapitel Band 2 Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Siebentes Kapitel Achtes Kapitel Neuntes Kapitel Zehntes Kapitel Elftes Kapitel Zwölftes Kapitel Dreizehntes Kapitel Vierzehntes Kapitel Fünfzehntes Kapitel Sechzehntes Kapitel Siebzehntes Kapitel Achtzehntes Kapitel ImpressumWalter Scott
Das Kloster
Band 1
Erstes Kapitel
Das Dorf, das der Benediktiner-Abt in dem von ihm hinterlassenen Manuskript unter dem Namen Kennaqhueir beschreibt, weist dieselbe keltische Endform auf, wie wir sie in Traqhueir, Caahueir und andern Zusammensetzungen treffen. Gelehrte leiten das Wort Ohneir her von gekrümmtem Flusslauf, was eigentümlicherweise mit den schlängelnden Windungen zusammenstimmen würde, die der Tweed unweit von dem Dorfe Kennaqhueir macht. Das Dorf stand lange Zeit in Berühmtheit durch sein Sankt Marien-Kloster, das zusammen mit den andern nicht minder hoch angesehenen Abteien derselben Grafschaft: Melrose, Jedburgh und Kelso, von David I., König über Schottland und Shetland, gestiftet wurde. David I. beschenkte diese kirchlichen Stifte mit reichem Gut an Ländereien und Gerechtsamen und wurde aus Dankbarkeit hierfür vom Papst heilig gesprochen, was freilich einen verarmten Nachkommen von ihm nicht gehindert hat, sich dahin zu äußern, besagter König David sei ob dieser und andrer Torheiten besser unter die Kategorie der Unheiligen zu setzen. Nichtsdestoweniger ist es nicht unwahrscheinlich, dass besagtem schottischen König David neben diesen Verdiensten um den katholischen Glauben auch mancherlei weltliche Verdienste beizumessen sein werden, und dass er zu seinen Schenkungen an die Kirche durch weltliche Rücksichten mitbestimmt worden ist. Es stand seit der „Fahnenschlacht“, aus der er nicht als Sitzger hervorging, um die Sicherheit seiner Besitzungen in Northumberland und Cumberland nicht sonderlich günstig. Und da infolge dieser Schlacht zu erwarten stand, dass das fruchtbare Tal des Teviot zur Landesgrenze gemacht werde, griff er diesem in England gehegten Gedanken vor und versuchte sich einen Teil dieser einträglichen Besitzungen dadurch zu sichern, dass er ihn der Kirche als Eigentum überwies, und diese hat sich des ihr auf diese Weise anheim gefallenen Gutes auch lange Zeit, sogar in den wilden Grenzkriegen, in ziemlich ungestörter Ruhe erfreuen dürfen.
Man geht wirklich nicht fehl, wenn man dem König David von Schottland einräumt, dass dies für ihn die einzige Hoffnung war, den Bebauern dieser Landstriche Schutz und Sicherheit zu schaffen, und in der Tat ließen sich auch Generationen hindurch diese Besitzungen der genannten Abteien dem biblischen Lande Gosen vergleichen, denn über ihnen breitete der Engel des Friedens seine segnende Hand, und ihre Felder und Wälder gediehen und brachten reiches Gut, während alle andern Teile des Reichs unter dem Druck der eisernen Faust wilder Clans und raubgieriger Barone seufzten und aus der düstersten Verwirrung, aus blutigem Krieg und gewalttätiger Fehde niemals herauskamen.
Indessen erhielten sich diese kirchlichen Vorrechte in voller Kraft nicht bis zu der Zeit, da die Kronen der beiden Reiche vereinigt wurden, und lange schon vor dem Eintritt dieses Ereignisses hatten die Kriege zwischen England und Schottland den Charakter nationaler Zwietracht eingebüßt und waren aufseiten Englands zum rücksichtslosen Unterjochungskampfe, in Schottland dagegen zum rasenden Ringen um die dem Lande eigentümlichen Rechte und Freiheiten geworden. Dadurch wuchs die Erbitterung auf beiden Seiten zu einer Höhe, wie man sie in der wildesten Zeit der früheren Zwietracht nicht gekannt hatte, und als sich später noch Glaubensstreit und religiöse Zweifel hinzugesellten und den Hass der beiden Völker aus allen Fesseln und Banden lösten, da blieben auch der Kirche die alten Vorrechte trotz aller Verbrieftheit nicht mehr erhalten, und sie gingen des staatlichen Schirmrechts allmählich verlustig.
Aber die Untertanen und Lehnsmannen genannter großer Abteien besaßen noch immer allerhand Vorteile vor denen der weltlichen Grundherren, denen infolge des ununterbrochenen Kriegsdienstes, der ihnen oblag, aller Sinn für die Künste des Friedens abhanden kam. Dem Kirchenvasallen lag hingegen die Verpflichtung des Waffendienstes nur dann ob, wenn das eigentliche Reichsinteresse in Gefahr stand; in aller Privatfehde der Barone blieb ihnen die völlige Ruhe und Unantastbarkeit gewahrt, und keines ihrer Lehen, wie die Abteien ihre an Pächter gegen mäßige Abgabe verliehenen kleinen Landgüter zu nennen liebten, durfte anderm als kirchlichem Aufgebot folgen. Auf diese Weise blieb ihnen der ruhige Besitz vergönnt, und selbst heute noch trifft man in Schottland in der Gegend, wo diese großen Klöster lagen, auf Nachkommen solcher einstigen Kirchenvasallen, die sich das Besitztum ihrer Väter von Kind auf Kindeskind zu erhalten verstanden haben. Kein Wunder, dass infolge dieses Zusammenwirkens so günstiger Umstände die Abteiländer Schottlands sich besserer Bewirtschaftung rühmen durften, als aller in weltlicher Hand befindliche Besitz, und dass in ihrem Bereiche die Bewohner nicht allein in materieller Hinsicht sich besser befanden, als alle übrigen Landbewohner von Schottland, sondern ihnen auch in Eigenschaften des Geistes bedeutend überlegen waren.
Die Wohnstätten solcher Kirchenvasallen bildeten in der Regel eine kleine Dorfschaft, in der sich dreißig bis vierzig Familien zu gegenseitigem Schutz und Trutz zusammen zu siedeln pflegten. Indessen verschwand hierfür bald der Name Dorf und machte dem Namen Stadt Platz, wie man auch die Ländereien, die zu solcher Niederlassung gehörten, Stadtgebiet oder „Stadtfreiheit“, bezeichnete. In der Regel waren diese Ländereien gemeinsamer Pachtbesitz der Bewohner solcher „Stadt“, dessen Aufteilung jedoch nach Maßgabe der Verhältnisse jedes einzelnen „Bürgers“, erfolgte, derjenige Teil des Landes, der den Ackerboden enthielt und also gepflügt werden musste, führte den Namen „Infeld“; gebaut wurden Hafer und Gerste, zumeist in Wechselfurchen-Weise, und die Arbeit fiel bei der Aussaat und Ernte allen gleichmäßig zu, während die Ansprüche an der Jahresfrucht je nach den „Bürgerrechten“ sich regelten.
Anders verhielt es sich um das sogenannte „Ausfeld“, dessen Bebauung in gewissem Grade der Willkür seiner Anwohner überlassen blieb. Jeder Lehnsmann wählte sich von den zum „Ausfeld“, gehörigen Triften und Höhen, was ihm beliebte, und die Unsicherheit des Ertrages aus diesen zu Gemeindeweiden benützten Strecken lieh jedem Lehnsmann, der sich der Mühe, den Anbau zu versuchen, unterzog, ein ausschließliches Anrecht auf die Frucht, die ihm solches Stück „Ausfeld“ brachte.
Die Wohnstätten der Kirchenvasallen behielten ihren ursprünglichen, einfachen Charakter, ebenso wie die Weise, ihr Feld zu bauen, ursprünglich und einfach blieb, ganz wie man es heutzutage noch finden kann, überall auf den shetländischen Inseln. Jedes Dorf oder Städtchen hatte mehrere kleine Türme, deren Zinnen über die Mauern aufragten, und die in der Regel ein paar vorspringende Winkel bildeten, die mit Schießscharten versehen waren, während das starke, mit eisernen Nägeln beschlagene eichene Tor zumeist noch durch ein eisernes Gitter außen verrammelt war. In den kleinen Häusern wohnten zumeist bloß die bessern Lehnsleute mit ihrer „Sippe“, aber sobald die geringste Gefahr im Verzuge war, kamen die andern Dörfler aus ihren ringsherum gelegenen ärmlichen Hütten herbeigeeilt und besetzten alle Verteidigungspunkte. Infolgedessen war es für Feinde nicht leicht, in solches Dorf einzubrechen, denn die Männer waren geübt in Armbrust und Muskete, und die „Wehrtürme“, waren gemeinhin so angelegt, dass ihr Feuer kreuzweise strich, sodass es eine Unmöglichkeit war, den Angriff auf einen einzelnen Turm zu richten.
Die innere Einrichtung dieser Wohnstätten war zumeist äußerst dürftig und einfach, denn es wäre Torheit gewesen, durch irgendwelchen Überfluss oder gar Zierrat die lüsterne Gier kriegerischer Nachbarn zu wecken. Immerhin fand sich in diesen Familien von Kirchenvasallen ein höherer Grad von Wohlstand, Unabhängigkeitssinn und Verständnis vor, wie sich eigentlich hätte vermuten lassen. Ihr Acker versorgte sie mit Brot, ihre Herden mit Fleisch, und in allen Familien wurde im Monat November ein fetter Ochse geschlachtet und für den Winter in Salzwasser gelegt, und bei besonders festlichen Gelegenheiten griff die kluge Hausfrau wohl nach einem Hahn oder einer Henne oder auch wohl ein paar Tauben in den Geflügelstall, und der Garten brachte Kohl und andres Gemüse, die Flüsse aber, deren Wasser noch durch keinerlei Industrie verdorben wurde, lieferten Fische für die Fastenzeit im Überfluss.
Auch an Feuerungsmaterial litten sie nie Mangel, denn die Moore lieferten Torf über Torf und die Wälder Bau- und Brennholz. Dazu kam nun für die Besserung der Lebensverhältnisse noch der nicht unbedeutende Vorteil, dass diesen Kirchenlehen Jagdrecht zustand, und kein guter Hausvater unterließ es, im Herbst einen Rehbock abzuschießen.
Mit dem Unterricht lag es freilich noch sehr im argen, und man durfte wirklich sagen, dass die Bewohner „besser ernährt als belehrt“, würden, indessen boten auch ihnen sich zur Erweiterung des Wissens bessere Gelegenheiten als andern Landleuten im Reiche. Die Mönche unterhielten im allgemeinen freundlichen Verkehr und Umgang mit ihren Vasallen und Hörigen, und es traf sich oft, wenn ein Knabe besonders gute Veranlagung zeigte, dass sich ein Bruder der besondern Mühe unterzog, ihm Unterricht in den Wissenschaften zu geben, die sich freilich zumeist nur auf die Mysterien des Schreibens und Lesens erstreckten, denn nur in Ausnahmefällen reichten die Kenntnisse der Klosterbrüder selbst in andre Wissenssphären hinüber. Da aber, wie schon bemerkt, den Häuptern dieser Familien mehr Ruhe zu geistiger Arbeit blieb, so konnten sie begreiflicherweise all ihr Tun und Lassen besser überlegen und erwägen als die in ewigen Fehden liegenden Nachbarn, und hierdurch waren sie mit den Jahren in der ganzen Umgegend solcher Abtei in den Ruf von Schlauheit und Pfiffigkeit gekommen, während sie anderseits zufolge des verhältnismäßig größeren Wohlstandes, in welchem sie sich befanden, und der geringeren Gelegenheit, sich kriegerisch zu betätigen, keinen günstigen Ruf als mutige, unternehmungslustige Männer genossen. Sie hielten sich auch möglichst untereinander, heirateten gemeinhin nur aus einem Abteidorf ins andre und hatten vor nichts anderm in der Welt größere Bange, als in die verderblichen Fehden und die unaufhörlichen Ärgernisse und Zwistigkeiten der weltlichen Lehnsleute verwickelt zu werden.
So beschaffen war im Großen und Ganzen der Zustand dieser Abteigemeinden, die aber in den verhängnisvollen Unruhen, die in die Regierungsjahre der Königin Maria fielen, infolge von feindlichen Einfällen furchtbar gelitten hatten. Die protestantischen Engländer waren so wenig geneigt, katholisches Klerisei-Gut zu schonen, dass sie darin noch weit schlimmer hausten als in jedem weltlichen Besitztum. Der im Jahre 1550 zwischen den beiden Nachbarreichen geschlossene Frieden hatte den unglücklichen Landstrichen wieder einige Ruhe verschafft, und es hatte sich allmählich alles wieder ins alte Gleis zurückgefunden. Die Mönche hatten ihre zerstörten Kapellen wieder angefangen aufzubauen, und die kleinen Vasallenfesten, die von den englischen Söldnern in Schutt und Asche gelegt worden waren, erstanden nacheinander wieder zu neuer Blüte. Der Ackersmann schlug seine Hütte wieder auf, und aus den Einöden, wohin die Leute ihr Vieh getrieben hatten, kehrte langsam, was noch am Leben war, in die Dorfschaften zurück, die Felder wurden wieder bebaut, aus den Mooren wurde wieder Torf gefördert, die Wälder wurden wieder aufgeholzt, für neuen Wildstand wurde gesorgt, und so zog wieder, wie für die andern Abteien im schottischen Reiche, auch für das Sankt Marien-Kloster zu Kennaqhueir und für die zu ihm gehörige und von ihm abhängige Gemeinschaft voll Lehnsleuten und Hörigen Ruhe und Frieden ein und währte manches glückliche Jahr, so lange es der Geist der Zeit und die Lage des Volkes vergönnten.
Zweites Kapitel
Wir sagten im vorigen Kapitel, dass die meisten Pächter oder Lehensleute in dem zu ihrem Stadtgebiete gehörigen Bezirk ihre Wohnstätte hatten. Das war jedoch nicht immer der Fall, und der einsame Turm, in den wir unsre Leser jetzt führen werden, bildete zum wenigsten eine feste Ausnahme von der sonstigen Gepflogenheit.
Es war ein kleines Gebäude, aber noch immer größer, als die sonst in diesen Dörfern befindlichen, und dem Anschein nach darauf eingerichtet, dass sich der Eigentümer im Falle eines Angriffs auf die eigene Tapferkeit verlassen müsse. Ein paar ärmliche Hütten am Fuße der „Burg“, dienten den Pachtleuten oder Hörigen des Vasallen als Aufenthalt. Die Lage der „Burg“, war romantisch: Sie erhob sich auf einem bewaldeten Hügel, der nach Süden zu in eine wilde Schlucht vorsprang, während auf der andern Seite sich ein Bach um sie herumzog, der die ihr von Natur verliehene Sicherheit wesentlich erhöhte.
Die größte Sicherheit aber verlieh der kleinen Feste, die den Namen Glendearg führte, ihre versteckte Lage. Wer zu ihr gelangen wollte, musste sich ein paar Stunden auf mühsamem Pfade durch das vielfach verschlungene Tal hindurcharbeiten und wohl an die zwanzig Mal über den Bach setzen, der sich durch die engen Gründe wand und alle hundert Schritte durch neue Felsschiebungen in ein andres Bett hineingezwängt wurde, um dann über Schroffen und Schrägen hernieder zu schießen. Jäh stiegen zu beiden Seiten des Tales die Felswände empor und hielten den Bach gefangen. Für Reiter war jede Passage hier ein Ding der Unmöglichkeit; nur auf Fußpfaden war es möglich, hier vorwärts zu kommen, und so schien niemand zu vermuten, dass man auf solch beschwerlichen Wegen anderswohin als zur Hütte eines Hirten gelangen werde.
Aber so einsam und beschwerlich auch das schmale Tal zu sein schien und so unfruchtbar es sein mochte, so entbehrte es anderseits doch manches Reizes nicht. Am Ufer des Baches, auf den kleinen schmalen Rändern wuchs Gras so dicht und grün, dass an die hundert Gärtner vierzehn Tage hätten mähen können und wohl kaum damit zustande gekommen wären. Der Gießbach, der bald zwischen engen Wänden sich wand, bald unbehindert durch das Tal hin schoss, führte seine Fluten sorglos dem hellen Teiche zu. Die Berge stiegen über dem Tale auf und wiesen ihm das graue Felsgestein, von der vor Menschengedenken reißende Gewässer alles Grün hinweggewaschen hatten, aber stellenweise blinkten noch immer einzelne Baumgruppen und mageres Gebüsch herunter von den Höhen, das dem Zahn der Herden, dem Messer der Lehnsleute entgangen war und der Gegend Schönheit und Mannigfaltigkeit zugleich verlieh. Äußerst reich war die Waldflora im Tal, Eichen und Birken, Eschen und Erlen, Schwarzdorn und Espen einten sich mit dem purpurnen Schimmer der mit Heidekraut bewachsenen Spitzen zu einem buntfarbigen Bilde ohnegleichen, das zu dem tieferen Grün und zu der samtenen Weiche des Rasens am Höhenfuß und in den Talgründen in anziehendem Gegensatze stand.
Aber trotz all dieser Schönheiten ließ sich die Gegend weder als erhaben noch auch nur als malerisch bezeichnen. Die seltsame Einsamkeit, die hier herrschte, bedrückte das Herz, und der Wanderer fühlte sich unsicher, wohin er die Schritte lenken solle und wo der unwegsame Pfad sein Ende finden werde. Dadurch wird die Fantasie wohl immer stärker angeregt als durch große Szenerien, bei denen sich genau berechnen lässt, wie weit ein Gasthaus noch entfernt ist, in welchem wir wissen, dass wir den Mittagstisch gedeckt finden oder eines bequemen Nachtquartiers uns versichert halten dürfen. Indessen sind dies alles Gesichtspunkte einer späteren Zeit, denn in derjenigen, von welcher wir sprechen, wusste man weder etwas von malerischer Natur noch von den Bequemlichkeiten eines Gasthofs. Für sie war diese Gegend schätzenswert aus andern, dem Geist ihres Zeitalters angemessenen Gesichtspunkten. Der Name des „roten Tales“, den sie trug, war nicht bloß herzuleiten von der Purpurfarbe des Heidekrauts auf ihren Höhen, sondern auch von dem dunkleren Rot der Felsen und Erdmassen, die in dieser Gegend unter dem Namen „Scaurs“, bekannt sind. Auf der Höhe von Ettrick liegt ein ähnliches Tal, das aus ähnlichen Ursachen den gleichen Namen führt, und wahrscheinlich hat es solcher Täler mehrere in Schottland gegeben.
Da Glendearg, mit dem wir uns hier zu befassen haben, keinen übermäßigen Zuwachs von sterblichen Gästen erhielt, so bevölkerte es der Aberglaube zum Ersatze hierfür mit Bewohnern einer andern Welt, für die seine einsamen Klüfte ohne Zweifel einen vorzüglichen Zufluchtsort boten. Das „braune Männchen“, wohl der echte Abkömmling der Zwerge des Nordens, wollte man öfter im Moorgrunde gesehen haben, und zwar ganz besonders nach der herbstlichen Nachtgleiche, wenn sich im dichter werdenden Nebel die Dinge nicht mehr genau unterscheiden lassen. Auch eine „Feenhöhle“, kannte man im Tale, in einer abgelegenen rauen Schlucht, und hier sollten die grillenhaften Geschöpfe, die nur selten dem Menschen wohlwollen, nächtlicherweise ihren Spuk treiben. Geheimnisvolle Schauer lagerten über dem ganzen Tale, durch das man aus dem breiteren Tale des Tweed nach der Feste Glendearg gelangte. Jenseits des Hügels, auf dem die Feste stand, wurden die Höhen steiler, um sich stellenweise so dicht an den schmalen Bach heranzudrängen, dass sie kaum Platz für einen schmalen Pfad freiließen, und hier bildete ein tosender Wasserfall eine Art Talsperre und über ein paar Felsen hinweg stürzten polternd die zu Gischt und Schaum gepeitschten Wassermengen in grausige Tiefe. Unfern von dieser Stelle zog sich ein unwegsamer Morast, scheinbar ohne Grenzen, auf dem nur Wasservögel hausten, und der zwischen den Talbewohnern und den Nachbarn auf der Nordseite eine Art Scheidewand bildete.
Freilich war dieser Morast den Wegelagerern und Freibeutern wohlbekannt, und gar oft suchten sie hier sichre Zuflucht. Oft auch dehnten sie ihre Streifen bis ins Tal hinunter aus und drangen zu der kleinen Feste hinauf, um dort Gastfreundschaft zu begehren, die ihnen auch gewährt wurde, ohne dass jedoch die friedlichen Bewohner aus jener Zurückhaltung heraustraten, die ein europäischer Ansiedler im nördlichen Amerika bezeigen mag, wenn wilde Indianertrupps bei ihm Einkehr halten und um Bewirtung ansprechen, die er mehr aus Furcht denn aus Gastfreundschaft gewährt.
Indessen waren auch in dieser Hinsicht früher andre Anschauungen hier maßgebend gewesen. Der letzte Lehnsmann, Simon Glendinning, rühmte sich, von dem alten Geschlecht der Glendowynne zu stammen, die auf der Westgrenze ihre Sitze gehabt hatten, und wenn er abends am Feuer saß, dann erzählte er gern von den Heldentaten seiner Ahnen, von denen einer bei Ottoburne an der Seite des tapferen Grafen von Douglas gefallen sein sollte. Bei solchem Anlass hielt dann Simon Glendinning in der Regel ein altes Schlachtschwert auf dem Schoß, das seine Ahnen geführt hatten, lange vorher, ehe einer aus dem alten Geschlecht sich bemüßigt gefunden hatte, bei den Mönchen von Kennaqhueir sich um ein Kirchenlehen zu bewerben. In neueren Zeiten hätte ja Glendinning gemütlich auf seiner Besitzung hausen und mit seinem Schicksale murren können, das ihn hierher verwiesen hatte und ihm nun jede Gelegenheit raubte, sich als Kriegsmann zu verdingen; damals aber fanden sich so viel Anlässe, das murrende Wort durch grimme Tat zu ersetzen, dass sich Simon sogar gezwungen sah, unter den Mauern des Klosterbanns vom Sankt Marien jenen unglückseligen Feldzug mitzumachen, der in der Schlacht von Pinkie ein so schlimmes Ende fand.
In diese Fehde war die katholische Geistlichkeit stark verwickelt, weil man die Heirat der noch unmündigen Maria mit dem Sohn des ketzerischen Heinrich zu verhindern strebte. Infolgedessen hatten die Abteien ihre sämtlichen Vasallen aufgeboten und einen kriegsgeübten Heerführer gedungen, und viele von ihnen hatten sich selbst Waffen umgegürtet und waren mit einer Fahne ins Feld hinausgerückt, auf der die schottische Kirche unter dem Bilde einer weiblichen Gestalt kniete, mit der Umschrift: „ Afflictae sponsae ne oblivisceris. “
Den Schotten tat es aber von je not an besonnenen Führern, denn an Feuer und Ungestüm fehlte es ihnen selber nie. Ihr unbesonnener Mut stürzte sie oft in den Kampf, ohne dass sie Rücksicht auf die eigne und die Stellung des Feindes nahmen, und die unausbleibliche Folge war immer der Verlust einer Schlacht. Aber bei der unheimlichen Schlächterei von Pinkie wollen wir uns nicht aufhalten; es genüge hier bloß die Bemerkung, dass Simon Glendinning an diesem Tage mit zehntausend Rittern und Hörigen den Tod fand und den Ruhm des alten Geschlechts durch diesen Tod nicht verringerte.
Als die traurige Kunde hiervon zum Turme von Glendearg gelangte auf ihrem Schreckenswege durch Schottland, da befand sich Simons Witwe Elspath Brydone in der einsamen Burg allein, ein paar Knechte ausgenommen, die weder zur Arbeit noch zum Kriege mehr taugten, und die hilflosen Witwen und Waisen der Mannen ausgenommen, die im Verein mit ihrem Herrn den Tod gefunden hatten. Der Jammer hielt seinen Einzug, aber was konnte Klagen und Jammern nützen? waren doch die Mönche, ihre Herren und Beschützer, durch die englischen Söldner selbst aus der Abtei vertrieben worden, hatten sich doch die Söldnerscharen überall in den Grenzdistrikten festgesetzt und die Bewohner, wenn auch zumeist nur dem Scheine nach, unter ihr Joch gezwungen. Bei den Trümmern der alten Feste Roxburgh hatte der Protektor Somerset ein festes Lager bezogen und befahl alle Umwohnenden zu sich, um, wie es in seinem Erlasse hieß, gegen Abgabe Sicherheit zu bekommen. Es war wirklich auch alle Kraft zum Widerstande gebrochen worden, und die wenigen Barone, die edelsinnig genug waren, sich auch dem Scheine nach nicht zu unterwerfen, gaben ihre Wohnstätten der Zerstörung preis und flüchteten in die einsamen Burgen im Gebirge, während alle Gegenden, deren Herren sich der Unterwerfung weigerten, von englischen Haufen durchzogen und gebrandschatzt wurden. Der Abt und die Klosterbrüder hatten sich über den Forth hinüber geflüchtet, und ihre Ländereien wurden um so härter mitgenommen, weil man sie für ganz unversöhnliche Feinde der englischen Krone hielt.
Unter den zu solchen Streifen kommandierten Truppenabteilungen kommandierte Stawarth Bolton eine kleine Schar. Er war Hauptmann in englischen Diensten, aber er gehörte zu jenem bessern Teile englischer Hauptleute, die sich durch eine derbe Großmut und ritterlichen Sinn gegen die Besiegten auszeichnen. Als Frau Elspath Brydone ein Dutzend Reiter den Pfad durchs Tal entlang kommen sah und an der Spitze einen Mann gewahrte, dessen Purpurmantel und glänzende Rüstung mit dem wallenden Federbusch auf dem Helme den Anführer kennzeichneten, ersah sie sich keinen bessern Rat, als im langen Trauergewande mit ihren beiden Knaben an der Hand vor die mit eisernen Nägeln beschlagene Pforte zu treten, die Burg in ihrem vereinsamten Zustande zu übergeben und für sich und ihre Knaben um Schonung zu bitten.
„Ich unterwerfe mich, weil ich Widerstand nicht leisten kann“, waren die wenigen Worte, die sie an den englischen Hauptmann richtete.
„Um der gleichen Ursache willen, Frau, nehme ich Eure Unterwerfung nicht an“, erwiderte der englische Hauptmann; „ich begnüge mich mit der Erklärung, dass Ihr Frieden halten wollt, und nach dem Sinn Eurer Worte zu urteilen, ist daran wohl nicht zu zweifeln.“
„So teilt wenigstens mit uns, was an Vorräten noch in der Burg ist“, sagte Elspath Brydone, „denn Eure Rosse sind erschöpft und Eure Mannschaft bedarf der Erquickung.“
„Nein“, erwiderte der Hauptmann, „ich lehne Euer Anerbieten ab, denn es soll von uns englischem Kriegsvolk nicht heißen, dass wir die Witwe eines tapferen Kriegsmanns mit einem Zechgelage belästigt hätten, als sie noch um den Hausvater trauerte. Kameraden! Doch halt!“, setzte er hinzu und schwenkte sein Ross herum, „es streifen in allen Richtungen Parteien herum, sie müssen ein Wahrzeichen finden, dass Ihr unter meinem Schutze steht. Komm her, kleiner Gesell“, sagte er zu dem ältesten Knaben, der etwa neun oder zehn Jahre alt sein mochte, „gib mir mal Deine Mütze!“
Der Knabe wurde rot bis hinter die Ohren, zauderte und blickte finster drein, bis es endlich der Mutter gelang, ihm unter Worten freundlicher Zurechtweisung die Mütze aus der Hand zu nehmen. Sie gab sie dem Hauptmann, der das gestickte rote Kreuz aus seinem Barett löste und an die Mütze steckte. Hierauf sagte er zu der Witwe:
„Durch dieses Zeichen, das all den Unsern heilig ist, werdet Ihr gesichert sein vor jedem Überfall.“
Dann setzte er dem Knaben die Mütze wieder auf, aber kaum war es geschehen, als der Knabe trotzig, mit wilden Blicken, ehe die Mutter es ihm wehren konnte, die Mütze vom Kopf gerissen und in den Bach geschleudert hatte. Eilends aber kam der andre Knabe herbeigerannt, lief zum Bache hin und sprang der Mütze nach. Es gelang ihm, sie den Fluten zu entreißen, und er brachte sie der Mutter wieder. Vorher aber zog er das Kreuz aus dem Tuche, küsste es mit tiefer Inbrunst und barg es an seiner Brust. Den Engländer befremdete und ergötzte dieser Auftritt, und mit einem Tone, der zwischen Ernst und Scherz schwankte, fragte er den älteren der beiden Knaben:
„Weshalb hast Du das Kreuz weggeworfen?“
„Weil der heilige Georg bloß im Süden was zu suchen hat“, antwortete mürrisch der Knabe.
„Gut“, sagte der Hauptmann, und dann wandte er sich an den jüngeren:
„Und was dachtest Du, kleiner Freund, als Du das Kreuz wieder aus dem Wasser holtest?“
„Der Priester sagt, es sei allen Christen ein Zeichen des Heils.“
„Auch gut erklärt“, sagte der Hauptmann. „Wahrlich, liebe Witfrau, um diese beiden Jungen beneide ich Euch. Gehören sie Euch beide?“
Wenn der Hauptmann diese Frage stellte, so hatte er gewiss Grund dazu, denn Halbert Glendinning hatte rabenschwarzes Haar und schwarze, große, stechende Augen, die unter den gleichfarbigen Brauen düster blitzten, und eine dunkelgebräunte Hautfarbe; sein Gesichtsausdruck war freimütig, fest und bestimmt in einem Masse, wie sein Alter kaum hätte erwarten lassen. Der jüngere Bruder hingegen hatte blondes Haar und blaue Augen, eine zartere Gestalt und einen sanfteren Gesichtsausdruck, er sah fast bleich aus und auf seinen Wangen leuchtete nicht der rosige Hauch kräftiger Gesundheit. Indessen sah der Knabe durchaus nicht krankhaft aus, auch mangelte ihm nicht das Ebenmaß der Formen; er war im Gegenteil ein hübsches Kind, dessen milder, liebevoller Blick unmittelbar zum Herzen sprach.
Die Mutter blickte erst stolz, dann zärtlich von einem Knaben zum andern, dann antwortete sie dem Hauptmann:
„Freilich, edler Herr! es sind beides meine Jungens!“
„Und vom gleichen Vater?“, fragte der Hauptmann weiter; doch als er die Röte bemerkte, die ihre Wangen überflog, setzte er rasch hinzu: „Nein, kränken wollte ich Euch nicht, liebe Frau; aber ich würde meine Gevatterin drüben in Merry Lincoln auch nicht anders fragen. Na, das muss ich sagen, Ihr habt da ein Paar herrliche Buben, und ich wünschte, Ihr könntet mir einen davon überlassen, denn ich könnt gar gut einen gebrauchen, lebe ich doch mit meiner Frau auf unsrer alten Burg ganz kinderlos. Na, wie steht's, Jungens, wer will von Euch beiden mit mir mitkommen?“
Die Mutter erschrak ob solcher Rede und zog mit beiden Händen die Knaben näher zu sich heran, während beide dem Hauptmann ihre Antworten gaben.
„Ich geh nicht mit Euch mit“, sagte Halbert keck, „Ihr seid ein treuloser Mann aus dem Süden, und die Männer aus dem Süden haben meinen Vater erschlagen, aber ich will auf Tod und Leben mit Euch kämpfen und streiten, kann ich erst einmal das Schwert meines Vaters schwingen.“
„Na, Du kleiner Streithammel“, versetzte der Hauptmann, „der schöne Brauch, auf Tod und Leben miteinander zu ringen, wird ja in unsern Tagen noch nicht verschwinden. ... Na, und Du, mein zarter Flachskopf, Du magst auch nicht mit mir mitkommen und auf hübschen Steckenpferdchen spazieren reiten?“
„Nein“, erwiderte Edward stockend, „denn Ihr seid ja ein Ketzer!“
„Ei, das muss ich sagen, liebe Frau“, erwiderte der Hauptmann, „meine Werbung hat bei Euch schlechten Fortgang, und doch beneide ich Euch um die beiden Jungen.“ Weder Harnisch noch Koller konnten den tiefen Seufzer verbergen, mit dem er innehielt, dann aber fuhr er fort: „Na, wer weiß, schließlich setzte es bloß Verdruss mit meiner Hausfrau darüber, welcher von beiden ihr der liebste wäre, denn mir gefiele doch der schwarzäugige besser, und sie entschiede sich doch ganz gewiss für den flachsblonden. Na, was hilft's! wir müssen uns mal drein finden, dass wir keine Kinder haben sollen, und müssen das Glück, Kinder zu haben, glücklicheren Menschen lassen als wir sind. ... Sergeant Brittson, Du bleibst hier, bis Du abkommandiert wirst. Beschütze diese Leute, Du bist mir Bürge für sie. Füge ihnen keinerlei Kränkung und Schaden zu, und sorge dafür, dass dies auch von andern nicht geschieht. Ich halte mich an Dich, verstehst Du? ... Liebe Frau, Brittson ist ein verheirateter Mann, alt und verlässlich. Sorgt, dass er pünktlich sein Essen hat. Aber haltet ihn mäßig im Trinken!“
Abermals bot Frau Glendinning dem Hauptmann Erfrischungen an, aber mit unsicherer Stimme und erfüllt von dem stillen Wunsche, dass er es ablehnen möge; denn da sie, nach dem gewöhnlichen Irrtum von Eltern, annahm, dem Hauptmann möchte es ebenso sehr darum gehen, Kinder zu bekommen, wie ihr, sie zu behalten, so fürchtete sie, es möchte ihn am Ende die Freude über die beiden Jungen, der er so derben Ausdruck gegeben, dazu verleiten, ihr einen davon zu nehmen. Sie umklammerte sie deshalb mit beiden Händen, wie wenn sie mit ihrer schwachen Kraft bereit sei, sie zu beschützen, wenn man Gewalt brauchen sollte, und mit sichtlicher Freude sah sie, wie der kleine Trupp umlenkte und sich anschickte, den Talweg hinunter zu ziehen.
„Ich bin Euch nicht böse drum“, sagte Stawarth Bolton, dem ihre Empfindung nicht entging, „dass Ihr mir argwöhnisch nachschaut, wie der englische Falke über Eurer schottischen Sumpfbrut schwebt. Aber macht Euch keine Sorge! wenig Kinder, wenig Sorgen; und ein kluger Mann holt sich Kinder nicht aus fremdem Hause. Gehabt Euch, liebe Witfrau, und wenn Euer schwarzer Musje mal in die Lage kommt, einen Zug nach England zu unternehmen, dann soll er Weiber und Kinder schonen, und soll nicht vergessen, dass es Stawarth Bolton in Schottland auch so gemacht hat.“
„Gott geleit Euch, Ihr edler Mann aus dem Süden!“, sagte Elspath Brydone, doch erst, wie er es nicht mehr hören konnte, denn er gab seinem Rosse die Sporen, um an die Spitze des Zuges zu kommen, und langsam verschwanden Helmbusch und Rüstung hinter der Biegung, die das Tal hier machte, in der Ferne.
„Mutter“, sagte der älterer der beiden Knaben, „wenn hier für solchen Kerl aus dem Süden gebetet wird, dann sag ich nicht Amen dazu.“
„Mutter“, sagte der andere in ehrerbietigerer Weise, „darf man auch für einen Ketzer beten?“
„Darauf kann Gott allein Antwort geben, zu dem ich bete und flehe“, antwortete in schwerer Bedrängnis ob dieser beiden Reden aus Kindermund Witwe Elspath, „aber die beiden Worte: Süden und Ketzer, haben Schottland zehntausend seiner tapfersten und rüstigsten Männer gekostet, haben Euch den Vater und mir den Gatten geraubt, und ich mag die beiden Worte nicht mehr hören, weder als Segnung noch als Verwünschung. Geht mit mir in den Turm, Sergeant Brittson!“, sagte sie zu dem Soldaten. „Was wir unser nennen, steht Euch zu Diensten.“,
Drittes Kapitel
Die Kunde davon, dass der englische Hauptmann der Witwe von Glendearg Sicherheit gegeben habe, dass weder ihr Vieh weggetrieben, noch ihre Vorräte geraubt würden, hatte sich bald über das ganze Klostergebiet und seine Umgegend verbreitet, und unter den Leuten, zu deren Ohren sie gelangte, befand sich auch eine Dame, die, obgleich viel höheren Standes als die Witwe Glendinning, sich nun zufolge des gleichen Verhängnisses in weit größeres Elend versetzt sah.
Die Frau war die Witfrau Walter Avenels, eines tapferen Kriegsmanns aus altem, vornehmem Grenzgeschlechte, das vormals unermessliche Güter in der Grafschaft Eskdale besessen, die aber schon seit vielen Jahren in andre Hände übergegangen waren. Indessen war ihnen eine Herrschaft von beträchtlichem Umfange und unfern von dem Landsitz des Sankt Marien-Klosters geblieben. Dieselbe lag auf der gleichen Flussseite, wo sich an der Spitze des Tals von Glendearg der kleine Turm Glendinnings erhob. Hier hatten sie seit vielen Jahren gelebt und, ob sie gleich weder reich noch mächtig waren, einen ansehnlichen Rang unter den Adeligen der Umgegend inne gehabt. Durch seinen Mut und Unternehmungsgeist hatte sich der letzte Ritter und Baron von Avenel in eine noch höhere Achtung gesetzt.
Als Schottland nach dem furchtbaren Schlage, den es bei Pinkie-Cleuch erhalten hatte, wieder sich einigermaßen zu erholen anfing, da war Walter Avenel einer der Ersten gewesen, die einen Guerillakrieg gegen die englischen Machthaber eröffnen halfen in der ganz richtigen Auffassung, dass ein Volk, das von einem fremden ins Joch gespannt wird, sich am leichtesten durch fortdauernde Nadelstiche lästig und verderblich machen kann. In einem dieser Guerillakämpfe war der Ritter von Avenel erschlagen worden, und als die Nachricht hiervon auf das Schloss gedrungen war, folgte ihr eine andre Hiobspost auf dem Fuße, dass ein Trupp englischer Krieger im Anmarsche sei, um das Schloss und die Besitztümer der Witwe zu plündern. Es sei in dem feindlichen Hauptquartier beschlossen worden, ein Exempel zu statuieren, das andre im Lande abschrecken sollte, dem Beispiele des Erschlagenen zu folgen.
Der unglücklichen Witwe von Avenel bot sich keine andre Zuflucht, als eine erbärmliche Schäferhütte zwischen den Hügeln. Dorthin schaffte man sie in aller Eile, sodass sie kaum begriff, was mit ihr vorging, und warum die bestürzte Schlossdienerschaft sie mit ihrem jungen Töchterchen aus ihrem Hause und in eine so unwirtliche Gegend brachte. Die Frau des Schäfers war in besseren Tagen Magd auf dem Schlosse gewesen und hieß sie mit all der Ehrfurcht und Demut willkommen, die sie von diesem früheren Verhältnis zu der Schlossherrin noch gewöhnt war. In der ersten Zeit war sich die Schlossherrin ihres Elendes kaum bewusst geworden. Als aber der Schmerz sich halb und halb beruhigt hatte, und als sie für ihre Lage Verständnis fassen konnte, da fehlte wenig, so hätte sie den Gemahl um die schweigsame Stätte beneidet, die er, wenn auch viel zu früh, gefunden hatte. Die Dienerschaft musste sich, als sie die Herrin in der einsamen Hütte untergebracht hatte, selbst nach einer Unterkunft umtun, und die armen Hirten waren bald nicht mehr imstande, den Unterhalt für ihre Herrin zu beschaffen, da sie ja selbst am Notwendigsten Mangel litten, denn die paar Schafe und Kühe, die noch aus der ersten Durchsuchung der Gegend gerettet worden waren, hatten die Engländer bald nachher aufgestöbert und weggetrieben, sodass ihnen nun der Hunger entgegengrinste.
„Nun sind wir verloren und stehen am Bettelstabe“, sagte der alte Schäfer Martin, händeringend, „o, diese Spitzbuben, diese habgierigen Kerle! Kein Stück von der Herde haben sie uns übrig gelassen! wovon sollen wir nun leben?“
„Ach, und wie weh hats mir getan, als Dickchen und Grauchen, unsre letzten beiden Kühe, den Hals nach dem Stall zurückwandten und brummten, als die Rotjacken sie mit ihren Lanzen aus dem Stall trieben.“
„Vier Kerle warens bloß“, sagte Martin, „und wie lange ists her, da hätten sich keine vierzig so weit getraut, aber mit unserm guten Ritter ist alle Kraft und Mannheit hin.“
„Um des heiligen Kreuzes willen, Mann, sei still“, bat die Frau, „ist doch unsre arme Herrin ohnedem halb tot! Sieh nur, wie ihr die Augenlider zucken! Noch ein Wort mehr, und sie stirbt uns am Herzkrampf!“
„Ach, wenn wir bloß erst alle hinüber wären!“, sagte Martin, „wie das noch werden soll, das geht über meinen Verstand. Um meinetwillen härme ich mich nicht, Tibbie, wir können ja darben und arbeiten; aber die gnädige Herrin hat ja beides nicht gelernt.“
So besprachen sie sich unverblümt über die Lage, in der festen Meinung, die arme Frau mit ihrem todbleichen Gesicht, mit den zuckenden Lippen und den halb erloschenen Augen könne sie nicht hören.
„Einen Rat wüsst ich schließlich noch“, meinte nach einer Weile der Schäfer wieder, „aber ich weiß nicht, ob sie es übers Herz bringt. Die Witwe überm Tal drüben, die Glendinning, hat von den Halunken aus dem Süden Sicherheit bekommen, dass ihr kein Soldat, gleichviel aus was für Grund und Ursach, ins Haus hinein treten darf. Wenn sich unsre Frau ein bisschen beugen wollt und bei der Frau Elspath um Unterkunft nachsuchen möcht, bis sich die Zeiten ein bisschen beruhigt und gebessert haben, dann wär das für ihresgleichen keine geringe Ehre, aber ...“
„Eine Ehre ...“, erwiderte Frau Tibbie, „na, und was für eine! ... damit könnt ihre Sippe sich noch groß tun, und wenn ihre Knochen schon lange gebleicht sind! ... Aber, Gott im Himmel! bei der Witwe eines Kirchenvasallen soll unsre gnädige Frau, eine Baronin von Avenel, um Unterstand einkommen!“
„Dumm genug ists freilich“, meinte Martin; „aber was bleibt andres übrig? Hier im Elend bleiben und verhungern? und wo wollen wir denn sonst hin? Ich weiß nicht besser zu raten, als der erste beste Schafbock, den ich auf die Weide getrieben habe.“
„Sprecht nicht weiter darüber“, ergriff da, sich unvermutet ins Gespräch mischend, die Witwe von Avenel das Wort, „ich will zum Turme hinüber gehen. Frau Elspath stammt von braven Leuten, sie ist Witwe und Mutter von Waisen. Sie wird mir ein Plätzchen in ihrem Hause vergönnen, bis sich das Gewitter verzogen hat. So lange solcher Sturm haust, bleibt man besser im tiefen Busche versteckt, als dass man sich auf Höhen begibt.“
„Siehst Du, Frau“, sagte Schäfer Martin, „die Gnädige ist zweimal so gescheit wie wir.“
„Das muss doch auch sein“, antwortete Frau Tibbie, „denn die Gnädige ist ja im Kloster erzogen worden, sie kann in Seide sticken, kann Weißzeug säumen und Muscheln aufreihen.“
„Meint Ihr“, sagte die Dame zu Martin, ihr Kind fest an den Busen pressend, „dass wir bei der Frau von Simon Glendinning willkommen sein werden?“
„O, sicher, ganz sicher, gnädigste Frau“, erwiderte Martin, „des Willkomms sind wir doch auch wohl wert. In den ewigen Kriegen sind die Menschen zur Rarität geworden und werden wohl noch lange Rarität bleiben. Ich kann mich doch noch immer tüchtig rühren, besser als je im Leben, und kein Weib weiß mit Kühen bessern Umgang als meine Frau, die Tibbie!“
„Ich wollte noch ganz andre Dinge verrichten, wenn ich in einem vornehmen Hause sein könnte“, sagte die Frau, „aber bei der Frau Elspath Glendinning gibts keine Perlen zu reihen und keine Hauben aufzuputzen.“
„Lass ab mit Deinen hoffärtigen Gedanken, Weib!“, versetzte der Schäfer, „Du wirst im Hause und draußen genug zu schaffen finden, und es müsste doch schlecht hergehn, wenn nicht zwei Menschen das bisschen Essen für drei verdienen sollten, denn das kleine liebe Ding von Fräulein ist doch noch gar nicht zu rechnen. Aber weg von hier, weg! was wollen wir herumstehn und Zeit verlieren, es sind doch an die drei Stunden, die wir wandern müssen über Berge und durch Sumpf und Morast. Für eine zum vornehmen Leben geborne Dame ist das doch was andres, als ein Spazierritt ums Schloss herum!“
Um das bisschen Hausgerät brauchten sich die beiden Schäfersleutchen nicht zu bekümmern. Ein alter abgetriebener Gaul, den die Soldaten wohl nicht gemocht hatten, weil er scheute und sich von keinem Fremden einfangen ließ, obendrein das Futter wohl nicht wert war, erhielt die Aufgabe, die paar Decken und sonstigen Dinge zu tragen, die des Mitnehmens verlohnten. Shagram hieß der Gaul, und als er auf den Pfiff des Schäfers herankam, da fand der alte Mann, dass er durch einen Pfeil, den gewiss irgend solch ein Rotrock aus Ärger darüber, dass er ihn nicht hatte fangen können, in den Leib geschossen, verwundet worden war.
„Ach, du armer Kerl“, klagte Martin, „musst du auch noch lernen, was die langen Bogen von diesem Gesindel auf sich haben? musst dus auf deine alten Tage auch noch lernen, wie wir alle?“
„Ach, in welcher Schlucht, in welchem Tale wehklagt man nicht darüber?“, sagte die Witwe von Avenel.
„Ja, ja, gnädige Frau“, erwiderte der Schäfer, „Gott behüte bloß die Schotten vor diesen schrecklichen Waffen! denn vor flinken Hieben wissen sie sich zu schützen. ... Aber machen wir uns nur auf den Marsch! das bisschen Kram, das wir noch in der Hütte lassen, kann ich schon ein ander Mal nachholen. Vergreifen wird sich hierherum wohl niemand dran, es wohnt ja bloß gute Nachbarschaft im ganzen Tale ... und mit andrer ...“
„Lieber Mann, sprecht nicht solche Gedanken aus“, bat die Witwe, „wir müssen noch über manch einsame, gefährliche Stelle, ehe wir am Gatter von Glendinnings sein werden. Um Gottes willen, haltet vor allen Dingen Frieden!“
Der Mann versprach es ihr durch ein Nicken, denn es hatte schon seine Gefahr, von den Feen und Hexen des Talgrundes als guter Nachbarschaft zu reden, vor allem, wenn man an Plätzen vorbei musste, die in dem Rufe standen, von ihnen bewohnt zu sein.
Es war der letzte Tag des Oktobermonats, an welchem die drei Leute mit dem kleinen Freifräulein die Wanderschaft antraten.
„Heut ist grade Dein Geburtstag, meine süße Mary“, sagte die Witwe, und der Stachel bittrer Erinnerung traf ihr Herz. „O, wer hätte ahnen sollen, dass das kleine Köpfchen, das heute vor wenig Jahren im Schoß fröhlicher Verwandten gewiegt wurde, in dieser Nacht vielleicht umsonst nach einem Obdach suchen wird?“
Die Flüchtlinge machten sich nun auf den Weg. Das liebliche kleine Mädchen, Mary Avenel, ein Kind zwischen fünf und sechs Jahren, ritt nach Zigeunerart, zwischen Betten gepackt, auf dem Gaule, die Witwe von Avenel schritt neben dem Gaule, die Schäfersfrau führte den Gaul am Zügel, und der alte Martin ging ein Stück voraus, um den besten Weg zu ermitteln.
Aber sobald man die erste Wegstunde hinter sich hatte, wurde dieses Amt mühseliger und schwieriger, als er sich vielleicht gedacht oder als er es hatte sagen wollen. Das große Stück von Weidefläche, wo er jeden Winkel kannte, mussten sie im Westen liegen lassen, denn das Tal von Glendearg lag in östlicher Richtung, und in den raueren Strichen von Schottland ist der Übergang von einem Tal ins andre, wenn man nicht über die Berge steigen will, in der Regel nur schwer zu finden. Der Wanderer muss über Schroffen und Klüfte, und Sümpfe und Klippen halten ihn auf oder bringen ihn vom Wege ab. So erging es auch dem Schäfer Martin, und wenn er auch im Allgemeinen sich nicht im unklaren darüber war, dass er die rechte Richtung inne behielt, so wurde ihm doch mit der Zeit bange, und er musste sich langsam eingestehen, dass er den graden Weg verfehlt habe. Noch immer aber meinte er versichern zu dürfen, dass man nicht mehr weit vom Ziele ab sein könne.
„Wenn wir bloß erst über den großen Sumpf hinüber wären“, sagte er, „dann könnt ich einstehen, dass wir die Turmspitze von Glendearg sehen müssten.“
Aber diese Aufgabe zu lösen, war keine geringe Schwierigkeit, denn je weiter sie vordrangen, unter der äußersten Behutsamkeit, die Martin gebot, um so gefährlicher wurde der Weg, um so tiefer sanken sie ein; aber da sie die gleichen Gefahren zu überwinden hatten, wenn sie wieder umdrehten, wurde es für besser erachtet, den Weg fortzusetzen und nicht umzudrehen.
Lady Avenel war freilich für solche Strapazen nicht erzogen worden, aber was vermag eine Mutter nicht zu vollbringen, wenn sie ihr Kind in Gefahr weiß! Sie klagte weniger über die Beschwerden der Wanderung als Martin und seine Frau, die an dergleichen Dinge doch von Kindesbeinen an gewöhnt waren. Sie blieb dicht an der Seite des Pferdes, achtete fürsorglich auf jeden seiner Tritte, immer ängstlich bedacht, ihr Kind in die Arme zu heben, wenn dem Pferde der Boden unter den Füssen verschwinden sollte.
Endlich gelangten sie an eine Stelle, wo der Schäfer nicht mehr aus und ein wusste, denn rings um die Wanderer her zeigte sich zerrissener Heideboden, nach allen Seiten hin liefen tiefe Furchen, die mit schwarzem, zähem Moor gefüllt waren.
Nach langer Überlegung entschied sich Martin endlich für einen Pfad, der in schrägerer Richtung lief als die andern, und damit das Kind noch besser geschützt sei als bisher, nahm Martin das Pferd selbst am Zügel. Aber Shagram fing an zu schnaufen, die Vorderfüße zu strecken und die Hinterbeine anzuziehen und weigerte sich, auch nur einen Schritt noch weiter zu tun. Martin stand in Verwirrung und Zweifeln da, er wusste nicht, ob er Gewalt gegen das Tier brauchen oder ihm den Willen lassen solle, und was ihm seine Frau darauf sagte, als er unschlüssig fragte, was wohl am besten sei, war auch nicht danach angetan, ihn mutiger oder gescheiter zu machen, denn als sie sah, dass Shagram die Nüstern blähte und ängstlich zusammenschauerte, sagte sie leise:
„Du, glaub mir, der sieht mehr als ein Mensch sehen kann.“
Als sie nun unschlüssig standen und keiner wusste, was zu tun sei, rief das Kind plötzlich:
„Die schöne Dame winkt uns zum Turme hinauf!“
Alle blickten nach der Stelle, die des Kindes Finger wies, aber sie nahmen nichts wahr, als ein aufsteigendes Gekräusel von Dunst, aus dem bloß eine Kindesfantasie sich eine menschliche Gestalt zurechtgliedern konnte, und der Martin bloß noch die weitere Gefahr im Anzuge befindlicher Nebel vor die Augen rückte.
Noch einmal versuchte er, das Pferd in der Richtung, die er für die beste hielt, vorwärts zu treiben, aber er musste das Vergebliche solcher Bemühung erkennen. Das Tier weigerte sich, auch nur noch einen Schritt weiter zu machen.
„Na, dann lauf Deinen eignen Weg, dummes Biest“, rief Martin, „und zeig, wohin Du uns bringst.“
Als das Tier seinen eignen Weg gehen durfte, schlug es kühn die Richtung ein, die das Kind gezeigt hatte. Es braucht das weiter nicht zu verwundern, auch nicht, dass das Pferd auf diesem Pfade die Wanderer glücklich über den Sumpf brachte, denn der „Sumpfinstinkt“, von Pferden, die in Sumpfgegenden geboren sind, ist eine seltsame, viel bemerkte Eigenschaft dieses an sich zu den klügsten Tieren gehörenden Geschöpfes. Aber merkwürdig blieb es, dass das Kind noch mehrmals der „schönen Dame“, Erwähnung tat, wie auch der Winke, die sie ihm gebe, und dass anderseits das Pferd sich beflissen zeigte, genau die angedeutete Richtung einzuhalten. Die Lady achtete im Augenblicke jedoch wenig darauf, denn ihre ganze Aufmerksamkeit war auf die Gefahr gerichtet, die sie zu bestehen hatten, dagegen tauschten die beiden Schäfersleute bedeutungsvolle Blicke miteinander.
„Aller Heiligen Abend“, flüsterte Frau Tibbie ihrem Manne zu.
„Um der heiligen Gottesmutter willen jetzt kein Wort hiervon“, sagte Martin ebenso leise, „sprich Dein Gebet, Frau, wenn Du sonst nicht zu schweigen vermagst!“
Als sie auf festen Grund gelangt waren, gewahrte Martin auf der Spitze der nächstliegenden Hügel die rohen Grenzsteine, die ihm zeigten, in welcher Richtung er gehen müsse, und nun erreichten sie bald den Turm von Glendearg. Bei dem Anblick der kleinen Feste fühlte sich die unglückliche Dame von den herben Unglücksschlägen, die sie getroffen hatten, tief erschüttert. Mit welcher Ehrerbietung war sie sonst begrüßt worden, wenn sie sich in der Kirche oder auf Märkten oder sonst im öffentlichen Leben gezeigt hatte! alle Weiber der Vasallen und Lehensmänner sahen in ihr die Gemahlin des angesehenen, mächtigen, aus uraltem Geschlecht stammenden Ritters von Avenel, und nun war ihr Stolz so tief gebeugt, nun war sie in ihrem Range so tief gestürzt worden, dass sie um Unterstand betteln musste bei der Witwe eines solchen Vasallen, um Unterstand, der vielleicht gar keine Sicherheit für sie bot! ... Martin, der wohl merken mochte, was in ihrem Innern vorging, blickte zu ihr auf mit flehendem Ausdruck, wie wenn ihn die Furcht beschliche, sie könnte ihren Entschluss am Ende noch ändern, aber die Dame beschwichtigte, indem sie mehr auf seine Mienen einging als auf seine Worte hörte, diese Regung in dem Gemüte des schlichten Mannes, wenn auch der alte Stolz nur mühsam bezwungen ward und hin und wieder noch immer in ihren Augen aufleuchtete:
„Wär ich allein, dann stürbe ich lieber ... aber um des Kindes willen, um meiner lieben, süßen Mary willen, ... um dieses letzten Sprossen des Hauses Avenel willen ...“
„Freilich, gnädigste Dame, freilich!“, sprach ihr der Schäfer zu, und um jede Möglichkeit eines andern Entschlusses abzuschneiden, fügte er hinzu: „Ich will vorausgehen zu der Frau Elspath, ich hab ihren Mann gut gekannt und hab mit ihm eingekauft und Geschäfte gemacht, als er auch einer von den Bessergestellten im Lande noch war.“
Martin hatte sich seines Anliegens bald entledigt, und die Unglücksgenossin sagte nicht Nein. Lady Avenel war im Glück immer leutselig und nie hochmütig gewesen, hatte auch vieles Gute getan unter den Armen im Lande, und das Unglück, das sie jetzt betraf, rief bei allen Leuten im Lande, vornehmlich aber in der Nachbarschaft ihrer Besitzung, das tiefste Mitleid wach. Zudem musste es ja auch dem Selbstgefühl einer niedriger gestellten Frau schmeicheln, dass sie durch ein freundlicheres Schicksal in die Lage gesetzt wurde, einer so hochgestellt gewesenen Dame Unterstand in ihrer bescheidenen Behausung zu gewähren. Um jedoch alle Gerechtigkeit gegen Frau Elspath Glendinning zu wahren, dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dass sie auch Teilnahme für eine Frau im Herzen trug, die von dem gleichen Unglück betroffen worden war wie sie, die aber weit schwerer daran zu tragen hatte als sie. Den armen Flüchtlingen wurde alle Gastfreundschaft gewährt, die die gegebenen Umstände ermöglichten, ehrerbietig und willig, und das herzliche Ersuchen wurde damit verbunden, sich so lange in Glendearg wohnlich einzurichten, als es durch die Umstände geboten wäre oder sich mit Geschmack und Neigungen vertrüge.
Viertes Kapitel
Als die Verhältnisse im Lande wieder ruhiger geworden waren, wäre die Witwe Walter Avenels wohl gern wieder in ihr Schloss zurückgekehrt, doch stand solches Tun nicht mehr in ihrer Macht. Unter der damaligen Regierung, die von einem der eigentlichen Königin gesetzten Vormunde geführt wurde, galt das Recht des Stärkeren, und wer viel Gewalt und ein weites Gewissen hatte, machte sich diese Wirren zunutze und riskierte die gröblichsten Eingriffe in die Rechte andrer. Sir Walter von Avenel hatte noch einen jüngeren Bruder, Julian mit Namen, der war ein Mann von solchem Schlage und säumte nicht lange, von der Burg und den Ländereien des Bruders Besitz zu ergreifen, sobald die Engländer das Land verlassen hatten. Zuvörderst ergriff er wohl Besitz im Namen seiner Nichte. Als aber seines Bruders Witwe die Absicht äußerte, mit ihrem Töchterchen wieder in das Schloss zurückzukehren, erklärte er kurz und bündig, Schloss und Land Avenel sei ein Mannslehen und falle mithin nach dem Heimgang des älteren an den jüngeren Bruder, also an ihn. So wenig wie jener Philosoph sich in einen Streit mit dem Kaiser einließ, der über zwanzig Legionen gebot, so wenig konnte die Witwe Walter Avenels sich in einen Prozess mit dem Herrn über zwanzig Banditen und Freibeuter einlassen, die alle im Falle der Not bereit und willig waren, ihm Hilfe und Beistand zu leisten.
So rechtlich begründet nun auch der Anspruch von Walters ehelicher Tochter mit seiner Gattin zur rechten Hand und erster Ehe auch war, so sah sich die Witwe, wenn auch nur vorläufig, doch gezwungen, ihrem gewissenlosen Schwager freie Hand zu lassen. Ihre Langmut und friedliche Gesinnung zeitigte zum wenigsten den Entschluss bei demselben, sie der Milde einer Vasallenwitwe nicht völlig anheimgestellt zu lassen, sondern eine Viehherde nach Glendearg in Weidepacht zu geben und Kleidung und Hausgerät, auch einiges Geld, dies jedoch nur in beschränkter Höhe, zu senden.
Mittlerweile fanden die beiden Witwen Gefallen an ihrem Zusammenleben, sodass sie sich nur ungern wieder hätten trennen mögen. Einen stilleren und sichereren Aufenthaltsort als ihr der Turm von Glendearg bot, hätte die Witwe von Avenel kaum finden können, und sie war ja jetzt auch in die Lage gesetzt, ihr Teil zu den Kosten des gemeinschaftlichen Haushalts beizutragen. Anderseits gewährte der Frau Elspath der Umgang mit einer so vornehmen Dame nicht minder Freude als Ehre, und sie zeigte ihr immer weit mehr Demut und Hingebung, als von dieser begehrt und gern gesehen wurde.
Das Schäferpaar Martin und Tibbie erwiesen sich als die emsigsten und treuesten Knechte und suchten sich in allerhand Verrichtung nützlich zu machen, und zwar beiden Frauen, wenn sie sich auch in erster Linie abhängig von der Dame Avenel hielten. Hin und wieder kam es infolgedessen wohl zu einem kleinen Zwiste zwischen Frau Elspath und Martins Frau, wenn die eine eifersüchtig auf ihrem Ansehen bestand und die andre Rang und Herkunft ihrer Herrin zu scharf in den Vordergrund schob. Indessen ließen es sich beide immer angelegen sein, solchen Zwist untereinander abzumachen und die Dame Avenel nichts davon merken zu lassen, denn die Frau Elspath hatte vor ihrer Leidensgefährtin wohl kaum einen geringeren Respekt als die Schäfersfrau. Auch gingen diese kleinen Misshelligkeiten nie so weit, dass der Hausfriede gestört wurde, denn von dem einen der beiden Teile wurde immer rechtzeitig eingelenkt und nachgegeben, wenn der andre, und das war in der Regel die Schäfersfrau, ein wenig zu weit in ihrem Übereifer für ihre eigentliche Herrin gegangen war.
Nach und nach entschwand den beiden Witwen das Interesse für die jenseits ihrer Berge gelegene Welt, und nur, wenn Alice von Avenel an hohen Festtagen in der Klosterkirche Messe hörte, gedachte sie jener Zeit noch, da sie auf gleicher Höhe mit den stolzen Gemahlinnen der Barone des Landes gestanden hatte, die gleich ihr in der Abteikirche erschienen. Aber solche Erinnerungen schmerzten sie nur wenig. Sie hatte ihren seligen Gemahl nicht um des äußerlichen Ansehens willen geliebt, sondern um seiner persönlichen Tugenden willen, und nachdem sie seinen Verlust hatte ertragen müssen, war alles andre Leid, das sie betraf, nicht mehr imstande, sie zu erschüttern. Zwar kam es ihr bisweilen in den Sinn, für ihre Tochter den Schutz der Königin-Regentin Maria von Guise zu erbitten, aber immer trat hindernd die Bange vor ihrem Schwager Julian zwischen Gedanken und Ausführung, denn sie durfte sich nicht verhehlen, dass ein solcher Mensch wie er, sich nicht besinnen würde, ihr das Kind zu rauben, wenn er nicht gar noch zu schrecklicheren Maßregeln griffe, sobald er sich in seinem Raube irgendwie gefährdet sähe. War er doch ein gewalttätiger und roher Gesell, der in allerhand Fehden verstrickt war und überall sich einmischte, wo Lanzen und Speere gebrochen wurden. Zudem zeigte er keinerlei Neigung, in den Ehestand zu treten. Und bei seiner ewigen Händelsucht konnte ihn leicht das Schicksal heimsuchen, das er unentwegt herausforderte, und ihn aus dem Erbe reißen, das er sich auf so schmähliche Weise angeeignet hatte. Darum meinte Lady Alice, dass sie klüger täte, den Einflüsterungen ihres Ehrgeizes jetzt nicht Gehör zu leihen, sondern ihr Leben in der bisherigen Ruhe und Zurückgezogenheit in der dürftigen, aber friedlichen Freistatt weiter zu führen wie bisher.
Es war wiederum zu Allerheiligen, und die beiden Witfrauen hatten nun drei Jahre zusammen gelebt, und sie saßen in der alten engen Halle in der Feste von Glendearg mit der Dienerschaft um das lodernde Herdfeuer versammelt. Damals kannte man den Brauch von heute, dass die Herrschaft für sich und die Dienerschaft für sich haust, noch nicht. Man wohnte zusammen und nahm die Mahlzeiten zusammen ein. Der oberste Platz am Tische und der behaglichste Sitz am Herde, das waren die einzigen Vorrechte, die der Herrschaft innerhalb der Wohnstätte zugehörten, und der Dienerschaft stand nicht minder das Recht zu, an dem von der Herrschaft geführten Gespräch, wenn in ehrsamer, züchtiger Weise, sich zu beteiligen. Was die eigentlichen Knechte anbetraf, so gehörten denselben die außen gelegenen Hütten, und die beiden Dirnen, die Töchter des einen Knechts, versahen die häusliche Arbeit, früh, ehe sie aufs Feld hinaus gingen, oder abends, wenn sie vom Felde heimkehrten.
Wenn sie draußen waren, schloss Martin erst das eiserne Gatter, dann das innere Tor ab, und dann ordnete sich die kleine Hausgemeinschaft wie folgt: Frau Elspath setzte sich an den Spinnrocken, Tibbie kochte die Molken ab, die in einem großen Kessel über dem Feuer hingen, und Martin widmete sich aller Hausarbeit, die sich gerade fand, denn zu jener Zeit war jeder Haushälter sein eigner Maurer, Schmied und Zimmermann, sein eigner Schneider und Schuster, und hatte außerdem noch ein aufmerksames Auge auf die Kinder des Hauses.
Den Kindern stand das freie Recht zu, sich nach Herzenslust in den Räumen des Hauses zu tummeln; aber heute war es ihnen danach nicht zumute, heute blieben sie in der Nähe der Mutter.
Alice von Avenel saß bei einem eisernen Leuchter, in welchem eine ungetüme Fackel brannte, deren Gestell aus der häuslichen Schmiede hervorgegangen war, und beim Schein des Feuers, das in derselben flammte, las sie abgerissene Stellen aus einem mit starken Schlössern versehenen Buche, das sie mit äußerster Sorgfalt aufbewahrte. Die Lady hatte in ihrer Jugend, während ihres Aufenthalts im Kloster, die Kunst des Lesens gelernt, aber sie in den letzten Jahren kaum noch betätigen können, da sich ihr ganzer Bücherschatz auf das kleine Buch, das sie jetzt in der Hand hielt, beschränkte. Die Hausgenossenschaft lauschte ihrem Vortrag, wenn sie auch für den Sinn so gut wie kein Verständnis haben mochte, aufmerksam, und wenn auch Alice oft gewillt war, ihrer Tochter einen tieferen Einblick in ihr Wissen zu verschaffen, so kam sie doch auch hiervon immer wieder ab, weil es damals noch eine gefährliche Sache war, Dinge zu verstehen, die noch nicht als Allgemeingut des Volkes galten, im Gegenteil leicht auf den Verdacht führten, dass sie nur durch Umgang mit bösen Geistern erworben seien.
Von Zeit zu Zeit wurde die Dame von Avenel in ihrer Lektüre durch das Toben der Kinder gestört, denen dann Frau Elspath einen bald mehr, bald minder derben Verweis erteilte. Zuletzt schickte sie ihre beiden Knaben ins Bett, aber kaum hatten sie in der Absicht, sich diesem Befehle zu fügen, den Fuß aus der Halle gesetzt, als sie mit angsterfüllten Gesichtern wieder hereingestürzt kamen, um zu melden, dass in der Speisekammer ein gewappneter Mann sich aufhalte.
„Wer wirds denn anders sein als der Christie von Clinthill?“, sagte Martin; „aber warum mag er zu solcher Stunde sich hier einfinden?“
„Und wie mag er hierher gekommen sein?“, fragte Elspath.
„Ach, was wird er wollen?“, rief die Dame von Avenel, der dieser Mann, den sie als einen Anhänger ihres Schwagers kannte und der als sein Beauftragter schon hin und wieder in Glendearg gewesen war, immer ein geheimes Grauen verursachte. „Gott! o Gott! wo ist mein Kind?“, rief sie plötzlich und sprang auf.
Alle rannten nach der Speisekammer, Halbert Glendinning wappnete sich mit dem rostigen Schwert seines Vaters, und sein jüngerer Bruder nahm das Gebetbuch der Dame. Aber ihre Angst schwand, als sie vor der Tür der Speisekammer die kleine Mary stehen sahen, die nicht im geringsten erschrocken oder geängstigt aussah. Schnell traten sie nun in den Raum, wo zur Sommerszeit hin und wieder einmal das Essen eingenommen wurde. Aber es befand sich niemand in dem Raume.
„Wo ist denn Christie von Clinthill?“, fragte Martin.
„Ich weiß es nicht“, antwortete die Kleine.
„Was treibt Ihr denn für Unfug, Ihr garstigen Kinder?“, fragte Frau Elspath ihre beiden Knaben. „Ihr rast in die Halle herein, schreit, als wenn Ihr am Spieße steckt, und erschreckt unsre liebe Dame um nichts und wider nichts.“
Die Knaben sahen einander stumm und verwirrt an, und die Mutter fuhr in ihrer Strafpredigt fort:
„Konntet Ihr keinen andern Abend als Allerheiligen und keine andre Zeit, als da uns die Dame von den frommen Heiligen vorlas, für Eure Possen finden? ... Aber kommt mir nur unter die Finger! ich wills Euch schon eintränken!“
Der ältere der Knaben schlug die Augen nieder, der jüngere fing an zu weinen, aber beide schwiegen, und wenn sich das kleine Mädchen jetzt nicht eingemischt hätte, würde es ohne Schläge für die beiden Knaben wohl nicht abgegangen sein.
„Frau Elspath, es ist meine Schuld, dass Halbert und Edward gerufen haben. Ich sagte ihnen, es sei ein Mann in der Speisekammer.“
„Und warum erschreckst Du uns alle so?“, fragte die Mutter ihre Tochter.
„Weil“, stammelte das Kind, „weil ich nicht anders konnte.“
„Weil Du nicht anders konntest?“, sagte die Mutter. „Was ist das für eine Rede, Kind? Du verursachst unnützen Lärm, unnütze Angst, weil Du nicht anders konntest? ... was soll diese Rede, mein Kind?“
„Aber es ist wirklich ein gewappneter Mann in der Speisekammer gewesen“, sagte das Kind, „und weil ich mich darüber gar so gewundert habe, habe ich Halbert und Edward gerufen.“
„Also hat sie es selbst gesagt“, meinte Halbert, „ich hätt' es gewiss nicht erzählt!“
„Ich auch nicht!“, ergänzte wetteifernd Edward.
„Fräulein Mary“, hob Frau Elspath an, „Ihr habt uns doch nie was gesagt, das nicht wahr gewesen wäre; nun sagt uns doch aufrichtig, wozu war solche Komödie notwendig zu Allerheiligen?“
Es schien, als wenn die Dame von Avenel willens sei, sich einzumischen, aber sie wusste nicht recht, wie, und Elspath war zu neugierig, in Erfahrung zu bringen, wie es sich um die Sache verhielt, als dass sie einen Wink von ihr hätte beachten sollen, und fuhr deshalb fort:
„War es denn Christie von Clinthill? Wie soll er denn aber ins Haus hineingekommen sein, ohne dass man es gehört hätte?“
„Christie wars nicht“, antwortete Mary, „es war ..., war ... ein Herr, ein hübscher Mann mit glitzerndem Harnisch, wie ich ihn damals gesehen habe, als wir noch oben auf dem Schlosse waren.“
„Und wie hat er denn ausgesehen?“, fragte Tibbie, die Schäfersfrau, die auch an dem Verhör, in das die Kleine genommen wurde, teilnahm.
„Er hat schwarze Augen gehabt, schwarzes Haar und einen schwarzen Spitzbart“, antwortete das Kind, „und lauter Perlenschnüre um den Hals, die ihm bis auf den Harnisch hinunter reichten, und auf seiner linken Hand hat ein wunderschöner Falke gesessen, mit silbernen Glöckchen und rotseidener Haube auf dem Kopfe.“
„Um Gottes willen!“, rief die erschrockene Dienerin, „fragen wir nicht weiter! Seht doch nur, wie bleich meine Herrin wird!“
Aber die Dame von Avenel nahm ihr Kind bei der Hand und drehte sich eilig um, um in die Halle zurückzugehen, sodass man nicht sehen konnte, welchen Eindruck die Erzählung des Kindes, die sie so rasch abgebrochen hatte, auf sie weiter gemacht hatte. Was jedoch Frau Tibbie darüber dachte, ließ sich an den vielen Kreuzen erkennen, die sie schlug. Und nach einer Weile flüsterte sie der Frau Elspath ins Ohr:
„Gott steh uns bei! die Kleine hat ihren Vater gesehen.“
Als sie nachher wieder in die Halle traten, fanden sie die Dame von Avenel mit ihrem Töchterchen auf dem Schoß, in Tränen gebadet. Sie küsste das Kind mit leidenschaftlichem Schluchzen, stand aber auf, als die andern Hausbewohner wieder hereintraten, wie wenn sie nicht wollte, dass man sie beobachtete, und ging in das kleine Stübchen, wo sie mit dem Kinde zu schlafen pflegte.
Dass sich die Bewohner, als sie sich allein sahen, sogleich mit der übernatürlichen Erscheinung, für die sie den Vorfall ansahen, weiter beschäftigten, war bei dem abergläubischen Charakter, der den Schotten überhaupt eigentümlich ist, nicht zu verwundern.
„Mir wärs lieber gewesen, ich hätte den Gottseibeiuns – die Heilige Jungfrau möge uns schützen – leibhaftig gesehen, als dass ich diesen Christie von Clinthill in meinen vier Pfählen vermuten sollte. Wie die Rede im Lande geht, ist der Kerl ein ganz vermaledeiter Spitzbube, wie kaum je einer im Sattel gesessen hat.“
„Na, na, Frau Elspath, der Christie tut Euch nichts zuleide. Ihr wisst doch, jede Kröte hält ihr Loch sauber. Ihr Kirchenleute erhebt auch gar zu viel Lärm, wenn sich einer um sein bisschen Brot drehen und wenden muss. Wenn unsre Grundherren die flinken Jungen aus dem Hause jagten, dann ritten sie gar bald mit kleinem Gefolge.“
„Besser wärs schon, sie ritten allein, als dass sie bloß Not und Elend damit übers Land bringen!“
„Wer soll denn aber die aus dem Süden vom Lande fernhalten?“, fragte Tibbie, „wenn Ihr Lanzen und Schwerter aus dem Lande bringt? .... Wir alten Weiber mit Rocken und Spindel könnens doch, weiß der Himmel, nicht machen, und die Mönche mit dem Weihrauchwedel und dem Gebetbuch doch auch nicht!“
„Und wann habt Ihrs erlebt, dass Schwerter und Lanzen sie vom Lande ferngehalten hätten?“, fragte Elspath, „wenn ich dazu was sagen soll, dann stritte wohl niemand mir ab, dass mich einer aus dem Süden besser behütet hat als all die Grenzreiter mit all ihren Andreaskreuzen! und der Mann aus dem Süden war Stawarth Bolton! ... An der ganzen Feindschaft mit England ist nach meinem Dafürhalten weiter nichts schuld, als die ewigen Ausfälle und Einfälle an der Grenze; weiter nichts als das hat meinem guten Manne und so vielen andern noch das Leben gekostet! ... Da wird immer geschwatzt von einer Heirat zwischen unsrer Königin und dem Prinzen drüben; aber das ist doch immer bloß der Deckmantel, um die Leute drüben in Cumberland auszuplündern, die dann wieder über uns herfallen.“
Frau Tibbie wäre unter andern Umständen die Antwort auf solch verächtliche Bemerkungen ihrer Landsleute nicht schuldig geblieben, aber sie zog in Betracht, dass die Frau, die es ihr sagte, die Hausherrin sei, und deshalb schluckte sie die Bemerkungen, so heftig sie sie auch wurmten, hinunter und wechselte, ihre Vaterlandsliebe unterdrückend, eilends den Gesprächsgegenstand.
„Ist es nicht seltsam, dass die Erbtochter von Avenel in dieser Heiligen Nacht ihren Vater gesehen hat?“, fragte sie.
„Meint Ihr denn wirklich, dass es ihr Vater gewesen sei?“, fragte Frau Glendinning.
„Was soll man sonst glauben?“, fragte Frau Tibbie.
„Vielleicht hat irgendein Unhold sich in seine Gestalt gesteckt?“, meinte Frau Elspath.
„Das ist für mich nicht leicht zu sagen“, erwiderte die Tibbie, „aber dass es eine Gestalt war, das steht fest, darauf möcht ich jeden Eid tun! grade so hat er ausgesehen, wenn er auf die Jagd ritt, und wenn Feinde in der Nähe waren, legte er selten den Brustharnisch ab. Ich meinesteils bin immer der Meinung gewesen“, setzte die Tibbie hinzu, „ein Mann, der keinen Brustharnisch trägt, ist kein ganzer Mann.“
„Ich habe an Eurem Brustharnisch durchaus keinen Gefallen“, erwiderte Frau Glendinning, „aber ich weiß, dass auch solchen Gesichtern an solch heiligen Tagen kein großer Segen kommt.“
„Meint Ihr?“, fragte die Tibbie.
„Das ist meine Meinung ganz entschieden“, – erklärte die Glendinning ... „mir ist übrigens auch solch Gesicht gekommen.“, „Wirklich? was Ihr sagt!“, und mit diesen Worten rückte die Tibbie ihren Schemel näher an die Hausherrin heran; „ach, erzählt doch bitte, von so was hör ich gar zu gern.“
„Na, Tibbie, Ihr müsst nämlich wissen“, hub Frau Glendinning an, „dass ich in meinem neunzehnten und zwanzigsten Jahr auf keinem Tanzfest, bei keiner Lustbarkeit gefehlt habe, wenn ich nur irgend von daheim hab abkommen können.“
„Das ist doch weiter nicht verwunderlich“, sagte die Tibbie, „aber seitdem seid Ihr um vieles gesetzter geworden, sonst hätten sich doch auch unsre jungen Burschen nicht so arg um Euch gerissen.“
„Mir sind Dinge passiert, die wohl jedem die Lust ausgetrieben hätten!“, meinte die Glendinning, „aber recht habt Ihr, Tibbie, an Freiersleuten hats mir nicht gefehlt, denn so ungestalt war ich eben nun nicht grade, dass alle Kälber hinter mir hergeblökt hätten.“
„Das muss wohl gewesen sein“, pflichtete die Tibbie bei, „seid Ihr doch heut noch eine stattliche Frau!“
„Ach, redet doch nicht!“, verwies sie die Herrin über Glendearg, indem nun auch sie ihren Ehrenschemel ein Stückchen näher an den der Gevatterin rückte ... „mit meiner Schönheit ists längst vorbei, aber es mag ja früher anders damit ausgesehen haben; ich hab mich ja auch immer ganz manierlich herausstaffiert und hatte ja doch auch ein ganz hübsches Eckchen Land mit als Zugabe unterm Mieder. War doch mein Vater Eigentümer von Littledearg ...“
„Richtig, das habt Ihr mir schon ein paar Mal gesagt“, erwiderte die Tibbie, „jetzt erzählt aber lieber, wies am Heiligen Abend sich verhalten hat!“