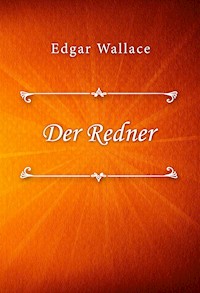
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Redner, so nannten sie Inspektor Rater von Scotland Yard, erfuhr in seinem Urlaub vom Tod Lord Eustace Lightley. Dabei fiel ihn ein, dass der örtliche Apotheker ihm vor Monaten mal von einer Arsenkur des Lord´s erzählt hat... Als der Polizist Simpson einen Toten findet, ahnt der Redner noch nicht, dass dies sein schwierigster Fall wird...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1932
Copyright © 2022 Classica Libris
Original Title
Edgar Wallace
The Orator
Der Redner
Allgemein nannte man Chefinspektor Oliver Rater durch Zusammenziehung seines Vor- und Familiennamens „Orator“. Das heißt auf deutsch „Redner“. Die Entstehung des Spitznamens ist ohne weiteres klar, aber weniger bekannt ist die Tatsache, daß der Chefinspektor eigentlich sehr wenig sprach und daß diese Bezeichnung daher eine ironische Bedeutung hatte. Aber sowohl seine Vorgesetzten als auch andere Leute wußten sehr gut, daß er dafür um so mehr dachte.
Er war hochgewachsen und breitschultrig und hatte regelmäßige, klare Züge, aber sein Gesicht blieb meist unbewegt. Wenn sich jemand mit ihm unterhielt, hatte er zweifellos zunächst den Eindruck, daß der Chefinspektor ihm nicht glaubte. Außerdem kam ihm am Ende des Gesprächs zum Bewußtsein, daß Mr. Rater kaum zehn Worte gesagt hatte. Mancher Verbrecher hatte ein so vollständiges Alibi, daß es lächerlich schien, ihn in Gewahrsam zu halten. Wenn er aber dem Redner vorgeführt wurde, brachte ihn oft genug das tödliche Schweigen dieses Mannes zur Verzweiflung, und er bekannte schließlich doch die Wahrheit.
Als Mr. Rater an einem Februarnachmittag in der Ecke eines großen Saales stand, in dem eine Hochzeitsfeier abgehalten wurde, hüllte er sich wieder wie gewöhnlich in tiefes Schweigen. Auf großen Tischen waren die Geschenke aufgebaut, die von den Gästen bewundert wurden.
Im Allgemeinen lädt man einen Chefinspektor der Geheimpolizei nicht ein, um Hochzeitsgeschenke zu bewachen. Der Redner hatte sich aber freiwillig zu dieser Aufgabe angeboten, obwohl er selbst zu den Gästen gehörte. Der verstorbene Vater der Braut war eng mit ihm befreundet gewesen. Angela Marken erinnerte sich daran, als sie die Liste der einzuladenden Personen aufstellte.
„Aber Liebling“, sagte ihre Mutter ärgerlich, „du kannst doch unmöglich einen Polizeibeamten zu der Gesellschaft bitten. Das halte ich einfach für lächerlich.“
Angela seufzte und lehnte sich in ihren Stuhl zurück.
„Ach, das ist doch nicht so schlimm“, erwiderte sie ein wenig gelangweilt. „Er bekleidet immerhin ein hohes öffentliches Amt.“ Nach einem kleinen Zögern fragte sie: „Wie wäre es, wenn ich Donald Grey zur Feier bitten würde?“
Mrs. Marken zog die Augenbrauen hoch und sah ihre Tochter verwundert an.
„Das geht unter keinen Umständen, Angela. Ich verstehe wirklich nicht, wie du auf solche Einfälle kommst. Donald ist ja ein ganz netter junger Mann, und ich schätze ihn persönlich außerordentlich, aber du kannst doch nicht seinetwegen an deine Hochzeitstage sentimental werden. Ich bitte dich, er verdient im Jahr dreihundert Pfund!“
„Schön, dann werde ich es nicht tun“, entgegnete Angela ruhig und adressierte den Briefumschlag an den Chefinspektor. „Vielleicht beaufsichtigt Mr. Rater die Wertsachen für uns. Das wäre sehr nett von ihm – und wir könnten dann schließlich auch ein paar Pfund sparen“, fügte sie ein wenig bitter hinzu.
Warum sie in so trüber Stimmung war, wußten nur wenige Gäste. Lord Eustace Lightley war reich und erbte wahrscheinlich in absehbarer Zeit einen Herzogstitel. Er hatte auch ein hübsches Gesicht und stand außerdem in dem Ruf, poetisch veranlagt zu sein. Vom Standpunkt der großen Menge aus war er jedenfalls eine glänzende Partie für die Tochter eines mittellosen Feldmarschalls.
Angela sah an ihre Hochzeitstage sehr schön aus, obwohl ihr Gesicht kaum Farbe hatte. Sie trat vollkommen sicher und selbstbewußt auf, und als sie in ihrem Brautkleid im Saal erschien, gefiel sie dem Redner ausnehmend gut.
Später traf er auch den Bräutigam, aber dieser große, schlanke Herr mit den etwas hageren Zügen und dem langen Schädel war ihm aus irgendeinem Grunde sofort unsympathisch. Er hatte eine Gesichtsfarbe wie Milch und Blut, die einem jungen Mädchen besser gestanden hätte als einem Mann von fünfunddreißig Jahren. Hätte der liebe Gott Mr. Rater die Aufgabe gestellt, Menschen zu formen, so wäre dieser Lord Eustace Lightley sicher nicht geschaffen worden!
Der Lord schien nervös und gereizt zu sein und zeigte sich wenig liebenswürdig. Die erste und einzige Unterhaltung zwischen ihm und dem Redner verlief deshalb auch nicht besonders befriedigend.
„Ach so, Sie sind ein Detektiv?“ fragte Sir Eustace von oben herab.
Der Redner nickte, was für ihn schon gleichbedeutend mit einer langen Antwort war.
„Aber warum stehen Sie denn in der Ecke? Von hier aus können Sie doch gar nichts sehen! Es wäre viel besser, wenn Sie auf das Podium gingen.“ Er zeigte auf die große Musiknische, von der aus man den ganzen Saal überschauen konnte.
Mr. Rater legte die Stirn in Falten.
„Hier sind Sie tatsächlich vollkommen nutzlos“, fuhr der Lord fort. „Ebensogut könnten Sie auf dem Grosvenor Square stehen.“
„Ich werde auch sofort hinausgehen“, erwiderte der Chefinspektor und verließ das Fest, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
Das war die erste und einzige Begegnung, die er mit Lord Eustace Ligthley hatte.
Als er aus der Haustür trat, wandte sich ein gutgekleideter junger Mann an ihn, der ein kleines Paket trug, und erkundigte sich, wie er wohl am besten den Lord allein sprechen könnte. Offenbar kannte er Mr. Rater dem Aussehen nach; das Bild des Chefinspektors erschien ja auch häufig genug in den Zeitungen.
„Es ist merkwürdig, was für romantische Geschichten im Leben passieren, Mr. Rater. Dinge, die man kaum für möglich hält. Schon über hundert Jahre hat die Familie des Lords nur in unserer Apotheke gekauft. Wir liefern ihm alles, was er an Medizinen und Drogen braucht. Und als er in Syrien lungenkrank wurde – das ist allerdings schon einige Jahre her – haben wir ihm alles dorthin nachgeschickt. Jetzt ist er wieder ausgeheilt. Er machte damals zu seiner Kräftigung eine Arsenkur, und wir schickten ihm jede Woche...“
Mr. Rater hörte interessiert zu, was der junge Mann zu berichten wußte.
Ein Vierteljahr später brachte Mr. Rater seinen Sommerurlaub in Ostende zu. Da er Junggeselle war, konnte er für eine Erholungsreise ziemlich viel Geld ausgeben. Für Ostende entschied er sich, weil er dort bestimmt viele Landsleute treffen würde, die ihn am wenigsten in dem belgischen Seebad vermuteten und über seine Anwesenheit nicht gerade sehr erfreut sein würden.
Wenn er auf Urlaub war, las er gewöhnlich keine Zeitung. Aber nachdem er im Hippodrom eine kurze Unterhaltung gehört hatte, ließ er sich sofort die neuesten Londoner Blätter geben und fand auch kurz darauf, was er suchte. Es war nur eine kleine Notiz.
Zu unserem größten Bedauern müssen wir den Tod von Lord Eustace Lightley melden. Seit einigen Wochen lag er krank darnieder und starb in der vorigen Nacht plötzlich in seiner Stadtwohnung in der Hart Street, Mayfair.
„So, so!“ murmelte der Redner nachdenklich vor sich hin.
Wenn er seiner eigenen Neigung hätte folgen dürfen, hätte er der Witwe ein Glückwunschtelegramm geschickt. Die Todesanzeige erinnerte ihn wieder an die Unterredung, die er damals mit dem jungen Mann aus der Apotheke hatte, und er machte sich eine Notiz in sein Tagebuch, um später darauf zurückzukommen. Da ihn aber in den nächsten Tagen eingehende Konferenzen mit den Ostender Polizeibehörden vollauf in Anspruch nahmen, vergaß er die Angelegenheit. Es waren nämlich mehrere Juwelendiebstähle in den großen Hotels begangen worden, während die Gäste beim Diner saßen oder sich im Kasino aufhielten.
Mr. Rater unterbrach seine Untätigkeit und sah sich unter seinen verdächtigen Landsleuten um, die sich zurzeit in dem belgischen Seebad aufhielten.
Soweit er feststellen konnte, kamen fünf Individuen zweifelhaften Charakters in Frage, aber der Mann, nach dem er vor allem ausschaute, befand sich nicht in Ostende. Nach allen Nebenumständen zu urteilen, waren die Einbrüche typisch für einen gewissen Bill Osawold. Der Redner telefonierte mit Scotland Yard und hörte zu seiner großen Enttäuschung, daß sich der Mann zurzeit in London aufhielt, wo ihn die Polizei schon seit einem Monat beobachtet hatte.
„Beinahe hätten wir ihn hier an dem Tag verhaftet, an dem die großen Diebstähle in Ostende begangen wurden“, sagte der Beamte am Apparat. „Ein Schutzmann sah ihn mitten in der Nacht aus einem Haus im Westen herauskommen und erkannte ihn. Aber anscheinend hat ihn tatsächlich eine Dame zu Hilfe gerufen, weil ihr Mann plötzlich schwer erkrankte. Ihr Telefon funktionierte nicht, und deshalb rief sie ihn von der Straße herein und bat ihn, einen Arzt zu holen.“
„Pech!“ erwiderte der Redner.
Am nächsten Tag wurde der richtige Dieb gefaßt, und damit war das Geheimnis gelöst.
Mr. Rater kehrte gestärkt und gekräftigt von seinem Urlaub nach London zurück und war in so freundlicher Stimmung, daß er sogar einem Mitreisenden antwortete, der mit ihm über das Wetter sprach.
In London stürzte er sich sofort wieder auf die Arbeit, und es warteten auch bereits zahlreiche Aufgaben auf ihn.
Eines Tages ging er durch den Hyde Park, als ihn plötzlich eine rauhe Stimme anrief.
„Hallo, Inspektor! Wollen Sie nicht eine kleine Spazierfahrt mit mir machen?“
Der Redner wandte sich langsam um und war erstaunt über den Anblick, der sich ihm bot. In einer prachtvollen, teuren Limousine saß ein elegant gekleideter Herr. Diamantringe mit großen Steinen glänzten an seinen Fingern.
„Steigen Sie doch bitte ein, Inspektor“, sagte Bill Osawold vergnügt.
Offenbar glaubte er nicht, daß seine Einladung angenommen würde, denn als der Redner die Tür des Wagens tatsächlich öffnete und einstieg, zeigte sich Bestürzung in Bills Gesicht, und er kniff die Augen zusammen. Der Tätigkeit des Chefinspektors hatte er es zu danken, daß er schon dreimal für empfindlich lange Zeit ins Gefängnis gewandert war.
„Nun, geschäftlich scheint es Ihnen nicht schlecht zu gehen“, meinte Mr. Rater und sah ihn scharf an.
Osawold räusperte sich verlegen und machte eine unruhige Bewegung.
„Ich habe selten jemanden gesehen, der einen so kompletten Eindruck machte wie Sie“, fuhr der Redner fort.
Bill Osawold sah auch wirklich tadellos aus. Er trug einen schwarzweiß karierten Anzug, der ihm vorzüglich stand, dazu ein seidenes Hemd mit passendem, weichem Kragen. Die Brillantnadel in seinem Schlips war allerdings etwas zu groß.
„Ich lasse mir jetzt nichts mehr zuschulden kommen, Inspektor“, erwiderte Bill mit etwas belegter Stimme. „Eine Tante von mir ist gestorben und hat mir eine Menge Geld hinterlassen. Sie müssen einmal zu mir kommen und sehen, wie schön ich es habe.“
Mr. Rater betrachtete, ihn so eingehend vom Kopf bis zum Fuß, als ob seine Augen Staubsauger wären, die gründlich und sorgfältig auch das letzte Stäubchen erfassen wollten.
„So? Eine Tante? Na, die wird ja sehr zufrieden mit ihrem Neffen sein, wenn sie jetzt durch ein Himmelsfenster herunterguckt und den eleganten Wagen und den schönen Anzug bewundern kann. Sie wohnte wohl früher in Australien?“
„Nein, in Amerika.“ Bill grinste. „Wenn Sie einmal durstig sind und gern etwas trinken wollen, dann kommen Sie doch zu mir – ich wohne Bloomsbury Mansions, Nr. 107.“
„Danke schön, wenn ich etwas trinken will, gehe ich lieber in ein Lokal“, entgegnete der Redner freundlich.
Die Verwunderung, die sich in seinen Zügen spiegelte, war nicht erheuchelt, sondern echt.
„Es ist doch kaum zu glauben“, sagte er nachdenklich. „Bei unserer letzten Begegnung habe ich Sie auf frischer Tat oben auf dem Dach von Albemarle Mansions erwischt. Fünf Jahre haben Sie brummen müssen, weil Sie eine Schußwaffe bei sich trugen!“
Bill ließ sich nicht gern an die Vergangenheit erinnern.
„Das hat nun alles aufgehört“, erwiderte er mit einer abwehrenden Handbewegung. „Seitdem mein Onkel gestorben ist –“
„Ach, ich dachte, es wäre eine Tante gewesen!“
„Natürlich war es eine Tante! Also, seit der Zeit habe ich nichts Unrechtes mehr getan. Ich komme auch nicht mehr mit der schlechten Gesellschaft zusammen, mit der ich früher verkehrte.“
Der Redner betrachtete Bill wie ein Kassierer einen gefälschten Scheck, und er war in mancher Beziehung nicht zufrieden. Mr. William Osawold hatte auch noch andere Verbrechen begangen als Einbrüche. Er war ein wilder und leidenschaftlicher Bursche. Der Chefinspektor erinnerte sich daran, daß Bill einmal wegen Vergewaltigung und Notzucht auf mehr als vier Jahre von der Bildfläche verschwinden mußte, und sprach auch von dieser Angelegenheit.
„Ich muß damals direkt verrückt gewesen sein“, entgegnete Mr. Osawold und schüttelte den Kopf. „Aber das Mädel hat das Blaue vom Himmel heruntergelogen, und Sie haben es mir auch ordentlich eingetränkt.“
„Das tue ich immer.“
Der Wagen war inzwischen am Marble Arch angekommen, und Osawold klopfte dem Chauffeur.
„Hier muß ich Sie leider absetzen, Inspektor. Ich habe nämlich eine Verabredung mit einer Freundin“, sagte er und atmete erleichtert auf, als sein Feind außer Sicht war.
Er hatte tatsächlich eine Verabredung, und zwar mit einer hübschen Verkäuferin, die unvorsichtigerweise eine Einladung zum Lunch in seiner Wohnung angenommen hatte.
Um fünf Uhr nachmittags wurde Mr. Rater von einem Bezirk aus angerufen – es handelte sich um Bill Osawold. Die junge Verkäuferin war verstört und entsetzt zur Polizeiwache gekommen. Sie war kaum vernehmungsfähig, aber sie beschuldigte den Mann schwerer sittlicher Vergehen.
„Gut, ich komme“, erwiderte der Redner freundlich.
Als er von Scotland Yard nach Whitehall ging, war der erste, dem er begegnete, Bill Osawold. Der Verbrecher wollte gerade zum Bahnhof fahren und hatte allem Anschein nach der Absicht, das Land für immer zu verlassen, denn auf dem Dach des Autos lagen ein großer Kabinen- und zwei riesige Lederkoffer. Der Wagen fuhr an Mr. Rater vorbei, wurde aber gleich gegenüber dem Parlamentsgebäude an einer Straßenkreuzung aufgehalten. Bevor der etwas phlegmatische Verkehrspolizist dem wartenden Wagen das Zeichen zur Weiterfahrt gab, war der Redner herangekommen und öffnete die Tür.
„Steigen Sie aus“, sagte er. „Und etwas lebhaft, bitte!“
Bill gehorchte wütend. Die Farbe wich aus seinem Gesicht, als der Chefinspektor einen uniformierten Polizisten heranwinkte.
„Durchsuchen Sie die Taschen des Mannes“, befahl er kurz. „Ich habe ihn in Verdacht, daß er eine Schußwaffe trägt.“
Der starke, kräftige Schutzmann führte die Aufgabe gründlich durch.
Fünf Minuten später stand Bill vor dem Pult des Sergeanten in der Cannon Row-Polizeistation und antwortete auf die Fragen nach seinen Personalien.
„Das ist eine abgekartete Geschichte!“ rief er ärgerlich. „Was das Mädchen gegen mich sagt, sind die gemeinsten Lügen! Sie kam aus freiem Willen – seit Wochen hat sie mich verfolgt –“
„Bis jetzt ist überhaupt noch von keinem jungen Mädchen die Rede gewesen“, bemerkte der Redner.
Bills häßliches Gesicht verzog sich zu einem höhnischen Grinsen.
„Sie glauben wohl, Sie haben mich? Aber diesmal ist die Sache anders als sonst. Diesmal habe ich Geld hinter mir! Wenn ich will, kann ich dafür sorgen, daß Sie hinausfliegen!“
„Bringen Sie ihn in die Zelle mit der harten Pritsche“, sagte der Redner freundlich. „Wenn er sich zur Wehr setzt, geben Sie ihm einen kräftigen Kinnhaken, damit er zunächst einmal das Aufstehen wieder vergißt.“
Bills Eigentum lag auf dem Pult des Sergeanten. Es befanden sich darunter eintausendsiebenhundertfünfzig Pfund in Banknoten, eine kleine, geladene Browningpistole und verschiedene Brillantringe. Mr. Rater sah sich diese Dinge eingehend und nachdenklich an, ließ die Nummern der Banknoten aufschreiben und schickte dann drei Beamte aus, um Nachforschungen anzustellen.
In der Zeit, die von der Verhandlung vor dem Polizeigericht bis zu dem eigentlichen Prozeß verging, erfuhr er viele Einzelheiten. Einen Einbruch oder Raub konnte er Osawold allerdings nicht nachweisen.
Der Angeklagte wurde von den besten Verteidigern vertreten, und zwar nicht nur vor dem Polizeigericht, sondern auch während des Strafverfahrens selbst. Drei der bekanntesten und angesehensten Rechtsanwälte setzten sich für ihn ein. Infolgedessen dauerte der Prozeß, der unter gewöhnlichen Umständen nur ein paar Stunden in Anspruch genommen hätte, drei Tage. Es wurde eine Reihe von Leuten verhört, die die Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin erschüttern und widerlegen sollten. Das gelang auch bis zu einer gewissen Grade. Aber der Gerechtigkeit wurde doch Genüge getan, denn der Staatsanwalt war ein kluger Mann und überführte Bill Osawold langsam, aber sicher.
Am zweiten Verhandlungstag sah der Redner eine Dame auf der Galerie, deren Gesicht ihm sehr bekannt vorkam. Eine Weile später fiel ihm plötzlich ein, daß es Lady Angela Lightley war. Sie folgte den Vorgängen mit außerordentlichem Interesse, und es schien sie nicht nur reine Neugierde hergeführt zu haben. Bei manchen Aussagen, die für den Angeklagten katastrophal waren, zuckte sie zusammen.
Das Ende der Verhandlung kam. Die Geschworenen sprachen nach kurzer Beratung Bill Osawold schuldig.
Der Richter mit den hageren Zügen setzte seinen Klemmer auf, sah einen Augenblick nach dem Gefangenen hinüber und dann zu den Geschworenen.
„Ist sonst noch irgend etwas gegen diesen Mann vorzubringen?“ fragte er mit harter, sachlicher Stimme.
Der Redner erhob sich, trat in den Zeugenstand, leistete mit erhobener Hand den Eid und gab dann eine kurze, aber schwerwiegende Auskunft.
„... der Angeklagte ist ein Dieb und Einbrecher. Außerdem hat er ein ähnliches Verbrechen wie dieses schon einmal begangen und ist deshalb zu einer fünfjährigen Zuchthausstrafe verurteilt worden. Er hat einen sehr schlechten Ruf und ist einer der gefährlichsten Verbrecher, die Scotland Yard kennt.“
Wütend sprang Osawold von der Anklagebank auf.
„Das sollen Sie noch bereuen, Rater!“ schrie er.
Der Richter tauchte die Feder ein und schrieb.
„Sie werden zu einer Zuchthausstrafe von zwölf Jahren verurteilt“, sagte er.
Vier Gefängniswärter waren nötig, um den Tobenden aus dem Gerichtssaal in seine Zelle zu schaffen. Rater wartete draußen in der großen Eingangshalle und beobachtete die Leute, die das Gebäude verließen. Lady Angela konnte ihm nicht aus dem Weg gehen. Er sah, wie sie erblaßte, dann errötete und wieder bleich wurde.
„Ach, Mr. Rater, was werden Sie nur von mir denken... Ich schreibe ein Buch über Verbrechen..., es war ein ganz schrecklicher Fall, nicht wahr?“
Sie tat ihm beinahe leid, daß sie ihre Bestürzung über diese plötzliche Begegnung mit ihm so wenig verbergen konnte. Sie zitterte an allen Gliedern.
„Sahen Sie mich schon während der Verhandlung? Ich dachte nicht, daß Sie mich wiedererkennen würden.“
„Sie wollen ein Buch schreiben, Mylady“, fragte er ruhig. Dann erinnerte er sich plötzlich daran, daß er ihr sein Beileid aussprechen mußte.
„Ach ja“, erwiderte sie hastig. „Meine Ehe war nicht sehr glücklich. Ich konnte kaum mit meinem Mann auskommen. Er war sehr – schwierig. In drei Monaten verheirate ich mich wieder – mit Mr. Donald Grey. Er hat jetzt eine gute Stellung im Auswärtigen Amt.“
Sie sah sich um, als ob sie einen Ausweg suchte, um ihm zu entkommen. Aber er begleitete sie noch hinunter.
„Haben Sie diesen Mann eigentlich früher schon gesehen?“ fragte er.
Sie blieb entsetzt stehen.
„Osawold? Nein! Wie sollte ich denn dazu kommen?“
„Ein wirklich gemeiner Charakter“, sagte der Redner halb zu sich selbst. „Er hatte eine ziemlich große Summe bei sich, als wir ihn verhafteten. Ich möchte nur wissen, wie er zu dem Geld kam.“
„Es tut mir leid, aber darüber kann ich Ihnen auch keine Auskunft geben“, entgegnete sie atemlos. Das Sprechen fiel ihr schwer, und er hätte darauf schwören mögen, daß sie dicht vor einem Nervenzusammenbruch stand.
„Irgend jemand hat seine Verteidigung bezahlt. Es ist nichts von dem Geld verlangt worden, das wir für ihn in Verwahrung haben, und ich nehme deshalb an, daß er einflußreiche Freunde hat. Darf ich Sie einmal besuchen, Lady Angela?“
Sie zögerte.
„Ja“, erwiderte sie schließlich und gab ihm ihre Adresse. Sie wohnte in einem vornehmen Hotel im Westen.
Als sie auf die Straße traten, wurde sie ruhiger, und es gelang ihr, sich wieder einigermaßen zu fassen.
„Sie sind wahrscheinlich an solche Fälle so gewöhnt, daß es Ihnen nichts mehr ausmacht, zuzuhören. Aber mich hat es furchtbar mitgenommen. Ich habe niemals geglaubt, daß es so abscheuliche Menschen geben könnte. Wird er Berufung einlegen?“
Er fühlte, daß es sie große Überwindung kostete, diese Frage an ihn zu richten.
„Das nehme ich ohne weiteres als selbstverständlich an. Er scheint ja über sehr viel Geld zu verfügen.“
„Glauben Sie auch, daß er Erfolg damit haben wird? Auf der Galerie sagte jemand, daß der Richter verschiedene Bemerkungen gemacht hätte, die seine Voreingenommenheit gegen den Angeklagten bewiesen...“
Rater beobachtete sie scharf und schüttelte den Kopf.
„Nein, Osawold hat nicht die geringste Aussicht auf Erfolg, wenn er Berufung einlegt.“
„Ach!“ Sie sagte dieses eine Wort so verzweifelt, daß er sie bestürzt anschaute.
„Ich wünschte, Sie würden sich mir anvertrauen, Lady Angela“, sagte er ernst.
„Warum denn?“ fragte sie schnell.
„Sie haben schwere Sorgen, und ich könnte Sie vielleicht davon befreien. Ihr Vater war einer meiner besten Freunde. Ich würde alles tun, um seiner Tochter zu raten und zu helfen.“
Sie zwang sich zu einem Lächeln.
„Ich fürchte nur, das können Sie nicht, es sei denn, daß Sie das Buch für mich schrieben!“
Sie winkte ihrem Chauffeur, und Mr. Rater sah dem vornehmen Wagen nachdenklich nach.
Die Pflicht rief ihn in das Gefängnis von Pentonville, um den Verurteilten noch einem Verhör zu unterwerfen. Es handelte sich um einen der Brillantringe, der sich als gestohlenes Gut erwiesen hatte. Daß Osawold der Dieb war, hatte der Redner keinen Augenblick geglaubt, und die Aussage des Mannes, wie er in den Besitz des Stücks gekommen war, klang auch vollkommen überzeugend.
„Ich habe ihn von Louis Rapover. Dreiundvierzig Pfund habe ich dafür bezahlt. Wenn er gestohlen ist, kann ich nichts dazu. Ich weiß nichts davon. Deshalb können Sie mich doch wohl nicht vor Gericht stellen lassen, Mr. Rater.“
„Na, da sind Sie ja diesmal ein Unschuldslämmchen“, meinte der Chefinspektor etwas ironisch. „Wollen Sie übrigens gegen das letzte Urteil Berufung einlegen?“
Bill nickte.
„Machen Sie sich darüber nur keine Sorgen, ich komme schon damit durch. Meine Freunde müssen dafür sorgen, sonst geht es ihnen schlecht. Mir zwölf Jahre aufzuknallen..., das alte Schwein! Legen Sie doch ein gutes Wort für mich ein, wenn ich wieder vor die Geschworenen komme. Ich gebe Ihnen auch ein schönes Stück Geld ab.“
„Kommt für mich nicht in Frage, Bill“, erwiderte der Redner.
Die Berufung wurde vor dem Königlichen Gerichtshof im Strand verhandelt. Zwei Stunden vor Beginn der Sitzung brachte man Bill Osawold in das Gerichtsgebäude. Er kam in einem Auto, begleitet von drei Gefangenenwärtern, und wurde in einen kleinen, zellenartigen Raum geführt, der unter den Verhandlungssälen lag. Um zehn Uhr erschien ein junges Mädchen aus dem Restaurationsraum, um ihm das Frühstück zu bringen.
Ein Polizist begleitete sie und ging vor ihr die enge Treppe hinunter. Er war bereits außer Sicht, bevor sie das erste Podest erreicht hatte.
„Ach, entschuldigen Sie einen Augenblick.“
Die Kellnerin wandte sich um und sah eine Dame hinter sich, die ein kostbares Trauerkleid französischer Machart trug. Ein dichter, schwarzer Schleier fiel über den Rand ihres Hutes und verdeckte ihr Gesicht.
„Bringen Sie das Frühstück für Mr. Osawold?“ fragte sie in gebrochenem Englisch.
„Ja.“
„Gehört der Polizist zu Ihnen?“ fragte die Dame weiter und zeigte die Treppe hinunter.
Die Kellnerin schaute in die Richtung, konnte aber niemand bemerken.
„Wen meinen Sie denn?“
„Ach, ich dachte, ich hätte eben noch einen Polizisten gesehen.“
Mehr wurde nicht gesprochen. Die Dame drehte sich um und wäre beinahe mit Chefinspektor Rater zusammengestoßen, der von einem höheren Treppenabsatz aus der Szene interessiert beobachtet hatte. Mit einer Entschuldigung eilte sie an ihm vorbei, ohne aufzublicken. Sie stieg die Treppe so schnell hinauf, als ob sie fürchtete, verfolgt zu werden.
Mr. Rater sah ihr eine Sekunde nach, ging dann aber rasch hinter der Kellnerin her. Dicht vor der Zellentür erreichte er sie, nahm die Kaffeetasse vom Tablett, betrachtete sie einen Moment zerstreut und ließ sie dann plötzlich zu Boden fallen, wo sie in tausend Stücke zerschellte.
„Es tut mir leid, ich bin heute morgen etwas nervös“, sagte er. „Ich werde dafür sorgen, daß die Scherben aufgekehrt werden. Gehen Sie gleich zurück und holen Sie eine andere Tasse Kaffee. Und sagen Sie in der Wirtschaft, daß Chefinspektor Rater für den Schaden aufkommt.“
Er wartete bei dem Gefangenenwärter, bis das Mädchen zurückkam, dann stieg er die Treppe zur Halle hinauf.
Später war er bei der Verhandlung zugegen, als die drei Richter die Berufung verwarfen und die außerordentlich lange Zuchthausstrafe bestätigten, die fast einem Todesurteil gleichkam.
Um vier Uhr nachmittags wurde Lady Angela der Besuch gemeldet, den sie im Stillen schon erwartet hatte. Mit düsterem Gesicht saß sie in ihrem Wohnzimmer. Rings um sie her lagen viele Zeitungen auf dem Boden verstreut.
„Lassen Sie Mr. Rater eintreten“, sagte sie so leise, daß sie den Auftrag wiederholen mußte.
Bei dieser Gelegenheit war der Redner wirklich einmal gesprächig. Er unterhielt sich mit Lady Angela über das Wetter, über den Lärm des Straßenverkehrs und über die hohen Kosten des Hotellebens. Dann kam er schließlich auf die Sache zu sprechen, die ihn zu ihr geführt hatte.
„Die Berufung Ihres Freundes ist nicht durchgegangen.“
„Warum nennen Sie denn diesen entsetzlichen Menschen meinen Freund?“ fragte sie, ohne ihn anzusehen.
„Ach ja, man kann ihn eigentlich kaum so bezeichnen.“ Er lächelte liebenswürdig. „Auf jeden Fall ist er nicht mein Freund. Ich hatte ihn wegen einer Reihe von Juwelendiebstählen in Ostende in Verdacht, telefonierte von dort nach Scotland Yard und erfuhr dabei etwas sehr Merkwürdiges. Der Beamte erzählte mir nämlich, daß man Osawold an demselben Morgen aus Ihrem Haus kommen sah, an dem Ihr Mann starb.“
Sie erwiderte nichts darauf.
„Nun ist es insofern schlimm mit mir“, fuhr der Redner fort, „als ich mir immer gleich Theorien bilden muß. Ich denke darüber nach, was sich wohl hinter verschlossenen Türen abgespielt haben mag, bis ich schließlich einen Zusammenhang entdeckte. Deshalb habe ich auch versucht, eine Erklärung für Ihr großes Interesse an Bill Osawold zu finden, und ich glaube, das ist mir gelungen.
Manches bringt man allerdings nicht bloß durch Nachdenken heraus.“ Er schüttelte traurig den Kopf. „Was schüttete zum Beispiel heute morgen die französische Dame in den Kaffee, der Bill Osawold gebracht wurde? Ich sah, wie sie den Inhalt eines Fläschchens hineingoß, als die Kellnerin einen Augenblick wegschaute. Vielleicht war die Dame überhaupt keine Französin? Auf jeden Fall war sie aber wahnsinnig vor Furcht. Das ist nicht der richtige Weg, einen Mann vom Sprechen abzuhalten. Wenn Sie mit der Psyche der Verbrecher so vertraut wären wie ich, Lady Angela, wüßten Sie auch, daß die Drohungen solcher Menschen nicht zu fürchten sind. Bill Osawold erreicht auch nichts, wenn er eine Dame verrät, die ihm geholfen hat. Außerdem wird er nicht mehr lange leben, wenn der Gefängnisarzt seinen Zustand richtig beurteilt. Sollte er Ihnen jemals schreiben, schicken Sie mir seine Briefe nur zu. Aber ich glaube nicht, daß Sie noch etwas von ihm hören werden.“
Der Chefinspektor nahm seinen Hut und schaute ein paar Sekunden nachdenklich aus dem Fenster.
„Ich gehe jetzt, Lady Angela“, sagte er dann. „Vielleicht schreiben Sie mir an einem der nächsten Tage einmal, wie Ihr verstorbener Mann, der soviel Arsen zu sich nahm, Sie in eine schwierige Lage gebracht hat.“
Sie sprang auf und stand bleich und zitternd vor ihm.
„Sprachen Sie nicht eben von Arsen... Woher wußten Sie denn das?“
„Er hat ein paar Jahre in Syrien zugebracht, und ich weiß, daß auch andere Europäer dort dieser Schwäche verfallen sind. An Ihre Hochzeitstage traf ich einen jungen Mann aus der Apotheke, der ein Paket Arsen für ihn abgeben sollte. Die Leute fangen erst mit kleinen Dosen an und nehmen schließlich so viel von dem Gift zu sich, daß man ein ganzes Regiment Soldaten damit unter die Erde bringen könnte, und bei diesem Stadium war Ihr Mann angelangt.“





























