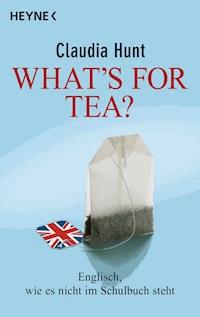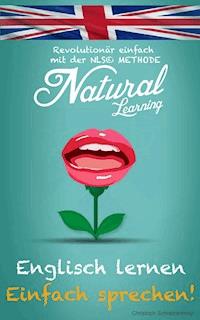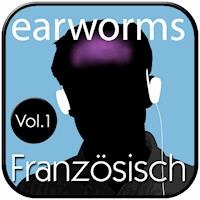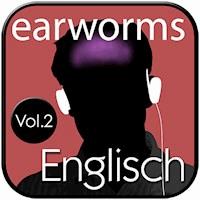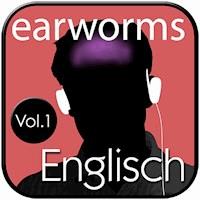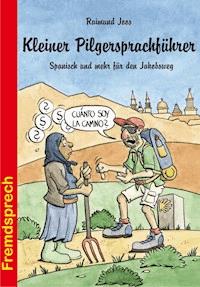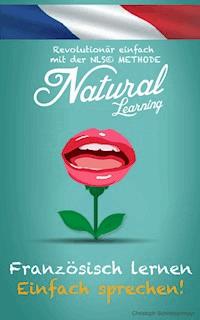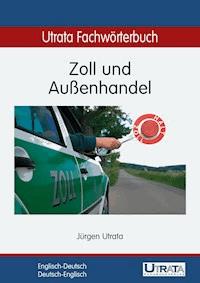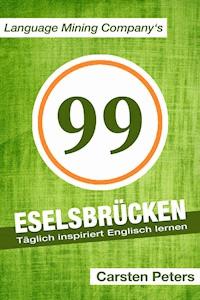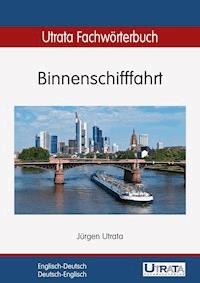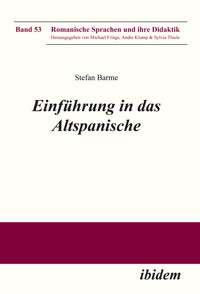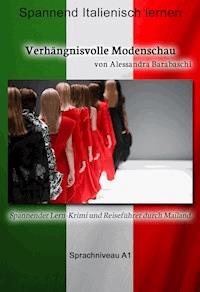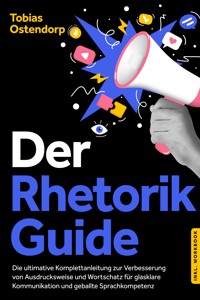
Der Rhetorik Guide: Die ultimative Komplettanleitung zur Verbesserung von Ausdrucksweise und Wortschatz für glasklare Kommunikation und geballte Sprachkompetenz - inkl. Workbook E-Book
Tobias Ostendorp
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Fremdsprachen
- Sprache: Deutsch
Fehlen Ihnen manchmal die Worte? Oder erzeugen die Worte, die Sie wählen, nicht immer den gewünschten Effekt? Bleiben Sie gar hinter Ihren Möglichkeiten zurück, einfach, weil es an der Kommunikation hapert? Dann schnappen Sie sich schleunigst diesen Ratgeber und machen Sie aus Ihrer Schwäche in kürzester Zeit eine unbezahlbare Stärke! Ob beruflich oder privat, rhetorisches Talent bringt einen oftmals weiter als die tatsächliche Qualifikation – umso bitterer, wenn Sie eigentlich brillante Ideen haben, aber über sprachliche Hürden stolpern. Doch zum Glück ist gewandte Redekunst kein in die Wiege gelegtes Geschenk, sondern kann ganz einfach trainiert werden, und dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie das klappt. Mit den wichtigsten Grundlagen rund um Wortschatz, Syntax, sprachliche Klarheit, stilistische Variationen, Fachjargon sowie kreatives Schreiben und Sprechen steigen Sie mühelos in das Thema Redekunst ein und erfahren, worauf es bei überzeugender Kommunikation wirklich ankommt. Anschließend wird's praktisch: Mit dem Workbook, das zu jedem Aspekt eine Vielzahl an effektiven und leicht durchführbaren Übungen enthält, feilen Sie Wort für Wort an Ihrer Ausdrucksfähigkeit und bringen Ihre Überzeugungskraft auf ein neues Level. Reden ist so gar nicht Ihres? Keine Sorge! Denn dieses Praxisbuch ist genau so konzipiert, dass auch zögerliche Redner in ihrem eigenen Tempo an die Rhetorikkunst herangeführt werden und mit konkreten Übungen ganz gezielt Ihre Kompetenzen verbessern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2024 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Über-setzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Foto-kopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2024
Inhalt
Warum die Verbesserung der Ausdrucksweise wichtig ist
Grundlagen der Ausdrucksweise
Elemente einer klaren und präzisen Ausdrucksweise
Verbesserung der Satzstruktur und Syntax
Steigerung der Verständlichkeit und Klarheit in der Kommunikation
Wortschatzerweiterung
Strategien zur gezielten Erweiterung des Wortschatzes
Verwendung von Synonymen, Antonymen und Idiomen
Anwendung und Festigung neuer Vokabeln
Stilistische Variation
Unterschiedliche Stilebenen und deren Einsatz in verschiedenen Kontexten
Entwicklung eines persönlichen Schreib- und Sprechstils
Fachsprache und Fachjargon
Umgang mit Fachsprache in speziellen Fachgebieten
Vermeidung von übermäßigem Fachjargon und klare Kommunikation
Kreatives Schreiben und Rhetorik
Tipps und Tricks für eine gelungene Kommunikation
Förderung der kreativen Schreibfähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten
Literarisches Schreiben versus kreatives Schreiben
Rhetorische Mittel und Techniken zur Überzeugungskraft in der Kommunikation
Workbook
Grundlagen der Ausdrucksweise
Aufgaben zur Verständlichkeit und Klarheit in der Kommunikation
Wortschatzerweiterung
Verwendung von Synonymen, Antonymen und Idiomen
Stilistische Variation
Entwicklung eines persönlichen Schreib- und Sprechstils
Fachsprache und Fachjargon
Vermeidung von übermäßigem Fachjargon und klare Kommunikation
Kreatives Schreiben und Rhetorik
Anhang: Lösungen und Erklärungen zu den Übungen im Workbook
Grundlagen der Ausdrucksweise
Wortschatzerweiterung
Stilistische Variation
Fachsprache und Fachjargon
Kreatives Schreiben und Rhetorik
Bonus: Praktische Kniffe der Rhetorik
Förderung des kreativen Schreibens
Actionplan/Planer
Weitere Anwendungsaufgaben
Lösungen
Am Ziel angekommen
Warum die Verbesserung der Ausdrucksweise wichtig ist
Bin ich besonders ausdrucksstark? Und wie stelle ich meinen Standpunkt durch kompetente Rhetorik klar und direkt dar? Wir kommunizieren an jedem Tag, in jeder Sekunde – bei jedweder zwischenmenschlichen Interaktion. Doch trotz dieser Präsenz der Kommunikation entstehen zwischen den Menschen Miss- beziehungsweise Unverständnis sowie Verwirrung. Im Kollegenkreis oder der besten Freundschaft schwenkt das schnell in die falsche Richtung ab. Aufmerksamkeit und Zeit wird verschwendet. Oft werden Ziele sogar nur auf Umwegen erreicht. Diese Risiken der sprachlichen Fehldeutung lassen sich mittels klaren Ausdrucks sehr wirkungsvoll minimieren. Denn Kommunikation ist ein komplexes Modell. Sie findet auf mehreren Ebenen statt. Zu den fünf Kommunikationsarten zählen diese fünf Kommunikationskategorien:
verbal (Ausdruck, Wortschatz und Rhetorik)
nonverbal (Mimik und Gestik)
paraverbal (Betonung, Lautstärke und Tempo)
schriftlich (Text, Mail und Chat)
visuell (Bilder, Videos und Präsentationen)
Dieser Ratgeber möchte sich insbesondere der sprachlichen Kompetenz widmen und diese fördern. In den einzelnen Kapiteln folgen nach dem theoretischen Einstieg zahlreiche Übungen und Tipps zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten – ein extra Workbook bietet Ihnen Potenzial, um die Fähigkeiten weiter auszubauen. Im Privatgespräch oder bei einer thematischen Debatte – mit der richtigen Wahl der Worte und einer präzisen Kommunikationslinie schenken wir uns selbst Respekt, Vertrauen und Erfolg. Die Wahrnehmung der eigenen Person wird insbesondere in der Öffentlichkeit durch ein stimmiges Auftreten, klaren Inhalt und in vielen Situationen die notwendige Überzeugung erzielt. Die Optimierung Ihres Ausdrucks, die Erweiterung des individuellen Wortschatzes sowie die Aneignung einiger rhetorischer Mittel versprechen Ihnen einen nachweislich größeren kommunikativen Erfolg! Es ist Zeit, Ihre Professionalität auch sprachlich ans Licht zu führen.
Grundlagen der Ausdrucksweise
Sind Sie ausdrucksstark? Die Einstiegsfrage rekapitulierend, definiert sich eine Ausdrucksstärke durch eine besonders überzeugende Darstellung. In vielen Fällen werden dabei Emotionen ausgelöst, die Ihre Zuhörerschaft binden. Kurz gesagt: Verwenden Sie die richtigen Worte, verknüpfen Sie diese möglichst direkt miteinander und erschaffen Sie damit eine Bindung beim Gegenüber. Doch die Frage nach dem „Wie“ präsentiert sich etwas verschleiert. Denn die Sprache ist komplex – wer kann sich nicht an die Grammatikprüfungen zu den Zeitformen, unregelmäßigen Verben und Co. im Deutschunterricht erinnern? Abertausende Worte für gefühlt jede Situation, feste Satzstrukturen sowie grammatikalische Regeln minimieren oft die Motivation. Das Bewusstsein für den eigenen Ausdruck, Syntax und Synonyme sind jedoch gerade die einfachen Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer Sprachkenntnisse. Sie müssen Ihr sprachliches Know-how einfach nur trainieren. Und das funktioniert am besten durch konsequente Anwendung.
Vorab: Es gibt für eine klare Sprache keinen ultimativen Tipp. In immer kleinen Nuancen verbessern Sie über einen Zeitraum Ihr rhetorisches Vermögen. Es ist daher ein Prozess.
Elemente einer klaren und präzisen Ausdrucksweise
Ausdrucksstärke kennzeichnet sich primär durch ein inhaltlich abgeschlossenes Sujet. Wenn sich Ihr Thema logisch aufbaut, haben Sie die Zuhörer bereits auf Ihrer Seite. Sie gewinnen an Aufmerksamkeit, sofern sich ein roter Faden durch Ihre Mitteilungen zieht. Fangen Sie daher gern auch beim ersten Satz an. Dies vereinfacht den Einstieg. Wir beginnen oft bei Folgegedanken und deklarieren den Startpunkt unseres Berichts ohne entsprechende Würdigung als selbstverständlich für jedermann voraus – dies geschieht öfter, als Sie denken. Natürlich existieren für eine gelungene Ausdrucksweise einige Elemente:
Einfachheit: Gute Kommunikation funktioniert durch schnell verständliche Inhalte. Die Auffassungsgabe des Gegenübers profitiert dabei dank einfacher Sprache! Verwenden Sie aussagekräftige Hauptsätze mit nur wenigen Nebensätzen kombiniert. Auch wenn eine komplexe Sache sich nicht so einfach erzählen lässt, können Sie diese immer in kleine Abschnitte splitten. Sie müssen keine Bandwurm- oder Schachtelsätze produzieren.
Das Gute an der Einfachheit: Sie setzt Anforderungen herab. Einerseits gestaltet Einfachheit jegliche Kommunikation übersichtlicher. Andererseits präsentieren sich Reden, Gespräche und andere Formen des Austausches ganz einfach verständlicher. Der Fokus wird automatisch auf das Wesentliche gelegt. Ein Vorteil dabei: Sie reduzieren Hürden und Barrikaden in der sprachlichen Kompetenz zwischen Kommunikator und Rezipient. Die Basis für Verständnis zeigt sich in einer klaren Struktur. Am besten verwenden Sie daher bekannte Wörter. Beurteilen Sie das Wortverständnis dabei nicht durch die eigene Brille, sondern setzen Sie den Wissensstand Ihrer Zuhörer zugrunde. Zudem stehen Nebensätze am Anfang beziehungsweise am Ende des Satzes – sie werden zudem kurz gehalten. Bitte fügen Sie keine komplizierten Nebensätze mitten im Hauptsatz ein! Sie dürfen an anderer Stelle gern Ihre grammatikalischen Kenntnisse offenbaren. Die Aufmerksamkeit und damit das Verständnis leiden darunter ungemein.
Beispiel:
„Das tangiert mich peripher.“
Besser:
„Das berührt mich nur am Rande.“
Klarheit: Blumige Formulierungen helfen bei der Vermittlung belletristischer Darstellungen oder beim Einbeziehen der Rezipienten als Anekdote. Ansonsten verwirren sie. Für den Anfang halten Sie sich an kurzen Sätzen mit leicht aufnehmbaren Inhalten fest – siehe Einfachheit. Ein klarer Ausdruck koppelt sich stets an klares Denken. Nur durchdachte Aspekte/Thematiken bringen Sie in einem einfach verständlichen Kontext unter. Sie müssen nicht an ausgefeilten Formulierungen sitzen, wenn Sie Herz und Leidenschaft für ein Thema aufbringen. Denken Sie daran: Einfache Wörter überzeugen eher. Dieses Problem ist bei vielen Personen aus dem öffentlichen Leben erkennbar. Ohne genauen Durchblick werden Phrasen, Satzkonstrukte und Fachwörter aneinandergereiht – oft bleibt der Inhalt in einer getrübten Blase zurück.
Tipp: Positiv sprechen – niemand möchte das Wort „nicht“ hören oder lesen. Deshalb nutzen Sie es am besten nicht und formulieren Sie positiv um. Wenn Sie beispielsweise von einer Speise begeistert sind, dann schmeckt sie Ihnen gut. Personen verwenden oft die Phrase „schmeckt nicht schlecht“. Wenn etwas „nicht mehr lange dauert“, dann „ist es bald so weit“.
Klarheit verlangt eine gewisse Fokussierung. Im Kopf spuken einige Gedanken zum Thema herum. Nicht alle dieser Gedankenspiele sollen ungebündelt und im Wirrwarr herausgeschmettert werden. Daher greift auch das Sprichwort: Erst denken, dann reden! Oft offenbaren sich Ihnen zu einem Thema mehrere Sichtweisen. Sprechen Sie alles ungebündelt aus, blicken Sie anschließend nur noch in fragende Augen. Der Begriff der „inneren Teams“ hat sich in der Kommunikationswissenschaft durchgesetzt. Er beschreibt genau diese verschiedenen Bezüge. Für Ihre eigene Reflexion benötigen Sie genau diese verschiedenen Blickwinkel. Und sie sind auch wichtig bei einer Besprechung – aber nicht alle zusammen zur selben Zeit. Sie verhandeln unterbewusst daher mit Ihren diversen Stimmen. Daraus ergibt sich Ihre Position. Erst wenn Sie diese gefunden haben, lohnt sich ein Gespräch oder ein Text darüber. Denn jetzt sehen Sie klarer.
Tipp: Beruflichen Texten, Präsentationen oder wissenschaftlichen Ausarbeitungen verschafft eine klare Ordnung die beste Basis. Nutzen Sie eine Mindmap, um die verschiedenen Ansatzpunkte zu einem Thema zu erkennen.
Präzise Formulierungen vermitteln Wissen oder anderweitige Informationen. Dabei hilft eindeutig eine visualisierende Darbietung. Wenn Sie zusätzlich Ihre Erfahrungen einbinden, wirken Sie direkter und dabei zeitgleich ehrlich.
Die Elemente einer klaren Ausdrucksweise sind Ihnen nun bewusst. Mit folgenden Maßnahmen beginnen Sie Ihren sprachlichen Wandel. Was einem klaren Ausdruck hilft, sind Pausen. Setzen Sie diese, bevor Sie eine neue Frage stellen oder zwischen zwei Argumenten tanzen. Eine Zäsur schenkt dem Gegenüber die benötigte Zeit zum Nachdenken – die ist wichtig für dauerhafte Aufmerksamkeit. Was unternehmen Sie nun als Erstes?
Ausdruck kontrollieren: Ein klarer Ausdruck lässt sich durch aktive Wahrnehmung sehr gut festigen. In diesem Fall schärfen Sie auch Ihre Wahrnehmung. Sie müssen sich vorstellen: Das Gehirn beschäftigt sich stets damit, was es favorisiert. Sind Sie hungrig, werden Sie verlockende Düfte aus Kantine oder Bäckerei eher wahrnehmen. Sind Sie schwanger, sehen Sie süße Kindersachen und eine Menge Schwangere mehr. Daher fokussieren Sie sich auf das Thema Ausdruck!
Dazu betrachten Sie die Ausdrucksstärke von geschätzten oder einigen Ihrer alltäglichen Mitmenschen – das funktioniert auch mit Fremden im Bus. Ein selbstkritischer Vergleich bringt einige Lücken ans Tageslicht. Nach diesem ersten Schritt schauen Sie auf Ihre Präsenz. Diesbezüglich helfen Videotagebücher oder eine Aufnahme Ihrer letzten Vortragsprobe – Sie erkennen nun selbst im Abspielen der Filme, was Sie gut und was Sie suboptimal gelöst haben. Mitunter stellen Sie an sich Marotten wie das häufige „Ähm“ oder sich wiederholende Lieblingswörter fest. Der erste Ansatz ist demzufolge gefunden. Manche Aspekte lassen sich durch Ihren eisernen Willen und intensives Training verbessern. Andere Dinge betreffen regelrechte Denkmuster und -strukturen. Hierfür bedarf es eines längerfristigen Prozesses.
Ziele sichtbar machen: Positives kommt, Negatives geht. Schreiben Sie sich wichtige Phrasen auf einen Zettel. Folglich befestigen Sie diese kleine Nachricht an einem frequent genutzten Standort Ihres Alltags. Dabei darf es sich um den Arbeitsplatz, die Entspannungsecke in Ihrer Wohnung oder die Zimmertür handeln. Sprechen Sie es bei jedem unmittelbaren Kontakt aus. Immer wenn Sie vor Ort sind, integrieren Sie Ihr Ziel – auf diese Weise erweitern Sie auch effektiv Ihren Wortschatz. Als Gegenbeispiel notieren Sie eine ungewünschte Phrase und streichen diese auf dem Zettel gleich durch. Verfahren Sie nun wie bei den positiven Beschreibungen. Sobald Sie es sehen, eliminieren Sie es Stück für Stück aus Ihrer Sprache. Bei der Eliminierung von schlechten sprachlichen Angewohnheiten fällt das Aussprechen natürlich weg. In diesen Fällen hilft unterbewusst das Ansehen des „Verbots“.
Trainingspartner finden: Zu zweit geht vieles besser und effektiver voran. Auch bei der Verbesserung Ihres Ausdrucks offenbart ein Team-Player mehr Potenzial. Im Duett besprechen Sie die jeweiligen sprachlichen Aspekte, die Sie stören. Immer wenn Sie diese im Alltag verwenden, spricht Sie Ihre vertraute Person nun darauf an. Setzen Sie sich dafür einen quantitativen Rahmen für das Aufzeigen der Fehler. Drei bis fünf Ermahnungen pro Tag reichen mit Sicherheit. Es soll schließlich auch langfristig Vergnügen bereiten. Fangen Sie damit am besten mit dem Lebenspartner oder der besten Freundin im privaten Umfeld an. Das Prinzip erweitern Sie später auf das berufliche Umfeld. Ein Dank für die Aufmerksamkeit verschafft der anderen Seite ein gutes Gefühl.
Tipp: In der Öffentlichkeit passt die verbale Konfrontation mit einer ungewollten Sprachsituation selten. Für diese Gelegenheiten bieten sich ausgemachte Zeichen an. So werden Sie subtil auf das Manko aufmerksam gemacht. Gleichzeitig bekommen die Menschen in Ihrer Umgebung nichts davon mit.
Ein präziser Ausdruck lässt sich trainieren. Es handelt sich lediglich um eine Gewohnheit. Diese resultiert aus verbalen Konfrontationen in der Familie, dem Freundeskreis oder dem Arbeitskollektiv. Verbringen wir viel Zeit mit einer Person, gleichen sich auch sprachliche Optionen einander an. Suchen Sie sich daher auch gern Menschen in Ihrem Umfeld, die Sie sprachlich begeistern.
Verbesserung der Satzstruktur und Syntax
Subjekt, Prädikat und Satzbau – all das wird nun etwas detaillierter betrachtet. Bevor wir die Sätze betrachten, richtet sich unser Fokus auf die hauptsächlichen Satzglieder. Sie sind Bestandteile eines eigenständigen Satzes:
Subjekt (Akteur)
Prädikat (Aktivität)
Objekt (Zusatzinhalt)
Merken Sie sich: Satzglieder bestehen in einigen Fällen aus mehreren Wörtern („Meine Mutter ...“, „ist ... gegangen“, „... um 3 Uhr an der Scheune“ etc.).
Das letzte Beispiel über mehrteilige Satzglieder stellt eine Besonderheit der Satzstruktur dar. Mit der Adverbialbestimmung offenbart sich Ihnen eine Quelle zusätzlicher Informationen. Es gibt vier verschiedene Arten der Detailerweiterung:
Temporal (Zeit – „Anton besucht heute seine Oma.“)
Kausal (Grund – „Anton besucht seine Oma aus Sehnsucht.“)
Modal (Art und Weise – „Anton besucht seine Oma mit dem Fahrrad.“)
Lokal (Ort – „Anton besucht seine Oma in Rostock.“)
Treten mehrere adverbiale Bestimmungen in einem Satz auf, ordnen Sie diese genau in der Reihenfolge der obigen Liste im Satz ein – TeKaMoLo (als Merkwort).
Beispiel:
„Anton besucht heute aus Sehnsucht seine Oma mit dem Fahrrad in Rostock.“
Die Verbindung von einzelnen Wörtern zu Wortgruppen beziehungsweise kompletten Sätzen wird als Syntax bezeichnet. Sie ist ein Teilgebiet der Grammatik. Mit einfachen Mitteln verknüpfen Sie fortan jede sprachliche Einheit zu einem korrekten Satz. Legen wir gleich los! Die frequent genutzte Form des Satzes ist S-P-O (Subjekt-Prädikat-Objekt). Einfache Sätze setzen sich nun einmal durch. Es geht aber auch noch kürzer: S-P („Anton lacht.“).
Obacht: Diese kürzeste Form des Satzbaus funktioniert nicht mit allen Verben. Manche Aktivitäten erfordern ein Objekt, wie beispielsweise „geben“. „Anton gibt.“ ist daher kein richtiger Satz. Es bedarf eines Objektes, was wem gegeben wird.
Es werden drei gängige Satzkategorien unterschieden:
Einfacher Satz – nur ein Hauptsatz
Komplexer Satz – ein Haupt- und ein Nebensatz
Zusammengesetzte Sätze – zwei Hauptsätze
Der kurze Überblick über die Satzglieder und drei simple Satzkonstruktionen verraten es Ihnen schon: Syntax muss kein Teufelswerk sein! Mit den oben genannten Satzstrukturen bilden Sie nahezu 90 Prozent Ihrer Alltagssprache. Ihr Ausdruck wird unter Berücksichtigung dieser wenigen Regeln bereits sehr viel besser. Damit Ihnen das zeitnah gelingt, helfen folgende Regeln:
Verwenden Sie aktive Sprache – Aktivität erhöht die Aufmerksamkeit, weil sie im Kopf die Zuhörer das Ganze erleben lässt. Zudem stellen Partizipien inhaltliche Distanz her. Passivsätze verschleiern oft den Akteur – etwas wird eben irgendwie umgesetzt oder passiert einfach. Da fehlt doch die Bühne für die Hauptfigur.
Beispiel:
„Daraufhin hat er sich davongestohlen.“
„Die Katze wurde von der Feuerwehr vom Baum geholt.“
Besser:
„Er stahl sich daraufhin davon.“
„Die Feuerwehr holte die Katze vom Baum.“
Benutzen Sie wenige Substantive – Adjektive und Verben kennzeichnen fesselnde Erlebnisse. Dinge dagegen bilden eine statische Komponente ohne Dynamik. Mitten im Satz verwenden Sie Aufzählungen mit höchstens 3 Aufzählungspunkten. Das fördert den Überblick. Weiterführende Aspekte dürfen im nächsten Satz genannt werden. Je mehr Nebensätze Sie verwenden, desto häufiger schleichen sich neue Substantive ein. Um welches Nomen geht es nun, wenn drei Teilsätze später ein Fragezeichen auftaucht? Verwirren Sie die Rezipienten nicht!
Beispiel:
„Das Knattern des Kühlschranks ist äußerst laut.“
Besser:
„Der Kühlschrank knattert äußerst laut.“
Weitere Beispiele:
Zu Ende bringen
Zur Sprache bringen
Hilfe leisten
In Auftrag geben
Besser:
Beenden
Ansprechen
Helfen
beauftragen
Treffen Sie die richtige Wortwahl – Verzichten Sie auf Substantive mit der Endung -ung. Zudem existieren Verben, die inhaltslos sind und ein weiteres Substantiv verlangen. Paradoxerweise führen sie oft ein Nomen mit der Endung -ung nach sich. Dazu gehören:
sorgen
machen
bewirken
Verben schenken Ihnen Inhalt, Aktion und Dynamik. Als inhaltsrelevante Komponente führt das Verb zu richtiger Aufmerksamkeit.
Beispiel:„Die Marketingmaßnahme bewirkte eine Steigerung ...“„Du machst eine Übung.“
Besser:„Die Marketingmaßnahme steigerte die Absatzzahlen.“„Du übst.“
Eliminieren Sie Bandwurmsätze – Ein Satz muss aufgenommen und verarbeitet werden. Die Überlänge der Sätze erfordert mehr Aufmerksamkeit. Derweil entscheidet der Rezipient, welche Thematik die wichtigste ist. Während dieser Bewertung verpasst er jedoch die nächsten Informationen. Gerade bei fachspezifischen Thematiken wird der Fachfremde durch unverständliche Aneinanderreihungen akustisch gefoltert. Splitten Sie daher den einen Satz in mehrere kleine Sätze. Jetzt legen Sie das Wichtige in den Hauptsatz, die Erklärung in den Nebensatz.
Erkennen Sie Pseudo-Aufforderungen – Hinter einer Pseudo-Aufforderung verbergen sich Fragen. „Könntest du morgen pünktlich sein?“ oder „Würdest du dir Hände waschen?“ ergeben keinen guten Ausdruck. Stattdessen nutzen Sie direkte Aufforderungen wie „Sei morgen pünktlich!“ oder „Wasche dir die Hände!“.
Sprechen Sie die Zuhörer an – Menschen werden gern angesprochen. Dadurch fühlen sie sich ernst sowie überhaupt wahrgenommen, in einigen Fällen sogar verstanden. Denn wie überall zählt der erste Eindruck in besonderem Maß. Ein guter Ausdruck bringt alles auf den Punkt – und bezieht das Gegenüber mit ein. Eine direkte Ansprache schafft eine Einbindung aller Gesprächsteilnehmer. In einer Gruppe leitet eine Ansprache die Aufmerksamkeit auf den gewünschten Gesprächspartner. Dies vereinfacht die Kommunikation und verhindert verwirrtes Schweigen. Vor jeder Ansprache richten Sie am besten den Blick auf Ihr Publikum.
„Wir haben das Produkt für Sie optimiert“ klingt besser als „Das Produkt wurde für Sie optimiert“.
Tipp: Sprechen Sie Personen am Anfang Ihrer Ausführung an.
„Tim, wollen wir heute Abend ins Kino gehen?“ hört sich besser an als „Wollen wir heute Abend ins Kino gehen, Tim?“.
Behalten Sie sich die nachstehenden fünf Regeln im Hinterkopf. Folglich klappt es auch mit dem richtigen Ausdruck und der optimalen Syntax!
Halten Sie sich an S-P-O!
Verwenden Sie aktive Sprache!
Variieren Sie Ihre Satzeröffnung!
Verändern Sie die Länge Ihrer Sätze!
Wechseln Sie zwischen verschiedenen Satzstrukturen!
Zu Punkt 5 ein Hinweis: Zwei kurze Hauptsätze lassen sich mittels Bindeworts sehr gut verknüpfen. Wenn Sie Schachtelsätze durch Aufsplitten vermeiden, bereichern Sie Ihr Sprachbild mit Vielfalt. Dafür müssen die beiden Komponenten aber auch kurz und bündig ausfallen. Als Bindewörter dienen vorwiegend:
und
oder
Einige Bindewörter schenken Ihnen eine Verknüpfung eines vollständigen Satzes mit einem unvollständigen Nebensatz. In dem Fall werden sie mittels Kommas getrennt. Dafür stehen Ihnen folgende Wörter zur Verfügung:
aber
denn
jedoch
obwohl
während
weil
Beispiel:
„Ich bin in die Schule gegangen. Danach ging ich zum Sport. Danach ging ich nach Hause.“
Besser:
„Ich bin heute Morgen in die Schule gegangen. Danach ging ich zum Sport, bevor ich zu Hause ankam.“
Ebenso entscheidet der richtige Fall (Kasus) über einen guten Ausdruck. Welchen Fall Sie verwenden, verraten oft bereits die Wörter innerhalb des Satzes. Folgende Übersicht hilft Ihnen bestimmt weiter:
Satzglied
Fall
Beispiele
Präposition
Nominativ
Keine eindeutigen Präpositionen
Genitiv
anstatt, statt, anstelle, anlässlich, aufgrund, bezüglich, einschließlich, inmitten, infolge, längs, trotz, während, wegen, diesseits, jenseits, außer-, inner-, ober- und unterhalb, abzüglich, zuzüglich, angesichts, entlang, kraft, mangels, mittels, seitens, ungeachtet, unweit, zwecks, abseits, anhand, ausschließlich, beiderseits, exklusive, inklusive, hinsichtlich, vorbehaltlich, nördlich, östlich, südlich, westlich
Dativ
am, aus, bei, mit, von, seit, zu, außer, hinter,nach, ab, binnen, entgegen, entsprechend, gegenüber, gemäß, samt, mitsamt, nebst, zuliebe, zufolge, laut, nahe, zuwider
Akkusativ
bis, durch, für, gegen, um, ohne, ans, auf,betreffend, in, je, neben, über, unter, via, vor
Verben
Nominativ
sein, werden, heißen, bleiben
Genitiv
anklagen, annehmen, bedenken, bedienen, bedürfen, befleißigen, begeben, belehren, bemächtigen, berauben, beschuldigen, besinnen, bewusst sein, bezichtigen, brauchen, brüsten, entbehren, entheben, enthalten, entledigen, entsinnen, erbarmen, erfreuen, erinnern, erwehren, gedenken, rühmen, schämen, spotten, überführen, verdächtigen, vergewissern, versichern, verweisen, walten …
Dativ
helfen, gefallen, passen, danken, antworten, vertrauen, nützen, gratulieren, gehören, schmecken, passieren, zuhören, widersprechen, glauben, gelingen, absagen, begegnen, folgen, sich nähern, schreiben, sich anpassen, beibringen, mitteilen, wehtun, zustimmen, befehlen, zu etwas raten, fehlen, nachlaufen, vergeben, verzeihen, widersprechen, zusehen, ähneln, beistehen, beitreten, drohen, genügen, ausweichen, dienen, misslingen ...
Akkusativ
haben, lernen, brauchen, anrufen, essen, trinken, nehmen, suchen, kennen, machen, lieben, hassen, besuchen, besichtigen, bestellen, bekommen, mögen, putzen, kontrollieren, vorbereiten, waschen, öffnen, schließen, reparieren, sehen, fotografieren, tragen, unterbrechen, nennen, lassen, vergessen, genießen, beneiden, heiraten, suchen, überlegen, es gibt ...
Mehr Tipps zu einem besseren Text finden Sie im Kapitel zum Thema Stil.
Steigerung der Verständlichkeit und Klarheit in der Kommunikation
Textverständlichkeit beschreibt die Auffassung einer sprachlichen Äußerung durch den Rezipienten zu einem inhaltlichen Konstrukt. Daher dürfen als Erstes keine Fragen auftreten! In Kombination wird die Verständlichkeit durch folgende Kriterien gekennzeichnet:
Vokabular
Gliederung
Satzkomplexität
Inhalt
Typografie
Diese Eigenschaften widmen sich allein dem Text oder dem Gespräch selbst. Bei einer klaren Kommunikation steht jedoch auch der Rezipient im Fokus. Nun summieren sich zusätzlich einige Aspekte, um die Verständlichkeit bewerten zu können:
Eigene Sprachkompetenz
Relevantes Vorwissen
Individuelles Interesse
Aktuelle Konzentrationsfähigkeit
In Verbindung mit dem Stil des Kommunikators sowie möglichen Hintergrundgeräuschen auf dem Übertragungskanal entsteht das jeweilige Kommunikationsniveau. Dank des Hamburger Verständlichkeitskonzepts aus den 1970er-Jahren lassen sich die vier wesentlichen Dimensionen der Textverständlichkeit bis heute wie folgt deklarieren:
Einfachheit
Semantische Kürze
Kognitive Gliederung
Stimulierender Konflikt
Ideendichte sowie innere Kohärenz bestimmen zudem die Qualität des Textes. Des Weiteren beeinflussen einerseits das Thema sowie andererseits die Unterstützung der Struktur durch eine Gliederung genau diese Einschätzung. Eines ist leicht festzustellen: Die Textverständlichkeit muss als Interaktion zwischen Text und Leser betrachtet werden. Auf den individuellen Rezipienten, seine Sichtweise und den momentanen Augenblick lässt sich schwer eingreifen. Deshalb orientieren Sie sich am besten erst einmal an Ihrem jeweiligen Gegenüber – Ihrer favorisierten Zielgruppe. Beantworten Sie bei einem längeren Text erst einmal folgende Fragen, bevor Sie loslegen:
Welche Themen behandeln Sie?
In welcher Reihenfolge integrieren Sie diese Themen?
Wie soll der Wortumfang allgemein sowie pro Argument ausfallen?
Wenn Sie diese Tipps aus dem vorherigen Abschnitt Syntax bereits verinnerlicht haben, begeben Sie sich nun auf den nächsten Level. Ein lückenloser Start präsentiert sich als beste Basis für eine klare Kommunikation. Wie sieht die Prämisse zu Ihrem aktuellen Gesprächsstoff aus? Wann haben Sie wo und mit wem welche Situation erlebt – bevor es zu dem nun Geschilderten kam? Das verhilft zu einem deutlich besseren Texteinstieg. In Mails lohnt sich bereits die Bezugnahme zu einem gewissen Sujet: „Betreffend Ihrer Anfrage zu ...“ Im privaten Umfeld starten Sie mit einem Ort, an dem etwas geschah oder geschieht. Mit nur einer kleinen Einleitung vereinfachen Sie den Einstieg in private wie berufliche Kommunikationstexte. Auch im Bereich des Marketings werden als Erstes Szenarien aufgezeigt, für die es folglich „die eine Lösung“ gibt. Für den weiteren Verlauf des Textes beachten Sie folgende Regeln:
Finden Sie einen roten Faden.
Setzen Sie die wichtigen Fakten an den Anfang.
Zeigen Sie die Vorgeschichte auf.
Zeichnen Sie Zusammenhänge auf.
Benutzen Sie konkrete Wörter.
Führen Sie Beispiele an.
Vermeiden Sie Schachtelsätze.
Blähen Sie den Text nicht unnötig auf.
Visuelle Auflockerungen helfen bei der Lektüre längerer Texte oder fachlicher Artikel. Daher empfehlen sich die nachstehenden Tipps:
Verbessern Sie die optische Gliederung (Zwischenüberschriften, Listen, Tabellen etc.)
Absätze lockern auf
Fügen Sie Abbildungen ein
Nutzen Sie Info-Kästen als Erläuterung
Teilen Sie den Text in Portionen auf
Steht der Text, fängt die Überarbeitung an. Es haben sich sicherlich einige Hindernisse für ein reibungsloses Textverständnis eingeschlichen. Schauen Sie einmal in Ihrem Schriftstück nach und berücksichtigen Sie weitere Tipps:
Entscheiden Sie sich gegen Amtssprache
Gehen Sie Gleichklang aus dem Weg
Streichen Sie abstrakte Nomen (Wörter mit den Endungen -keit, -heit, -ät)
Ersetzen Sie Substantivierungen (Wörter mit den Endungen -ung, -ion, -ive)
Integrieren Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Verzichten Sie auf Einschübe
Klammern mitten im Satz behindern den Lesefluss / das Verständnis
Ersetzen Sie Fremdwörter/Anglizismen – die relevanten bleiben und werden erklärt
Setzen Sie kein Expertenwissen voraus
Erklären Sie Abkürzungen
Ganz wichtig: Beachten Sie Satzzeichen, Rechtschreibung und Grammatik!
In der Kommunikationswissenschaft hat sich eine Obergrenze von 9 bis 12 Wörtern pro Satz als optimale Menge herausgestellt. In Fachartikeln wird diese Zahl entsprechend dem Vorwissen auf das Doppelte erhöht. Ihr Text wird verständlicher, wenn Sie am Ende Ihrer Ausführung das Relevante wiederholen und zusammenfassen.
Für die akustische Kommunikation spielen zusätzliche Faktoren eine Rolle. Die folgenden Kriterien üben Sie am besten mit einer Aufnahme oder vor Publikum:
Lautstärke
Tonhöhe
Sprechtempo
Aussprache
Hintergrundgeräusche
Tipp: Es gibt einen Tipp schlechthin für die Beurteilung der Verständlichkeit Ihrer eigenen Texte – lesen Sie das Niedergeschriebene einfach laut vor! Sie merken sofort, ob Ihr Satzbau funktioniert oder nicht. Wenn Sie holpern, dann ändern Sie den Text.
Wortschatzerweiterung
Können Sie sich gut ausdrücken? Was soll Ihr Gesprächspartner darauf antworten? Meist folgt dann: „Mir fehlen manchmal die Worte!“ Diese Erkenntnis sagt mehr, als die Frage implizierte. Denn tatsächlich eignen Sie sich mit einem größeren Wortschatz auch automatisch eine bessere Ausdrucksweise an. Mehr Wörter in Ihrem Sprachalltag führen zu einer zielgerichteten Kommunikation. Ein Gespräch wird dadurch nachhaltiger und genießt mehr Aufmerksamkeit – auch im Nachhinein an das Gespräch selbst.
Sammeln Sie daher Fremdwörter für einen größeren Wortschatz
Verwenden Sie bewusst Synonyme für einen besseren Stil
Erweitern Sie im Berufsumfeld Ihren Fachjargon
Eine schlechte Sprache oder nur eine falsche Wortwahl pflanzt oft ein Unwohlsein bei Kunden und Gesprächspartnern ein. Oft fehlt ihnen die bewusste Benennung, aber das unangenehme Gefühl siegt. Bevor wir uns Ihrer individuellen Wortschatzerweiterung widmen, folgt erst einmal ein Blick auf die Theorie der Wortschöpfung. Diese erfolgt auf vier verschiedenen Wegen:
Wortbildung: Zwei bekannte Wörter werden zusammengefügt. Eine zweite Option offenbart sich Ihnen im Zusammenfügen von Affixen (Vor- oder Nachsilben) und Konfixen (gebräuchliche Wortkürzungen wie bio für biologisch). Alternativ wird ein Nomen einfach zu einem Verb.
Hausdach (aus Haus und Dach)
Ökonom (aus öko- und -nom)
fischen (vom Substantiv Fisch)
Entlehnung: Hierbei werden aus einer Quellsprache einzelne Wörter oder gesamte Phrasen in eine Zielsprache übernommen. Auch hier werden Affixe sowie Konfixe angewendet.
Camouflage (Französisch)
Crash (Englisch)
Tohuwabohu (Hebräisch)
prä-therm
Bedeutungsveränderung: Diese Wortschatzerweiterung findet ebenso wie die Wortbildung nur innerhalb einer Sprache statt. Eine bekannte Bedeutung wird rein inhaltlich zu einer anderen übersetzt.
Ich stehe auf (lokale Beschreibung → jemanden gut finden – Bedeutungserweiterung)
fortbewegen (gehen → mit etwas Speziellem fahren – Bedeutungsverengung)
Fuchs (Tier → schlauer Mensch – Metonymisierung, inhaltsbezogenes Ersatzwort)
Rücken (Anatomie → Buchrücken – Metonymisierung)
verrückt (psychisch gestört → toll – Bedeutungsaufwertung)
Dirne (Mädchen → Prostituierte – Bedeutungsverschlechterung)
Urschöpfung: Wenn Sie aus Lauten ein Wort erschaffen, dann waren Sie in der Urschöpfung erfolgreich. Diese Schöpfung verwenden Sie generell als Lautäußerung, weniger als Geräuschbeschreibung.
Pfui!
Eieiei!
Igitt!