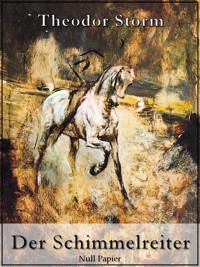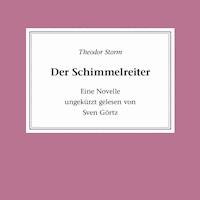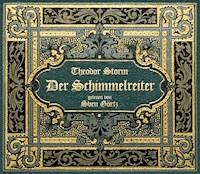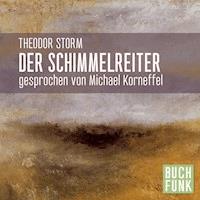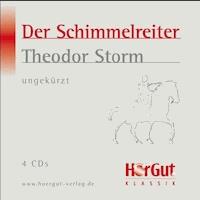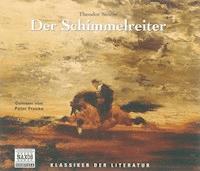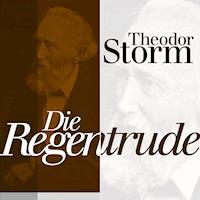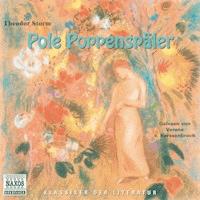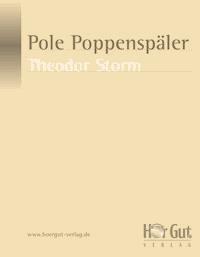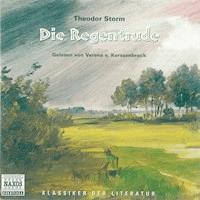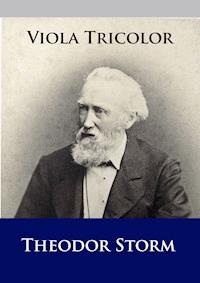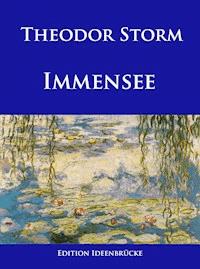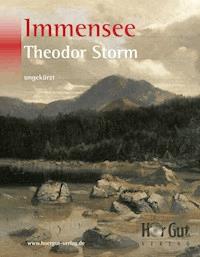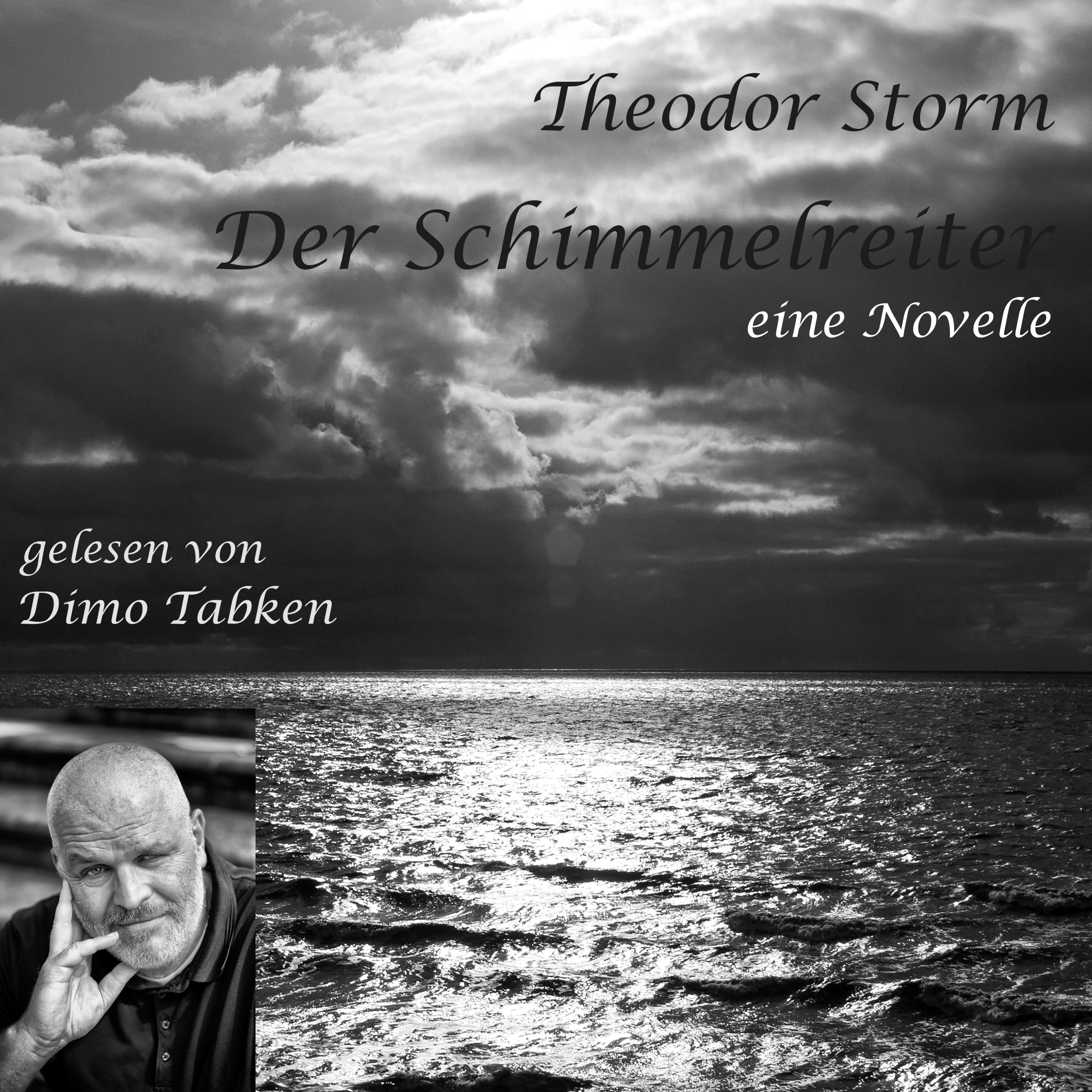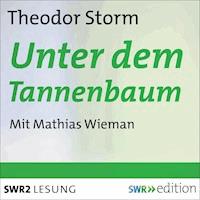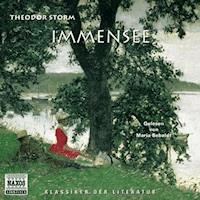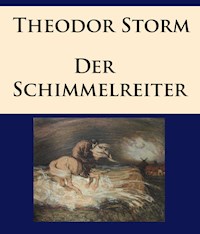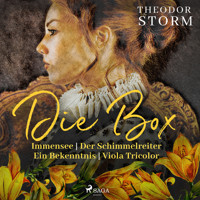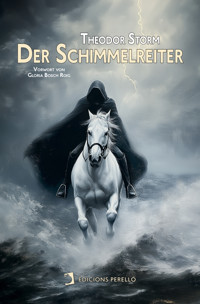
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Edicions PerellóHörbuch-Herausgeber: BÄNG Management & Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Universell
- Sprache: Deutsch
Storms postum veröffentlichter Text aus dem Jahr 1888 zählt zu den reichhaltigsten und vielschichtigsten Beispielen des poetischen Realismus im deutschsprachigen Raum und reiht sich ein in die Tradition der tragischen Novellen des 19. Jahrhunderts. Der Schimmelreiter verdichtet die Beziehung zwischen rationalem Denken und Mythos, zwischen Naturgesetz und gesellschaftlicher Ordnung. Die symbolischen Elemente – allen voran das gespenstische weiße Pferd – widersprechen dem realistischen Erzählton nicht, sondern fügen sich organisch in die Textur der Erzählung ein und erweitern die Realität um eine existenzielle, beinahe archetypische Dimension, die als charakteristisch für den poetischen Realismus gilt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Sammlung würdigt die wichtigsten Werke der Weltliteratur, jeweils in ihrer Originalsprache.
Die Serie „Deutsche Briefe“ enthält Titel wie: Die Verwandlung von Franz Kafka; Gebrüder Grimms beste Märchen von Jacob und Wilhelm Grimm; Die unsichtbare Sammlung von Stefan Zweig; Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe; Das kalte Herz von Wilhelm Hauff unter anderen...
Theodor Storm
DER SCHIMMELREITER
© Ed. Perelló, SL, 2025
© Vorwort von Gloria Bosch Roig
© Deckblatt-Design: José Cazorla García
Calle Milagrosa Nº 26, Valencia
46009 - Spanien
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 978-84-10227-73-6
Das Fotokopieren oder freie Online-Stellen dieses Buches ohne Genehmigung des Herausgebers ist strafbar.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung, Verbreitung, Eine öffentliche Kommunikation oder Transformation dieser Arbeit kann nur erfolgen mit der Erlaubnis ihrer Inhaber, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kontaktieren Sie CEDRO (Spanisches Zentrum für Reprografische Rechte, www.cedro.org) wenn Sie einen Ausschnitt dieser Arbeit fotokopieren oder scannen müssen.
Vorwort
Der Schimmelreiter ist ein postum erschienener Text aus dem Jahr 1888, der nicht nur als literarisches Vermächtnis Theodor Storms gilt, sondern zugleich eines der reichhaltigsten und vielschichtigsten Beispiele des poetischen Realismus im deutschsprachigen Raum des späten 19. Jahrhunderts darstellt. Diese Strömung strebte eine Abbildung der Wirklichkeit an, die sich durch Objektivität, stilistische Nüchternheit und präzise Detailfülle auszeichnete – stets mit einem feinen Gespür für die sozialen, psychologischen und ethischen Spannungsfelder, in denen sich das Individuum bewegt.
Um die Bedeutung des Werkes besser zu erfassen, lohnt sich ein vertiefender Blick auf Storms Biografie, die eng mit den geistigen Bewegungen und gesellschaftlichen Spannungen seiner Zeit verwoben ist.
Theodor Storm (1817–1888) wurde in Husum, einer kleinen Hafenstadt an der nordfriesischen Küste, geboren, ein Ort, der ihn sein Leben lang prägte und in seiner Ideenwelt zur „grauen Stadt am Meer“ wurde, wie er sie in einem seiner bekanntesten Gedichte nannte. In dieser vom rauen Klima, vom Rhythmus der Gezeiten und vom Leben mit der Natur bestimmten Region entwickelte Storm früh eine besondere Sensibilität für die Vergänglichkeit, die Stille und die verborgene Tiefe des Alltäglichen.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Kiel und Berlin war Storm zunächst als Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt tätig. Aufgrund der politischen Umbrüche während der Schleswig-Holsteinischen Erhebung (1848–1851) und seiner Sympathien für die deutsche Nationalbewegung wurde ihm jedoch von den dänischen Behörden die Ausübung seines Berufs untersagt. Diese erzwungene berufliche Neuorientierung führte ihn nach Potsdam, wo er über ein Jahrzehnt als preußischer Beamter wirkte. Erst 1864, nach der Angliederung Schleswig-Holsteins an Preußen, kehrte er nach Husum zurück und übernahm erneut eine juristische Stellung.
Seine berufliche Laufbahn verlief parallel zu seinem literarischen Schaffen, das in dieser Phase eine besondere Reife erlangte. Storm war kein politischer Autor im engen Sinne, doch ein feinsinniger Chronist der seelischen Regungen, der gesellschaftlichen Konventionen und der leisen Tragik des menschlichen Daseins.
Seine Werke – über vierzig Novellen sowie Gedichte und Briefe – sind geprägt von einer melancholischen Grundstimmung, einer tiefen Auseinandersetzung mit Zeit, Natur, Heimat und Erinnerung. Was Storms Werk besonders auszeichnet, ist sein verankerter Regionalismus, der jedoch nie ins Provinzielle abgleitet. Vielmehr dient ihm die nordfriesische Landschaft als Schauplatz universeller Themen: der Konflikt zwischen Tradition und Fortschritt, das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, die unaufhebbare Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Sein dichterischer Blick ist nach innen gerichtet, doch das, was er beschreibt, öffnet sich stets über das Lokale hinaus – ein Fenster zum Allgemeinen, zum Existenziellen. In diesem Spannungsfeld zwischen enger Heimatverbundenheit und weitreichender Reflexion ist Storms Werk verortet.
Der Schimmelreiter erscheint vor diesem biografisch-geistigen Hintergrund als verdichteter Ausdruck von Storms literarischem Weltbild, das in der Novelle seine vollkommenste Gestalt findet.
Theodor Storm greift in seiner reflektierten Auseinandersetzung mit traditionellen Sagenstoffen auf überraschend moderne Weise die Frage nach der literarischen Gattungszugehörigkeit seiner Werke auf und knüpft dabei an Goethes berühmte Definition der Novelle als „unerhörte, sich ereignete Begebenheit“ an, der zufolge dieses Genre eine klare Verbindung zur Wirklichkeit aufweisen muss.
Storm spielt jedoch bewusst mit der Grenze zwischen Mythos und Wirklichkeit und stellt damit die Gattungsgrenzen infrage. Dürfen wir noch von einer Novelle sprechen, wenn ihr Fundament eine Sage ist – auch wenn diese etwas Irreales oder Fantastisches erzählt? Storm antwortet mit einem klaren Ja, denn selbst das Fantastische kann eine Verbindung zur Wirklichkeit aufweisen – und eben darin liegt das Wesentliche dieses Genres.
Ein zentrales Element, das die Novelle eindeutig im Kontext des Realismus definiert, ist ihre Themenwahl. Im Mittelpunkt steht das alltägliche Leben einer ländlichen Gemeinschaft, das jedoch mit einer Tiefe und Vielschichtigkeit geschildert wird, die weit über eine bloße Milieustudie hinausgeht. Dabei gelingt es Storm, durch minutiöse Landschaftsbeschreibungen und die eindrucksvolle Darstellung des bäuerlichen Daseins im nordfriesischen Raum ein erzählerisches Gefüge von hoher atmosphärischer Dichte und sinnlicher Unmittelbarkeit zu schaffen.
Zugleich ist die Verankerung in der friesischen Küstenregion – mit ihren Deichen, Kögen, Stürmen und archaischen Bräuchen – nicht bloß schmückendes Beiwerk. Vielmehr entfaltet diese Umgebung einen symbolischen Resonanzraum, in dem Natur und Kultur, Ordnung und Chaos, Fortschritt und Beharren miteinander ringen.
Die Einflechtung technischer Termini aus dem Deichbau verleiht der Erzählung dokumentarische Glaubwürdigkeit, während die Integration volkstümlicher Redewendungen und regionalsprachlicher Elemente – insbesondere in den Dialogen der Dorfbewohner – einen realitätsnahen Mikrokosmos entstehen lässt. In diesem spiegeln sich exemplarisch die Spannungen zwischen Individuum und Gemeinschaft, zwischen Wandel und Tradition.
Hinzu tritt ein weiteres literarisches Merkmal der Novelle: die komplexe Erzählstruktur. Es handelt sich um eine Rahmenerzählung, innerhalb derer eine zweite, tiefere Erzählebene eingeflochten ist.
Die Novelle beginnt mit einem Ich-Erzähler, der die Geschichte einleitet und den erzählerischen Rahmen absteckt. Dieser erinnert sich daran, die Sage vom Schimmelreiter einst in einer Zeitschrift gelesen zu haben. Der zweite Erzähler ist ein Reisender, der auf die Legende stößt und sie uns durch die Stimme eines dritten Erzählers – eines alten Dorflehrers – vermittelt. Diese Struktur verleiht dem Text nicht nur zusätzliche Tiefe, sondern fungiert auch als stilistisches Mittel zur Herstellung von Distanz und kritischer Reflexion. In ihr tritt ein zentrales Motiv des poetischen Realismus besonders deutlich hervor: die gleichzeitige Präsenz von Vergangenheit und Gegenwart, von mythischem Erzählen und rationaler Analyse.
Die legendären und symbolischen Elemente – allen voran das gespenstische weiße Pferd – widersprechen dem realistischen Erzählton nicht, sondern fügen sich organisch in die Textur der Erzählung ein. Sie erweitern die Realität um eine existenzielle, beinahe archetypische Dimension, wie sie für den poetischen Realismus charakteristisch ist.
Angesichts dieses Hintergrunds erscheint auch der Protagonist Hauke Haien in einem besonderen Licht. Er ist weit mehr als ein einfacher Held der Moderne: Er verkörpert die Ambivalenz des realistischen Menschenbildes – geprägt von Vernunft und Fortschrittsglauben, zugleich aber verletzlich, isoliert und den Kräften seiner Umwelt ausgesetzt. Seine psychologische Tiefe und innere Zerrissenheit spiegeln das zentrale Interesse des poetischen Realismus wider, den Menschen in seiner Widersprüchlichkeit, seiner Würde und seinem Scheitern zu zeigen – ohne Pathos, aber mit großer literarischer Empathie.
Diese existenzielle Kluft wird auch durch die bereits erwähnte Erzählinstanz gestützt: Ein anonymer Erzähler führt in die Geschichte ein, nachdem er die Erzählung eines betagten Dorflehrers vernommen hat, der sie seinerseits einem alten Manuskript entnommen hat. Diese vielschichtige Rahmendramaturgie, die in ihrer Struktur an romantische Erzählverfahren erinnert, erzeugt eine produktive Ungewissheit über die Faktizität des Dargestellten. Storm spielt hier bewusst mit den Grenzen zwischen Realität, Überlieferung und Legende.
Im narrativen Zentrum steht dabei stets Hauke Haien, der Sohn eines Landvermessers – ein junger Mann mit außergewöhnlicher Geisteskraft, getrieben von einem rationalen Weltbild und einem tiefen Vertrauen in den Fortschritt. Sein sozialer Aufstieg zum Deichgrafen macht ihn zur Grenzfigur zwischen Wissenschaft und Tradition. In Hauke kulminiert das Ideal des aufgeklärten Selbstdenkers. Doch sein Umfeld ist durchdrungen von alten Riten, kollektiven Ängsten und einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Neuen. Die daraus resultierende Ambivalenz zwischen dem visionären Einzelnen und der konservativen Gemeinschaft bildet den tragenden Konflikt der Novelle.
Storm erhebt den Deich zur zentralen Metapher des Menschlichen. Er ist nicht nur Bollwerk gegen das Meer, sondern Sinnbild eines andauernden Ringens: Der Mensch versucht, dem Chaos der Welt – Natur, Zufall, Unheil – mit Ordnung und Verstand zu begegnen. Haukes Vision eines neuen, stabileren Deiches steht somit für mehr als technischen Fortschritt. Sie markiert einen Zivilisationsanspruch, der letztlich das kulturelle Gleichgewicht infrage stellt. Auch das rätselhafte weiße Pferd, das Hauke begleitet, wird in der Vorstellung der Dorfbewohner zum Spiegel dämonischer Mächte. Der Held erscheint zunehmend als Figur zwischen Licht und Schatten, zwischen Aufklärung und Unheil.
Im finalen Orkan, der über das Land hinwegzieht, kristallisiert sich die Tragödie. Es ist nicht allein die Gewalt der Natur, die zerstört, sondern die unausweichliche Konfrontation zwischen Fortschritt und Mythos, zwischen Vernunft und Aberglaube, zwischen der Einsamkeit des Einzelnen und der Trägheit der Gemeinschaft. Storm verweigert sich dabei jeder eindeutigen Deutung, und am Ende steht der Leser vor der moralischen Ambivalenz einer Figur, in der sich Triumph und Tragik zugleich verdichten.
Der Schimmelreiter reiht sich in die große Tradition der tragischen Novellen des 19. Jahrhunderts ein. Zugleich aber offenbart die Erzählung eine moderne Sensibilität, die zentrale Fragen des gegenwärtigen Denkens antizipiert: die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur, die Grenzen des Wissens, das Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft sowie die Frage nach der Konstruktion von Wahrheit durch Sprache und Erzählung. In einem Stil, der durch nüchterne Klarheit und poetische Tiefe gleichermaßen besticht, gelingt Storm schließlich etwas, das nur große Erzähler erreichen: eine scheinbar lokale, konkrete Geschichte zu erzählen, die ein zeitloses Bild der menschlichen Existenz widerspiegelt.
Gloria Bosch Roig
Der Schimmelreiter
Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kund geworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte; ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den „Leipziger“ oder von „Pappes Hamburger Lesefrüchten“. Noch fühle ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über Achtzigjährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben; vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht, und ich kann daher um so weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen als, wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen; nur so viel kann ich versichern, daß ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlaß in mir aufs neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe.
Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag—so begann der damalige Erzähler—als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh geleerte Marsch, zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee; zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können; aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten; dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ; denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt; meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten, und ich verdachte es nicht den Krähen und Möwen, die sich fortwährend krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufe meines Pferdes erkennen; keine Menschenseele war mir begegnet, ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften, und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter in sicheres Quartier.
Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag, und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger; ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen selbstgezogenen Perinette- und Grand-Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davongeritten. „Wart nur, bis du ans Meer kommst,“ hatte er noch an seiner Haustür mir nachgerufen; „du kehrst noch wieder um; dein Zimmer wird dir vorbehalten!“
Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf. „Sei kein Narr! Kehr’ um und setz’ dich zu deinen Freunden ins warme Nest.“ Dann aber fiel’s mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel; und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend.
Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran; ich hörte nichts; aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich eine dunkle Gestalt zu erkennen, und bald, da sie näher kam, sah ich es, sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen hageren Schimmel; ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an.
Wer war das? Was wollte der?—Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen; und Roß und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren.
In Gedanken darüber ritt ich weiter; aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken, schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei; mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war, wie das erstemal, lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir; dann war’s, als säh’ ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen.
Etwas zögernd ritt ich hinterdrein. Als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Kooge unten das Wasser einer großen Wehle blinken—so nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden, und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben.
Das Wasser war, trotz des schützenden Deiches, auffallend unbewegt; der Reiter konnte es nicht getrübt haben; ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte: vor mir, von unten aus dem Kooge, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf; sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen; dicht vor mir aber auf halber Höhe des Binnendeiches lag ein großes Haus derselben Art; an der Südseite, rechts von der Haustür, sah ich alle Fenster erleuchtet; dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, daß es ein Wirtshaus war; denn vor den Fenstern gewahrte ich die sogenannten „Ricks“, das heißt auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen eisernen Ringen, zum Anbinden des Viehes und der Pferde, die hier haltmachten.
Ich band das meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam. „Ist hier Versammlung?“ frug ich ihn, da mir jetzt deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubentür entgegendrang.
„Is wull so wat,“ entgegnete der Knecht auf Plattdeutsch—und ich erfuhr nachher, daß dieses neben dem Friesischen hier schon seit über hundert Jahren im Schwange gewesen sei—„Diekgraf und Gevollmächtigten un wecke von de annern Interessenten! Dat is um’t hoge Water!“
Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tische sitzen, der unter den Fenstern entlanglief; eine Punschbowle stand darauf, und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen.
Ich grüßte und bat, mich zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwilligst gestattet wurde. „Sie halten hier die Wacht!“ sagte ich, mich zu jenem Manne wendend; „es ist bös Wetter draußen; die Deiche werden ihre Not haben!“
„Gewiß,“ erwiderte er; „wir hier an der Ostseite aber glauben jetzt außer Gefahr zu sein; nur drüben an der andern Seite ist’s nicht sicher; die Deiche sind dort meist noch mehr nach altem Muster; unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt.—Uns ist vorhin da draußen kalt geworden, und Ihnen,“ setzte er hinzu, „wird es ebenso gegangen sein; aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten; wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten.“ Und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirte machen konnte, war schon ein dampfendes Glas mir hingeschoben.
Ich erfuhr bald, daß mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei; wir waren ins Gespräch gekommen, und ich hatte begonnen, ihm meine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde aufmerksam, und ich bemerkte plötzlich, daß alles Gespräch umher verstummt war. „Der Schimmelreiter!“ rief einer aus der Gesellschaft, und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die übrigen.
Der Deichgraf war aufgestanden. „Ihr braucht nicht zu erschrecken,“ sprach er über den Tisch hin; „das ist nicht bloß für uns; Anno 17 hat es auch denen drüben gegolten; mögen sie auf alles vorgefaßt sein!“
Mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen. „Verzeiht!“ sprach ich, „was ist das mit dem Schimmelreiter?“
Abseits hinter dem Ofen, ein wenig gebückt, saß ein kleiner hagerer Mann in einem abgeschabten schwarzen Röcklein; die eine Schulter schien ein wenig ausgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der andern teilgenommen; aber seine bei dem spärlichen grauen Haupthaar noch immer mit dunklen Wimpern besäumten Augen zeigten deutlich, daß er nicht zum Schlaf hier sitze.
Gegen diesen streckte der Deichgraf seine Hand. „Unser Schulmeister,“ sagte er mit erhobener Stimme, „wird von uns hier Ihnen das am besten erzählen können; freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig, wie zu Haus meine alte Wirtschafterin Antje Vollmers es beschaffen würde.“
„Ihr scherzet, Deichgraf!“ kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, „daß Ihr mir Euren dummen Drachen wollt zur Seite stellen!“
„Ja, ja, Schulmeister!“ erwiderte der andere, „aber bei den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Verwahrung sein!“
„Freilich!“ sagte der kleine Herr; „wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung“; und ein überlegenes Lächeln glitt über das feine Gesicht.
„Sie sehen wohl,“ raunte der Deichgraf mir ins Ohr; „er ist immer noch ein wenig hochmütig; er hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur einer verfehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimat als Schulmeister behangen geblieben.“
Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. „Erzählt, erzählt nur, Schulmeister,“ riefen ein paar der Jüngeren aus der Gesellschaft.
„Nun freilich,“ sagte der Alte, sich zu mir wendend, „will ich gern zu Willen sein; aber es ist viel Aberglaube dazwischen und eine Kunst, es ohne diesen zu erzählen.“
„Ich muß Euch bitten, den nicht auszulassen,“ erwiderte ich; „traut mir nur zu, daß ich schon selbst die Spreu vom Weizen sondern werde!“
Der Alte sah mich mit verständnisvollem Lächeln an. „Nun also!“ sagte er. „In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr, um genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen; aber es reichte doch wohl kaum; denn was die studierten Fachleute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen; sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Ihr höret wohl schon, Herr, die Friesen rechnen gut, und habet auch wohl schon über unseren Hans Mommsen von Fahretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Bussolen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachherigen Deichgrafen gewesen; freilich wohl nur ein kleines. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh graste, ging unterweilen im Herbst und Frühjahr auch aufs Landmessen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und an seinen Läden rüttelte, zu ritzen und zu prickeln, in seiner Stube. Der Junge saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete, und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends frug er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wußte, schüttelte den Kopf und sprach: „Das kann ich dir nicht sagen; genug, es ist so, und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserm Boden steht, ein Buch, einer, der Euklid hieß, hat’s geschrieben; das wird’s dir sagen!“
——Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden; denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause; aber der Vater lachte, als er es vor ihn auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid, und Holländisch, wenngleich es doch halb Deutsch war, verstanden alle beide nicht. „Ja, ja,“ sagte er, „das Buch ist noch von meinem Vater, der verstand es; ist denn kein deutscher da?“
Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur: „Darf ich’s behalten? Ein deutscher ist nicht da.“
Und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. „Auch das?“ frug er wieder.
„Nimm sie alle beide!“ sagte Tede Haien; „sie werden dir nicht viel nützen.“
Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik, und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, daß er den Euklid, welcher damals stark im Schwange war, fast überall verstand.
„Es ist mir nicht unbekannt, Herr,“ unterbrach sich der Erzähler, „daß dieser Umstand auch von Hans Mommsen erzählt wird; aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauke Haien—so hieß der Knabe—berichtet worden. Ihr wisset auch wohl, es braucht nur einmal ein Größerer zu kommen, so wird ihm alles aufgeladen, was in Ernst oder Schimpf seine Vorgänger einst mögen verübt haben.
Als der Alte sah, daß der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, daß die kleine Stelle wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen könne, ingleichen, daß er auch selber nicht auf einen grünen Zweig gekommen sei, so schickte er seinen großen Jungen an den Deich, wo er mit andern Arbeitern von Ostern bis Martini Erde karren mußte. „Das wird ihn vom Euklid kurieren,“ sprach er bei sich selber.
Und der Junge karrte; aber den Euklid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf seinem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manch ein Mal die Arbeit eingestellt werden mußte, dann ging er nicht mit den andern nach Hause, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinaufschlugen; erst wenn ihm die Füße überspült waren, und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die seinen blitzend; er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete; was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches auswusch.