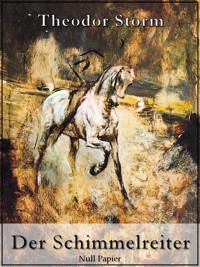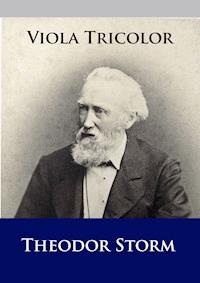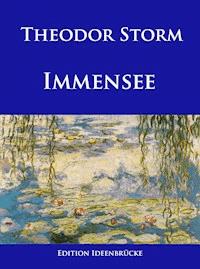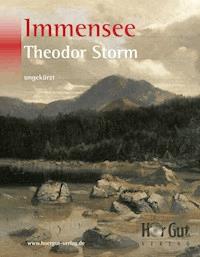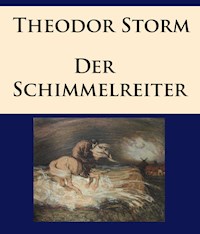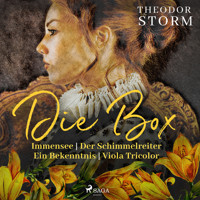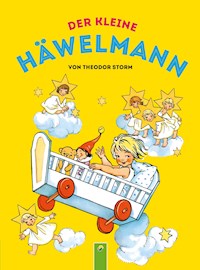Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Theodor Storms Novellensammlung 'Der Schimmelreiter und andere Novellen' ist ein Meisterwerk der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Der Band, der insgesamt 103 Titel umfasst, zeichnet sich durch seinen prägnanten und zugleich poetischen Schreibstil aus, der das Leben und die Landschaft Norddeutschlands mit großer Intensität einfängt. Storms Geschichten sind geprägt von einer düsteren Atmosphäre und psychologischer Tiefe, die den Leser in den Bann ziehen und zum Nachdenken anregen. Die Novellen behandeln Themen wie Schuld, Verlust und die Macht der Natur, wobei der Autor subtil gesellschaftskritische Elemente einfließen lässt. In seinem Werk vereint Theodor Storm Romantik und Realismus zu einer einzigartigen Erzählkunst, die bis heute fasziniert und beeindruckt. Storms 'Der Schimmelreiter und andere Novellen' ist ein bedeutendes literarisches Werk, das in der deutschen Literaturgeschichte einen festen Platz einnimmt. Der Autor, Theodor Storm, war ein bedeutender Vertreter des deutschen Realismus und zählt zu den wichtigsten Erzählern des 19. Jahrhunderts. Als Jurist und Schriftsteller konnte er sein profundes Verständnis für menschliche Abgründe und das Wesen der Natur in seinen Werken kraftvoll zum Ausdruck bringen. Geboren in Schleswig-Holstein, war Storm eng mit der Landschaft Norddeutschlands verbunden, die er in seinen Novellen eindrucksvoll beschreibt. Seine literarische Meisterschaft und psychologische Feinfühligkeit machen ihn zu einem der herausragenden Autoren seiner Zeit. 'Der Schimmelreiter und andere Novellen' von Theodor Storm ist ein lesenswertes Buch für alle Liebhaber deutscher Literatur, die sich von eleganten Erzählungen und tiefgründigen Themen begeistern lassen möchten. Stürzen Sie sich in die fesselnde Welt des Realismus und erleben Sie die zeitlose Schönheit und Tiefe von Theodor Storms Meisterwerken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 3652
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Schimmelreiter und andere Novellen
(103 Titel in einem Band)
Books
Inhaltsverzeichnis
Märchen und Spukgeschichten:
Geschichten aus der Tonne
Einer der wackersten Spielkameraden in meinen Knabenjahren war Claas Räuber. Er war der Sohn eines armen Schuhflickers und schon seit mehreren Jahren ein Stadtwaisenkind; den Beinamen Räuber aber hatten seine Genossen ihm gegeben, weil er in dem Spiel »Räuber und Soldat«, das wir an hellen Sommerabenden zu exerzieren pflegten, eine besondere Geschicklichkeit besaß und daher auch stets nur als Räuber ausgehoben wurde. Trotz seines abschreckenden Titels aber war Claas Räuber der ehrlichste und spaßhafteste Bursche von der Welt und besaß außerdem noch ein anderes, von seinen Genossen sehr geschätztes Talent.
An den kurzen Herbstabenden nämlich, wo uns für die ausgelassenen Spiele nach der Schulzeit gar bald das Licht ausging, pflegten wir uns auf den breiten Steinen einer Haustreppe zusammenzufinden, und nun hieß es: »Stücken vertellen.« Hier war nun Claas Räuber wieder der beste und beliebteste Kamerad, denn sein Reichtum an allen möglichen Arten von Döntjes und Schnurren war unerschöpflich. Je heimlicher aber und verborgner wir unseren Märchensaal aufgeschlagen hatten, desto schöner hörten sich die Geschichten an, desto lebendiger traten all die wunderlichen und süßen Gestalten, die verwünschten Prinzen und Prinzessinnen, Schneewittchen und die Frau Holle vor unsere Phantasie; ja ich erinnere mich, daß wir einmal bei einer solchen Gelegenheit ganz deutlich den Niß Puk aus einer Dachöffnung in meines Vaters Scheune herausgucken sahen und infolgedessen einen zwar vergeblichen Feldzug durch die sämtlichen Böden gegen den Kobold unternahmen. Mich vorzüglich trieb jene Vorliebe für heimliche Erzählungsplätzchen zur Entdeckung immer neuer Schlupfwinkel. So hatte ich unter andern eine große leere Tonne dazu ausersehen, welche in einem Packhause unweit meines Vaters Schreibstube stand. In dieser Tonne hab ich die schönsten Geschichten meines Lebens gehört. Sie war das Allerheiligste, das nur von mir und Claas bezogen wurde. Hier kauerten wir abends, wenn ich aus den Privatstunden kam, zusammen, nahmen meine kleine Laterne, die wir zuvor mit einigen Lichtendchen versehen hatten, auf den Schoß und schoben, nachdem wir hineingeklettert waren, ein großes, auf der Tonne liegendes Brett von innen wieder über die Öffnung derselben, so daß wir wie in einem kleinen Stübchen zusammen saßen. Wenn nun die Leute abends nach meines Vaters Schreibstube gingen und ein dumpfes Gemurmel aus der alten Tonne aufsteigen hörten und einzelne verlorene Lichtstrahlen daraus hervorschimmern sahen, so konnte der alte Schreiber nicht genug die wunderliche Ursache davon berichten.
Hätten die lieben Leute bei uns in der Tonne gesessen, so hätten sie wohl selbst Gefallen an unseren Abendunterhaltungen gefunden, wozu ich den Leser nach zwanzig Jahren nachträglich aufs beste eingeladen haben will.
»Nun, Claas«, sagte ich, nachdem ich unser Häuschen gehörig verschlossen hatte, »was hast du denn heute abend?«
»Es ist ein ganz altes Stück«, sagte Claas, »das meiner Großmutter schon von ihrer Urgroßmutter erzählt ist, und die hat gesagt, es sei ein Stück aus der Mauskiste.«
»Nun«, sagte ich, »so erzähle; die Stücke aus der Mauskiste sind mir immer die liebsten gewesen.« Und Claas erzählte:
Das Märchen von den drei Spinnfrauen
Es war einmal ein Dienstmädchen, die war ebenso schön, als sie ehrbar und fleißig war; auch war sie im Nähen und Stricken und anderer häuslichen Arbeit wohl erfahren, nur spinnen konnte sie nicht. Sie hatte aber einen Freier, der war reich und jung und war gewaltig aufs Spinnrad versessen. Als nun die Hochzeit heranrückte, so kam er eines Sonntags zu ihr und ließ sich zehn Pfund Flachs nachtragen. Er umarmte sie und sprach: »Kannst du diesen Flachs zum feinen Faden verspinnen, dein goldenes Haar würde mir noch einmal so lieb sein. Hast du's fertig zum Sonnabend, so soll die Hochzeit sein.« Dann ging er fort; sie aber wußte sich keinen Rat, wer ihr die große Menge Flachs in so kurzer Zeit verspinnen sollte, und ging hinaus auf den Weg und weinte. Wie sie so eine Strecke gegangen war, kam sie an eine Hütte; als sie die Tür aufgemacht hatte, sah sie drinnen eine Frau am Spinnrad sitzen, die hatte Lippen, die waren so – lang. Das Mädchen erschrak gar heftig vor dieser Gestalt; denn die Alte brummte böse vor sich weg, was sie bei ihr zu suchen habe. Bald aber faßte sie sich einen Mut und sprach: »Ach! liebe Frau, ich sehe, daß Ihr gar tätig und kunstvoll seid; wolltet Ihr mir diesen Flachs nicht verspinnen bis zum Sonnabend der Woche? Ich will Euch gerne das Pfund mit einer baren Mark bezahlen.« Die Alte besah den Flachs und sagte, das sei unmöglich, soviel Flachs in einer Woche. Da fiel das Mädchen vor ihr auf die Knie und erzählte ihr alles und daß sie sonst keinen Mann bekommen würde. Als die Alte das hörte, schlug sie in sich und sagte: »Steh nur auf, Töchterchen, der Flachs soll versponnen werden; aber da muß ich deinen Ehrentag doch mitmachen.« Das Mädchen ward so froh, daß sie alles versprach, und ging dann ihren Weg wieder nach Haus.
Am Sonnabend hatte sie das schönste Garn im Hause, und als am Sonntage der Bräutigam kam, da freuete er sich über den Faden, der fast so fein war und so golden war als das Haar seiner Braut; aber er ward durch das saubre Gespinste nur immer begieriger und konnte sein Herz nicht zufriedengeben. Daher küßte er seine Braut und sprach: »Noch diese sechzehn Pfund zum nächsten Sonnabend, dann soll die Hochzeit sein.« Damit ging er fort; die Braut aber ging in Traurigkeit den alten Weg hinaus und ging die erste Hütte vorbei und kam zu einer zweiten. Sie stieß die Tür auf und trat hinein; da saß drinnen eine alte Frau am Spinnrad, die hatte eine Nase, die war wohl eine Elle lang. Marie aber hatte sie mit der Tür an ihre große schöne Nase gestoßen; darüber schrie und schalt die Frau und war ganz braunrot im Gesicht, und die Nase schwoll ihr wie eine Blutwurst. Das Mädchen aber faßte sich einen Mut und erzählte ihr alles, wie es war, und daß sie keinen Mann bekäme, wenn das Garn nicht gesponnen wäre zum Sonnabend der Woche, und bot ihr zwanzig Schilling Spinnerlohn das Pfund. Die Frau besah den Flachs und sagte, es sei unmöglich; aber wenn sie mit auf ihrer Hochzeit tanzen dürfe, so wolle sie es versuchen. Da ward das Mädchen froh und ging heim, und am Sonnabend hatte sie das schönste Garn im Hause, noch ebener, als das erste war. Als aber der Bräutigam am Sonntag zu ihr kam und das saubre Gespinste betrachtete, da wollte er sich noch nicht zufriedengeben, sondern brachte aufs neue zwanzig Pfund und sagte: »Noch dieses bis zum Sonnabend, dann soll gewiß die Hochzeit sein.« Als er fortgegangen war, blieb das Mädchen in großer Traurigkeit zurück; denn es schien ihr unmöglich, das Verlangte ins Werk zu setzen. Es war aber schon Abend, und die Sterne schienen klar auf die Erde, und als sie so in trüben Gedanken den alten Weg wieder einschlug, da fiel ein Stern vom Himmel, der blieb in ihrer Schürze liegen auf dem Flachs; da dachte sie dran, daß ihre Mutter ihr immer gesagt habe, das bedeute Glück, und als sie etwas weiter gegangen war, da fand sie beim Sternenschein eine Kleevier und steckte sie ans Mieder; und als sie noch etwas weiter gegangen war, da gesellte sich ein schneeweißes Lamm zu ihr, dem ging sie nach, und so kamen beide an eine Hütte; da saß drinnen eine alte freundliche Frau am Spinnrad, die war so breit, daß sie auf drei Stühlen nicht Platz hatte. Die Frau aber fragte das Mädchen, was sie herführe. »Es muß Gottes Schickung sein«, antwortete sie und erzählte ihr alles; und die Frau versprach ihr, das Garn zu spinnen, unter der Bedingung, daß sie mit zur Hochzeit käme. Das Mädchen aber ging frohen Herzens nach Hause, und als nun der Sonntag kam, da zeigte sie dem Bräutigam das Gespinste, das schöner war als alles andre. Da vermochte er der Schönheit des Mädchens nicht länger zu widerstehn und sagte: »Morgen soll die Hochzeit sein«; die Braut aber gedachte mit Angst ihres Versprechens. »Ich habe drei alte Bekannte«, sagte sie, »erlaubt mir, daß ich sie mit zur Hochzeit lade.« Der Bräutigam aber sagte es ihr willig zu, sie möchte laden, was sie an Freunden und Sippschaft hätte.
Als nun der Tag vorüber war, so war die Hochzeit; da ging's lustig her, und waren viel feine und saubre Leute zu Gast, denn der Bräutigam war wohl angesehen. Als nun die Gäste beinahe versammelt waren, so hielten noch drei Kutschen vor der Tür; da kam aus der ersten die mit den breiten Lippen, aus der zweiten die mit der langen Nase, und aus der dritten – – – nein, die dritte kam nicht heraus, denn die Kutschentür war zu eng, die mußte mit Stricken herausgezogen werden. Die drei gingen nun in den Hochzeitssaal und pflanzten sich unter den andern Frauen der Reihe nach auf. Die Gäste erstaunten sehr, und der Bräutigam fragte die Braut: »Wie kamst du zu der garstigen Freundschaft?« Dann ging er zu der ersten und fragte: »Liebe Frau, habt Ihr allzeit solche breite Lippen gehabt?« – »Ei, mein Söhnchen«, antwortete sie, »wie sollte man nicht breite Lippen haben, wenn man so lange am Spinnrad sitzt und den Faden leckt.« Darauf ging er zu der andern und fragte: »Liebe Frau, habt Ihr allzeit eine so entsetzlich lange Nase gehabt?« – »Ei, mein Söhnchen«, antwortete die, »da muß einem die Nase wohl ausschießen, wenn man so lange Jahre sitzt und nickt und tritt das Rad und stößt mit der Nase den Flachs auseinander.« Endlich ging er auch zur dritten und fragte: »Liebe Frau, seid Ihr allzeit so gewaltig breit gewesen?« – »Ei, mein Söhnchen«, antwortete sie, »da muß man wohl breit werden, wenn man so lange Jahre am Spinnrad sitzen muß.« Da befiel den Bräutigam auf einmal eine Angst, daß seine Braut wegen des vielen Spinnens auch schon zu solchen Mißgestaltungen ansetzen möchte. Daher nahm er sie schnell in seinen Arm und besah sie von allen Seiten, aber er fand sie noch schlank und schön, daß es eine Freude war. Das Spinnrad aber ließ er heimlich zerschlagen, und war von der Zeit an vom Flachsspinnen nicht mehr die Rede, sondern als die Hochzeit vorüber war, lebten sie ohne Spinnrad in Glück und Freuden, denn wenn er unwirsch war, war sie freundlich. –
»Das Stück gefällt mir«, sagte ich, »vorzüglich, weil es am Ende doch noch so herauskommt, daß die alten häßlichen Spinnfrauen drei wohltätige Feen sind; aber unrecht war es doch von der Marie, daß sie ihrem Bräutigam solche Flausen vormachte.«
»Oh!« versetzte Claas, »meine Mutter pflegte immer zu sagen, das müsse eine schlechte Frau sein, die ihrem Manne nicht einmal was vormachen könnte, denn die Männer wären gar zu oft unvernünftig.«
»Das gefällt mir nicht«, erwiderte ich, »meine Frau soll mir nichts vormachen, auch wenn ich unvernünftig bin.«
»Nun«, sagte Claas, »du hast auch noch lange keine, sei jetzt nur still, da fällt mir gleich noch ein anderes Stück ein.«
»Wie heißt denn das?« fragte ich. Claas aber dehnte sich, daß die Tonne knackte, und erzählte dann das Stück:
Se dohn sick wat to gude
»Nu will wi uns wat to gude dohn«, sagte Frau Marthe; da ging ihr Mann, der Schustermeister, aus der Haustür, und die Frau »Naversch« watschelte hinein. ›Aha‹, dachte der Meister, der es gehört hatte, ›nu geit 't över Koffee und Zucker her.‹ Als er aber nach einer halben Stunde wieder nach Hause kam, da ging »Fru Naversch« eben wieder aus der Stube, und die Kaffeetassen standen unberührt auf dem Brett über der Tür. Da konnte der Mann gar nicht begreifen, was doch die Weiber sich zugute täten. Es dauerte aber nicht lange, so ging er wieder aus dem Hause und sagte, daß er so bald nicht wiederkommen würde. Kaum ist er um die nächste Ecke, so hört er noch seine Frau rufen: »Kumm Se 'n bät um, Naversch, nu will wi uns recht wat to gude dohn«; und wie er so über die Straßensteine schreitet, so kann er's immer nicht loswerden, und er muß immer denken: ›Wat willt se sick denn to gude dohn?‹ Kaum kommt er wieder nach Hause, so geht »Naversch« aus der Tür, und die Tassen stehen ruhig auf ihrem Platz, ist auch sonst nichts gerührt. Da nimmt der Mann seine Marthe vor und fragt: »Na, laat mi doch oock mal wäten, wat jüm jüm denn to gude doht!« Die Frau aber sagt, daß sei nur so eine Redensart, und was sie sich wohl zugute tun sollten; sie täte sich nichts zugute als mit Arbeit und Plagen den ganzen Tag; genug, der Mann bekommt's nicht heraus. Da dacht er's mit List anzufangen – denn es ließ ihm nun einmal keine Ruhe mehr – und sagte eines Nachmittags, er wolle aufs Land gehen. Damit geht er um die nächste Ecke und hört sein Weib an »Fru Naversch« Fensterscheiben klopfen und wie gewöhnlich sagen: »Kumm Se 'rum, Naversch, min Ohl' is uut; wi willt uns en bät to gude dohn.« Der Mann aber geht hinten wieder ins Haus hinein und steigt leise die Bodentreppe hinauf; als er oben ist, bohrt er ebenso leise ein Loch in den Boden und sieht nun deutlich in die Stube hinab. Da sitzen Frau Marthe und Frau Naversch gegeneinander über, die Arme ineinandergeschlagen auf dem Tisch und die Feuerkieken unter den Füßen. ›Na‹, denkt der Mann, ›dohn se sick all wat to gude?‹ Aber auf dem Tisch liegt nichts als der wollne Strickstrumpf der Frau Marthe. Und wie die Weiber sich so einander gegenübersitzen, so fangen ihre Augen ordentlich an zu brennen und zu funkeln, so als wenn die Katz einen Kanarienvogel oder eine feine Nachtigall zerreißen will.
›Na‹, denkt der Mann, ›nu geit 't los‹, und erwartet jeden Augenblick, daß die Magd das heimliche Gericht auf den Tisch tragen solle. Es kam aber keins, und doch ging's nun in der Tat los, und die Zungen hatten heiße Arbeit. Das war ein ganz anderes Gericht, das blieb nicht bei einem gebratenen Täubchen oder Hühnchen; die ganze Stadt verschlangen die beiden Weiber; Väter, Mütter, Bräute, Kinder, alle mußten herhalten, kaum die Wiegenkinder blieben verschont, und war bald von allen kein Haar mehr übrig. Dabei schmatzten sie mit den Lippen, und die Zungen gingen ihnen wie zwei Messerspitzen, und ihre Augen wurden immer brennender und gieriger, daß es genau den Anschein bekam, als wenn sie sich zum Beschluß noch selber verschlingen wollten, damit doch alles verputzt sei und es morgen schön Wetter werde. ›Tööf still‹, denkt der Meister, steigt leise die Bodentreppe herunter und platzt mit einem Male in die Stube hinein. Da wurden die Weiber auf der Stelle ruhig, Frau Marthe nahm hastig den Strickstrumpf in die Hand; Fru Naversch wickelte die Schürze um die Arme und wollte zur Tür hinaus. »Tööf still«, sagte der Mann und verschloß die Tür, »nu paß mal op, nu will ick mi mal wat to gude dohn.« Somit nahm er den Knieriemen von seinem Schustertisch, kriegte seine Frau Marthe beim Kranshaken und fing an, sie etwas durchzugerben, wobei er in einem fort ausrief: »Dat is för Hans und dat is för Greth, und dat is för Greth und dat för Hans«, und dabei ging es immer: »Hast du mich gesehen!« – »Sieh so,« sagte er endlich und warf den Knieriemen wieder auf den Tisch, »up so 'n Maaltied, as du von Dag holen hest, schall so 'n Motschion di wull gut dohn.« Dann schloß er die Tür auf, und Fru Naversch schlich wie 'ne Katze aus der Stube. »Nu nehm Se sick in acht«, rief der Meister hinterdrein, »dat ick mi nich ock 'n mal bi Är to Gaste laad.«
Seit der Zeit haben Frau Naversch und Frau Marthe sich niemals etwas wieder zugute getan; denn Frau Marthe hatte allen Appetit auf ihre Nebenmenschen verloren; und – Schnipp, schnapp, schnuut, min Stück is uut! –
»Das ist ein sonderbares Stück, Claas«, sagte ich und putzte mit meinem Taschenmesser unser Lichtendchen; »das hast du wohl selbst gemacht.«
»Nein«, versetzte Claas, »das hat mein Vater immer meiner Mutter erzählt, wenn sie den Mund nicht darüber halten konnte, daß die Frau Muhme so breite Knüppels auf der Dormeuse trage.«
»Aber hat denn dein Vater seine Frau auch mitunter mit dem Knieriemen gegerbt?« fragte ich.
»So alle Festtage einmal«, erwiderte Claas, »er sagte dann immer, das sei nach dem jütschen Lov. – Aber nun sollst du auch etwas erzählen; denn mir wird der Mund trocken, und es ist hier auch gewaltig heiß in der Tonne.«
»Ich kann besser hören, lieber Claas«, sagte ich, »erzähle nur noch ein einziges kleines Stück; dein Vater hat dir ja soviel Schönes erzählt. Ich will das Brett etwas von der Tonne schieben. – Siehst du, nun ist's wieder ganz kühl und luftig!«
Und Claas ließ sich noch einmal bewegen und erzählte:
»Dree to beed«
Es wohnte einmal in einem Dorfe eine alte Frau, die hatte viel Geld und Gut. Nun hätte wohl mancher langfingrige Bursche sich gern sein Teil davon genommen; aber die Frau stand in dem Ruf, als könne ihr nichts verborgen bleiben. Trotzdem fanden sich jedoch drei Bursche, die nicht für voll dran glaubten und sich berieten, wie sie abends der Alten ein gut Stück Geld abholen möchten. Nun aber pflegte die Frau, wenn sie abends beim Spinnen das erstemal gähnte, zu sagen: »Dat wer een to Bedd«, wenn sie zum zweitenmal gähnte: »Dat weren twee«, und wenn sie beim drittenmal gesagt hatte: »Dat weren dree!«, so setzte sie hinzu: »Nu kaam ick!« und ging zu Bette.
Als nun Abend geworden war, so kam der erste von den drei Dieben und guckte ins Fenster, da saß die Alte noch bei ihrer Lampe und spann. »Oha!« sagte sie und gähnte, »dat wer een!« Der Bursche aber glaubte, die kluge Frau habe ihn gemeint und wisse um ihr ganzes Vorhaben. Da machte er lange Beine und lief zu den andern zurück und erzählte ihnen, wie es ihm ergangen. Darauf kam der zweite dran; der guckte auch ins Fenster, da gähnte die Frau zum zweitenmal und rief: »Oha, dat weren twee!« Da glaubte auch er, die Frau meine ihn damit, weil er der zweite war, und lief zurück wie der erste. – »Jüm sind man all dumme Jungens«, rief der dritte und machte sich ebenfalls auf den Weg. Als er aber ans Fenster kam, da gähnte die Alte zum drittenmal und rief: »Oha, dat weren dree!« Dann stieß sie das Spinnrad von sich, stand auf und setzte hinzu: »Nu kaam ick!« Da lief der dritte auch weg; die Frau aber ging ruhig in ihr Bett.
»Denn«, pflegte mein Vater zu sagen, »wer ein bös Gewissen hat, den kann ein altes Weib mit der Nachtmütze durchs Schlüsselloch jagen.«
Als Claas diese Geschichte auserzählt hatte, hörten wir die Turmuhr neun schlagen, und von der Hoftür aus rief die Magd zum Abendessen. Da nun auch unsre Lichtendchen allmählich eins nach dem andern verbrannt waren, so hatten für diesen Abend die Geschichten in der Tonne ein Ende.
Der Schimmelreiter
Novelle (1888)
Was ich zu berichten beabsichtige, ist mir vor reichlich einem halben Jahrhundert im Hause meiner Urgroßmutter, der alten Frau Senator Feddersen, kundgeworden, während ich, an ihrem Lehnstuhl sitzend, mich mit dem Lesen eines in blaue Pappe eingebundenen Zeitschriftenheftes beschäftigte; ich vermag mich nicht mehr zu entsinnen, ob von den »Leipziger« oder von »Pappes Hamburger Lesefrüchten«. Noch fühl ich es gleich einem Schauer, wie dabei die linde Hand der über Achtzigjährigen mitunter liebkosend über das Haupthaar ihres Urenkels hinglitt. Sie selbst und jene Zeit sind längst begraben; vergebens auch habe ich seitdem jenen Blättern nachgeforscht, und ich kann daher um so weniger weder die Wahrheit der Tatsachen verbürgen, als, wenn jemand sie bestreiten wollte, dafür aufstehen; nur so viel kann ich versichern, daß ich sie seit jener Zeit, obgleich sie durch keinen äußeren Anlaß in mir aufs neue belebt wurden, niemals aus dem Gedächtnis verloren habe.
Es war im dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, an einem Oktobernachmittag – so begann der damalige Erzähler –, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlangritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh geleerte Marsch, zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee; zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können; aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich wie mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten; dahinter wüste Dämmerung, die Himmel und Erde nicht unterscheiden ließ; denn auch der halbe Mond, der jetzt in der Höhe stand, war meist von treibendem Wolkendunkel überzogen. Es war eiskalt; meine verklommenen Hände konnten kaum den Zügel halten, und ich verdachte es nicht den Krähen und Möwen, die sich fortwährend krächzend und gackernd vom Sturm ins Land hineintreiben ließen. Die Nachtdämmerung hatte begonnen, und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufen meines Pferdes erkennen; keine Menschenseele war mir begegnet, ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel, wenn sie mich oder meine treue Stute fast mit den langen Flügeln streiften, und das Toben von Wind und Wasser. Ich leugne nicht, ich wünschte mich mitunter in sicheres Quartier.
Das Wetter dauerte jetzt in den dritten Tag, und ich hatte mich schon über Gebühr von einem mir besonders lieben Verwandten auf seinem Hofe halten lassen, den er in einer der nördlicheren Harden besaß. Heute aber ging es nicht länger; ich hatte Geschäfte in der Stadt, die auch jetzt wohl noch ein paar Stunden weit nach Süden vor mir lag, und trotz aller Überredungskünste des Vetters und seiner lieben Frau, trotz der schönen selbstgezogenen Perinette-und Grand-Richard-Äpfel, die noch zu probieren waren, am Nachmittag war ich davongeritten. »Wart nur, bis du ans Meer kommst«, hatte er noch an seiner Haustür mir nachgerufen; »du kehrst noch wieder um; dein Zimmer wird dir vorbehalten!«
Und wirklich, einen Augenblick, als eine schwarze Wolkenschicht es pechfinster um mich machte und gleichzeitig die heulenden Böen mich samt meiner Stute vom Deich herabzudrängen suchten, fuhr es mir wohl durch den Kopf. ›Sei kein Narr! Kehr um und setz dich zu deinen Freunden ins warme Nest.‹ Dann aber fiel’s mir ein, der Weg zurück war wohl noch länger als der nach meinem Reiseziel; und so trabte ich weiter, den Kragen meines Mantels um die Ohren ziehend.
Jetzt aber kam auf dem Deiche etwas gegen mich heran; ich hörte nichts; aber immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich eine dunkle Gestalt zu erkennen, und bald, da sie näher kam, sah ich es, sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen hageren Schimmel; ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern, und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem bleichen Antlitz an.
Wer war das? Was wollte der? – Und jetzt fiel mir bei, ich hatte keinen Hufschlag, kein Keuchen des Pferdes vernommen; und Roß und Reiter waren doch hart an mir vorbeigefahren!
In Gedanken darüber ritt ich weiter, aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken, schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei; mir war, als streifte mich der fliegende Mantel, und die Erscheinung war, wie das erste Mal, lautlos an mir vorübergestoben. Dann sah ich sie fern und ferner vor mir; dann war’s, als säh ich plötzlich ihren Schatten an der Binnenseite des Deiches hinuntergehen.
Etwas zögernd ritt ich hintendrein. Als ich jene Stelle erreicht hatte, sah ich hart am Deich im Kooge unten das Wasser einer großen Wehle blinken – so nennen sie dort die Brüche, welche von den Sturmfluten in das Land gerissen werden und die dann meist als kleine, aber tiefgründige Teiche stehen bleiben.
Das Wasser war, trotz des schützenden Deiches, auffallend bewegt; der Reiter konnte es nicht getrübt haben; ich sah nichts weiter von ihm. Aber ein anderes sah ich, das ich mit Freuden jetzt begrüßte: vor mir, von unten aus dem Kooge, schimmerten eine Menge zerstreuter Lichtscheine zu mir herauf, sie schienen aus jenen langgestreckten friesischen Häusern zu kommen, die vereinzelt auf mehr oder minder hohen Werften lagen, dicht vor mir aber auf halber Höhe des Binnendeiches lag ein großes Haus derselben Art; an der Südseite, rechts von der Haustür, sah ich alle Fenster erleuchtet; dahinter gewahrte ich Menschen und glaubte trotz des Sturmes sie zu hören. Mein Pferd war schon von selbst auf den Weg am Deich hinabgeschritten, der mich vor die Tür des Hauses führte. Ich sah wohl, daß es ein Wirtshaus war; denn vor den Fenstern gewahrte ich die sogenannten »Ricks«, das heißt auf zwei Ständern ruhende Balken mit großen eisernen Ringen, zum Anbinden des Viehes und der Pferde, die hier haltmachten.
Ich band das meine an einen derselben und überwies es dann dem Knechte, der mir beim Eintritt in den Flur entgegenkam: »Ist hier Versammlung?« frug ich ihn, da mir jetzt deutlich ein Geräusch von Menschenstimmen und Gläserklirren aus der Stubentür entgegendrang.
»Is wull so wat«, entgegnete der Knecht auf plattdeutsch – und ich erfuhr nachher, daß dieses neben dem Friesischen hier schon seit über hundert Jahren im Schwange gewesen sei –, »Diekgraf und Gevollmächtigten un wecke von de annern Interessenten! Dat is um ‘t hoge Water!«
Als ich eintrat, sah ich etwa ein Dutzend Männer an einem Tische sitzen, der unter den Fenstern entlanglief, eine Punschbowle stand darauf, und ein besonders stattlicher Mann schien die Herrschaft über sie zu führen.
Ich grüßte und bat, mich zu ihnen setzen zu dürfen, was bereitwillig gestattet wurde. »Sie halten hier die Wacht!« sagte ich, mich zu jenem Mann wendend, »es ist bös Wetter draußen; die Deiche werden ihre Not haben!«
»Gewiß«, erwiderte er; »wir, hier an der Ostseite, aber glauben, jetzt außer Gefahr zu sein; nur drüben an der andern Seite ist’s nicht sicher, die Deiche sind dort meist noch mehr nach altem Muster; unser Hauptdeich ist schon im vorigen Jahrhundert umgelegt. – Uns ist vorhin da draußen kalt geworden, und Ihnen«, setzte er hinzu, »wird es ebenso gegangen sein; aber wir müssen hier noch ein paar Stunden aushalten; wir haben sichere Leute draußen, die uns Bericht erstatten.« Und ehe ich meine Bestellung bei dem Wirte machen konnte, war schon ein dampfendes Glas mir hingeschoben.
Ich erfuhr bald, daß mein freundlicher Nachbar der Deichgraf sei; wir waren ins Gespräch gekommen, und ich hatte begonnen, ihm meine seltsame Begegnung auf dem Deiche zu erzählen. Er wurde aufmerksam, und ich bemerkte plötzlich, daß alles Gespräch umher verstummt war. »Der Schimmelreiter!« rief einer aus der Gesellschaft, und eine Bewegung des Erschreckens ging durch die übrigen.
Der Deichgraf war aufgestanden. »Ihr braucht nicht zu erschrecken«, sprach er über den Tisch hin; »das ist nicht bloß für uns; Anno 17 hat es auch denen drüben gegolten; mögen sie auf alles vorgefaßt sein!«
Mich wollte nachträglich ein Grauen überlaufen. »Verzeiht!« sprach ich, »was ist das mit dem Schimmelreiter?«
Abseits hinter dem Ofen, ein wenig gebückt, saß ein kleiner hagerer Mann in einem abgeschabten schwarzen Röcklein; die eine Schulter schien ein wenig ausgewachsen. Er hatte mit keinem Worte an der Unterhaltung der andern teilgenommen, aber seine bei dem spärlichen grauen Haupthaar noch immer mit dunklen Wimpern besäumten Augen zeigten deutlich, daß er nicht zum Schlaf hier sitze.
Gegen diesen streckte der Deichgraf seine Hand. »Unser Schulmeister«, sagte er mit erhobener Stimme, »wird von uns hier Ihnen das am besten erzählen können; freilich nur in seiner Weise und nicht so richtig, wie zu Haus meine alte Wirtschafterin Antje Vollmers es beschaffen würde.«
»Ihr scherzet, Deichgraf!« kam die etwas kränkliche Stimme des Schulmeisters hinter dem Ofen hervor, »daß Ihr mir Euern dummen Drachen wollt zur Seite stellen!«
»Ja, ja, Schulmeister!« erwiderte der andere, »aber bei den Drachen sollen derlei Geschichten am besten in Verwahrung sein!«
»Freilich!« sagte der kleine Herr; »wir sind hierin nicht ganz derselben Meinung«; und ein überlegenes Lächeln glitt über das feine Gesicht.
»Sie sehen wohl«, raunte der Deichgraf mir ins Ohr; »er ist immer noch ein wenig hochmütig; er hat in seiner Jugend einmal Theologie studiert und ist nur einer verfehlten Brautschaft wegen hier in seiner Heimat als Schulmeister behangen geblieben.«
Dieser war inzwischen aus seiner Ofenecke hervorgekommen und hatte sich neben mir an den langen Tisch gesetzt. »Erzählt, erzählt nur, Schulmeister«, riefen ein paar der jüngeren aus der Gesellschaft.
»Nun freilich«, sagte der Alte, sich zu mir wendend, »will ich gern zu Willen sein; aber es ist viel Aberglaube dazwischen und eine Kunst, es ohne diesen zu erzählen.«
»Ich muß Euch bitten, den nicht auszulassen«, erwiderte ich; »traut mir nur zu, daß ich schon selbst die Spreu vom Weizen sondern werde!«
Der Alte sah mich mit verständnisvollem Lächeln an. »Nun also!« sagte er. »In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, oder vielmehr, um genauer zu bestimmen, vor und nach derselben, gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich-und Sielsachen mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen; aber es reichte doch wohl kaum, denn was die studierten Fachleute darüber niedergeschrieben, davon hatte er wenig gelesen; sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Ihr hörtet wohl schon, Herr, die Friesen rechnen gut, und habet auch wohl schon über unsern Hans Mommsen von Fahretoft reden hören, der ein Bauer war und doch Bussolen und Seeuhren, Teleskopen und Orgeln machen konnte. Nun, ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachherigen Deichgrafen gewesen; freilich wohl nur ein kleines. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen baute, auch eine Kuh graste, ging unterweilen im Herbst und Frühjahr auch aufs Landmessen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen kam und an seinen Läden rüttelte, zu ritzen und zu prickeln, in seiner Stube. Der Junge saß meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete, und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends frug er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wußte, schüttelte den Kopf und sprach: »Das kann ich dir nicht sagen; genug, es ist so, und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserm Boden steht, ein Buch, einer, der Euklid hieß, hat’s geschrieben; das wird’s dir sagen!«
– – Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden; denn viele Bücher gab es überhaupt nicht in dem Hause; aber der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid, und Holländisch, wenngleich es doch halb Deutsch war, verstanden alle beide nicht. »Ja, ja«, sagte er, »das Buch ist noch von meinem Vater, der verstand es; ist denn kein deutscher da?«
Der Junge, der von wenig Worten war, sah den Vater ruhig an und sagte nur: »Darf ich’s behalten? Ein deutscher ist nicht da.«
Und als der Alte nickte, wies er noch ein zweites, halb zerrissenes Büchlein vor. »Auch das?« frug er wieder.
»Nimm sie alle beide!« sagte Tede Haien; »sie werden dir nicht viel nützen.«
Aber das zweite Buch war eine kleine holländische Grammatik, und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte es, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, daß er den Euklid, welcher damals stark im Schwange war, fast überall verstand.
Es ist mir nicht unbekannt, Herr«, unterbrach sich der Erzähler, »daß dieser Umstand auch von Hans Mommsen erzählt wird; aber vor dessen Geburt ist hier bei uns schon die Sache von Hauke Haien – so hieß der Knabe – berichtet worden. Ihr wisset auch wohl, es braucht nur einmal ein Größerer zu kommen, so wird ihm alles aufgeladen, was in Ernst oder Schimpf seine Vorgänger einst mögen verübt haben.
Als der Alte sah, daß der Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, und weiterhin bedachte, daß die kleine Stelle wohl mit einem Bauer und einem Jungen, aber nicht mit einem Halbgelehrten und einem Knecht bestehen könne, angleichen, daß er auch selber nicht auf einen grünen Zweig gekommen sei, so schickte er seinen großen Jungen an den Deich, wo er mit andern Arbeitern von Ostern bis Martini Erde karren mußte. ›Das wird ihn vom Euklid kurieren‹, sprach er bei sich selber.
Und der Junge karrte; aber den Euklid hatte er allzeit in der Tasche, und wenn die Arbeiter ihr Frühstück oder Vesper aßen, saß er auf seinem umgestülpten Schubkarren mit dem Buche in der Hand. Und wenn im Herbst die Fluten höher stiegen und manch ein Mal die Arbeit eingestellt werden mußte, dann ging er nicht mit den andern nach Haus, sondern blieb, die Hände über die Knie gefaltet, an der abfallenden Seeseite des Deiches sitzen und sah stundenlang zu, wie die trüben Nordseewellen immer höher an die Grasnarbe des Deiches hinaufschlugen; erst wenn ihm die Füße überspült waren und der Schaum ihm ins Gesicht spritzte, rückte er ein paar Fuß höher und blieb dann wieder sitzen. Er hörte weder das Klatschen des Wassers noch das Geschrei der Möwen und Strandvögel, die um oder über ihm flogen und ihn fast mit ihren Flügeln streiften, mit den schwarzen Augen in die seinen blitzend; er sah auch nicht, wie vor ihm über die weite, wilde Wasserwüste sich die Nacht ausbreitete; was er allein hier sah, war der brandende Saum des Wassers, der, als die Flut stand, mit hartem Schlage immer wieder dieselbe Stelle traf und vor seinen Augen die Grasnarbe des steilen Deiches auswusch.
Nach langem Hinstarren nickte er wohl langsam mit dem Kopfe oder zeichnete, ohne aufzusehen, mit der Hand eine weiche Linie in die Luft, als ob er dem Deiche damit einen sanfteren Abfall geben wollte. Wurde es so dunkel, daß alle Erdendinge vor seinen Augen verschwanden und nur die Flut ihm in die Ohren donnerte, dann stand er auf und trabte halb durchnäßt nach Hause.
Als er so eines Abends zu seinem Vater in die Stube trat, der an seinen Meßgeräten putzte, fuhr dieser auf: »Was treibst du draußen? Du hättest ja versaufen können, die Wasser beißen heute in den Deich.«
Hauke sah ihn trotzig an.
– »Hörst du mich nicht? Ich sag, du hättst versaufen können.«
»Ja«, sagte Hauke; »ich bin doch nicht versoffen!«
»Nein«, erwiderte nach einer Weile der Alte und sah ihm wie abwesend ins Gesicht – »diesmal noch nicht.«
»Aber«, sagte Hauke wieder, »unsere Deiche sind nichts wert!«
– »Was für was, Junge?«
»Die Deiche, sag ich!«
– »Was sind die Deiche?«
»Sie taugen nichts, Vater!« erwiderte Hauke.
Der Alte lachte ihm ins Gesicht. »Was denn, Junge? Du bist wohl das Wunderkind aus Lübeck!«
Aber der Junge ließ sich nicht irren. »Die Wasserseite ist zu steil«, sagte er; »wenn es einmal kommt, wie es mehr als einmal schon gekommen ist, so können wir hier auch hinterm Deich ersaufen!«
Der Alte holte seinen Kautabak aus der Tasche, drehte einen Schrot ab und schob ihn hinter die Zähne. »Und wieviel Karren hast du heut geschoben?« frug er ärgerlich; denn er sah wohl, daß auch die Deicharbeit bei dem Jungen die Denkarbeit nicht hatte vertreiben können.
»Weiß nicht, Vater«, sagte dieser, »so, was die andern machten; vielleicht ein halbes Dutzend mehr; aber – die Deiche müssen anders werden!«
»Nun«, meinte der Alte und stieß ein Lachen aus; »du kannst es ja vielleicht zum Deichgraf bringen; dann mach sie anders!«
»Ja, Vater!« erwiderte der Junge.
Der Alte sah ihn an und schluckte ein paarmal; dann ging er aus der Tür; er wußte nicht, was er dem Jungen antworten sollte.
Auch als zu Ende Oktobers die Deicharbeit vorbei war, blieb der Gang nordwärts nach dem Haff hinaus für Hauke Haien die beste Unterhaltung; den Allerheiligentag, um den herum die Äquinoktialstürme zu tosen pflegen, von dem wir sagen, daß Friesland ihn wohl beklagen mag, erwartete er wie heut die Kinder das Christfest. Stand eine Springflut bevor, so konnte man sicher sein, er lag trotz Sturm und Wetter weit draußen am Deiche mutterseelenallein; und wenn die Möwen gackerten, wenn die Wasser gegen den Deich tobten und beim Zurückrollen ganze Fetzen von der Grasdecke mit ins Meer hinabrissen, dann hätte man Haukes zorniges Lachen hören können. »Ihr könnt nichts Rechtes«, schrie er in den Lärm hinaus, »so wie die Menschen auch nichts können!« Und endlich, oft im Finstern, trabte er aus der weiten Öde den Deich entlang nach Hause, bis seine aufgeschossene Gestalt die niedrige Tür unter seines Vaters Rohrdach erreicht hatte und darunter durch in das kleine Zimmer schlüpfte.
Manchmal hatte er eine Faust voll Kleierde mitgebracht; dann setzte er sich neben den Alten, der ihn jetzt gewähren ließ, und knetete bei dem Schein der dünnen Unschlittkerze allerlei Deichmodelle, legte sie in ein flaches Gefäß mit Wasser und suchte darin die Ausspülung der Wellen nachzumachen, oder er nahm seine Schiefertafel und zeichnete darauf das Profil der Deiche nach der Seeseite, wie es nach seiner Meinung sein mußte.
Mit denen zu verkehren, die mit ihm auf der Schulbank gesessen hatten, fiel ihm nicht ein, auch schien es, als ob ihnen an dem Träumer nichts gelegen sei. Als es wieder Winter geworden und der Frost hereingebrochen war, wanderte er noch weiter, wohin er früher nie gekommen, auf den Deich hinaus, bis die unabsehbare eisbedeckte Fläche der Watten vor ihm lag.
Im Februar bei dauerndem Frostwetter wurden angetriebene Leichen aufgefunden; draußen am offenen Haff auf den gefrorenen Watten hatten sie gelegen. Ein junges Weib, die dabeigewesen war, als man sie in das Dorf geholt hatte, stand redselig vor dem alten Haien. »Glaubt nicht, daß sie wie Menschen aussahen«, rief sie; »nein, wie die Seeteufel! So große Köpfe«, und hielt die ausgespreizten Hände von weitem gegeneinander, »gnidderschwarz und blank, wie frischgebacken Brot! Und die Krabben hatten sie angeknabbert; und die Kinder schrien laut, als sie sie sahen!«
Dem alten Haien war so was just nichts Neues. »Sie haben wohl seit November schon in See getrieben!« sagte er gleichmütig.
Hauke stand schweigend daneben; aber sobald er konnte, schlich er sich auf den Deich hinaus; es war nicht zu sagen, wollte er noch nach weiteren Toten suchen, oder zog ihn nur das Grauen, das noch auf den jetzt verlassenen Stellen brüten mußte. Er lief weiter und weiter, bis er einsam in der Öde stand, wo nur die Winde über den Deich wehten, wo nichts war als die klagenden Stimmen der großen Vögel, die rasch vorüberschossen; zu seiner Linken die leere weite Marsch, zur andern Seite der unabsehbare Strand mit seiner jetzt vom Eise schimmernden Fläche der Watten; es war, als liege die ganze Welt in weißem Tod.
Hauke blieb oben auf dem Deiche stehen, und seine scharfen Augen schweiften weit umher; aber von Toten war nichts mehr zu sehen; nur wo die unsichtbaren Wattströme sich darunter drängten, hob und senkte die Eisfläche sich in stromartigen Linien.
Er lief nach Hause; aber an einem der nächsten Abende war er wiederum da draußen. Auf jenen Stellen war jetzt das Eis gespalten; wie Rauchwolken stieg es aus den Rissen, und über das ganze Watt spann sich ein Netz von Dampf und Nebel, das sich seltsam mit der Dämmerung des Abends mischte. Hauke sah mit starren Augen darauf hin; denn in dem Nebel schritten dunkle Gestalten auf und ab, sie schienen ihm so groß wie Menschen. Würdevoll, aber mit seltsamen, erschreckenden Gebärden; mit langen Nasen und Hälsen sah er sie fern an den rauchenden Spalten auf und ab spazieren; plötzlich begannen sie wie Narren unheimlich auf und ab zu springen, die großen über die kleinen und die kleinen gegen die großen; dann breiteten sie sich aus und verloren alle Form.
›Was wollen die? Sind es die Geister der Ertrunkenen?‹ dachte Hauke. »Hoiho!« schrie er laut in die Nacht hinaus; aber die draußen kehrten sich nicht an seinen Schrei, sondern trieben ihr wunderliches Wesen fort.
Da kamen ihm die furchtbaren norwegischen Seegespenster in den Sinn, von denen ein alter Kapitän ihm einst erzählt hatte, die statt des Angesichts einen stumpfen Pull von Seegras auf dem Nacken tragen; aber er lief nicht fort, sondern bohrte die Hacken seiner Stiefel fest in den Klei des Deiches und sah starr dem possenhaften Unwesen zu, das in der einfallenden Dämmerung vor seinen Augen fortspielte. »Seid ihr auch hier bei uns?« sprach er mit harter Stimme; »ihr sollt mich nicht vertreiben!«
Erst als die Finsternis alles bedeckte, schritt er steifen, langsamen Schrittes heimwärts. Aber hinter ihm drein kam es wie Flügelrauschen und hallendes Geschrei. Er sah nicht um; aber er ging auch nicht schneller und kam erst spät nach Hause; doch niemals soll er seinem Vater oder einem andern davon erzählt haben. Erst viele Jahre später hat er sein blödes Mädchen, womit später der Herrgott ihn belastete, um dieselbe Tages-und Jahreszeit mit sich auf den Deich hinausgenommen, und dasselbe Wesen soll sich derzeit draußen auf den Watten gezeigt haben; aber er hat ihr gesagt, sie solle sich nicht fürchten, das seien nur die Fischreiher und die Krähen, die im Nebel so groß und fürchterlich erschienen; die holten sich die Fische aus den offenen Spalten.
Weiß Gott, Herr!« unterbrach sich der Schulmeister, »es gibt auf Erden allerlei Dinge, die ein ehrlich Christenherz verwirren können; aber der Hauke war weder ein Narr noch ein Dummkopf«
Da ich nichts erwiderte, wollte er fortfahren; aber unter den übrigen Gästen, die bisher lautlos zugehört hatten, nur mit dichterem Tabaksqualm das niedrige Zimmer füllend, entstand eine plötzliche Bewegung; erst einzelne, dann fast alle wandten sich dem Fenster zu. Draußen – man sah es durch die unverhangenen Fenster – trieb der Sturm die Wolken, und Licht und Dunkel jagten durcheinander; aber auch mir war es, als hätte ich den hageren Reiter auf seinem Schimmel vorbeisausen gesehen.
»Wart Er ein wenig, Schulmeister!« sagte der Deichgraf leise.
»Ihr braucht Euch nicht zu fürchten, Deichgraf!« erwiderte der kleine Erzähler, »ich habe ihn nicht geschmäht und hab auch dessen keine Ursach«; und er sah mit seinen kleinen, klugen Augen zu ihm auf
»Ja, ja«, meinte der andere, »laß Er Sein Glas nur wieder füllen.« Und nachdem das geschehen war und die Zuhörer, meist mit etwas verdutzten Gesichtern, sich wieder zu ihm gewandt hatten, fuhr er in seiner Geschichte fort:
»So für sich, und am liebsten nur mit Wind und Wasser und mit den Bildern der Einsamkeit verkehrend, wuchs Hauke zu einem langen, hageren Burschen auf. Er war schon über ein Jahr lang eingesegnet, da wurde es auf einmal anders mit ihm, und das kam von dem alten weißen Angorakater, welchen der alten Trin’ Jans einst ihr später verunglückter Sohn von seiner spanischen Seereise mitgebracht hatte. Trin’ wohnte ein gut Stück hinaus auf dem Deiche in einer kleinen Kate, und wenn die Alte in ihrem Hause herumarbeitete, so pflegte diese Unform von einem Kater vor der Haustür zu sitzen und in den Sommertag und nach den vorüberfliegenden Kiebitzen hinauszublinzeln. Ging Hauke vorbei, so mauzte der Kater ihn an, und Hauke nickte ihm zu; die beiden wußten, was sie miteinander hatten.
Nun aber war’s einmal im Frühjahr, und Hauke lag nach seiner Gewohnheit oft draußen am Deich, schon weiter unten dem Wasser zu, zwischen Strandnelken und dem duftenden Seewermut, und ließ sich von der schon kräftigen Sonne bescheinen. Er hatte sich tags zuvor droben auf der Geest die Taschen voll von Kieseln gesammelt, und als in der Ebbezeit die Watten bloßgelegt waren und die kleinen grauen Strandläufer schreiend darüber hinhuschten, holte er jählings einen Stein hervor und warf ihn nach den Vögeln. Er hatte das von Kindesbeinen an geübt, und meistens blieb einer auf dem Schlicke liegen; aber ebensooft war er dort auch nicht zu holen; Hauke hatte schon daran gedacht, den Kater mitzunehmen und als apportierenden Jagdhund zu dressieren. Aber es gab auch hier und dort feste Stellen oder Sandlager; solchenfalls lief er hinaus und holte sich seine Beute selbst. Saß der Kater bei seiner Rückkehr noch vor der Haustür, dann schrie das Tier vor nicht zu bergender Raubgier so lange, bis Hauke ihm einen der erbeuteten Vögel zuwarf.
Als er heute, seine Jacke auf der Schulter, heimging, trug er nur einen ihm noch unbekannten, aber wie mit bunter Seide und Metall gefiederten Vogel mit nach Hause, und der Kater mauzte wie gewöhnlich, als er ihn kommen sah. Aber Hauke wollte seine Beute – es mag ein Eisvogel gewesen sein – diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an die Gier des Tieres. »Umschicht!« rief er ihm zu, »heute mir, morgen dir; das hier ist kein Katerfressen!« Aber der Kater kam vorsichtigen Schrittes herangeschlichen; Hauke stand und sah ihn an, der Vogel hing an seiner Hand, und der Kater blieb mit erhobener Tatze stehen. Doch der Bursche schien seinen Katzenfreund noch nicht so ganz zu kennen; denn während er ihm seinen Rücken zugewandt hatte und eben fürbaß wollte, fühlte er mit einem Ruck die Jagdbeute sich entrissen, und zugleich schlug eine scharfe Kralle ihm ins Fleisch. Ein Grimm, wie gleichfalls eines Raubtiers, flog dem jungen Menschen ins Blut; er griff wie rasend um sich und hatte den Räuber schon am Genicke gepackt. Mit der Faust hielt er das mächtige Tier empor und würgte es, daß die Augen ihm aus den rauhen Haaren vorquollen, nicht achtend, daß die starken Hintertatzen ihm den Arm zerfleischten. »Hoiho!« schrie er und packte ihn noch fester; »wollen sehen, wer’s von uns beiden am längsten aushält!«
Plötzlich fielen die Hinterbeine der großen Katze schlaff herunter, und Hauke ging ein paar Schritte zurück und warf sie gegen die Kate der Alten. Da sie sich nicht rührte, wandte er sich und setzte seinen Weg nach Hause fort.
Aber der Angorakater war das Kleinod seiner Herrin; er war ihr Geselle und das einzige, was ihr Sohn, der Matrose, ihr nachgelassen hatte, nachdem er hier an der Küste seinen jähen Tod gefunden hatte, da er im Sturm seiner Mutter beim Porrenfangen hatte helfen wollen. Hauke mochte kaum hundert Schritte weiter getan haben, während er mit einem Tuch das Blut aus seinen Wunden auffing, als schon von der Kate her ihm ein Geheul und Zetern in die Ohren gellte. Da wandte er sich und sah davor das alte Weib am Boden liegen; das greise Haar flog ihr im Winde um das rote Kopftuch. »Tot!« rief sie, »tot!« und erhob dräuend ihren mageren Arm gegen ihn: »Du sollst verflucht sein! Du hast ihn totgeschlagen, du nichtsnutziger Strandläufer, du warst nicht wert, ihm seinen Schwanz zu bürsten!« Sie warf sich über das Tier und wischte zärtlich mit ihrer Schürze ihm das Blut fort, das noch aus Nas’ und Schnauze rann; dann hob sie aufs neue an zu zetern.
»Bist du bald fertig?« rief Hauke ihr zu, »dann laß dir sagen: ich will dir einen Kater schaffen, der mit Maus-und Rattenblut zufrieden ist!«
Darauf ging er, scheinbar auf nichts mehr achtend, fürbaß. Aber die tote Katze mußte ihm doch im Kopfe Wirrsal machen, denn er ging, als er zu den Häusern gekommen war, dem seines Vaters und auch den übrigen vorbei und eine weite Strecke noch nach Süden auf dem Deich der Stadt zu.
Inmittelst wanderte auch Trin’ Jans auf demselben in der gleichen Richtung; sie trug in einem alten blaukarierten Kissenüberzug eine Last in ihren Armen, die sie sorgsam, als wär’s ein Kind, umklammerte; ihr greises Haar flatterte in dem leichten Frühlingswind. »Was schleppt Sie da, Trina?« frug ein Bauer, der ihr entgegenkam. »Mehr als dein Haus und Hof«, erwiderte die Alte; dann ging sie eifrig weiter. Als sie dem unten liegenden Hause des alten Haien nahe kam, ging sie den Akt, wie man bei uns die Trift-und Fußwege nennt, die schräg an der Seite des Deiches hinab-oder hinaufführen, zu den Häusern hinunter.
Der alte Tede Haien stand eben vor der Tür und sah ins Wetter. »Na, Trin’!« sagte er, als sie pustend vor ihm stand und ihren Krückstock in die Erde bohrte, »was bringt Sie Neues in Ihrem Sack?«
»Erst laß mich in die Stube, Tede Haien! Dann soll Er’s sehen!« Und ihre Augen sahen ihn mit seltsamem Funkeln an.
»So kommen Sie!« sagte der Alte. Was gingen ihn die Augen des dummen Weibes an.
Und als beide eingetreten waren, fuhr sie fort: »Bring Er den alten Tabakskasten und das Schreibzeug von dem Tisch – was hat Er denn immer zu schreiben? – So; und nun wisch Er ihn sauber ab!«
Und der Alte, der fast neugierig wurde, tat alles, was sie sagte; dann nahm sie den blauen Überzug bei beiden Zipfeln und schüttete daraus den großen Katerleichnam auf den Tisch. »Da hat Er ihn!« rief sie; »Sein Hauke hat ihn totgeschlagen.« Hierauf aber begann sie ein bitterliches Weinen; sie streichelte das dicke Fell des toten Tieres, legte ihm die Tatzen zusammen, neigte ihre lange Nase über dessen Kopf und raunte ihm unverständliche Zärtlichkeiten in die Ohren.
Tede Haien sah dem zu. »So«, sagte er; »Hauke hat ihn totgeschlagen?« Er wußte nicht, was er mit dem heulenden Weibe machen sollte.
Die Alte nickte ihn grimmig an: »Ja, ja; so Gott, das hat er getan!« Und sie wischte sich mit ihrer von Gicht verkrümmten Hand das Wasser aus den Augen. »Kein Kind, kein Lebigs mehr!« klagte sie. »Und Er weiß es ja wohl auch, uns Alten, wenn’s nach Allerheiligen kommt, frieren abends im Bett die Beine, und statt zu schlafen, hören wir den Nordwest an unseren Fensterläden rappeln. Ich hör’s nicht gern, Tede Haien, er kommt daher, wo mein Junge mir im Schlick versank.«
Tede Haien nickte, und die Alte streichelte das Fell ihres toten Katers. »Der aber«, begann sie wieder, »wenn ich winters am Spinnrad saß, dann saß er bei mir und spann auch und sah mich an mit seinen grünen Augen! Und kroch ich, wenn’s mir kalt wurde, in mein Bett – es dauerte nicht lang, so sprang er zu mir und legte sich auf meine frierenden Beine, und wir schliefen so warm mitsammen, als hätte ich noch meinen jungen Schatz im Bett!« Die Alte, als suche sie bei dieser Erinnerung nach Zustimmung, sah den neben ihr stehenden Alten mit ihren funkelnden Augen an.
Tede Haien aber sagte bedächtig: »Ich weiß Ihr einen Rat, Trin’ Jans«, und er ging nach seiner Schatulle und nahm eine Silbermünze aus der Schublade »Sie sagt, daß Hauke Ihr das Tier vom Leben gebracht hat, und ich weiß, Sie lügt nicht; aber hier ist ein Krontaler von Christian dem Vierten; damit kauf Sie sich ein gegerbtes Lammfell für Ihre kalten Beine! Und wenn unsere Katze nächstens Junge wirft, so mag Sie sich das größte davon aussuchen, das zusammen tut wohl einen altersschwachen Angorakater! Und nun nehm Sie das Vieh und bring Sie es meinethalb an den Racker in der Stadt, und halt Sie das Maul, daß es hier auf meinem ehrlichen Tisch gelegen hat!«
Während dieser Rede hatte das Weib schon nach dem Taler gegriffen und ihn in einer kleinen Tasche geborgen, die sie unter ihren Röcken trug; dann stopfte sie den Kater wieder in das Bettbühr, wischte mit ihrer Schürze die Blutflecken von dem Tisch und stakte zur Tür hinaus. »Vergiß Er mir nur den jungen Kater nicht!« rief sie noch zurück.
– – Eine Weile später, als der alte Haien in dem engen Stüblein auf und ab schritt, trat Hauke herein und warf seinen bunten Vogel auf den Tisch; als er aber auf der weißgescheuerten Platte den noch kennbaren Blutfleck sah, frug er, wie beiläufig: »Was ist denn das?«
Der Vater blieb stehen: »Das ist Blut, was du hast fließen machen!«
Dem Jungen schoß es doch heiß ins Gesicht: »Ist denn Trin’ Jans mit ihrem Kater hier gewesen?«
Der Alte nickte: »Weshalb hast du ihr den totgeschlagen?«
Hauke entblößte seinen blutigen Ann. »Deshalb«, sagte er; »er hatte mir den Vogel fortgerissen!«
Der Alte sagte nichts hierauf, er begann eine Zeitlang wieder auf und ab zu gehen; dann blieb er vor dem Jungen stehn und sah eine Weile wie abwesend auf ihn hin. »Das mit dem Kater hab ich rein gemacht«, sagte er dann; »aber, siehst du, Hauke, die Kate ist hier zu klein; zwei Herren können darauf nicht sitzen – es ist nun Zeit, du mußt dir einen Dienst besorgen!«
»Ja, Vater«, entgegnete Hauke; »hab dergleichen auch gedacht.«
»Warum?« frug der Alte.
– »Ja, man wird grimmig in sich, wenn man’s nicht an einem ordentlichen Stück Arbeit auslassen kann.«
»So?« sagte der Alte, »und darum hast du den Angorer totgeschlagen? Das könnte leicht noch schlimmer werden!«
– »Er mag wohl recht haben, Vater; aber der Deichgraf hat seinen Kleinknecht fortgejagt; das könnt ich schon verrichten!«
Der Alte begann wieder auf und ab zu gehen und spritzte dabei die schwarze Tabaksjauche von sich. »Der Deichgraf ist ein Dummkopf, dumm wie ‘ne Saatgans! Er ist nur Deichgraf, weil sein Vater und Großvater es gewesen sind, und wegen seiner neunundzwanzig Fennen. Wenn Martini herankommt und hernach die Deich-und Sielrechnungen abgetan werden müssen, dann füttert er den Schulmeister mit Gansbraten und Met und Weizenkringeln und sitzt dabei und nickt, wenn der mit seiner Feder die Zahlenreihen hinunterläuft, und sagt: ›Ja, ja, Schulmeister, Gott vergönn’s Ihm! Was kann Er rechnen?‹ Wenn aber einmal der Schulmeister nicht kann oder auch nicht will, dann muß er selber dran und sitzt und schreibt und streicht wieder aus, und der große dumme Kopf wird ihm rot und heiß, und die Augen quellen wie Glaskugeln, als wollte das bißchen Verstand da hinaus.«
Der Junge stand gerade auf vor dem Vater und wunderte sich, was der reden könne; so hatte er’s noch nicht von ihm gehört. »Ja, Gott tröst!« sagte er, »dumm ist er wohl; aber seine Tochter Elke, die kann rechnen!«
Der Alte sah ihn scharf an. »Ahoi, Hauke«, rief er; »was weißt du von Elke Volkerts?«
– »Nichts, Vater; der Schulmeister hat’s mir nur erzählt.«
Der Alte antwortete nicht darauf, er schob nur bedächtig seinen Tabaksknoten aus einer Backe hinter die andere.
»Und du denkst«, sagte er dann, »du wirst dort auch mitrechnen können.«
»O ja, Vater, das möcht schon gehen«, erwiderte der Sohn, und ein ernstes Zucken lief um seinen Mund.
Der Alte schüttelte den Kopf. »Nun, aber meinethalb; versuch einmal dein Glück!«
»Dank auch, Vater!« sagte Hauke und stieg zu seiner Schlafstatt auf dem Boden; hier setzte er sich auf die Bettkante und sann, weshalb ihn denn sein Vater um Elke Volkerts angerufen habe. Er kannte sie freilich, das ranke achtzehnjährige Mädchen mit dem bräunlichen schmalen Antlitz und den dunklen Brauen, die über den trotzigen Augen und der schmalen Nase ineinanderliefen; doch hatte er noch kaum ein Wort mit ihr gesprochen; nun, wenn er zu dem alten Tede Volkerts ging, wollte er sie doch besser darauf ansehen, was es mit dem Mädchen auf sich habe. Und gleich jetzt wollte er gehen, damit kein anderer ihm die Stelle abjage; es war ja kaum noch Abend. Und so zog er seine Sonntagsjacke und seine besten Stiefel an und machte sich guten Mutes auf den Weg.
– Das langgestreckte Haus des Deichgrafen war durch seine hohe Werfte, besonders durch den höchsten Baum des Dorfes, eine gewaltige Esche, schon von weitem sichtbar; der Großvater des jetzigen, der erste Deichgraf des Geschlechtes, hatte in seiner Jugend eine solche osten der Haustür hier gesetzt; aber die beiden ersten Anpflanzungen waren vergangen, und so hatte er an seinem Hochzeitsmorgen diesen dritten Baum gepflanzt, der noch jetzt mit seiner immer mächtiger werdenden Blätterkrone in dem hier unablässigen Winde wie von alten Zeiten rauschte.
Als nach einer Weile der lang aufgeschossene Hauke die hohe Werfte hinaufstieg, welche an den Seiten mit Rüben und Kohl bepflanzt war, sah er droben die Tochter des Hauswirts neben der niedrigen Haustür stehen. Ihr einer etwas hagerer Arm hing schlaff herab, die andere Hand schien im Rücken nach dem Eisenring zu greifen, von denen je einer zu beiden Seiten der Tür in der Mauer war, damit, wer vor das Haus ritt, sein Pferd daran befestigen könne. Die Dirne schien von dort ihre Augen über den Deich hinaus nach dem Meer zu haben, wo an dem stillen Abend die Sonne eben in das Wasser hinabsank und zugleich das bräunliche Mädchen mit ihrem letzten Schein vergoldete.
Hauke stieg etwas langsamer an der Werfte hinan und dachte bei sich: ›So ist sie nicht so dösig!‹ Dann war er oben. »Guten Abend auch!« sagte er, zu ihr tretend; »wonach guckst du denn mit deinen großen Augen, Jungfer Elke?«
»Nach dem«, erwiderte sie, »was hier alle Abend vor sich geht, aber hier nicht alle Abend just zu sehen ist.« Sie ließ den Ring aus der Hand fallen, daß er klingend gegen die Mauer schlug. »Was willst du, Hauke Haien?« frug sie.
»Was dir hoffentlich nicht zuwider ist«, sagte er. »Dein Vater hat seinen Kleinknecht fortgejagt, da dachte ich bei euch in Dienst.«
Sie ließ ihre Blicke an ihm herunterlaufen. »Du bist noch so was schlanterig, Hauke!« sagte sie; »aber uns dienen zwei feste Augen besser als zwei feste Arme!« Sie sah ihn dabei fast düster an, aber Hauke hielt ihr tapfer stand. »So komm«, fuhr sie fort; »der Wirt ist in der Stube, laß uns hineingehen!«
Am andern Tage trat Tede Haien mit seinem Sohne in das geräumige Zimmer des Deichgrafen; die Wände waren mit glasurten Kacheln bekleidet, auf denen hier ein Schiff mit vollen Segeln oder ein Angler an einem Uferplatz, dort ein Rind, das kauend vor einem Bauernhause lag, den Beschauer vergnügen konnte; unterbrochen war diese dauerhafte Tapete durch ein mächtiges Wandbett mit jetzt zugeschobenen Türen und einen Wandschrank, der durch seine beiden Glastüren allerlei Porzellan-und Silbergeschirr erblicken ließ; neben der Tür zum anstoßenden Pesel war hinter einer Glasscheibe eine holländische Schlaguhr in die Wand gelassen.
Der starke, etwas schlagflüssige Hauswirt saß am Ende des blankgescheuerten Tisches im Lehnstuhl auf seinem bunten Wollenpolster. Er hatte seine Hände über dem Bauch gefaltet und starrte aus seinen runden Augen befriedigt auf das Gerippe einer fetten Ente; Gabel und Messer ruhten vor ihm auf dem Teller.
»Guten Tag, Deichgraf!« sagte Haien, und der Angeredete drehte langsam Kopf und Augen zu ihm hin.
»Ihr seid es, Tede?« entgegnete er, und der Stimme war die verzehrte fette Ente anzuhören, »setzt Euch; es ist ein gut Stück von Euch zu mir herüber!«