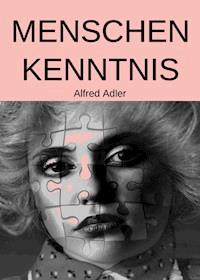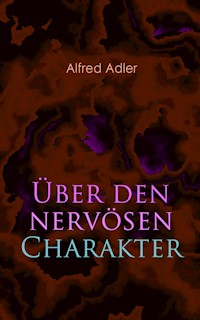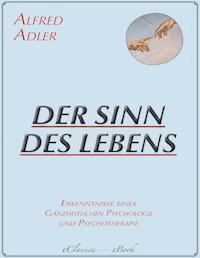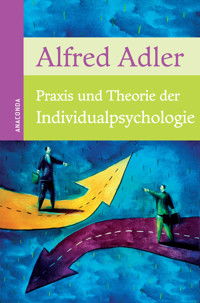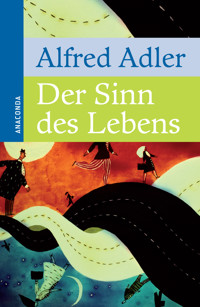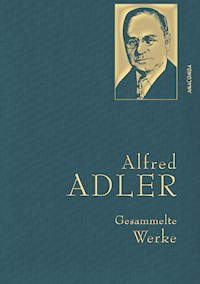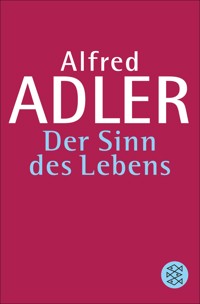
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alfred Adler, Werkausgabe (Taschenbuchausgabe)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Aus der erlebten »Minderwertigkeit« des hilflosen Kindes entwickelt sich sein ganzes Leben bestimmender individueller »Lebensplan«, der im Wesentlichen darauf hinausläuft, diese Minderwertigkeit zu überwinden. Die Zielgerichtetheit, mit der der Einzelne sein Leben gestaltet, ist nur von daher zu verstehen und äußert sich als ein »Streben nach Vollkommenheit«. Der Begriff von Vollkommenheit kann für jeden Menschen einen anderen konkreten Inhalt besitzen, da dieser sich aus dem individuellen Schicksal jedes Einzelnen herleitet, ihn zu verwirklichen aber gilt jedem als Sinn des Lebens. Alfred Adler schildert nun in seinem Spätwerk »Der Sinn des Lebens« (1933) den Konflikt zwischen subjektiver Sinngebung und objektivem Sinn; letzterer gilt als »wahr«, da er »außerhalb unserer Erfahrung« liegt. Der Grundgedanke, der dahintersteht, lautet: Die Menschen haben im Verlauf der Evolution das Gemeinschaftsgefühl als Artspezifikum erworben. Seelische Krankheiten ( u. a. Neurosen, Psychosen) sind Symptome eines Konflikts des Einzelnen mit der Gemeinschaft, sind also Hemmungen des Gemeinschaftsgefühls durch frühkindliche negative Einflüsse (z. B. in der Erziehung). Aus dieser Erkenntnis ergeben sich einesteils therapeutische Maßnahmen, darüber hinaus aber auch Ansätze für eine »wissenschaftliche« Ethik. »Die Individualpsychologie fordert weder die Unterdrückung berechtigter noch unberechtigter Wünsche. Aber sie lehrt, daß unberechtigte Wünsche als gegen das Gemeinschaftsgefühl verstoßend erkannt werden müssen und durch ein Plus an sozialem Interesse zum Verschwinden, nicht zur Unterdrückung gebracht werden müssen.« Alfred Adler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Ähnliche
Alfred Adler
Der Sinn des Lebens
FISCHER E-Books
Inhalt
Einführung
Der Sinn des Lebens ist Alfred Adlers letztes größeres Werk. Es erschien 1933, gut 20 Jahre nach der ersten umfassenden Darlegung seiner Erkenntnisse in der Schrift Über den nervösen Charakter[1] aus dem Jahre 1912, die bis 1928 vier Auflagen erlebt hatte. Die Stationen seines Weges sind durch die folgenden Werke gekennzeichnet: Zunächst zwei Sammelbände, in denen Aufsätze und Vorträge aus längeren Zeiträumen zusammengefaßt sind. Der erste, Heilen und Bilden[2], 1914 mit Carl Furtmüller und zahlreichen weiteren Mitarbeitern herausgegeben, umfaßt die Vorgeschichte von 1904 bis 1913 – in späteren Ausgaben mit einigen Zusätzen aus den zwanziger Jahren –; die zweite, Praxis und Theorie der Individualpsychologie[3] (1920) den Zeitraum von 1913 bis zum Erscheinungsjahr. Es folgen, neben zahlreichen Aufsätzen, die vor allem in der Internationalen Zeitschrift für Individualpsychologie erschienen sind, 1927 die Vorträge über Menschenkenntnis[4], 1929 die Vorlesungen für Lehrer und Erzieher über Individualpsychologie in der Schule[5], 1930Das Problem der Homosexualität und sexueller Perversionen[6] und Die Technik der Individualpsychologie[7], mit dem Untertitel »Die Seele des schwer erziehbaren Schulkindes«.
Der Ausdruck »Sinn des Lebens« hat, wie nicht anders zu erwarten, bei Adler zwei verschiedene Bedeutungen.
Er meint erstens den Sinn, den ein bestimmter Mensch in seinem Leben sucht und findet und der aufs engste zusammenhängt mit der »Meinung«, die er von sich, von der Welt, von den Mitmenschen und vom Leben hat. Diese Meinung kann sich nur auf die besondere Erlebniswelt dieses einzelnen beziehen. Sie ist, mit allem, was aus ihr folgt, eine echte Schöpfung des Kindes aufgrund der Art und Weise, wie es in dieser Welt empfangen wurde. Sie ist angelegt in einem Alter, in dem das Kind die Sprache noch nicht genügend beherrscht. Daher ist sie auch später aus Selbstbekenntnissen nicht zu entnehmen, und nur mittelbar aus Worten und Gedanken über die Welt und die Menschen. Mit einiger Sicherheit kann sie aber vom Erfahrenen aus dem »Lebensstil« des fraglichen Menschen erschlossen oder »erraten« werden, das heißt aus der Art, wie er sich in bestimmten Lagen benimmt, wie er sich bestimmten Menschen, Aufgaben, Schwierigkeiten des Lebens und Zumutungen seiner Umgebung gegenüber verhält.
Zweitens aber kann unter dem »Sinn des Lebens« auch sein »wahrer«, »außerhalb unserer Erfahrung liegender« Sinn verstanden werden. Er kann auch von demjenigen verfehlt werden, der fest überzeugt ist, zu wissen, worauf es im Leben ankommt, und der, sofern er das erreicht, in seinem Leben einen Sinn entdeckt oder verwirklicht zu haben glaubt. Der »wahre« Sinn des Lebens zeigt sich darin, »daß er diejenigen ins Unrecht setzt, die zu ihm in auffallendem Widerspruch stehen«. Er »zeigt sich in dem Widerstand, der sich dem unrichtig handelnden Individuum entgegenstemmt«. Er zeigt sich kurz darin, daß derjenige, der sich von ihm allzu weit entfernt, je nach seiner Veranlagung, seiner Vergangenheit und seiner gegenwärtigen Lage, neurotisch, psychotisch, pervers, süchtig oder kriminell wird.
Schon von der »lebenden Materie« vermutet Adler in den Überlegungen dieser Schrift, sie sei »einmal in Bewegung gesetzt, stets darauf aus« gewesen, von einer »Minussituation« in eine »Plussituation« zu gelangen. Und er wiederholt diesen Gedanken in den verschiedensten Wendungen: Das Lebende strebe von »unten« nach »oben«, von der »Minusseite des Lebens« auf seine »Plusseite«, von »Unsicherheit« nach »Sicherheit«, von Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit nach »Bewältigung«, nach »Überwindung«, von »Unterlegenheit« nach »Überlegenheit«.
Er geht jetzt so weit, zu behaupten, »Mensch sein heißt: sich minderwertig fühlen«, und zu erklären, daß dem Menschen »als Segen ein starkes Minderwertigkeitsgefühl mitgegeben ist, das nach einer Plussituation drängt, nach Sicherung, nach Überwindung« – nach der Überwindung eben dieses schmerzlichen Gefühls, »das mindestens so lange währt, als eine Aufgabe, ein Bedürfnis, eine Spannung nicht gelöst ist«. Die Auflehnung gegen dieses Gefühl der Minderwertigkeit ist die Grundlage der Menschheitsentwicklung und wird glücklicherweise in jedem Kind aufs neue erweckt. Der Lebenslauf des einzelnen ist, ebenso wie die geschichtliche Bewegung der Menschheit, als die Geschichte des Minderwertigkeitsgefühls und der Versuche seiner Überwindung anzusehen. »Grundsatz des Lebens ist [demnach] Überwindung.« »Ihr dient … das Streben nach Vollkommenheit.« Die Richtung der gesuchten Überwindung ist freilich ebenso tausendfach verschieden wie das Ziel der gesuchten Vollkommenheit. Aber immer wieder heißt es: »Das Ziel der menschlichen Seele ist Überwindung, Vollkommenheit, Sicherheit, Überlegenheit.« »Das Streben nach Vollkommenheit zieht uns hinan.«
Entscheidend für die Ausbildung des Lebensstils ist nun aber, was ein gegebener Mensch unter »oben«, unter »überlegen«, »sicher« und »vollkommen« versteht. Und dies hängt wieder von der »Meinung« ab, die er sich am Beginn seines Lebens, oder besser, seines Bewußtwerdens, von der Welt gebildet hat.
Adler bringt eine Reihe von Beispielen für solche privaten Meinungen über die Welt: Ein ängstliches Kind meint, es könne nicht ohne die Mutter sein. Ein Mann mit Platzangst meint, vor dem Hause schwanke der Boden. Ein Einbrecher meint, Berufsarbeit sei schwerer als Einbruch.
Wie die daraus folgenden und sinngemäß angestrebten »Vollkommenheiten« aussehen, wird nicht systematisch abgehandelt, und das soll auch hier nicht nachgeholt werden. Nur in losem Zusammenhang mit den »Meinungen« folgen Beispiele von »angestrebter Vollendung« oder »Vollkommenheit«.
Da gibt es eine vermeintliche Vollkommenheit, die »im Triumph über die anderen« besteht, ergänzt durch das erfolgreiche Bestreben, »andere um ihren Triumph zu bringen«.
Es gibt Leute, denen der Sinn des Lebens nur dann erfüllt erscheint, wenn sie jemand, oder möglichst viele, beherrschen können, wenn sie sie, ohne Rücksicht auf Verluste, ihre Macht fühlen lassen und ihnen fortgesetzt beweisen können, »wer Herr im Hause ist«. Ein neuerer Grenzfall, den Adler offenbar nicht mehr miterlebt hat, ist das erhebende Gefühl, für völlig fremde Menschen »Schicksal« zu spielen, wie es etwa jener Unbekannte tat, der eines Nachts zwei Schrotschüsse in ein geschlossenes Zelt abgab, wodurch er ein junges Ehepaar, mit dem er nie etwas zu tun gehabt hatte, fürs Leben zu Krüppeln machte. – Ein Sonderfall sind die Menschen, die alle engeren Beziehungen zu Frauen aufs heftigste ablehnen, da solche Beziehungen ihnen nur in zwei Formen möglich erscheinen: sie zu beherrschen, oder von ihnen beherrscht zu werden. Wenn sie sich das erste nicht zutrauen, wohl aber die Beherrschung von männlichen Wesen, und wenn für sie zugleich überhaupt das Herrschen der Inbegriff der Vollendung ist, so sind sie für die Homosexualität haargenau vorbestimmt. Es gibt Menschen, für die die erstrebte Vollkommenheit darin besteht, in allem, was sie unternehmen, allen anderen überlegen zu sein. Sie lassen niemanden gelten, sie sind die schärfsten Kritiker an den anderen, und würden bestimmt alles besser machen. Aber da jede Konkurrenz das Risiko enthält, nicht den ersten Platz zu gewinnen, und sie es schon als Katastrophe und unerträgliche Niederlage empfinden, auch nur auf den zweiten Platz verwiesen zu werden, erfinden sie, ohne sich wirklich über die Gründe ihres Handelns klarzusein, alle möglichen Tricks (oder »Arrangements«), um dem Wettbewerb auszuweichen, schieben aber ihre Behinderung höheren Mächten zu. Da sie schließlich jedes Unternehmen nur noch als Prüfung verstehen können und wegen der genannten Gefahr es auf die Entscheidung nicht ankommen lassen dürfen, gelingt es ihnen nicht mehr, vom Planen zum Tun überzugehen; sie können sich nicht endgültig entschließen; beginnen sie doch mit der Ausführung, so werfen sie sich selbst Knüppel zwischen die Beine: Sie verschlafen ihre Verabredungen, sie versäumen den Zug, manchmal sogar wörtlich. Das ist die von Adler so genannte »zögernde Attitüde«. In anderen Fällen treten sie den »Rückzug« auf andere Weise an. Sie schränken ihre Tätigkeit auf immer engere Bereiche ein, in denen sie noch hoffen können, ohne Risiko Erster (oder Herrscher) bleiben zu können. Eine von Adler besonders eingehend behandelte private »Vollkommenheit«, weniger des Subjekts selbst als seines Daseins, besteht darin, das ganze Leben lang Gegenstand der Fürsorge der gesamten Umgebung zu sein; die anderen, zum Beispiel den Ehemann, die Ehefrau, die Familie als ergebene Bedienstete zu haben, die man mit allen möglichen »Fleißaufgaben« in Atem hält.
Vielen genügt es auch, im Brennpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, beachtet, bewundert, beneidet, beklatscht zu werden. Ihre »fiktive Welt« ist ein Theater, in dem sie allein im Licht auf der Bühne stehen, während alle anderen sich im abgedunkelten Zuschauerraum befinden. Notfalls suchen sie ihre Freunde unter den geistig Armen und Minderbemittelten, deren Bewunderung ihnen sicher ist. Wenn es nicht gelingt, durch das Äußere oder durch Leistungen die erwünschte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so liegt bei vielen die Versuchung nahe, sie durch Untaten zu erzwingen. Das reicht von kindlichen Unarten bis zu Verbrechen, von denen die Spalten der Zeitungen voll sind.
Beim weiblichen Geschlecht war schon zu Adlers Zeiten das Vollkommenheitsideal verbreitet, »wie ein Mann« zu sein (in Adlers Sprache der »männliche Protest«), wobei alles, was in unserer Gesellschaft als Kennzeichen der Männlichkeit gilt, in oft übersteigerter und karikierter Weise vorgeführt wurde und wird.
Als letztes Beispiel einer »fiktiven Welt«, einer privaten Vorstellung von der Vollkommenheit des Daseins, seien (mit eigenen Worten) die Leute genannt, die nach dem Grundsatz leben: Was dein ist, ist mein, und was mein ist, geht dich nichts an –, die also ständig unbedenklich nehmen, aber nie auf den Gedanken kommen, daß sie auch einmal geben könnten.
Sie träumen davon, das Leben eines einjährigen Kindes, das wegen seiner Hilflosigkeit nur nehmen, aber noch nicht geben kann, bis zu ihrem Ende beizubehalten. Oft haben oder erhalten sie den Anschluß an einen ständig gebenden Menschen, etwa ihre (zum Beispiel verwitwete) Mutter; und wenn sie diese verlieren, verlieben sie sich mit Sicherheit in eine ältere Frau, die bereit ist, die Mutterrolle zu übernehmen. – (Weitere Abarten sind in dem Kapitel 7 über den »Überlegenheitskomplex« und im Kapitel 10 »Was ist eigentlich eine Neurose?« beschrieben.)
Kennzeichnend für das hier nur Angedeutete ist, daß nicht von der Vollkommenheit, sondern von Vollkommenheiten (in der Mehrzahl) oder von persönlichen »Zielen der Vollkommenheit« mit sehr speziellen Merkmalen die Rede ist. So heißt es (siehe S. 145) von einer sonst freundlichen und fleißigen Hausfrau, die Schwierigkeiten mit ihrem Mann hatte, daß »aufgezwungene Mitarbeit … außerhalb ihres Zieles der Vollkommenheit lag« (während es zugleich zu den Zielen der Vollkommenheit ihres Ehemannes gehörte, seine Frau ständig herumzukommandieren). Und von einem Mann, der das schon oben erwähnte »Ziel der Vollkommenheit« hatte, ständig von seiner Frau verwöhnt zu werden, wird gesagt, daß in dieses egoistisch gefärbte Lebensziel »ein großer Anteil eingeflossen (war), nach außen hin nicht als böse zu erscheinen« (S. 151).
Was ist demgegenüber der »wahre« Sinn des Lebens? – Die Antwort lautet: Sinnvoll ist, beziehungsweise Sinn hat ein menschliches Leben dann, wenn es »vom Ziele des Wohles der gesamten Menschheit geleitet ist«, wenn es einem Zustand »größerer Beiträge« (für die Gesamtheit), »größerer Kooperationsfähigkeit« zustrebt, wenn sich »jeder einzelne mehr als bisher als einen Teil des Ganzen darstellt« (S. 191). Man kann auch sagen: Wenn Überlegenheit nicht ohne die anderen, nicht auf Kosten der anderen, nicht gegen die anderen und vor allem nicht über die anderen gesucht wird, sondern gemeinsam mit ihnen über die Mißlichkeiten, Schwierigkeiten, Beschwerden, Unbilden, Gefahren des Lebens und der Welt.
Dieser Sinn des Lebens ist deshalb »wahr«, weil der Mensch nicht zum Einzelgänger geschaffen ist. Er kann erstens nur in der Gruppe oder überhaupt nicht existieren. Selbst der zurückgezogenste Einsiedler bleibt den übrigen Menschen in seiner näheren Umgebung ein »Gebender«: als Vorbild, als Berater, als Lehrer, als Beichtvater, als Mahner, als Prophet – und zugleich in etwas unwirtlicheren Gegenden ein »Nehmender«, da er mindestens zum Teil auf ihre Almosen angewiesen ist.
Der Mensch benötigt, zweitens, zur Sicherung seines Lebensunterhalts, und um diese Welt halbwegs wohnlich zu machen, auch allerlei Nöte und Gefahren abzuwenden, die Zusammenarbeit, die Arbeitsteilung, und das heißt auch, die Organisation und Leitung der Arbeit. Ein Quartett kommt noch ohne Dirigenten aus, aber schon in einem concerto grosso mit seiner bescheidenen Besetzung ist er nicht mehr zu entbehren. Drittens beruht der Fortbestand der Menschheit auf ihrer Zweigeschlechtlichkeit. Sie beruht darauf, daß Männer und Frauen sich zusammentun, um Kinder zu erzeugen, und zusammenbleiben und sich vertragen und laufend verständigen, um diese Kinder großzuziehen. Damit sind die »drei Aufgaben« genannt, die jedem Menschen grundsätzlich gestellt sind, und die er nur gemeinsam mit anderen, als Teil eines Ganzen, einer Arbeitsgemeinschaft, eines Betriebs, einer Ehe, lösen kann.
Es leuchtet ein, daß ein solches fruchtbares Zusammenwirken nur zustande kommen kann, wenn jeder bereit ist, Rat und Hilfe zu geben und anzunehmen und jedem anderen Glied der Gruppe dieselben Ansprüche zuzugestehen, die er selber stellt.
Eine Gesellschaft, in der jeder nur nimmt und keiner gibt, in der alle nur die Annehmlichkeiten des Zusammenlebens beanspruchen und keiner bereit ist, auch einen angemessenen Teil seiner (durchaus erträglichen) Beschwerden auf sich zu nehmen, in der fortgesetzt jeder über jeden anderen zu triumphieren und ihn zugleich um seinen Triumph zu bringen sucht, in der alle zugleich Klassenerste sind, jeder jeden anderen beherrscht und sich von ihm bedienen läßt, jeder von allen anderen bewundert wird, in der jeder jeden anderen zum Sündenbock macht und ihm die Verantwortung für die eigenen Fehler zuschiebt, ist ein Widerspruch in sich.
Herrschen und beherrscht werden, siegen und unterliegen, verwöhnen und verwöhnt werden, bewundern und bewundert werden, erster, zweiter oder auch letzter zu sein – alles das sind Fakten, die im Zusammenleben der Menschen vorkommen und über die man, wenn man selbst betroffen ist, sich freuen oder ärgern kann. Sie lassen sich nicht wegdiskutieren, sie sind aber ihrer Natur nach nicht geeignet, zu Merkmalen der wahren Vollendung oder Vollkommenheit (oder ihres Mangels) erhoben zu werden und die Verwirklichung eines »sinnvollen« Daseins zu verbürgen. – Der »wahre« Sinn des Lebens läßt sich also nur in der Gemeinschaft, gemeinsam mit den anderen erfüllen. Um das »Ziel der Vollendung oder Vollkommenheit« zu erreichen, müssen daher bestimmte Eigenschaften und Haltungen der einzelnen in genügendem Maß verwirklicht sein: Der einzelne muß fähig und bereit sein, sich anderen »anzuschließen«, »mitzuleben«, Kamerad, Freund, »Mitspieler« zu sein. Er muß sich zum »richtigen Mitmenschen« entwickeln.
Er muß Kooperationsfähigkeit und Neigung zur Mitarbeit, zur Übernahme von »Aufgaben zu zweit« oder zu mehreren besitzen. Er muß bereit sein, auch zum Nutzen anderer tätig zu werden, ohne ständig nach Gegenleistungen zu schielen. Das heißt, er muß ebenso an anderen wie an sich selber Interesse haben, ja sogar Interesse an der »Menschheit« und ihren Fragen. Dazu gehört Friedlichkeit, Einfügungsbereitschaft, Treue und Verläßlichkeit. Es gehört dazu die Übernahme der Verantwortung fürs eigene Tun und die zur Selbstverständlichkeit gewordene tätige Anerkennung der Gleichheit und Gleichberechtigung des anderen, dazu die Geduld gegenüber seinen Schwächen. Und dies um so mehr, je näher man ihm steht (zum Beispiel in der Ehe). Zusammenfassend: »Das eigene Wohl [kann] nur unter Voraussetzung eines genügenden Gemeinschaftsgefühls gesichert« werden. Alle Versuche, eine unbefriedigende Situation auf andere Weise zu lösen, werden von diesem Grundgedanken aus als »unstatthaft« und »unzweckmäßig«, auch als »unnützlich« bezeichnet. Die Bedeutung des Gemeinschaftsgefühls wird daher das ganze Buch hindurch weit stärker betont als in allen früheren Schriften. Dem Menschen, dem es abgeht, oder der es in ungenügendem Maße besitzt, werden folgende Eigenschaften bescheinigt (die natürlich nicht in jedem Fall alle gleichzeitig verwirklicht sein müssen): Er ist egoistisch, schwierig, neidisch, eifersüchtig; er ist eitel, hochmütig und überempfindlich; er ist ungeduldig und unbeherrscht aufbrausend; er erlahmt rasch, er neigt zu übertriebener Vorsicht und zum Rückzug vor seinen Aufgaben; er neigt zu autoritärem Verhalten und zur Herabsetzung der anderen; er ist überkritisch und mißtrauisch; er ist feige und versucht durch allerlei Tricks, den Schein der Vollkommenheit zu wahren; er weist jede, auch aufbauende, Kritik zurück, weil sie diesen Schein beeinträchtigen könnte.
Mit diesen beiden – da und dort etwas ergänzten, aber gleichwohl unvollständigen – Listen von Eigenschaften, Haltungen und Verhaltensneigungen als wesentlichen Bestandteilen der Psychologie des normalen und des gestörten (insbesondere neurotischen) Menschen wird bewußt und unwiderruflich die Grenzmauer zwischen Psychologie und Ethik eingerissen. Denn in dem Augenblick, wo die Gemeinschaft und ihre optimale Struktur zum Gegenstand der Psychologie wird, werden es auch diejenigen Eigenschaften, Haltungen und Bereitschaften des einzelnen, die wir, als »gut« und »schlecht« oder »böse«, bisher aus der Psychologie auszuklammern und der Ethik zuzuweisen pflegten. Denn, was wir »gut« nennen, sind genau diejenigen Eigenschaften, die ein reibungsloses und fruchtbares Funktionieren der Gemeinschaft verbürgen, und »schlecht« oder »böse« nennen wir diejenigen, die es stören oder verhindern. Und die Beurteilung der Menschen nach dem »Wert ihrer Beitragsleistung« ist völlig gerechtfertigt und legitim, ja sie ist psychologisch notwendig und unverzichtbar, da diese ihre Beitragsleistung auch die Grundlage und Voraussetzung der seelischen Gesundheit und des Lebensglücks jedes einzelnen ist.
Wie kommt es zu mehr oder weniger gemeinschaftsfreundlichen oder -feindlichen Lebensstilen? Maßgeblich sind in jedem Fall die Lebensumstände in der frühen Kindheit. Und es ist im wesentlichen mit vier »gemeinschaftshindernden Kindheitssituationen« zu rechnen:
Mängel und Schwächen der organischen Ausstattung (die »Organminderwertigkeiten«);
Vernachlässigung und mangelnde Zuwendung;
autoritärer Zwang und brutale Unterwerfung;
Verwöhnung oder Verzärtelung.
Die Liste ist sicher nicht vollständig, wenn man zum Beispiel bedenkt, wie niedrig in unserer Volksmeinung die elterliche Verläßlichkeit gegenüber den Kindern im Kurse steht, und wie verbreitet die unbefangene Pflege von »Lieblings«- und »Sündenbock«-Verhältnissen, also die unverhüllte Ungerechtigkeit in unseren Kinderzimmern ist. Adler kommt später selbst noch auf einige weitere Gesichtspunkte zurück, u. a. auf den Verlust des Haltes durch Streitigkeiten zwischen den Eltern, und auf die Entmutigung durch Überforderung und demütigende Kritik. – Im Hinblick auf die Bewertung der vier hauptsächlichen Störungsquellen hat Adler offenbar im Lauf der Jahrzehnte seine Meinung mehrfach geändert.
In dem Vortrag über den ›Arzt als Erzieher‹[8] von 1904 liegt das Hauptgewicht auf den elterlichen Unterwerfungsversuchen, wie sich aus der eingehenden Erörterung der körperlichen Züchtigung, des Schlagens und Prügelns, und aus ihrer strikten Ablehnung wegen ihrer unvermeidlich verhängnisvollen Folgen ergibt. Dies scheint auch noch 1922 die Meinung Adlers gewesen zu sein, als er Leonard Seifs Aufsatz über autoritäre Erziehung in die zweite Auflage der Sammlung Heilen und Bilden aufnahm, der genau dieses Thema behandelt und ihm eine entscheidende Bedeutung beimißt.
Zwischendurch, in der Studie über Minderwertigkeit von Organen von 1907, liegt der Schwerpunkt ganz auf der Beeinträchtigung der Entwicklung durch Mängel der körperlichen Ausstattung.
Im Jahr 1932, im Sinn des Lebens, ist der Schwerpunkt nochmals auffallend verschoben. Es wird nicht nur die Verwöhnung immer wieder als schwerster und folgenreichster Erziehungsfehler bezeichnet. Sondern zugleich handeln sämtliche Krankengeschichten von Ratsuchenden, die in ihrer Kindheit mehr oder weniger auffallend verhätschelt worden waren. Unter den Müttern der aufgeführten Patienten tritt nur eine auf, die ihn nicht verwöhnt, sondern seine Kindheit durch fortgesetztes Nörgeln verbittert hat. Wie diese Schwerpunktverlagerung zustande kommt, wissen wir nicht. Eine naheliegende Vermutung wäre, daß die geprügelten Kinder später eher beim Richter als beim Therapeuten in Erscheinung treten. – Dabei ist die Verwöhnungsgefahr seit Adlers letztem Werk und noch mehr seit seinem Tod ins unabsehbare gewachsen. Man hat zunächst in der amerikanischen »progressive education« und neuerdings in der sogenannten »antiautoritären« Erziehung vielfach die Erfüllung jedes kindlichen Wunsches zum heiligen Grundsatz erhoben, mit der Begründung, daß jeder Wunsch der Ausdruck eines Bedürfnisses sei und daß alle kindlichen Bedürfnisse befriedigt werden müßten, da jede »Frustrierung«, das heißt jedes Unbefriedigtbleiben eines Bedürfnisses unerwünschte Auswirkungen habe, zum Beispiel die Aggressivität erhöhe. Die individualpsychologische Erziehung ist schon 60 Jahre vor der antiautoritären eine Erziehung als gleichberechtigt betrachteter junger Menschen zur Selbständigkeit des Denkens und zur Selbstverantwortlichkeit des Handelns gewesen. Sie hat also wesentliche Anliegen der antiautoritären vorweg verwirklicht. Sie weicht aber in diesem einen Punkt grundsätzlich von ihr ab. Sie kennt auch den Begriff des unberechtigten Wunsches und gibt Anweisungen zu seiner Erkennung und Behandlung: »Da der im großen und ganzen verwöhnten Menschheit jeder unerfüllte oder unerfüllbare Wunsch als Unterdrückung erscheint, möchte ich hier noch einmal feststellen: Die Individualpsychologie fordert weder die Unterdrückung berechtigter noch unberechtigter Wünsche. Aber sie lehrt, daß unberechtigte Wünsche als gegen das Gemeinschaftsgefühl verstoßend erkannt werden müssen und durch ein Plus an sozialem Interesse zum Verschwinden, nicht zur Unterdrückung gebracht werden können« (S. 199).
Die Störungsquelle »Vernachlässigung« wird von Adler in dem vorliegenden Werk zwar wiederholt erwähnt, aber darin nirgends eingehender besprochen. Man muß die Rolle, die er ihr zuschreibt, aus den Anweisungen erschließen, die er – zum Beispiel im 13. Kapitel – den Eltern erteilt. Adler konnte bis zu seinem Tode nicht ahnen, welche Bedeutung diesem Faktor tatsächlich zukommt. Denn außer einer Abhandlung des Münchner Kinderarztes von Pfaundler von 1925, die jahrzehntelang unbeachtet blieb, ist keine der einschlägigen Arbeiten vor 1945 erschienen.
Adler spricht in dem eben genannten Kapitel von der »ungeheuren Bedeutung der Mutter« und des »mütterlichen Kontakts« für die Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls und der Kooperationsbereitschaft des Kindes. Und er fährt – im Sperrdruck – fort: »Wahrscheinlich verdanken wir dem mütterlichen Kontaktgefühl den größten Teil des menschlichen Gemeinschaftsgefühls und damit auch den wesentlichen Bestand der menschlichen Kultur.« Die Erforschung des Mutter-Kind-Verhältnisses in der Zwischenzeit hat ihm mehr als recht gegeben. Seit der bahnbrechenden Veröffentlichung von René Spitz von 1945 über die Trennungsschwermut (»anaclitic depression«) kleiner Kinder nach dem Verlust ihrer Mutter und ihre Verkümmerung (»Hospitalisierung«), wenn sie längere Zeit von den überbeschäftigten und ständig wechselnden Betreuerinnen eines Heimes versorgt werden, sind in der ganzen Welt Untersuchungen über die geistigen und menschlichen Bedürfnisse kleiner Kinder, insbesondere über ihr Geborgenheits- und Verbundenheitsbedürfnis, angestellt worden. Wir erwähnen von ihnen hier nur den Bericht von Lotte Schenck-Danzinger (1964) aus einem Wiener Waisenhaus, dessen Insassen in den ersten Lebensjahren jegliche Beschäftigung für ihre Sinne und Hände und sogar jeden Zuspruch von seiten ihrer Pflegerinnen entbehren mußten, die sich dann, mit drei bis vier Jahren in Pflegefamilien versetzt, zwar von ihrer körperlichen und geistigen Verkümmerung erholten, sich aber in der ersten Schulklasse sämtlich als unverbesserliche wüste Rohlinge entpuppten, mit einer unerschöpflichen Gabe im Erfinden immer neuer Quälereien ihrer Mitschüler. Hier haben wir in reiner Ausprägung das Gegenteil des »Mitmenschen«, den ständig »wie in Feindesland« und zwischen lauter Feinden lebenden »Gegenmenschen« (unten Kapitel 9). Und wir sehen zugleich, daß er das Ergebnis äußerster Vernachlässigung ist. Bei einem etwas geringeren Grad früher Vernachlässigung belegen die betroffenen Kinder später den Betreuer, zu dem sie Vertrauen gefaßt haben, völlig mit Beschlag und beanspruchen ihn pausenlos für sich allein. Hier erscheint der von Adler mehrfach erwähnte »extreme Wunsch nach Verwöhnung«, zusammen mit seiner Vorgeschichte. Über jeden Zweifel gesichert ist auch die Tatsache, daß spätestens vom zweiten Lebenshalbjahr ab schon jede vorübergehende, über ein paar Tage hinausgehende Trennung von der Mutter – besser, da es nicht auf die Blutsverwandtschaft, sondern nur auf die persönliche Verbundenheit ankommt, der »Hauptpflegeperson« –, also jeder etwas längere Krankenhaus- oder Heimaufenthalt des Kindes und jede Ferienreise seiner Mutter ohne das Kind, die Ausbildung des Gemeinschaftsgefühls und damit die Sozialisierung gefährdet, und daß der völlige Verlust der Mutter oder Pflegemutter und vor allem ihr mehrmaliger Wechsel sie völlig unterbindet. Kinderheime sind daher in ihrer herkömmlichen Struktur, bei Licht besehen, Einrichtungen zur Verhinderung der Ausbildung des Gemeinschaftsgefühls.
Das Gemeinschaftsgefühl ist, wie auch Adler nicht bestreitet, ein »biologisches Erbe«. Ob es aber in einem für ein geordnetes Zusammenleben ausreichenden Maß ausgebildet wird oder nicht, hängt, wie schon früher erwähnt, nach seiner Überzeugung völlig von den Lebensumständen des Kindes in seiner frühen Kindheit – bis etwa zu fünf Jahren – und dem Erziehungsstil der Eltern ab. Worauf es ankommt, kann hier natürlich nur angedeutet werden. Förderlich ist alles, was den Kontakt des Kindes verstärkt. Um ein Mitmensch (und kein Gegenmensch) zu werden, muß das Kind durch »innige Kooperation«, zunächst mit der Mutter, erst später auch mit dem Vater und den Geschwistern, in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, bei der beide gewinnen, als ein »gleichberechtigter Mitarbeiter« aufwachsen.
Je mehr das Kind den Eindruck von der Verläßlichkeit und Mitarbeit der anderen gewinnt, um so eher wird es zum »Mitleben« und zum selbständigen Mitarbeiten geneigt sein. Es wird, ohne daß man es dazu zu nötigen braucht, alles, was es besitzt, in den Dienst der Kooperation stellen. Jede Gelegenheit, vom Nehmenden zum Gebenden zu werden, auch sich selbst zu helfen, muß sorgsam ausgenutzt werden. Als das Schlimmste bezeichnet es Adler in dieser Schrift, durch Überfürsorge dem Kind die Mitarbeit überflüssig zu machen und es dadurch in eine parasitäre (ausbeutende) Entwicklung zu drängen. »Die Familie, besonders die Mutter, müßte es verstehen, ihre Liebe zum Kind nicht bis zur Verwöhnung zu steigern.« – Welche Klippen der Erzieher im einzelnen zu umschiffen hat, lese man im Kapitel 13.
Auch auf viele andere bemerkenswerte Einzelheiten, wie etwa auf die sehr spezielle Traumtheorie und die erheblich überzeugendere Darstellung der aus individualpsychologischen Grundsätzen abzuleitenden Verhaltensanweisungen für den Therapeuten oder Berater, soll hier nicht näher eingegangen werden. Sie haben mit dem Grundthema nicht unmittelbar zu tun.
Unsere abschließende Frage lautet: Was hat sich seit dem »nervösen Charakter« geändert? – Was ist geblieben?
Geblieben ist der geniale Wurf einer sozial- oder positionspsychologischen Neurosentheorie. Geblieben ist ferner die nachtwandlerische Sicherheit, mit der aus dem gegenwärtigen Lebensstil einerseits die frühkindlichen Beeinträchtigungserlebnisse oder -erfahrungen, andererseits die zu ihnen komplementären und zu ihrer Kompensation ins Auge gefaßten »Vollkommenheiten« oder »Lebensziele« und durch die Gegenüberstellung des Ausgangspunkts und des Zielpunkts die Leitoder Lebenslinie des neurotisch Kranken erraten und anschließend gesichert wird: Aus der Stellung in der Geschwisterreihe, aus der Würdigung noch feststellbarer ehemaliger Kinderfehler, aus – echten oder vermeintlichen – frühesten Erinnerungen, aus Tag- und Nachtträumen, aus dem Typ der Situationen, in denen die Beschwerden des Kranken aufzutreten pflegen, und endlich aus der Stellung, die der Kranke gegenüber dem Arzt bezieht. – Geblieben ist die unbeirrbare Konsequenz, mit der durch die Sammlung von kennzeichnenden Erlebnissen der Kranke selbst zur Einsicht in den Fehlansatz seines Lebens hingeleitet wird und zu der Erleuchtung, daß es befriedigendere Ansätze gibt – und mit der dabei auf jeden Überlegenheits- oder Führungsanspruch, auch auf jeden »Übertragungs«-versuch gegenüber dem Kranken verzichtet, seine volle Freiheit gewahrt und von vornherein klargestellt wird, daß er kein Gegenstand einer »Behandlung« oder »Beratung«, sondern ein für all sein Tun selbst verantwortliches Subjekt sei, dem der Arzt nur bei der Klärung der Grundlagen seiner eigenen Entscheidungen und Entschlüsse behilflich zu sein versucht. – Geblieben sind auch die Begriffe des Minderwertigkeitsgefühls und -komplexes, jedoch nunmehr ergänzt durch die Begriffe des (kompensatorisch-reaktiven) »Überlegenheitskomplexes« und des Gemeinschaftsgefühls oder sozialen Interesses, das Adler zwar schon 1908 zum ersten Mal erwähnt, mit dem er sich aber jetzt viel eingehender beschäftigt als je zuvor. – Geblieben ist nicht zuletzt die Überzeugung, daß die Weichen des Lebens in den ersten Kinderjahren gestellt werden und später ohne die Hilfe eines Therapeuten kaum noch umgestellt werden können, und im Zusammenhang damit das außerordentliche Gewicht, das von Adler auf eine wohlüberlegte, das Zugehörigkeitsbewußtsein, die Selbstsicherheit und den persönlichen Mut stärkende und dadurch Neurosen verhütende Früherziehung und auf die umfassende Verwirklichung der Vorbedingungen der Erziehbarkeit, also eines günstigen Familienklimas gelegt wird.
Auf den mehrfachen Wechsel der Ansichten Adlers über die verhältnismäßige Wichtigkeit der verschiedenen »gemeinschaftshindernden« Faktoren in der Kindheit wurde schon oben hingewiesen.
Einige Änderungen beziehen sich nur auf den Sprachgebrauch. Das Wort »Leitlinie« tritt kaum noch auf; an seiner Stelle stehen wechselnde Ausdrücke wie »Lebensplan«, »individuelles Bewegungsgesetz«, »Bewegungslinie« oder auch einfach »Gangart«. Neu ist wohl auch die – durchaus zweckmäßige – Absetzung des Begriffs »Lebensstil« von dem Begriff der Leitlinie als deren Verwirklichung im sichtbaren Verhalten. Das Wort »Fiktion« wird jetzt, in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch, nicht mehr für gedankliche Hilfskonstruktionen, sondern nur noch für ausgesprochene Illusionen verwendet: in der Rede von der »fiktiven Welt« des Neurotikers. Auch der Ausdruck »Gegenfiktion« ist verschwunden und durch das allgemein gebräuchliche Wort »Ideal« ersetzt. Erstaunlicherweise spielt das Begriffspaar »Mut« und »Entmutigung« nur eine unbedeutende Rolle.
Bedeutsam ist die Unterscheidung zwischen dem »vermeintlichen« und dem »wahren« Sinn des Lebens, und die entscheidende Bedeutung, die für die Verwirklichung des zweiten einem gut ausgebildeten »Gemeinschaftsgefühl« zugeschrieben wird. Leider erfahren wir über die Komponenten, Merkmale, Symptome eines gut ausgebildeten Gemeinschaftsgefühls nur aus zerstreuten Bemerkungen, die nirgends systematisch zusammengefaßt werden.
Wenn Adler immer wieder betont, daß von einem echten Gemeinschaftsgefühl nur gesprochen werden könne, wenn es sich auf die »ganze Menschheit und ihre Zukunft« bezieht, so ist man etwas verwundert, da der Gedanke an »die ganze Menschheit« nur einer intellektuellen Minderheit zugänglich ist, und man demnach etwa einer treuen Pflegerin, die Jahre ihres Lebens ihrem Schützling opfert, und dasselbe bei jedem anderen Schützling tun würde, oder einem Kellner, dem es Freude macht, seine Gäste gut zu bedienen, ohne dabei den leisesten Gedanken an die »ganze Menschheit« zu haben, kein echtes und voll ausgebildetes Gemeinschaftsgefühl zugestehen dürfte. Gemeint, aber nicht genügend herausgearbeitet, ist offenbar etwas anderes: nämlich daß die Hingabe an einen Nächsten oder an eine konkrete, gegebene Gemeinschaft nicht an Bedingungen über die besondere Art der Menschen geknüpft sein darf, die diese Gemeinschaft zusammensetzen, sondern grundsätzlich jedem Mitmenschen und jeder Gruppe gegenüber geübt wird, in die man vom Schicksal hineingestellt wurde. Hier ist das Neue Testament klarer.
Die Art und Weise, wie Adler den Begriff des Gemeinschaftsgefühls behandelt, bezeichnet keinen Abschluß, sondern einen Anfang: Einerseits ist an vielen Stellen, an denen man sinngemäß die Nennung der Gemeinschaft selbst als eines psychologischen Faktums erwartet, nur vom Gemeinschaftsgefühl die Rede, so daß dieser Begriff die Rolle eines Schleiers spielt, hinter dem die Gemeinschaft selbst sich nur andeutet. Andererseits wird das Gemeinschaftsgefühl zu einer Art Zauberstab oder deus ex machina erhoben, durch den nicht nur das friedliche Zusammenleben und das fruchtbare Zusammenarbeiten, sondern jegliche schöpferische Leistung erklärt werden soll, ohne daß dies überzeugend begründet wird.
Kopfschmerzen verursachen dem mitdenkenden Leser auch die Ausflüge in die Naturphilosophie, mit ihren manchmal geradezu beängstigenden Verallgemeinerungen und Vereinfachungen. Das Bemühen, an die biologische Entwicklungslehre Anschluß zu gewinnen, und zwar mit teils darwinistischen, teils lamarckistischen Ansätzen, führt dazu, daß die im »nervösen Charakter« erreichte Trennung zwischen dem Bemühen, spezielle, örtliche, umschriebene Schwächen zu überwinden, und den Versuchen, eine als unbefriedigend empfundene soziale Position zu korrigieren, wieder verwischt wird. Wenn Adler schon der »lebenden Materie« einen »Drang nach Überlegenheit« zuschreibt, der im Grund dasselbe sein soll wie der Drang eines Unternehmers, die Konkurrenz zu überflügeln, so ist das eine ebenso kurzschlüssige Philosophie, wie wenn Freud den Lebensüberdruß eines Schwermütigen auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zurückzuführen sucht.
Ich übergehe die Überlegungen über die Rolle des Minderwertigkeitsgefühls im Leben des Kindes, die ich angesichts vieler gutgesicherter Erfahrungen an fröhlichen, mit der Welt zufriedenen, unverzärtelten Kindern in günstiger Umgebung als stark überbetont und überverallgemeinert bezeichnen muß, und gehe nur noch auf die in diesem Werk neue These von dem »Streben nach Vollkommenheit« als Grundantrieb alles produktiven Verhaltens ein.
Über diese These hat es nicht ohne Grund Meinungsverschiedenheiten gegeben. Wenn, wie in der ganzen Schrift, nicht angegeben wird, wer oder was denn dabei vollkommen sein oder werden solle, so kann es sich nach deutschem Sprachgebrauch nur um einen erwünschten Zustand des Strebenden selbst handeln. Er selber will vollkommen werden; und man kann, wenn man Adlers Gedanken so auslegt, die Rolle der Gemeinschaft als die eines Mittels auffassen, zur persönlichen Vollkommenheit zu gelangen, da es dazu keine andere Möglichkeit gibt. Wenn man das Wort so versteht, ist das Streben nach Vollkommenheit im Rahmen der Individualpsychologie entweder eine unter vielen neurotischen Leitlinien (die gar nicht selten ist), oder eine theoretische Verirrung. In diesem Fall muß man Rudolf Dreikurs recht geben, wenn er betont, daß man an einem gesunden Menschen vielfach das lebhafte Streben beobachten kann, gewisse Fehler abzulegen, gewisse Fähigkeiten – zum Beispiel die Beherrschung einer fremden Sprache oder den Umgang mit Kindern – zu verbessern, oder sich in gewissen Lagen – zum Beispiel, wenn der Ehemann wieder einmal zu spät zum Essen kommt – vernünftiger zu benehmen –, daß dabei aber die »Vollkommenheit« nicht im Ernst als das »eigentliche« Ziel betrachtet werden kann.
Es gibt aber von Adler selbst einen kleinen Aufsatz aus dem Jahr 1928[9], über den ich hier so genaue Angaben mache, weil er, wie ich meine, einen Wendepunkt in der Entwicklung der Individualpsychologie darstellt. Sein Titel lautet: ›Kurze Bemerkungen über Vernunft, Intelligenz und Schwachsinn.‹ Hier tauchen, vielleicht mit etwas anderen Worten, die Begriffe der Selbstvergessenheit, der Versenkung in ein Werk, der Identifizierung mit ihm auf, und insofern ein Streben nicht nach der eigenen Vollkommenheit, sondern nach der Vollkommenheit des Werks. Das hat mehrere Folgen. Erstens: Das »Gemeinschaftsgefühl« kann von hier aus auch als ein Sonderfall dieses außersubjektiven Vollkommenheitsstrebens verstanden werden, nämlich als das Gefühl für das, was für die Gemeinschaft am besten ist, und die Bereitschaft, eben dies zu tun. In diesem Fall hört die Gemeinschaft auf, nur ein Mittel zur Erreichung der persönlichen Vollkommenheit zu sein. – Zweitens: Das Gefühl für das, was für ein Werk, für eine Aufgabe, für die Lösung eines Problems am besten ist, das Gefühl für das, was die Lage fordert, braucht dann, wenn die fragliche Lage nicht die einer Gruppe ist, nicht mehr künstlich auf das Gemeinschaftsgefühl zurückgeführt zu werden, wie das in der vorliegenden Schrift noch geschieht. Sondern umgekehrt: Das Gemeinschaftsgefühl wird zum Sonderfall einer allgemeineren Haltung, die Fritz Künkel genau 1928 schlicht als »Sachlichkeit« bezeichnet hat. Wird das »Streben nach Vollkommenheit« so umgedeutet, so hat H. L. Ansbacher recht, wenn er in der Annahme eines Strebens nach Vollkommenheit eine in der Sache angelegte Stufe der Entwicklung individualpsychologischen Denkens sieht.
Adler selbst kommt, fünf Jahre nach dem erwähnten Aufsatz, auf diesen Gedanken nicht mehr zurück. Wenn man ihn weiter verfolgt, so mündet er in die Forderung des Sich-selbst-Vergessens ein, auf die, auf ganz anderen Wegen, unter anderem auch Max Wertheimer und Michael Polanyi gestoßen sind, und die in der Mystik aller Zeiten und Länder als die Grundvoraussetzung nicht nur für den Frieden der Seele, sondern auch für jedes vollkommene Werk bezeichnet wird.
Diesen Faden hat, wie gesagt, Fritz Künkel in seiner Einführung in die Charakterkunde (1928) aufgenommen und weitergesponnen. Er hat sich dadurch, trotz der Zweifel Adlers (S. 203), als durchaus »sattelgerechter« Individualpsychologe erwiesen.
Bebenhausen, im Juli 1972
Wolfgang Metzger
»Der Mensch weiß viel mehr, als er versteht.«
Alfred Adler
Vorwort
Während meines Lebens als ärztlicher Berater in Fällen von seelischen Erkrankungen, als Psychologe und Erzieher in Schule und in Familien hatte ich stets Gelegenheit, ein ungeheures Menschenmaterial zu überblicken. Ich machte es mir zur strengen Aufgabe, nichts auszusagen, was ich nicht aus meiner Erfahrung belegen und beweisen konnte. Daß ich dabei mit vorgefaßten Meinungen anderer, die oft viel weniger intensiv ein Menschenschicksal beobachten konnten, gelegentlich in Widerspruch geriet, ist nicht verwunderlich. Dabei befleißigte ich mich, sachliche Argumente anderer kaltblütig zu prüfen, was ich um so leichter tun konnte, da ich mich an keine strenge Regel und Voreingenommenheit gebunden glaube, vielmehr dem Grundsatz huldige: alles kann auch anders sein. Das Einmalige des Individuums läßt sich nicht in eine kurze Formel fassen, und allgemeine Regeln, wie sie auch die von mir geschaffene Individualpsychologie aufstellt, sollen nicht mehr sein als Hilfsmittel, um vorläufig ein Gesichtsfeld zu beleuchten, auf dem das einzelne Individuum gefunden – oder vermißt werden kann. Diese Wertung von Regeln, die stärkere Betonung einer Anschmiegsamkeit und Einfühlung in Nuancen stärkte jedesmal meine Überzeugung von der freien schöpferischen Kraft des Individuums in der ersten Kindheit und seiner gebundenen Kraft später im Leben, sobald das Kind sich ein festes Bewegungsgesetz für sein Leben gegeben hat. In dieser Betrachtung, die dem Kinde für sein Streben nach Vollkommenheit, Vollendung, Überlegenheit oder Evolution einen freien Weg läßt, lassen sich die Einflüsse der angeborenen Fähigkeiten, ob nun allgemein oder modifiziert menschlich sowie die Einflüsse der Umgebung und Erziehung als Bausteine betrachten, aus denen das Kind in spielerischer Kunst seinen Lebensstil aufbaut.
Und noch eine weitere Überzeugung drängte sich mir auf. Der Aufbau des kindlichen Lebensstils könnte, ohne Rückschläge zu erleiden, dem Leben nur standhalten, wenn er sub specie aeternitatis richtig aufgebaut wäre. Stets aufs neue begegnen ihm immer verschiedene Aufgaben, die weder mit eingeübten Reflexen (bedingten Reflexen), noch mittels angeborener seelischer Fähigkeiten zu lösen sind. Es wäre das größte Wagnis, ein Kind mit eingeübten Reflexen oder ausgestattet mit angeborenen Fähigkeiten den Proben einer Welt auszusetzen, die stets andere Probleme aufwirft. Immer bliebe die größte Aufgabe dem nimmer ruhenden schöpferischen Geist vorbehalten, der freilich in die Bahn des kindlichen Lebensstils gezwängt bleibt. Dorthin läuft alles auch ab, was Namen hat in den verschiedenen psychologischen Schulen: Instinkte, Triebe, Gefühl, Denken, Handeln, Stellungnahme zu Lust und Unlust und endlich Eigenliebe und Gemeinschaftsgefühl. Der Lebensstil verfügt über alle Ausdrucksformen, das Ganze über die Teile. Ist ein Fehler vorhanden, so steckt er im Bewegungsgesetz, im Endziel des Lebensstils und nicht im Teilausdruck.
Ein Drittes hat mich diese Einsicht gelehrt: Alle scheinbare Kausalität im Seelenleben stammt aus der Neigung vieler Psychologen, ihre Dogmen in einer mechanistischen oder physikalischen Verkleidung zu produzieren. Bald dient zum Vergleich ein Pumpwerk, das auf und nieder geht, bald ein Magnet mit polaren Enden, bald ein arg bedrängtes Tier, das um die Befriedigung seiner elementaren Bedürfnisse kämpft. In solcher Sicht ist freilich wenig von fundamentalen Verschiedenheiten zu sehen, wie sie das menschliche Seelenleben aufweist. Seit sogar die Physik ihnen den Boden der Kausalität entzogen hat, um statt dessen einer statistischen Wahrscheinlichkeit im Ablauf des Geschehens das Wort zu reden, dürfen wohl auch Angriffe auf die Individualpsychologie wegen ihrer Leugnung der Kausalität im seelischen Geschehen nicht mehr ernst genommen werden. Es dürfte auch dem Laien einleuchten, daß die millionenfache Mannigfaltigkeit in den Fehlleistungen als Fehlleistung »verstanden«, aber nicht kausal begriffen werden kann.
Wenn wir nun mit Recht den Boden der absoluten Sicherheit verlassen, auf dem sich viele Psychologen herumtummeln, so bleibt nur ein einziges Maß übrig, an dem wir einen Menschen messen können: seine Bewegung gegenüber den unausweichlichen Fragen der Menschheit. Drei Fragen sind jedem unwiderruflich aufgegeben: die Stellungnahme zu den Mitmenschen, der Beruf, die Liebe. Alle drei, untereinander durch die erste verknüpft, sind nicht zufällige Fragen, sondern unentrinnbar. Sie erwachsen aus der Bezogenheit des Menschen zur menschlichen Gesellschaft, zu den kosmischen Faktoren und zum andern Geschlecht. Ihre Lösung bedeutet das Schicksal der Menschheit und ihrer Wohlfahrt. Der Mensch ist ein Teil des Ganzen. Auch sein Wert hängt von der individuellen Lösung dieser Fragen ab. Man kann sich diese Fragen wie eine mathematische Aufgabe vorstellen, die gelöst werden muß. Je größer der Fehler, desto mehr Verwicklungen drohen dem Träger eines fehlerhaften Lebensstils, die nur auszubleiben scheinen, solange er nicht auf die Tragfähigkeit seines Gemeinschaftsgefühls geprüft wird. Der exogene Faktor, die Nähe einer Aufgabe, die Mitarbeit und Mitmenschlichkeit verlangt, ist immer der auslösende Faktor des fehlerhaften Symptoms, der Schwererziehbarkeit, der Neurose und der Neuropsychose, des Selbstmordes, des Verbrechens, der Süchtigkeit und der sexuellen Perversion.
Ist so die mangelnde Fähigkeit zum Mitleben entlarvt, dann ist die Frage, die sich aufwirft, nicht bloß rein akademisch, sondern von Wichtigkeit für die Heilung: wie und wann ist das Wachstum des Gemeinschaftsgefühls unterbunden worden? Bei dem Suchen nach den entsprechenden Vorkommnissen stößt man auf die Zeit der frühesten Kindheit und auf Situationen, die erfahrungsgemäß eine Störung in der richtigen Entwicklung verursachen können. Aber man erhält sie immer zugleich mit der fehlerhaften Antwort des Kindes. Und man versteht bei genauerer Einsicht in die zutage getretenen Verhältnisse das eine Mal, daß ein berechtigter Eingriff fehlerhaft, das andere Mal, daß ein fehlerhafter Eingriff fehlerhaft, ein drittes Mal, daß – weit seltener – ein fehlerhafter Eingriff fehlerlos beantwortet wurde, versteht auch, daß in dieser Richtung, die immer auf Überwindung gerichtet ist, weiter trainiert wurde, ohne daß entgegengesetzte Eindrücke zum Aufgeben des einmal eingeschlagenen Weges geführt hätten. Erziehung, soweit man auch ihren Rahmen stecken möchte, heißt demnach nicht nur günstige Einflüsse wirken lassen, sondern auch genau nachsehen, was die schöpferische Kraft des Kindes aus ihnen gestaltet, um dann, bei fehlerhafter Gestaltung, den Weg zur Besserung zu ebnen. Dieser bessere Weg ist unter allen Umständen die Steigerung der Mitarbeit und des Interesses an den anderen.
Hat das Kind sein Bewegungsgesetz gefunden, in dem Rhythmus, Temperament, Aktivität und vor allem der Grad des Gemeinschaftsgefühls beobachtet werden müssen, Erscheinungen, die oft schon im zweiten Lebensjahre, sicher im fünften erkannt werden können, dann sind damit auch alle seine anderen Fähigkeiten in ihrer Eigenart an dieses Bewegungsgesetz gebunden. In dieser Schrift soll hauptsächlich die daran anknüpfende Apperzeption, wie der Mensch sich und die Außenwelt sieht, betrachtet werden. Mit anderen Worten: die Meinung, die das Kind, und später in der gleichen Richtung der Erwachsene, von sich und von der Welt gewonnen hat. Auch diese Meinung läßt sich nicht aus den Worten und Gedanken des Untersuchten gewinnen. Sie alle sind allzusehr im Banne des Bewegungsgesetzes, das nach Überwindung zielt und demnach sogar im Falle einer Selbstverurteilung noch nach der Höhe schielen läßt. Wichtiger ist der Umstand, daß das Ganze des Lebens, von mir konkret Lebensstil genannt, vom Kinde in einer Zeit aufgebaut wird, wo es weder eine zureichende Sprache noch zureichende Begriffe hat. Wächst es in seinem Sinne weiter, dann wächst es in einer Bewegung, die niemals in Worte gefaßt wurde, daher unangreifbar für Kritik, auch der Kritik der Erfahrung entzogen ist. Man kann hier nicht von einem etwa gar verdrängten Unbewußten reden, vielmehr von Unverstandenem, dem Verstehen Entzogenem. Aber der Mensch spricht zum Kenner mit seinem Lebensstil und mit seiner Haltung zu den Lebensfragen, die Gemeinschaftsgefühl zu ihrer Lösung erfordern.
Was nun die Meinung des Menschen von sich und von der Außenwelt anlangt, so kann sie am besten daraus entnommen werden, welchen Sinn er im Leben findet und welchen Sinn er seinem eigenen Leben gibt. Daß hier die mögliche Dissonanz zu einem idealen Gemeinschaftsgefühl, zum Mitleben, Mitarbeiten, zur Mitmenschlichkeit klar durchdringt, liegt auf der Hand.
Wir sind nun vorbereitet zu verstehen, welche Bedeutung darin liegt, über den Sinn des Lebens etwas zu erfahren und auch darüber, worin verschiedene Menschen den Sinn des Lebens sehen. Wenn es für den außerhalb unserer Erfahrung liegenden Sinn des Lebens wenigstens teilweise eine tragfähige Erkenntnis gibt, dann ist es klar, daß er diejenigen ins Unrecht setzt, die zu ihm in auffallendem Widerspruch stehen.
Wie man sieht, ist der Autor bescheiden genug, einen anfänglichen Teilerfolg anzustreben, der ihm durch seine Erfahrungen genügend gestützt zu sein scheint. Er unterzieht sich dieser Aufgabe um so lieber, als da die Hoffnung winkt, daß bei einigermaßen klarer Erkenntnis des Sinnes des Lebens nicht nur ein wissenschaftliches Programm für weitere Forschung in seiner Richtung erwächst, sondern auch, daß mit wachsender Erkenntnis die Zahl derer namhaft wächst, die durch den besser erkannten Sinn des Lebens für diesen Sinn gewonnen werden können.
1.Die Meinung über sich und über die Welt
Es ist für mich außer Zweifel, daß jeder sich im Leben so verhält, als ob er über seine Kraft und über seine Fähigkeiten eine ganz bestimmte Meinung hätte; ebenso, als ob er über die Schwierigkeit oder Leichtigkeit eines vorliegenden Falles schon bei Beginn seiner Handlung im klaren wäre; kurz,