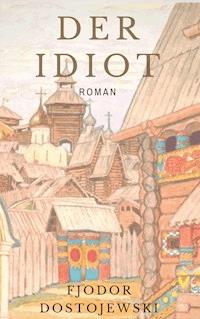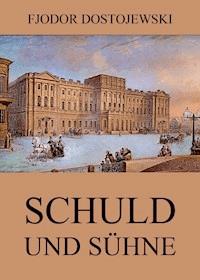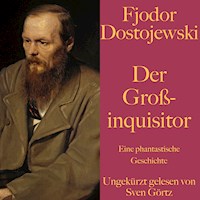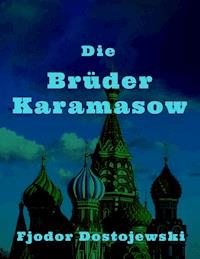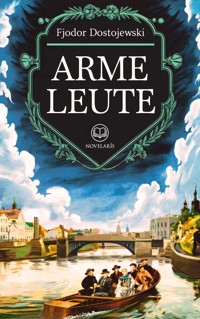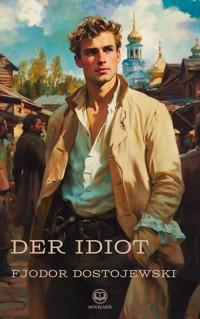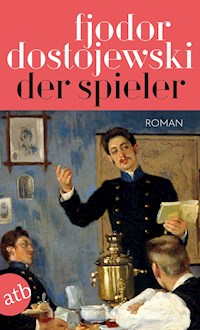
7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Glück in der Liebe oder im Spiel?
Alexej ist Hauslehrer in der Familie eines russischen Generals in Roulettenburg. Bisher glaubte er, seine Liebe zu dessen Tochter Polina sei der eigentliche Sinn seines Lebens. Doch als er mit seinem letzten Goldstück 100 000 Florin gewinnt, ergreift mehr und mehr die Spielleidenschaft von ihm Besitz.
„Dostojewski, der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte: Er gehört zu den schönsten Glücksfällen meines Lebens.“ Friedrich Nietzsche
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Ähnliche
Über das Buch
Glück in der Liebe oder im Spiel?
Alexej ist Hauslehrer in der Familie eines russischen Generals in Roulettenburg. Bisher glaubte er, seine Liebe zu dessen Tochter Polina sei der eigentliche Sinn seines Lebens. Doch als er mit seinem letzten Goldstück 100 000 Florin gewinnt, ergreift mehr und mehr die Spielleidenschaft von ihm Besitz.
»Dostojewski, der einzige Psychologe, von dem ich etwas zu lernen hatte: Er gehört zu den schönsten Glücksfällen meines Lebens.« Friedrich Nietzsche
Über Fjodor Dostojewski
Fjodor Dostojewski (1821–1881) wurde in Moskau als Sohn eines Militärarztes und einer Kaufmannstochter geboren. Er studierte an der Petersburger Ingenieurschule und widmete sich seit 1845 ganz dem Schreiben. 1849 wurde er als Mitglied eines frühsozialistischen Zirkels verhaftet und zum Tode verurteilt. Unmittelbar vor der Erschießung wandelte man das Urteil in vier Jahre Zwangsarbeit mit anschließendem Militärdienst als Gemeiner in Sibirien um. 1859 kehrte Dostojewski nach Petersburg zurück, wo er sich als Schriftsteller und verstärkt auch als Publizist neu positionierte.
Wichtigste Werke: »Arme Leute« (1845), »Der Doppelgänger« (1846), »Erniedrigte und Beleidigte« (1861), »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1862), »Schuld und Sühne« (1866), »Der Spieler« (1866), »Der Idiot« (1868), »Die Dämonen« (1872), »Der Jüngling« (1875), »Die Brüder Karamasow« (1880).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Fjodor Dostojewski
Der Spieler
Aus den Notizen eines jungen Mannes
Roman
Aus dem Russischen von Werner Creutziger
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Zu diesem Band
Anmerkungen
Impressum
Kapitel I
Nach zwei Wochen Abwesenheit kam ich endlich zurück. Seit drei Tagen schon waren die Unsern in Roulettenburg. Ich hatte gemeint, sie warteten Gott weiß wie auf mich, aber das war ein Irrtum. Der General gab sich höchst lässig, redete von oben herab zu mir und schickte mich zu seiner Schwester. Es lag auf der Hand, daß sie irgendwo für kurze Zeit Geld aufgetrieben hatten. Mir schien sogar, daß es dem General einige Pein bereitete, auf mich zu blicken. Marja Filippowna hatte gerade schrecklich viel zu schaffen und sprach unaufmerksam mit mir; das Geld jedoch nahm sie entgegen, sie zählte es nach und hörte sich meinen ganzen Bericht an. Zum Mittagessen erwartete man Mesenzow, den kleinen Franzosen und noch einen Engländer – nach Moskauer Brauch: Kaum ist Geld im Haus, wird zum Mahle geladen. Polina Alexandrowna fragte mich, als sie mich erblickte, wo ich so lange gewesen sei, und eilte weiter, ohne meine Antwort abzuwarten. Versteht sich, das tat sie mit Absicht. Dennoch werden wir einander manches sagen müssen. Viel hat sich angehäuft.
Mir hat man ein Zimmerchen im dritten Stock des Hotels zugedacht. Hier weiß man, daß ich zur Suite des Generals gehöre. Aus allem ist zu schließen, daß sie in der Kürze der Zeit schon von sich reden gemacht haben. Den General halten hier alle für einen steinreichen russischen Würdenträger. Wohlweislich trug er mir noch vor dem Mittagessen neben anderen Besorgungen auf, zwei Tausendfrankennoten wechseln zu lassen. Das tat ich im Hotelkontor. Jetzt werden uns die Leute als Millionäre ansehen, wenigstens eine Woche lang. Ich wollte gerade Mischa und Nadja holen, um mit ihnen spazierenzugehen, da rief man mich von der Treppe zum General; er geruhte sich zu erkundigen, wohin ich die Kinder führen wolle. Dieser Mensch kann mir einfach nicht offen in die Augen blicken; mag sein, daß er’s wirklich will, aber ich antworte ihm jedesmal mit einem so eindringlichen, das heißt unehrerbietigen Blick, daß es ihn wohl verwirrt. In arg hochtrabender Rede, eine Phrase auf die andere bauend und am Ende sich ganz verheddernd, gab er mir zu verstehen, daß ich mit den Kindern irgendwo im Park spazierengehen solle, nur recht weit weg vom Kurhaus.
Schließlich geriet er ganz in Rage und endete schroff: »Womöglich führen Sie die Kinder ins Kurhaus, zum Roulett. Sie müssen schon entschuldigen«, flocht er ein, »aber ich weiß, Sie sind noch ziemlich leichtsinnig und bringen es wohl fertig, zu spielen. Jedenfalls, wenn ich auch nicht Ihr Mentor bin und dieses Amt keineswegs auf mich zu nehmen wünsche, so habe ich doch in gewissem Maße das Recht, zu wünschen, daß Sie mich sozusagen nicht kompromittieren.«
»Ich habe doch gar kein Geld«, erwiderte ich ruhig. »Um welches zu verlieren, muß man es haben.«
»Sie werden es unverzüglich erhalten«, antwortete der General, ein wenig errötend. Er wühlte in seinem Schreibtisch, sah in einem Heft nach, und es zeigte sich, daß ich bei ihm ungefähr hundertzwanzig Rubel guthatte.
»Ja, also, um ins reine zu kommen …«, murmelte er. »Wir müssen in Taler umrechnen. Hier haben Sie erst mal hundert Taler, eine runde Summe; der Rest geht Ihnen natürlich nicht verloren.«
Ich nahm stumm das Geld.
»Nehmen Sie mir meine Worte bitte nicht übel; Sie sind so schnell gekränkt … Meine Bemerkung hatte sozusagen nur warnenden Charakter, und Sie zu warnen, glaube ich denn noch ein gewisses Recht zu haben.«
Als ich gegen Mittag mit den Kindern vom Spaziergang zurückkehrte, begegnete mir eine ganze Kavalkade. Die Unsern hatten sich aufgemacht, irgendwelche Ruinen zu besichtigen. Zwei prächtige Kutschen, großartige Pferde! Mademoiselle Blanche in der einen Kutsche mit Marja Filippowna und Polina; der kleine Franzose, der Engländer und unser General hoch zu Roß. Die Passanten blieben stehen und schauten; die Sache wirkte; nur daß für den General die Dinge schlecht standen. Ich rechnete mir aus: Viertausend Franken habe ich gebracht, dazu kommt das Geld, das sie offenbar für kurze Zeit selbst aufgetrieben haben; also verfügen sie jetzt über sieben- oder achttausend Franken; das ist zuwenig für Mademoiselle Blanche.
Mademoiselle Blanche wohnt auch in unserm Hotel, mit ihrer Mutter; in der Nähe ist unser kleiner Franzose abgestiegen. Die Diener melden ihn als »monsieur le compte«. Mademoiselle Blanches Mutter nennt sich »madame la comptesse«; nun ja, vielleicht sind sie wirklich comte und comtesse.
Ich hatte es gewußt, daß monsieur le comte mich nicht erkennen werde, wenn wir beim Mittagessen zusammenträfen. Dem General kam es natürlich nicht in den Sinn, uns miteinander bekannt zu machen oder auch nur mich ihm zu empfehlen; monsieur le comte wiederum ist selbst in Rußland gewesen und weiß, was für ein unbedeutender Wicht so ein Hauslehrer ist – ein outchitel, wie sie sagen. Er kennt mich übrigens sehr wohl. Immerhin bin ich auch ungeladen bei Tisch erschienen; der General hatte wohl Verfügung zu treffen vergessen, sonst hätte er mich gewiß zum Mittagessen an die table d’hôte geschickt. Ich stellte mich von mir aus ein, was den General bewog, mißbilligend auf mich zu blicken. Die gute Marja Filippowna wies gleich auf einen Platz, auf den ich mich setzen solle; doch endgültig aus der Verlegenheit half mir die Anwesenheit von Mister Astley – ob man wollte oder nicht, ich gehörte nun zu ihrer Gesellschaft.
Dieser wunderliche Engländer war mir das erstemal in Preußen begegnet, auf der Eisenbahn, als ich den Unsern nachreiste; da saßen wir einander gegenüber. Später kreuzten sich unsere Wege, als ich nach Frankreich fuhr, und schließlich wieder in der Schweiz; im Laufe der letzten beiden Wochen geschah das zweimal, und nun also sah ich ihn in Roulettenburg wieder. Nie im Leben ist mir ein schüchternerer Mensch begegnet; er ist schüchtern bis zur Blödigkeit und weiß das natürlich selber, denn blöde ist er keineswegs. Er ist überhaupt ein sehr lieber und stiller Mensch. Bei der ersten Begegnung, in Preußen, brachte ich ihn zum Reden. Er erzählte mir, daß er in diesem Sommer am Nordkap gewesen sei und große Lust habe, einmal den Jahrmarkt in Nishni Nowgorod zu erleben. Ich weiß nicht, wie er mit dem General bekannt geworden ist; mir scheint, er ist maßlos verliebt in Polina. Als sie eintrat, flammte er auf wie das Morgenrot.
Er freute sich sehr, mich bei Tisch neben sich zu haben, und ich glaube, er erachtete mich schon als seinen Busenfreund.
An der Tafel gab der kleine Franzose arg den Ton an; er spielte den Lässigen gegenüber allen und machte sich wichtig. In Moskau, ich weiß noch, trieb er ein bißchen Hokuspokus. Hier redete er schrecklich viel von Finanzen und von der russischen Politik. Der General raffte sich ein paarmal auf zu widersprechen; doch er tat es bescheiden, einzig um nicht den letzten Rest von Stolz zu verlieren.
Ich war in einer seltsamen Gemütsverfassung; natürlich hatte ich mir schon während der ersten Hälfte des Mahles von neuem die Frage gestellt, die mich immerfort beschäftigte: Warum vertrödle ich meine Zeit mit diesem General, warum krieg ich’s ewig nicht fertig fortzugehen? Dann und wann blickte ich auf Polina Alexandrowna; sie wollte mich überhaupt nicht bemerken. Es endete damit, daß ich in Wut geriet und Grobheiten zu sagen beschloß.
Zuerst mischte ich mich mir nichts, dir nichts in ein fremdes Gespräch – laut und ohne rechten Anlaß. Mir kam es nur darauf an, den kleinen Franzosen zu schmähen. Ich wandte mich zum General, fiel ihm offenbar ins Wort und bemerkte ganz laut und deutlich, daß in diesem Sommer ein Russe nahezu überhaupt keine Möglichkeit habe, in einem Hotel an der table d’hôte zu speisen. Der General richtete auf mich einen erstaunten Blick.
»Wenn Sie sich selber achten«, schwadronierte ich weiter, »so werden Sie unbedingt schimpfliche Reden auf sich ziehen und widerwärtige Ausfälle ertragen müssen. In Paris und am Rhein, sogar in der Schweiz lümmeln an der table d’hôte so viele Polen herum und auch Franzosen, die mit ihnen ein Herz und eine Seele sind, daß Sie einfach nicht zu Wort kommen, wenn Sie nur Russe sind.«
Das sagte ich auf französisch. Der General blickte in großer Verlegenheit auf mich; er wußte nicht, ob er sich erzürnen oder über meine Ungehörigkeit nur wundern sollte.
»Offensichtlich hat Ihnen irgendwer irgendwo eine Lektion erteilt«, sagte der kleine Franzose lässig und verächtlich.
»Ich habe mich in Paris zuerst mit einem Polen gestritten«, erwiderte ich, »dann mit einem französischen Offizier, der für den Polen Partei ergriff. Darauf aber ging ein Teil der Franzosen auf meine Seite über, weil ich ihnen erzählte, wie ich einem Monsignore in den Kaffee spucken wollte.«
»Wahrhaftig?« fragte der General gravitätisch-unsicher und schaute sich sogar um. Der kleine Franzose musterte mich mißtrauisch.
»Jawohl«, antwortete ich. »Da ich volle zwei Tage lang überzeugt war, daß ich in unserer Angelegenheit vielleicht auf einen Sprung nach Rom würde reisen müssen, ging ich in die Kanzlei der Gesandtschaft des Heiligen Vaters in Paris, um das Visum in den Paß eintragen zu lassen. Mich empfing ein Abbé, ein fünfzigjähriges dürres Männchen mit frostigen Zügen; er hörte mich höflich, aber außerordentlich frostig an und bat mich zu warten. Ich war zwar in Eile, doch ich setzte mich natürlich, um zu warten; ich holte die ›Opinion nationale‹ hervor und begann eine fürchterliche Schmähung Rußlands zu lesen. Unterdessen hörte ich, wie durch das Nachbarzimmer jemand zu Monsignore ging; ich sah, wie mein Abbé sich eifrig verbeugte. Ich wiederholte ihm meine Bitte; er wiederholte noch frostiger, ich möge bitte warten. Kurz darauf trat abermals ein Unbekannter ein, in Geschäften, ein Österreicher; man hörte ihn an und führte ihn sogleich hinauf. Das ärgerte mich nun sehr; ich erhob mich, trat zu dem Abbé und sagte in entschiedenem Tone, Monsignore könne ja wohl, da er empfange, auch meine Angelegenheit erledigen. Der Abbé fuhr, maßlos erstaunt, vor mir zurück. Er begriff einfach nicht, wie es zuging, daß ein nichtsbedeutender Russe sich Monsignores Gästen gleichzustellen wagte. Auf die hochmütigste Weise, so als freue er sich über die Gelegenheit, mich zu kränken, maß er mich vom Scheitel bis zur Sohle und schrie: ›Bilden Sie sich ein, Monsignore lasse Ihretwegen seinen Kaffee stehen?‹ Da schrie auch ich, aber lauter als er: ›Nehmen Sie zur Kenntnis, daß mich Monsignores Kaffee einen Dreck kümmert; es macht mir nichts aus, in ihn zu spucken! Wenn Sie nicht augenblicks meine Paßangelegenheit erledigen, gehe ich zu ihm selbst.‹
›Wie! Während der Kardinal bei ihm sitzt?‹ schrie das Kerlchen, der Abbé, wich entsetzt zurück, rannte zur Tür und stellte sich mit ausgebreiteten Armen vor sie, was heißen mochte, er werde eher sterben als mich durchlassen.
Darauf erwiderte ich, daß ich ein Ketzer, ein Barbar sei, ›que je suis hérétique et barbare‹, und daß mir diese Erzbischöfe, Kardinäle, Monsignores und was sonst noch – daß sie mir völlig gleichgültig seien. Kurz, ich gab zu verstehen, daß ich nicht lockerließ. Der Abbé richtete auf mich einen Blick voll grenzenloser Bosheit, riß mir den Paß aus der Hand und trug ihn hinauf. Eine Minute später war das Visum eingetragen. Hier, möchten Sie’s sehn?« Ich holte den Paß hervor und zeigte das römische Visum.
»Da haben Sie denn doch …«, begann der General.
»Das hat Sie gerettet: daß Sie sich selbst als Barbaren und Ketzer bezeichneten«, bemerkte mit hämischem Lächeln der kleine Franzose. »Cela n’était pas si bête.«
»Wirklich, wie soll man auf uns Russen blicken? Unsere Landsleute sitzen hier – wagen nicht zu mucksen und sind womöglich bereit, sich vom Russentum loszusagen. In Paris jedenfalls, in meinem Hotel, begann man viel aufmerksamer mit mir umzugehen, als ich allen von meinem Scharmützel mit dem Abbé erzählt hatte. Ein dicker polnischer Pan, der mir an der table d’hôte am feindseligsten begegnet war, schwand gleichsam dahin. Die Franzosen ertrugen es sogar, daß ich erzählte, wie ich vor zwei Jahren einen Menschen gesehen hätte, auf den ein französischer Karabinier im Jahre zwölf geschossen hatte – einzig deshalb, weil er das Gewehr entladen wollte. Dieser Mensch war damals ein zwölfjähriges Kind gewesen; seine Familie hatte Moskau nicht rechtzeitig verlassen.«
»Unmöglich«, brauste der Franzose auf, »ein französischer Soldat schießt nicht auf ein Kind!«
»Trotzdem war es so«, erwiderte ich. »Der mir es erzählt hat, war ein ehrenwerter Hauptmann im Ruhestand, und ich habe selber auf seiner Wange die Narbe gesehen, die von der Kugel stammte.«
Der Franzose begann viel und schnell zu reden. Der General setzte an, ihm beizupflichten, aber ich empfahl ihm, beispielsweise wenigstens ein paar Seiten in den »Aufzeichnungen« des Generals Perowski zu lesen, der 1812 in französische Gefangenschaft geraten war. Endlich brachte Marja Filippowna die Rede auf anderes. Der General war mit mir sehr unzufrieden, weil der Franzose und ich geradezu schrien. Mister Astley jedoch schien großes Gefallen an meinem Streit mit dem Franzosen zu finden; als wir nach dem Mahle aufstanden, lud er mich zu einem Gläschen ein. Gegen Abend gelang es mir, wie ich’s erwartet und gewünscht hatte, eine Viertelstunde mit Polina Alexandrowna zu sprechen. Das ergab sich beim Spaziergang. Alle waren in den Park gegangen, zum Kurhaus hin. Polina setzte sich auf eine Bank gegenüber dem Springbrunnen und ließ die kleine Nadja nahebei mit anderen Kindern spielen. Ich wiederum ließ Mischa zum Springbrunnen laufen, und so blieben wir endlich allein.
Zuerst ging es natürlich um Geschäfte. Polina wurde einfach wütend, weil ich ihr nicht mehr als siebenhundert Gulden übergab. Sie war überzeugt gewesen, daß ich ihr aus Paris, wo ich ihre Brillanten verpfändet hatte, wenigstens zweitausend brächte, sogar mehr.
»Ich brauche Geld um jeden Preis«, sagte sie. »Es muß beschafft werden, sonst bin ich einfach verloren.«
Ich erkundigte mich nach dem, was in meiner Abwesenheit geschehen war.
»Nichts weiter, nur daß aus Petersburg zwei Nachrichten eingetroffen sind: Zuerst hieß es, daß es Großmutter sehr schlecht geht, und zwei Tage später, daß sie wohl schon gestorben sei. Das hat Timofej Petrowitsch mitgeteilt«, erklärte Polina, »und der ist zuverlässig. Wir warten auf den letzten, endgültigen Bescheid.«
»Also ist hier alles auf Warten gestellt?« fragte ich.
»Natürlich, alle und alles; seit vollen sechs Monaten hofft man einzig auf dies.«
»Auch Sie?« fragte ich.
»Ich bin doch überhaupt nicht mit ihr verwandt, ich bin nur die Stieftochter des Generals. Aber ich weiß zuverlässig, daß sie mich im Testament bedacht hat.«
»Mir scheint, Ihnen wird sehr viel zufallen«, bestätigte ich.
»Ja, sie hatte mich lieb. Aber warum scheint es Ihnen so?«
»Sagen Sie«, antwortete ich mit einer Frage, »unser Marquis ist wohl auch in alle Familiengeheimnisse eingeweiht?«
»Und Sie, aus welchem Grund möchten Sie das wissen?« fragte Polina und blickte mich streng und kalt an.
»Es gibt schon Grund; wenn ich nicht irre, hat es der General schon fertiggebracht, von ihm Geld zu borgen.«
»Sie vermuten sehr richtig.«
»Nun, hätte er denn Geld gegeben, wenn er nichts über Babulenka wüßte? Ist Ihnen bei Tisch nicht aufgefallen, daß er zwei-, dreimal, als die Rede auf die Großmutter, auf Babuschka, kam, sie la baboulinka genannt hat. Was für enge, was für freundschaftliche Beziehungen!«
»Sie haben recht. Sobald er erfährt, daß nach dem Testament auch mir etwas zufällt, wird er sich um meine Hand bemühen. Ist es das, was Sie erfahren wollten?«
»Erst dann wird er sich bemühen? Ich glaubte, er tue es schon lange.«
»Sie wissen genau, daß es nicht so ist!« erwiderte Polina zornig. »Wo ist Ihnen dieser Engländer begegnet?« fuhr sie nach längerem Schweigen fort.
»Ich habe gewußt, daß jetzt diese Frage kommt.«
Ich berichtete ihr, wie ich Mister Astley mehrmals unterwegs getroffen hatte.
»Er ist schüchtern und geneigt, sich zu verlieben; und er ist natürlich in Sie verliebt?«
»Ja, das ist er«, antwortete Polina.
»Zudem ist er natürlich zehnmal reicher als der Franzose. Wie steht es denn, besitzt der Franzose wirklich etwas? Unterliegt das keinem Zweifel?«
»Keinem. Er hat ein Château. Das hat mir der General gestern entschieden versichert. Genügt Ihnen das?«
»Ich würde an Ihrer Stelle unbedingt den Engländer heiraten.«
»Warum?« fragte Polina.
»Der Franzose sieht besser aus, aber er ist niederträchtig; der Engländer ist nicht nur anständig, sondern er ist auch zehnmal reicher«, gab ich schroff zu bedenken.
»Ja; aber dafür ist der Franzose Marquis und klüger.« Das erwiderte sie mit der größten Gelassenheit.
Ich äußerte abermals Zweifel: »Stimmt das auch?«
»Jawohl.«
Meine Fragen mißfielen Polina schrecklich, und ich sah, daß sie mich mit dem schroffen, unbeherrschten Ton ihrer Antworten sehr gern in Zorn versetzt hätte; das sagte ich ihr sofort.
»Nun, es unterhält mich in der Tat, Sie wütend zu sehen. Allein schon dafür, daß ich Ihnen erlaube, solche Fragen und Gedanken auszusprechen, müssen Sie bezahlen.«
»Ich glaube wirklich, das Recht zu haben, Ihnen alle möglichen Fragen zu stellen«, antwortete ich gelassen, »eben weil ich bereit bin, auf jede erdenkliche Weise dafür zu zahlen, und weil mir mein Leben jetzt nichtig scheint.«
Polina lachte auf. »Das letztemal, auf dem Schlangenberg, haben Sie mir gesagt, Sie seien auf ein Wort von mir bereit, sich in einen Abgrund zu stürzen, und dort ging es, glaube ich, um einen von tausend Fuß Tiefe. Ich werde eines Tages dieses Wort einzig zu dem Zwecke aussprechen, zu sehen, wie Sie zu zahlen gedenken, und seien Sie sicher, ich bleibe fest. Sie sind mir verhaßt – gerade deshalb, weil ich Ihnen so viel erlaubt habe, und noch mehr verhaßt sind Sie mir, weil ich Sie so sehr brauche. Vorerst brauche ich Sie – ich muß Sie schonen.«
Langsam stand sie auf. Sie sprach gereizt. In der letzten Zeit beendete sie die Gespräche mit mir jedesmal erbost und gereizt, ja, wirklich erbost.
»Erlauben Sie die Frage: Was hat es mit Mademoiselle Blanche auf sich?« fragte ich, und ich war gewillt, sie nicht ohne Erklärung fortzulassen.
»Sie wissen selbst, was es mit Mademoiselle Blanche auf sich hat. Neues ist seither nicht dazugekommen. Mademoiselle Blanche wird wahrscheinlich Frau Generalin werden – versteht sich, sofern sich das Gerücht von Babuschkas Tod bestätigt. Denn sowohl Mademoiselle Blanche als auch ihre Mutter als auch ihr Großcousin, der Marquis – alle wissen sehr wohl, daß wir ruiniert sind.«
»Und der General ist wirklich und wahrhaftig verliebt?«
»Nicht darum geht es jetzt. Hören Sie, geben Sie gut acht: Nehmen Sie diese siebenhundert Gulden und gehen Sie zum Spieltisch; gewinnen Sie für mich beim Roulett, soviel Sie irgend können; ich brauche furchtbar dringend Geld.«
Nach diesen Worten rief sie Nadjenka herbei und ging zum Kurhaus; dort schloß sie sich der ganzen Gesellschaft um den General an. Ich hingegen bog, verwundert und nachdenklich, schon beim ersten Querweg links ab. Die Aufforderung, zum Roulett zu gehen, hatte mich wie ein Schlag getroffen. Seltsam, ich hatte wahrlich genug über anderes nachzudenken; indessen vertiefte ich mich ins Zergliedern meiner Empfindungen gegenüber Polina. Wirklich, leichter war mir in den zwei Wochen meiner Abwesenheit gewesen als jetzt, am Tag meiner Rückkehr, wenngleich ich mich unterwegs gesehnt hatte wie ein Verrückter, hierhin und dorthin gerannt war wie vom Feuer gesengt; sogar im Traum hatte ich sie immerfort vor mir gesehen. Einmal (das war in der Schweiz) muß ich, da ich im Eisenbahnabteil eingeschlafen war, im Traum laut mit Polina gesprochen und solcherart die Mitreisenden sehr erheitert haben. Und noch einmal stellte ich mir nun die Frage, ob ich sie liebe. Und abermals wußte ich keine Antwort, das heißt, besser gesagt, ich antwortete mir wieder, zum hundertsten Male, daß ich sie hasse. Ja, sie war mir verhaßt. Es gab Minuten (und zwar jedesmal, wenn wir ein Gespräch beendeten), da hätte ich mein halbes Leben drum gegeben, sie zu erwürgen! Ich schwöre, hätte sich die Möglichkeit geboten, ihr langsam einen Dolch in die Brust zu senken, so hätte ich sie, glaube ich, mit Wonne genutzt. Und dennoch, ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist: Wenn sie auf dem Schlangenberg, dem beliebten Aussichtspunkt, wirklich zu mir gesagt hätte: »Stürzen Sie sich hinab!«, so hätte ich mich augenblicks hinabgestürzt, und sogar mit Wonne. Das wußte ich. Es mußte entschieden werden, so oder so. Sie begreift das alles vorzüglich, und der Gedanke, daß ich aufs genaueste und deutlichste erkenne, wie ganz und gar unerreichbar sie mir ist, wie ganz und gar unerfüllbar meine Träume sind – dieser Gedanke bereitet ihr, davon bin ich überzeugt, außerordentlichen Genuß; denn ginge sie sonst bei ihrer Vorsicht und Klugheit so vertraut und offenherzig mit mir um? Mir scheint, sie hat bis heute so auf mich geblickt wie jene Kaiserin des Altertums, die sich in Gegenwart ihres Sklaven auszog, weil sie ihn nicht als einen Menschen erachtete. Ja, sie hat mich viele Male nicht als einen Menschen erachtet …
Nun aber hatte ich ihren Auftrag: um jeden Preis beim Roulett zu gewinnen. Mir fehlte die Zeit, darüber nachzudenken, wozu und wie bald ich zu gewinnen hatte und was für neue Überlegungen in diesem unaufhörlich berechnenden Kopf geboren wurden. Zudem hatten sich in diesen beiden Wochen offensichtlich eine Unmenge neuer Tatsachen ergeben, von denen ich noch keinen Begriff hatte. All das mußte ich ergründen, in alles mich hineinfinden, und zwar möglichst schnell. Vorerst aber blieb dazu keine Zeit – ich hatte mich an den Roulett-Tisch zu verfügen.
Kapitel II
Ich gestehe, es war mir unangenehm; zu spielen war ich zwar entschlossen, aber keineswegs war ich darauf eingestellt, den Anfang für andere zu machen. Es brachte mich sogar einigermaßen aus dem Konzept, und in die Spielsäle trat ich mit großem Verdruß. Vom ersten Augenblick an mißfiel mir dort alles. Nicht ausstehen kann ich die knechtische Beflissenheit in den Feuilletons der ganzen Welt, zumal in unseren russischen Zeitungen, wo unsere Schreiber fast jedes Frühjahr von zwei Dingen berichten: erstens von der gewaltigen Pracht und Herrlichkeit der Spielsäle in den Roulett-Städten am Rhein und zweitens von den Bergen Goldes, die dort angeblich auf den Tischen liegen. Sie werden gar nicht dafür bezahlt; derlei wird einfach den Lesern zuliebe berichtet, uneigennützig. Nichts von Pracht ist in diesen schäbigen Sälen zu finden, und Gold liegt nicht nur nicht haufenweis auf den Tischen, sondern kommt fast überhaupt nicht vor. Gewiß, irgendwann im Laufe der Saison taucht plötzlich ein Sonderling auf, vielleicht ein Engländer, vielleicht ein Asiat, ein Türke, wie dieses Jahr, und verliert oder gewinnt unversehens eine gewaltige Summe; die übrigen jedoch spielen alle um kleine Gulden, und im Durchschnitt liegt auf dem Tisch sehr wenig Geld. Nachdem ich in den Spielsaal getreten war (zum erstenmal im Leben), konnte ich mich noch eine ganze Weile nicht zum Spiel entschließen. Zudem störte mich das Gedränge. Aber auch wenn ich allein gewesen wäre, auch dann, glaube ich, wäre ich eher gegangen, als daß ich mich ans Spiel gemacht hätte. Ich gestehe, mir pochte das Herz, ich war keineswegs kaltblütig; es stand für mich seit langem fest, daß ich Roulettenburg als ein anderer Mensch verlassen würde, daß in meinem Schicksal unbedingt etwas Radikales und Endgültiges sich begeben werde. So muß es sein, so wird es sein. Mag es lächerlich aussehen, daß ich für mich so viel vom Roulett erwarte, noch lächerlicher kommt es mir vor, das zu meinen, was alle meinen: es sei dumm und sinnlos, etwas vom Spiel zu erwarten. Warum wäre das Spiel schlechter als eine beliebige andere Art des Gelderwerbs, zum Beispiel der Handel? Es stimmt schon, von hundert gewinnt einer. Doch was geht mich das an?
Jedenfalls kam ich zu dem Schluß, daß ich zunächst zusehen und an diesem Abend nichts Ernsthaftes anfangen sollte. Wenn an diesem Abend etwas geschähe, so höchstens aus Zufall und nebenher – davon ging ich aus. Ich mußte ja auch erst das Spiel selbst studieren; es gibt zwar Tausende von Beschreibungen des Rouletts, und ich habe sie immer mit größter Begierde gelesen, dennoch hatte ich, solange ich’s noch nicht selbst gesehen hatte, ganz und gar nicht begriffen, wie es wirklich vor sich geht.
Vor allem fand ich jegliches so schmutzig – irgendwie moralisch widerlich und schmutzig. Ich spreche keineswegs von den gierigen und aufgeregten Gesichtern, die zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umgeben. Ich sehe ganz und gar nichts Schmutziges in dem Wunsch, möglichst schnell möglichst viel Geld zu gewinnen; immer ist mir der Gedanke eines satten, feisten Moralisten höchst dumm vorgekommen – der hatte, als ein Spieler sich mit dem Hinweis auf geringen Einsatz sich hatte rechtfertigen wollen, erwidert, so sei es noch schlimmer, denn auch der Vorteil sei dann klein. Es stimmt freilich: kleiner Vorteil und großer Vorteil bedeuten nicht dasselbe. Es ist eine Frage des Verhältnisses. Was einem Rothschild wenig ausmacht, ist für mich gewaltiger Reichtum; und was Profit und Gewinn angeht, so richtet sich Menschenstreben wahrlich nicht nur beim Roulett, sondern allüberall darauf, vom andern Vorteil und Gewinn zu ziehen. Ob Profit und Gewinn überhaupt etwas Häßliches sind, ist eine andere Frage. Mit ihr befasse ich mich hier nicht. Daß ich selber im höchsten Grade beherrscht war von dem Wunsch zu gewinnen, das machte diese ganze Beutesucht, diesen ganzen Beutesuchtschmutz, wenn Sie so wollen, mir beim Eintritt in den Saal handlicher, vertrauter. Das ist mir doch am liebsten: wenn man miteinander keine großen Umstände macht, sondern offen und unverstellt handelt. Warum sollte man sich auch selber betrügen? Eine höchst unsinnige, unkluge Beschäftigung! Besonders abstoßend an all diesem Roulettgesindel war auf den ersten Blick der Respekt vor diesem Tun, die Ernsthaftigkeit, ja Ehrerbietigkeit, mit der sie die Tische umdrängten. Deshalb ist hier auch scharf unterschieden, welches Spiel zum mauvais genre gezählt wird und welches sich ein ordentlicher Mensch erlauben kann. Es gibt das Gentlemanspiel, und es gibt das Plebsspiel, das auf Beute zielt, das Spiel für jegliches Gesindel. Hier ist das streng unterschieden, und – wie gemein es im Grunde doch ist, dieses Unterscheiden! Ein Gentleman kann zum Beispiel fünf oder zehn Louisdor setzen, selten mehr, nun ja, wenn er sehr reich ist, mögen’s auch tausend Franken sein; aber ein Gentleman tut’s eigentlich allein um des Spieles, allein um des Vergnügens willen, eigentlich um der Möglichkeit willen, auf den Vorgang des Gewinnens oder Verlierens zu blicken; keineswegs darf er sich für den eignen Gewinn interessieren. Hat er gewonnen, so kann er beispielsweise laut auflachen, etwas Witziges zu einem sagen, der neben ihm steht; er kann sogar noch einmal setzen und dann noch verdoppeln, doch dies einzig aus Neugier, nur damit er seine Chancen erprobt, nur um des Addierens und Subtrahierens willen, frei von dem plebejischen Wunsche, zu gewinnen. Kurz, auf diese Spieltische, diese Rouletts und trente et quarante, darf er nicht anders blicken als auf einen Zeitvertreib, der einzig zu seinem Vergnügen unternommen wird. An den eignen Nutzen und die Tücken, auf die eine Spielbank eingerichtet ist, auf denen sie ruht, darf er nicht einmal denken. Ganz und gar nicht übel wäre es, wenn er beispielsweise die Vorstellung hätte, daß alle übrigen Spieler, das ganze Pack, das um die Gulden bangt – daß diese Leute genauso reich, genau solche Gentlemen seien wie er und daß sie einzig um der Zerstreuung, um der Kurzweil willen spielten. Diese gänzliche Unkenntnis der Wirklichkeit und der arglose Blick auf die Menschen wären natürlich im höchsten Maße aristokratisch. Ich habe gesehen, wie so manche Mama ihr Töchterchen, eine unschuldige, reich gekleidete fünfzehn- oder sechzehnjährige Miss, an den Spieltisch schob, wie sie ihr ein paar Goldmünzen gab und sie das Spiel lehrte. Ob das Fräulein gewann oder verlor, es lächelte und ging höchst befriedigt davon. Unser General trat solid und gewichtig an den Tisch; ein Diener stürzte herbei, um ihm einen Stuhl zu bieten; doch er bemerkte den Diener nicht; sehr lange brauchte er, den Beutel hervorzuholen, sehr lange, aus dem Beutel die dreihundert Franken in Gold zu nehmen; die setzte er auf Schwarz und gewann. Er nahm nicht den Gewinn, er ließ ihn stehen. Wieder kam Schwarz heraus; auch diesmal nahm er nicht den Gewinn, und als beim drittenmal die Kugel auf Rot rollte, hatte er auf einen Schlag eintausendzweihundert Franken verloren. Er ging mit einem Lächeln davon, er bewahrte Haltung. Ich bin sicher, es hat ihn schrecklich gewurmt; wäre der Einsatz doppelt oder dreimal so hoch gewesen, so hätte er nicht die Haltung bewahrt, sondern seine Erregung verraten. Übrigens hat in meiner Gegenwart ein Franzose an die dreißigtausend Franken zuerst gewonnen und dann verloren, und dies heiter und ohne jede Erregung. Ein wahrer Gentleman darf selbst dann, wenn er sein ganzes Vermögen verliert, keine Erregung zeigen. Das Geld muß so tief unterhalb der Gentleman-Ebene bleiben, daß es kaum irgendeiner Sorge wert ist. Höchst aristokratisch wäre es natürlich, den ganzen Schmutz des ganzen Gesindels und all der Umstände überhaupt nicht zu bemerken. Freilich ist manchmal das umgekehrte Verhalten nicht weniger aristokratisch, nämlich all das Gesindel zu bemerken, das heißt es anzublicken, sogar zu mustern, beispielsweise durchs Lorgnon, dies aber so zu tun, als nähme man die Menge und den Schmutz als eigentümliche Zerstreuung, gleichsam als Darbietung zum Gentlemansvergnügen. Man kann sich selbst in dieser Menge drängen und dennoch mit der uneingeschränkten Überzeugung um sich blicken, man selber sei ihr Beobachter und keineswegs ein Teil von ihr. Übrigens, gar zu eindringlich zu beobachten gehört sich andererseits auch nicht; es wäre einem Gentleman nicht angemessen, weil das Schauspiel, wie es auch sei, keine lange und eindringliche Beobachtung verdient. Es gibt überhaupt wenig Schauspiele, die es wert sind, von einem Gentleman übermäßig lange beobachtet zu werden. Mir persönlich hat es freilich geschienen, daß all dies höchst genaue Beobachtung sehr wohl verdiene, zumal durch einen, der nicht einzig des Beobachtens wegen gekommen ist, sondern der sich selbst aufrichtig und mit gutem Gewissen zu dem Gesindel hier zählt. Was meine innersten moralischen Überzeugungen betrifft, so finden sie in meinen gegenwärtigen Überlegungen natürlich keinen Platz. Soll dies denn so sein; ich sage es um der Gewissensreinheit willen. Doch eines bemerke ich dazu: In der ganzen letzten Zeit war es mir schrecklich zuwider, meine Handlungen und Gedanken an einer moralischen Elle zu messen, mochte die sein, wie sie wollte. Etwas anderes lenkte mich …
Das Gesindel spielt tatsächlich sehr schmutzig. Mir liegt sogar der Gedanke nahe, daß hier am Tisch ein gerüttelt Maß von gewöhnlichstem Diebstahl vor sich geht. Die Croupiers, die an den Schmalseiten der Tische sitzen, die Einsätze verfolgen und abrechnen, haben furchtbar viel zu tun. Auch so ein Gesindel – es sind größtenteils Franzosen. Im übrigen: Wenn ich hier beobachte und Eindrücke sammle, so keineswegs zu dem Zwecke, das Roulett zu beschreiben; ich will mir die Sache für mich selber zu eigen machen, will wissen, wie ich mich künftig verhalten soll. Ich habe zum Beispiel bemerkt, daß es die denkbar gewöhnlichste Sache ist, wenn irgendeiner, der am Tisch sitzt, plötzlich die Hand ausstreckt und sich das nimmt, was ein anderer gewonnen hat. Da wird gestritten, nicht selten auch geschrien und – ich bitte Sie, wie fänden Sie da Zeugen, wie könnten Sie beweisen, daß es Ihr Einsatz gewesen ist!
Anfangs war das ganze Treiben für mich ein Buch mit sieben Siegeln: schlecht und recht ahnte ich, suchte ich zu begreifen, daß man auf Zahlen, auf Gerade und Ungerade und auf Farbe setzen kann. Ich entschied mich, von Polina Alexandrownas Geld an diesem Abend hundert Gulden aufs Spiel zu verwenden. Der Gedanke, daß ich das Spielen begänne, indem ich nicht für mich selbst setzte, machte mich ganz unsicher. Mich beherrschte ein äußerst unangenehmes Gefühl, und es drängte mich, es schnell loszuwerden. Mir war ganz so, als untergrübe ich mein eigenes Glück, indem ich den Anfang für Polina machte. Wär’s denn denkbar, an den Spieltisch zu treten, ohne sogleich vom Aberglauben angesteckt zu werden? Fürs erste holte ich fünf Friedrichsdor, also fünfzig Gulden, hervor und setzte sie auf Gerade. Das Rad drehte sich, die Kugel fiel auf Dreizehn – ich hatte verloren. Mit einem krankhaften Gefühl, einzig um es irgendwie hinter mich zu bringen und dann wegzugehen, setzte ich noch einmal fünf Friedrichsdor, diesmal auf Rot. Rot kam heraus. Ich setzte alle zehn Friedrichsdor – wieder kam Rot heraus. Abermals setzte ich das Ganze – und wieder kam Rot heraus. Von den vierzig Friedrichsdor, die ich nun bekam, setzte ich zwanzig auf das mittlere Dutzend, ohne zu wissen, was das für Folgen haben kann. Man zahlte mir den dreifachen Betrag. So kam es, daß sich zehn Friedrichsdor für mich zu achtzig vermehrten. Ein ganz neues und sonderbares Gefühl ergriff so unerträglich von mir Besitz, daß ich zu gehen beschloß. Ich sagte mir, ich hätte ganz anders gespielt, wenn ich’s für mich getan hätte. Indessen setzte ich alle achtzig Friedrichsdor noch einmal auf Gerade. Diesmal kam Vier heraus; man zahlte mir zu den meinen noch einmal achtzig Friedrichsdor zu, ich strich den ganzen Haufen, nunmehr hundertsechzig Friedrichsdor, ein und verließ den Saal, um Polina Alexandrowna zu suchen.