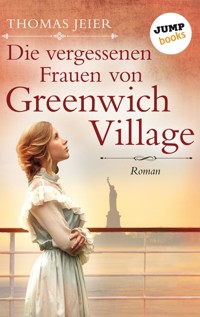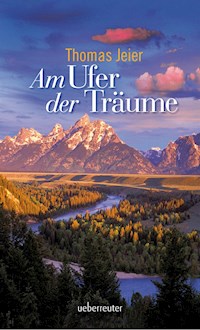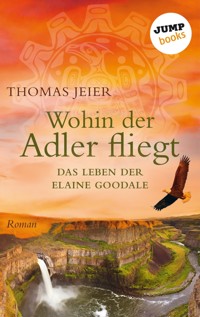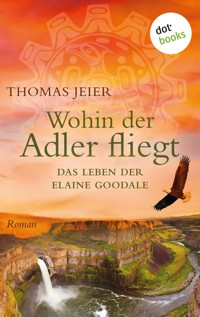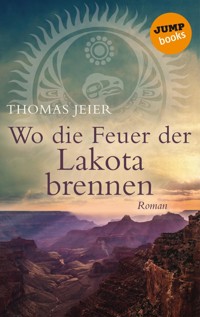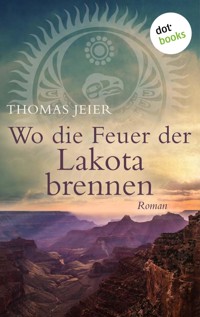Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aufbruch ins Ungewisse: der Abenteuer-Roman »Der Stein der Wikinger« von Thomas Jeier jetzt als eBook bei dotbooks. Eisland im Jahre 1000 nach Christus: Auf einem Raubzug erbeutet der junge Wikinger Hakon ein geheimnisvolles Buch. Darin entdeckt er ein Bild, das eine bisher ungekannte Abenteuerlust in ihm weckt … Mit dem Bildnis in den Händen macht Hakon sich auf die weite Reise in ein sagenumwobenes Land, von dem keiner seiner Männer je gehört hat – doch er ahnt nicht, welche Gefahren ihm auf seinem Weg bevorstehen! Knapp entrinnt der junge Wikinger auf hoher See dem sicheren Tod, nur um dabei in die Hände mächtiger Nordmänner zu fallen, die ihre ganz eigenen Pläne mit ihm haben … Wird Hakon das ferne Ziel seiner Reise jemals erreichen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Wikinger-Roman »Der Stein der Wikinger« von Thomas Jeier spielt im heutigen Island, Irland und dem Amerika der Indianer. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eisland im Jahre 1000 nach Christus: Auf einem Raubzug erbeutet der junge Wikinger Hakon ein geheimnisvolles Buch. Darin entdeckt er ein Bild, das eine bisher ungekannte Abenteuerlust in ihm weckt … Mit dem Bildnis in den Händen macht Hakon sich auf die weite Reise in ein sagenumwobenes Land, von dem keiner seiner Männer je gehört hat – doch er ahnt nicht, welche Gefahren ihm auf seinem Weg bevorstehen! Knapp entrinnt der junge Wikinger auf hoher See dem sicheren Tod, nur um dabei in die Hände mächtiger Nordmänner zu fallen, die ihre ganz eigenen Pläne mit ihm haben … Wird Hakon das ferne Ziel seiner Reise jemals erreichen?
Über den Autor:
Thomas Jeier wuchs in Frankfurt am Main auf, lebt heute bei München und »on the road« in den USA und Kanada. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet. Seine über 100 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Bei dotbooks erscheint auch:
Die Tochter des Schamanen
Biberfrau
Das Lied der Cheyenne
Die abenteuerliche Reise der Clara Wynn
Sterne über Vietnam
Flucht durch die Wildnis
Flucht vor dem Hurrikan
Die Reise zum Ende des Regenbogens
Die vergessenen Frauen von Greenwich Village
Die Reise zum Ende des Regenbogens
Hinter den Sternen wartet die Freiheit
Solange wir Schwestern sind
Blitzlichtchaos
Die Website des Autors: www.jeier.de
Der Autor im Internet: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2018
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Hoika Mikhail, vlastas
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96148-221-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Stein der Wikinger an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Thomas Jeier
Der Stein der Wikinger
Roman
dotbooks.
»Gibt es irgendwo einen Mann, König oder Prinz, zu Land oder zu Wasser, der so kühn ist wie wir? Niemand wagt es, sich mit uns Schwert gegen Schwert zu messen. Mögen wir im Recht oder Unrecht sein, Ackermann und Kaufmann, Reitersmann und Seemann, sie alle weichen vor uns.« Ivar Ragnarsson (866)
Prolog
Als James F. Hakon und sein Sohn Scott am frühen Morgen des 13. März 1899 ins Freie traten, ahnten sie nicht, dass sie noch vor dem Mittagessen eine Entdeckung von historischer Bedeutung machen würden. Wie alle Farmer hatten sie nur Augen für das Wetter. Im Westen über den Seen waren dunkle Wolken aufgezogen, und ferner Donner kündigte ein Gewitter an.
»Höchste Zeit, dass wir die alte Pappel ausgraben«, sagte James, ein kräftiger Mann mit rotblonder Löwenmähne, die wild nach allen Seiten abstand. Er trug keinen Hut. Seine Augen waren so blau wie der Himmel an einem der seltenen Sommertage in Minnesota. »Da braut sich was zusammen.«
»Bis Mittag sind wir sicher. Soll ich den Wallach mitnehmen?«, fragte Scott.
Sein Vater nickte, die Augen noch immer zum Himmel gewandt. »Ist wohl besser. Ohne den Gaul kommen wir nicht weit. Vergiss die Ketten nicht.«
Scott ging in den Stall und sattelte eines der beiden Arbeitspferde. Er legte ihm die Ketten, die sie für den Baumstumpf brauchen würden, über den Rücken, und führte es nach draußen. Der Wallach schnaubte unwillig, als er das nahende Gewitter spürte. Mit dem Pferd an den Zügeln überquerte Scott den Hof. Sein Vater hatte die Hacken, Pickel und Äxte aus dem Schuppen geholt und war bereits zum Acker unterwegs. Sein Haar leuchtete im Licht der wenigen Sonnenstrahlen, die durch die Wolken drangen.
Sie waren schon seit zwei Tagen damit beschäftigt, den Acker von Bäumen zu befreien, die beim Pflügen störten. An einigen Stellen war die Erde besonders fest, und es bedurfte großer Anstrengungen, die Baumstümpfe mit ihren verzweigten Wurzeln aus dem Boden zu ziehen. Einen besonders alten Baum mit verwitterter Rinde hatten sie sich für zuletzt aufgehoben.
Die Späne flogen nach allen Seiten, als sie ihre Äxte ins Holz trieben. Mit gleichmäßigen Schlägen gruben sie tiefe Keile in die Pappel. Sie waren so in ihre Arbeit vertieft, dass sie gar nicht merkten, wie der Wind auffrischte und die Gewitterwolken über den Himmel jagte. Zufrieden beobachteten sie, wie der Stamm knackend zu Boden fiel.
James wischte sich den Schweiß mit dem Hemdsärmel von der Stirn. Stirnrunzelnd betrachtete er den großen Baumstumpf mit seinen kräftigen Wurzeln, die teilweise über der Erde lagen. »Das wird ein hartes Stück Arbeit«, stöhnte er. »Ich wollte, wir hätten einen dieser neuen Motorwagen.«
Mit den Hacken und Schaufeln drangen sie bis zu den tieferen Wurzeln vor. Scott befestigte die Ketten am Sattelhorn des Wallachs und band sie um den freigelegten Baumstumpf. Er feuerte das schwerfällige Pferd an: »Nun mach schon! So ist es gut! Vorwärts, er bewegt sich schon!«
Doch der Baumstumpf löste sich kaum aus seiner Umklammerung. Er saß fest wie ein störrischer Backenzahn. »Halt, so geht es nicht«, hielt ihn sein Vater zurück, »die Wurzeln sitzen zu fest. Wir müssen noch tiefer graben.«
Sie trieben erneut die Hacken in die dunkle Erde und stießen plötzlich auf etwas Hartes. James fluchte wütend, als ihm der Aufprall die Hacke aus den Händen riss. Mit schmerzverzerrtem Gesicht griff er sich ans rechte Handgelenk. »Auch das noch! Als ob wir hier nicht schon genug Ärger hätten!«
Sie beugten sich über das Loch und sahen einen großen Stein aus der Erde ragen. Wie die Fangarme eines riesigen Kraken umschlossen ihn die Wurzeln, als weigerten sie sich, ihn herzugeben. Als Scott in das Loch kletterte und ihn von Erde und Wurzeln befreite, erkannten sie, dass er ungefähr einen Meter hoch und ein Drittel so breit war. »Sieht wie ein Grabstein aus«, sagte Scott.
»Unsinn! Hier draußen gab's keinen Friedhof«, erwiderte sein Vater.
Sie wuchteten den Stein aus dem Loch, mussten mehrmals ansetzen, um ihn über den Rand zu bekommen. Selbst zwei so starke Männer wie James und sein Sohn gerieten dabei ins Schwitzen. Der Stein war zentnerschwer, seine Oberfläche rau, doch er war kaum zu fassen. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis sie ihn endlich neben den umgestürzten Baum geschoben hatten.
»Mann!«, stöhnte James nur, als er den Stein losließ. Er griff nach der Wasserflasche an seinem Gürtel, nahm einen Schluck und reichte sie seinem Sohn. Scott war viel zu erledigt, um etwas zu sagen.
Ein heftiger Donnerschlag ließ den Boden erzittern. Es war dunkler geworden, als wollte die Nacht den Tag zurückerobern, und die ersten Regentropfen fielen vom Himmel. Böiger Wind fegte über den Acker. Die beiden Männer hielten ihre Gesichter in den Regen. Sie waren dankbar für die Dusche, die den Schweiß und den Schmutz von ihrer Haut und ihrer Kleidung wusch.
»Lass uns später weitermachen«, sagte James und schob sich die nassen Haare aus der Stirn. Er wollte gerade zu dem Wallach gehen, als sein Blick auf den Stein fiel. Überrascht blieb er stehen. »He, Scott! Sieh dir das an!«
Der Regen hatte einiges an Dreck von dem Stein gewaschen und eine Inschrift freigelegt, die fast die ganze Oberfläche bedeckte. Wie bei manchen Grabsteinen waren die Schriftzeichen tief in den Stein geschlagen worden.
Scott bückte sich und rieb mit der flachen Hand über die Inschrift. Verwundert betrachtete er die seltsamen Zeichen. Keine Buchstaben, wie er sie kannte, eher keilförmige Einkerbungen, die an die Spur eines Vogels erinnerten. »Seltsam«, wunderte er sich, »so was hab ich noch nie gesehen.«
Sein Vater beugte sich neben ihm über den Stein und betrachtete die Schrift minutenlang, strich immer wieder über die tief in den Stein gehauenen Zeichen, fuhr einzelne Symbole mit dem Finger nach, als würde ihm das helfen, sie zu verstehen. »Mann!«, sagte er dann. »Mann! Weißt du, was das ist? Weißt du das?«
Scott blickte ihn verständnislos an. »Keine Ahnung.«
»Erinnerst du dich an den Farmer in Kensington? Muss ungefähr ein Jahr her sein. Wie hieß er noch? Olof oder so ähnlich. Den Nachnamen hab ich vergessen. Der hat auch so einen Stein gefunden. Ich war damals gerade in Alexandria bei unserem Vetter Raymond. Du weißt schon, von dem wir den Wagen haben. Den Stein hab ich nie gesehen, aber in der Zeitung war ein Bild. Er sah genauso aus wie dieser hier. Die gleichen Schriftzeichen.«
»Bist du sicher?«
»Natürlich bin ich sicher«, sagte er. Der Regen lief ihm übers Gesicht und tropfte auf seine Jacke. Er spürte die schweren Tropfen kaum. »Als ob ein Vogel über den Stein gelaufen wäre. Irgendwas Indianisches, dachten alle.«
»Indianer haben keine Schrift.«
»Eben.« Ein Blitz zuckte über den Himmel und warf gespenstisches Licht auf den Stein, ließ die seltsamen Schriftzeichen noch geheimnisvoller erscheinen. »Sie haben den Stein einer Lehrerin gezeigt, aber die wusste auch nichts damit anzufangen und holte ihren Onkel, einen Professor von der Universität. Der hatte Geschichte studiert und wusste sofort, um was es ging.«
Scott blickte seinen Vater fragend an. »Und?«
»Die Wikinger«, antwortete James. »Er sagt, die Wikinger hätten die Zeichen in den Stein gemeißelt. Runen hat er sie genannt und er konnte sie sogar entziffern. Die Inschrift würde beweisen, dass die Wikinger schon vor vielen hundert Jahren in Amerika gewesen wären. Noch vor Kolumbus.«
»Die Wikinger? Die mit den Drachenbooten?«
»Genau die. Die Wikinger hätten damals in Grönland gelebt und wären mit ihren Booten über den St. Lawrence River und die Großen Seen bis zu uns nach Minnesota vorgestoßen. Ich konnte es auch nicht glauben, aber er sagt, die Schriftzeichen würden das eindeutig beweisen.« Er ließ seine Hand erneut über den Stein gleiten. »Stell dir vor ... die Wikinger ... auf unserer Farm!«
»Und wir sind vielleicht mit ihnen verwandt.«
James lächelte. »Ganz sicher sogar. Meine Eltern kamen damals aus Norwegen rüber und da lebten früher nur Wikinger.«
»Und was machen wir jetzt?«
»Na, was wohl?«, erwiderte sein Vater grinsend. »Wir holen den Professor. Ich will wissen, was auf dem Stein steht.«
Hakon
Kapitel 1
Wie riesige Vögel mit blutigem Gefieder flogen die drei Langschiffe auf die irische Küste zu, elegante Skarfis mit dunkelroten Segeln, die sich im Nordwestwind blähten. Beinahe schwerelos jagten sie über die Wellen, getrieben vom Wind und den Rudern der über hundert zu allem entschlossenen Männer. Jedes der Boote schien zuerst an der nahen Küste anlegen zu wollen.
Hakon saß neben Gunnar, einem erfahrenen Krieger, dessen Narben von zahlreichen Kämpfen berichteten, und legte sich mit aller Kraft in die Riemen. Jeweils zwei Männer bedienten ein Ruder, mit dem Rücken zum Bug, doch an den leuchtenden Augen des Steuermannes sahen sie, dass es nicht mehr weit bis zur Küste war. Alle waren dankbar, bei diesem Kriegszug dabei zu sein, freuten sich darauf, mit Schätzen beladen zurückkehren oder als glorreiche Krieger ins Reich Odins einziehen zu dürfen.
Für Hakon war es der erste Kriegszug. Er hatte noch keine zwanzig Winter erlebt und bisher nur an kleineren Gefechten teilgenommen. Wie die meisten jungen Krieger, die noch keinen Besitz angehäuft hatten, war er lediglich mit einem Lederwams und einem Lederhelm gegen feindliche Waffen geschützt, und das Schwert an seinem Gürtel war weder mit silbernen Ornamenten verziert noch so stabil wie die Klingen aus dem fernen Franken.
Auch körperlich war er den anderen Männern ein wenig unterlegen. Sein Körper war schlanker, und der Bartwuchs nur zu erkennen, wenn die Sonne auf sein Gesicht fiel. Sein Onkel hatte dröhnend gelacht, als er sich den Kriegern anschließen wollte, und duldete ihn nur an Bord seines Langschiffes, weil der Runenmeister ihm dazu geraten hatte. Der Hüter der magischen Schriftzeichen stand in direkter Verbindung zu Odin, dem mächtigen Gott der Weisheit und der Kriegsführung.
»Schneller, Männer!«, rief Ivar in den Fahrtwind. »Wir wollen den Pfaffen noch vor dem Morgengebet einheizen! Legt euch in die Riemen!«
Hakon zog kraftvoll am Ruder, folgte dem Rhythmus, den die Männer im vorderen Teil des Schiffes vorgaben. Er musste seine ganze Kraft aufwenden, um nicht hinter den anderen zurückzubleiben. Es war früh am Morgen, und die Sonne stand noch weit im Osten, blickte kaum über den Rand der Erdscheibe herüber. Mit jedem Ruderschlag spritzte weiße Gischt über die Reling. Das Meer rauschte unter dem flachen Kiel des schlanken Schiffes.
»Refft die Segel!«, erklang die kraftvolle Stimme seines Onkels hinter seinem Rücken. Ivar war ein Krieger mit verwittertem Gesicht und flachsblondem Bart, ein wahrer Hüne von Mann, der nicht einmal vor den bösen Geistern der Unterwelt in die Knie ging. Die meisten Männer seines Dorfes glaubten, dass er mit Thor im Bunde war, weil er während eines Gewitters geboren worden war und genauso aufbrausend und temperamentvoll wie der Gott des Regens und der Winde sein konnte. Angeblich hatte er nach drei Wintern seinen ersten Met getrunken und nach sieben Wintern einen Jungen erschlagen, der ihn beim Spiel besiegt hatte. Als er in einem Verlies der Engländer an einen Pfahl gebunden war, hatte er sich mit bloßer Muskelkraft befreit und die ledernen Fesseln mit seinen Zähnen durchtrennt. Anschließend hatte er die Feinde getötet und ihre Häuser in Brand gesteckt. So erzählte er jedenfalls, und Hakon hatte keinen Grund, seinem Jarl nicht zu glauben.
Die Anführer auf den anderen Booten gaben denselben Befehl, und jeweils zwei Männer verließen ihre Ruder und holten die roten Segel ein. Kaum lagen sie auf den Gabelstützen, glitten die Boote an Land und blieben im feuchten Ufersand liegen. Die Männer zogen ihre Schwerter und Äxte, griffen nach den runden Schilden und sprangen über die niedrige Reling ins Wasser.
»Zeigt ihnen, wozu Nordmänner fähig sind!«, rief Ivar.
»Tötet die Pfaffen!«, tönte einer der anderen Anführer.
Von den anfeuernden Rufen ihrer Häuptlinge getrieben, stürmten die Männer das Steilufer hinauf, allen voran Bekan, ein gefürchteter Berserkir, der mit einem der anderen Boote gekommen war und sich mit einem scharfen Kräutertrank aufgeputscht hatte. Hakon kannte den wilden Mann schon lange, es wurde erzählt, dass er sich mit bloßen Händen auf ein ganzes Rudel Wildschweine gestürzt haben sollte. Ein Mann aus seinem Dorf berichtete, dass er seine Feinde am liebsten zerfleischte und ihnen die Eingeweide aus dem Körper riss. Der Kräutertrunk, den er vor jedem Kampf zu sich nahm, versetzte ihn in einen Rauschzustand, den Hakon nicht einmal erreichte, wenn er mehrere Hörner süßen Met oder starkes Bier trank.
Bekan rannte den jungen Hirten nach, die mit der Schafherde zu fliehen versuchten, und schlug so lange mit seiner Axt auf sie ein, bis der Boden von Blut getränkt war. Schreiend reckte er die blutverschmierte Waffe, nur um sie im nächsten Augenblick in eines der Schafe zu rammen. Sein Schrei glich dem wütenden Brüllen des Bären, dessen Fell er um die Schultern gebunden hatte. Er gönnte sich keine Pause, entdeckte einen Kuhhirten, der in panischer Angst zu fliehen versuchte, und warf ihm die Axt in den Rücken. Sein nächstes Opfer war ein Mönch, der über die Mauer geklettert kam. Er zerrte ihn herunter und schlug seinen Kopf so lange gegen die Mauer, bis er tot war.
Hakon stürmte mit der Hauptstreitmacht zum Kloster hinauf. Drogheda Abbey war eines der christlichen Anwesen, das noch nicht von Nordmännern erobert worden war, eine Ansammlung von steinernen Giebelhäusern und runden Mönchshütten, umgeben von einer hohen Steinmauer. Ivar war bei den wagemutigen Männern, die sich aus vollem Lauf gegen das breite Holztor warfen und es zum Einsturz brachten. Vor Angriffslust johlend und von wilder Begeisterung getragen, stürmten sie in den großen Klosterhof.
Auch ohne Kommandos wussten die Männer, was sie zu tun hatten. Drogheda Abbey war nicht das erste Kloster, das sie überfielen. In jedem gab es eine Kirche mit wertvollen Schätzen, manchmal sogar einen Keller, in dem Gold, Silber und Edelsteine gehortet wurden, ein Schulhaus und zwei oder drei Häuser, in denen sich die Familien aus der näheren Umgebung verschanzt hatten, und die armseligen Hütten der Mönche, die meist betend auf dem Boden hockten und sich abschlachten ließen. Auch diesmal leisteten nur wenige Bewohner Gegenwehr. Es flogen ihnen kaum Pfeile entgegen, und die wenigen prallten wirkungslos an den Schilden der Krieger ab.
Hakon blieb im Schatten von Ivar, dort war er stets im Mittelpunkt des Geschehens und konnte sich am besten beweisen. Sein Onkel war ein Mann, der keinem Kampf aus dem Weg ging und immer die größte Gefahr suchte. »Jetzt zeig, dass du kein kleiner Junge mehr bist!«, rief Ivar ihm zu.
Mit erhobenem Schwert stürzte sich Hakon auf das erste Opfer, einen unbewaffneten Bauern, der in panischer Angst aus einem der Häuser gerannt kam. Er schlug ihn mit dem Schwert nieder, hörte verwundert, wie der Sterbende es fertigbrachte, ihn wortreich zu verfluchen, bevor er die Augen schloss. Hakon stieg über ihn hinweg und folgte Ivar, der sein zweischneidiges Schwert mit beiden Händen führte und reiche Ernte unter den Feinden hielt. Er machte keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern, tötete jeden, der sich ihm in den Weg stellte. Selbst einigen Gänsen, die laut schnatternd hinter einem der steinernen Kreuze hervorkamen, schlug er ins Gefieder.
Hakon ließ sich von der Mordlust seiner Mitstreiter anstecken. Mit wüstem Geschrei stürzte er sich auf die Feinde, die jetzt aus den Häusern kamen und nach allen Seiten davonrannten. Sein Schwert machte auch vor Schwachen und Hilflosen nicht halt. Jahrelang hatte man ihm beigebracht, dass ein Nordmann seine Feinde entweder vernichtete oder als Sklaven nahm, und dafür kamen nur kräftige Jünglinge und gesunde Mädchen oder Kinder in Betracht. Doch als er zwei junge Mädchen zur Mauer treiben wollte, versperrte Ivar ihm den Weg und tötete sie mit zwei wuchtigen Schwerthieben. »So viel Platz haben wir nicht in unserem Boot!«, rief er.
Ein Messer bohrte sich in Hakons Schild und erinnerte ihn daran, dass er nicht unverwundbar war. Er war kein Sagaheld wie Sigurd, dem die Götter einen unsterblichen Körper geschenkt hatten. Hastig riss er den Schild hoch, wehrte den Bauern ab, der das Messer geworfen hatte, und trieb ihn mit dem Schwert vor sich her. Er rammte ihn mit dem Schild gegen die Mauer und stieß ihm die Waffe in den Leib. Im selben Augenblick fuhr er herum und tötete einen Mann, der sich mit bloßen Händen auf ihn gestürzt hatte. Er sah, wie zwei Bauern mit Speeren auf einen Nordmann am Boden einstachen, schlug ihnen die Waffen aus den Händen und tötete sie jeweils mit einem einzigen Hieb. Von dem Krieger am Boden erntete er bloß ein wütendes Schnauben.
Vor Anstrengung keuchend drehte er sich zu den Mönchshütten um. Einige Krieger hatten Fackeln auf die Strohdächer geworfen und beißender Rauch zog über den Klosterhof. Die begeisterten Schreie der anderen Nordmänner vermischten sich mit den Hilferufen und den Todesschreien der Klosterbewohner. Das Prasseln der Flammen wurde immer lauter, brennende Strohbündel fielen von den Hütten und zerstoben in einem Funkenregen. Unberührt von dem Chaos kniete ein Mönch in seinem weißen Umhang auf dem Boden, beide Hände zum Himmel erhoben, und rief: »Habe ich es nicht gesagt? Aus dem Norden wird Böses hereinbrechen über alle Einwohner des Landes. So sprach Jeremias in seinen Prophezeiungen.« Und lateinisch fügte er hinzu: »A furore Normannorum libera nos, Domine! Herr, errette uns vor der Raserei der Nordmänner!«
Hakon verstand weder die eine noch die andere Sprache und beobachtete teilnahmslos, wie Gunnar aus dem dunklen Rauch auftauchte und den betenden Mönch mit seinem Schwert tötete. Eine Frau, die sich vor ihm auf den Boden warf und um Gnade flehte, beachtete Hakon gar nicht. Er hatte sich einen solchen Angriff anders vorgestellt, mit mehr Widerstand gerechnet. Es machte wenig Spaß, gegen Menschen zu kämpfen, die kaum Waffen besaßen.
Er beobachtete, wie Gunnar und einige andere Männer zur Kirche rannten und den Mönch, der sich ihnen vor der Tür in den Weg stellte, gnadenlos niedermetzelten. Mit blutigen Schwertern rannten sie in das halbrunde Gebäude hinein. Die Kirche lag dicht an der Klostermauer und war von blühenden Bäumen umgeben. Mit ihrem klobigen Turm ragte sie über die anderen Häuser empor. Neben dem Eingang erhob sich ein steinernes Kreuz, das mit eingemeißelten Zeichen versehen war und Hakon an Thors Hammer erinnerte.
Nachdem er den anderen in die Kirche gefolgt war, blieb er neugierig stehen. Für einen Nordmann wie ihn, der nur wenig über das Christentum wusste, war eine Kirche ein Haus wie jedes andere. Hier brauchte man weder Ehrfurcht noch Demut zu zeigen. Eher verwundert blickte er auf den Altar mit dem Kreuz und den goldenen Kelchen und die vergoldeten Figuren zu beiden Seiten. Gunnar stopfte die wertvollen Stücke in den mitgebrachten Sack und deutete auf den verschlossenen Raum rechts vom Altar. Die stärksten Männer traten die Tür ein und zerrten johlend einen Mönch nach draußen. »Das ist ihr Häuptling«, rief Gunnar. Seine Worte wurden von der gewölbten Decke als Echo zurückgeworfen. Er riss dem Mann eine silberne Kette vom Hals und warf sie in den Sack. »Ich habe mir sagen lassen, dass die Christen ihre Schulden im Feuer bezahlen.« Er deutete zum Ausgang. »Da draußen gibt es genug Feuer. Werft ihn in die Flammen!«
Zu Hakons großer Verwunderung gab der Anführer der Mönche keinen Laut von sich, als ihn zwei Krieger aus der Kirche schleppten. Hakon erkannte nicht mal Angst in seinen Augen. Er betete zu seinem Gott, als vertraute er immer noch darauf, dass der ihn und seine Glaubensbrüder vor dem Tod bewahrte, obwohl bereits alle Mönchshütten brannten und kaum noch einer der weiß gekleideten Pfaffen am Leben war.
»Worauf wartest du noch, Hakon?«, rief Gunnar. »Hilf uns, die Schätze in einen Sack zu packen und zum Schiff zu tragen. Der ganze Raum ist voll.«
Tatsächlich war der Raum, in dem sich der Anführer der Mönche versteckt hatte, voller wertvoller Schätze. Aus kostbaren Stoffen gefertigte und mit Seide durchwirkte Wandbehänge, mit Juwelen besetzte Kästchen und Gefäße, Figuren aus Gold und Silber, kostbare Becher und Teller und ein funkelndes, mit Edelsteinen verziertes Kreuz lagen in der schweren Holzkiste, hinter der sich der Mönch verschanzt hatte. Sogar ein mit eingelegten Rubinen und silbernen Ornamenten versehenes Schwert war dabei. Warum sich der Anführer damit nicht verteidigt hatte, verstand Hakon nicht. Ein Nordmann würde niemals kampflos in den Tod gehen.
Mit den prall gefüllten Säcken stürmten Gunnar und die anderen Männer nach draußen. Hakon blieb zurück, ließ sich durch eine flüchtige Bewegung ablenken, die er auf der anderen Seite des Altars wahrnahm. Ein Mönch, der geduckt eine kaum sichtbare Treppe hinunterlief. In dem Lichtstrahl, der durch die offene Tür hereinfiel, erkannte Hakon, dass der Mann einen rechteckigen Gegenstand wie etwas sehr Wertvolles mit beiden Händen an seine Brust gepresst hielt. Einen Schatz, den er in Sicherheit bringen wollte?
Hakon folgte ihm, den Schild in der linken, das Schwert in der rechten Hand. Als er die Treppe erreichte, sah er gerade noch, wie der Mönch um die Ecke verschwand. Er hatte einen Umhang über seine Schultern geworfen.
Hastig folgte Hakon ihm in den Keller der Kirche. Modriger Geruch und der beißende Rauch einer Öllampe erwarteten ihn. Ein eisiger Luftzug wehte ihm entgegen, gab ihm das Gefühl, von einer unsichtbaren Hand berührt zu werden. Er blieb am Fuß der Treppe stehen und blickte vorsichtig nach links. Der Mönch rannte durch einen schmalen Gang davon. Den geheimnisvollen Gegenstand hielt er in den Armen wie eine Mutter ihr neugeborenes Baby.
Fest entschlossen, den wertvollen Schatz in seinen Besitz zu bringen, rannte Hakon hinter ihm her. Sie waren hier, um reiche Beute zu machen und den Reichtum ihrer Sippe zu mehren. So hatte Ivar gesprochen, als sie mit ihrem Schiff in See gestochen waren.
Am Ende des Ganges führte eine Treppe ins Freie, nur wenige Schritte von der Klostermauer entfernt. Die Stelle war durch einige Bäume und Sträucher geschützt und vom Klosterhof nicht einsehbar. Hakon kam gerade noch zurecht, um den Mönch über die Mauer klettern zu sehen, die Augen voller Angst.
Hakon schlug mit dem Schwert nach ihm, traf aber nur die mit Mörtel zusammengefügten Steine. Durch den Aufprall sprühten Funken. Er kletterte an der Mauer empor, spähte vorsichtig darüber, um nicht in einen Hinterhalt bewaffneter Bauern zu laufen und lächelte grimmig, als er den Mönch durch die feuchte Erde eines frisch gepflügten Ackers stapfen sah. Die wenigen Sonnenstrahlen, die sich durch die Wolken kämpften, ließen das geheimnisvolle Etwas in seinen Armen in verlockenden Farben leuchten.
Siegessicher folgte ihm Hakon. Jenseits des Ackers waren weitere Felder zu sehen, die sich bis zu einem fernen Waldrand erstreckten und keine Möglichkeiten für ein Versteck boten. Der Flüchtende würde ihm nicht entkommen. Die schwache Sonne zauberte eine seltsam friedliche Stimmung auf die hügelige Landschaft, ließ die Erde in satten Brauntönen leuchten und passte so gar nicht zu dem schauerlichen Siegesgeheul, das hinter ihm im Kloster erscholl. Die Nordmänner hatten fast alle Einwohner getötet und feierten ihren Erfolg mit deftigen Kampfgesängen.
Als der Mönch stolperte und zu Boden fiel, wurde ihm klar, dass es keine Hoffnung mehr für ihn gab. Er war seinem Verfolger hilflos ausgeliefert und gab auf. Ohne den Gegenstand in seinen Armen loszulassen, sank er auf die Knie und begann zu beten. Er hielt die Augen geschlossen, wollte nicht zusehen, wie Hakon das Schwert zum tödlichen Schlag erhob und auf ihn niedersausen ließ. Er betete in einer seltsamen Mischung aus Latein und seiner Landessprache und versuchte so tapfer wie möglich zu sterben.
Doch Hakon tötete ihn nicht. Wie von einer unsichtbaren Macht gebannt blieb er stehen, das Schwert nur halb erhoben, und starrte auf den Schatz in den Armen des knienden Mönchs. Ein Buch, so viel konnte er nun erkennen. Eines dieser wertvollen Bücher, wie sie Ivar auch von einem anderen Raubzug nach Hause gebracht hatte. Einige seiner Verwandten hatten sie für wertloses und mit sinnlosen Symbolen verziertes Pergament gehalten und wollten sie ins Feuer werfen, aber Ivar erkannte den großen Wert der Bücher und verkaufte sie für schweres Silber an einen Händler aus Franken. Obwohl nur ein kleiner Teil des Buches unter den Armen des Mönchs hervorlugte, sah Hakon die goldenen Zeichen und das in allen Farben strahlende Bild auf der Vorderseite.
Hakon spürte, wie der Anblick des geheimnisvollen Buches seine Muskeln lähmte. Von dem bemalten Pergament schien eine magische Kraft auszugehen, die ihn daran hinderte, den Mönch zu töten. Oder hatte er nur Angst, mit seinem Hieb das Buch zu zerstören und es mit Blut zu besudeln? Er ließ die Hand mit dem Schwert sinken und wartete, bis der Mönch die Augen öffnete und ihn mit einer Mischung aus Furcht und Verwunderung anblickte. »Gib es mir!«, forderte Hakon ihn auf. Er unterstrich die barschen Worte, die der Mönch nicht verstand, mit einer eindeutigen Geste.
Der Mönch hatte bei seinem Anblick zu zittern begonnen, und selbst seine Gebete waren verstummt. Mit bebenden Lippen und purer Verzweiflung in den Augen reichte er Hakon das Buch. Dann senkte er den Kopf und wartete auf den Schlag, der seiner Meinung nach unweigerlich kommen musste.
Doch Hakon hatte sich längst abgewandt und kehrte zum Kloster zurück.
Kapitel 2
Das Buch in seinen Armen schien zu leben. Eine unerklärliche Energie floss von dem Pergament in seinen Körper, in sein Blut und ließ ihn wie der Anblick einer verlockenden Frau erschauern. Wie Feuer brannte es an seinem Körper, es schien sich zu bewegen, als verlangte es mit aller Macht danach, von ihm aufgeschlagen zu werden.
Vor der Mauer gab Hakon dem Drängen nach. Er setzte sich auf einen Grenzstein am Rande des Ackers, legte den erbeuteten Schatz auf seine Knie und strich beinahe ehrfurchtsvoll mit der flachen Hand über die bemalten Seiten. Eine eigenartige Wärme ging von den Zeichen und Bildern aus, obwohl das Pergament kalt war und ihm der frische Morgenwind ins Gesicht blies.
Er verstand die Zeichen nicht, hatte nie gelernt, die Schrift seiner Feinde zu entziffern. Sie interessierte ihn auch nicht besonders. Er bewunderte lediglich das handwerkliche Geschick, das der Schreiber bewiesen hatte. Die meisten Zeichen hatte er mit schwarzer Farbe auf das Pergament gemalt. In kunstvollen Bögen und scharfen Kanten schwangen sie sich über die getrocknete Tierhaut. Einige besonders große Zeichen waren mit leuchtender Farbe ausgemalt, strahlten rot, blau und grün und erinnerten ihn an die Muster auf königlichen Schwertern.
Was ihn dazu trieb, das Buch bis zur letzten Seite durchzublättern, wusste Hakon nicht. Er folgte einem unwiderstehlichen Drang, als würde Odin seine Hand führen und ein persönliches Interesse daran haben, dass er sich so eingehend mit dem Werk beschäftigte. Um ihn herum verblasste alles, die warmen Farben des Ackers, die Sonne zwischen den Wolken, selbst das Siegesgeheul hinter den Klostermauern. Wichtig war nur noch dieses seltsame Buch, dessen Kräfte einen so starken Zauber auf ihn ausübten, dass er kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte.
Er betrachtete die Bilder eingehend. Meist farbige Darstellungen des Gottes, zu dem die Christen beteten, ein blasser Mann mit schmächtigem Körper, den seine Feinde an ein Holzkreuz genagelt hatten. Dann seltsame Gestalten in farbigen Gewändern, die beinahe so aussahen wie die Araber, von denen einige Männer seiner Sippe erzählt hatten, die auf dem großen Markt in Haithabu gewesen waren. Doch auf einigen Seiten waren auch Landkarten zu sehen, wie sie Ivar manchmal in den Sand oder den Schnee malte. Linien und Zeichen, die bestimmte Länder und Städte darstellten. Ivar besaß eine solche Karte, ein Pergament mit ungelenken schwarzen Strichen, die ihm ein Händler in Haithabu als Zugabe gegeben hatte, und die ihre Heimat Eisland zeigte. Ähnliche Umrisse erkannte Hakon auf einer der Karten in dem kostbaren Buch, dazu eine rote Linie, die bis zum linken Rand des Buches führte.
Er blätterte ruhig weiter, als gäbe es nur noch dieses Buch auf der Welt. Der Mann vom Kreuz als lebender Prediger, ein farbiges Kreuz und viele schwarze Zeichen, bis auf die farbig ausgemalten alle gleich groß und säuberlich auf einer Linie stehend. Erst als er die vorletzte Seite aufschlug, erkannte er, warum er dieses Buch so gründlich studiert hatte.
Dabei war das Bild, das die ganze Seite bedeckte, nicht so bunt und auch nicht so eindrucksvoll wie die anderen. Aber die unwiderstehliche Kraft und der Zauber, die von ihm ausgingen, berührten Hakon stärker als alles, was er bisher erlebt hatte. Von einer seltsamen Wärme erfüllt blickte er auf das Gesicht einer jungen Frau, eines Mädchens noch, das ihn tief in seinem Inneren berührte. Obwohl es nur mit einfachen Strichen angedeutet und wenigen Farben ausgemalt war, glaubte er es körperlich vor sich zu sehen: die dunklen Augen, schwarz wie Torf und von der unergründlichen Tiefe eines Vulkansees im heimatlichen Eisland, die feinen Gesichtszüge und die hervorstehenden Wangenknochen, die leicht gebogene Nase und die anmutig geschwungenen Lippen. Er glaubte sogar ihr Lächeln zu sehen und ihre sanfte Stimme zu vernehmen.
»Odin, steh mir bei!«, flüsterte er ehrfürchtig. Niemals zuvor hatte er ein so eindrucksvolles Gesicht gesehen, das so starke Gefühle in ihm auslöste. Ein Bild nur und doch lebendig, ein wahres Kunstwerk. Hakon hatte einige Frauen in seinem Leben gekannt, Sklavinnen oder Mägde von niedrigem Stand, und bei keiner dieser Begegnungen hatte er so empfunden.
Er fühlte sich von dem zauberhaften Wesen gerufen, angelockt, und das sanfte Lächeln, das auf dem Pergament zu sehen war, schien sich zu verstärken und ihn zu umfangen. Eines Tages würde er die Frau kennenlernen, das wusste er in diesem Augenblick, eines Tages würde Odin dieses Bild zum Leben erwecken.
Er löste sich von dem Anblick und klappte das Buch zu, blickte prüfend an der Mauer empor, um festzustellen, ob ihn jemand beobachtet hatte. Ohne lange zu überlegen, verbarg er das Buch unter seinem Lederwams. Dieses Beutestück war nur für ihn bestimmt, kein anderer sollte das Bild zu Gesicht bekommen. Um sicherzugehen, dass es nicht unter seinem Wams hervorrutschte, schnallte er seinen Ledergürtel enger. Er war sich im Klaren darüber, wie gefährlich es war, ein wertvolles Beutestück vor dem Jarl zu verbergen, doch es kümmerte ihn nicht, denn seine Gedanken wurden noch von der jungen Frau beherrscht, die ein Unbekannter in dem Buch verewigt hatte.
Entschlossen kletterte er über die Mauer. Dabei achtete er darauf, das Buch nicht zu beschädigen. Er wischte sein blutiges Schwert im Gras sauber und kehrte zu den anderen Nordmännern im Klosterhof zurück. Sie hatten die Schätze zu den Schiffen gebracht und waren bereits dabei, das Kloster zu verlassen. Im schwarzen Rauch, der aus den Häusern und Hütten drang, folgte ihnen Hakon. Er stieg über tote Mönche hinweg, glaubte die verkohlte Leiche des Anführers zu erkennen und ließ das brennende Kloster hinter sich.
Aus dem Westen, von einem nahen Bauernhof, wie Hakon erfuhr, kehrten Bekan und einige seiner Getreuen auf Pferden zurück. Der Berserkir hatte die Tiere gestohlen und die Gelegenheit genützt, um einen eigenen Krieg zu führen. Seine Grausamkeit beeindruckte sogar Ivar, der für blutige Kriegszüge und unnachgiebiges Vorgehen gegenüber Feinden und Freunden berüchtigt war. Ein Blick auf die blutverschmierten Waffen und die menschlichen Trophäen des Berserkirs verrieten jedem, wie rücksichtslos er auf dem einsamen Gehöft gewütet hatte.
Die Wirkung seines Zaubertranks war bereits abgeklungen und er wirkte fröhlich und beinahe entspannt. Hakon hatte noch keinen Mann gesehen, dem das Töten solche Freude bereitete. Er präsentierte stolz seine Beute, vor allem Lebensmittel und lebende Tiere, die seine Begleiter auf einem Wagen mitführten, und sprang vor Ivar aus dem Sattel: »So einen guten Kampf hatte ich schon lange nicht mehr, mein Freund! Was für ein Leben, Ivar!«
Sie schoben die schmalen Schiffe ins Wasser und gingen an Bord. Ivar stand am Vordersteven, das Wams mit dem Blut der getöteten Mönche und Bauern beschmutzt, und rief Befehle, ließ die Rahe mit dem quadratischen Segel am Mast hochziehen und feuerte seine Männer an, so schnell wie möglich vom Ufer wegzurudern. So war seine Taktik bei allen Kriegszügen, die er unternahm: überraschend an der Küste auftauchen, so viele Feinde wie möglich töten und mit reicher Beute verschwinden, bevor ein zufällig Überlebender auf die Idee kommen könnte, Hilfe zu holen. Auf dem offenen Meer waren die Nordmänner zu Hause, dort brauchten sie keinen Feind zu fürchten.
Erst als die Küste nicht mehr zu sehen war, ließ er die Ruder einziehen und überließ es den Elementen, sie nach Eisland zu treiben. Die roten Segel wölbten sich knarrend im Wind, wurden von den kräftigen Tauen nur mühsam im Zaum gehalten, und der flache Kiel hielt das Schiff in der starken Strömung, die das Meer vor dem Feindesland aufwühlte. Der Vorder- und der Achtersteven tanzten im stetigen Rhythmus über die schäumenden Wellen.
»Odin, wir danken dir!«, rief Ivar so laut in den Wind, dass man es auch auf den anderen Schiffen hören musste. »Du bist mit Sleipnir, deinem achtbeinigen Hengst, an unserer Seite geritten und hast uns zu einem großen Sieg verholfen! Mögest du uns sicher in unsere Heimat nach Eisland geleiten!«
Hakon saß still auf einer Kiste, seine Gedanken weilten bei der jungen Frau, deren Bild an seinem Herzen lag. Bei jeder Welle, die das Schiff traf, spürte er die Berührung des Buches unter seinem Lederwams. Was war an dem erbeuteten Schatz, dass er kaum noch an etwas anderes denken konnte? Wer war die geheimnisvolle Frau, die ein unbekannter Künstler in das Buch gemalt hatte?
Er schloss die Augen und glaubte sie dicht vor sich zu sehen. Sie war anders als die Menschen, die er bisher gesehen hatte. Ihre Haut war rötlich braun, und ihre glutvollen Augen erinnerten ihn an die Sklavin, die Ivar im letzten Winter aus dem Süden mitgebracht und nach einem Streit getötet hatte. Ihre hohen Wangenknochen gaben ihr ein königliches Aussehen. Sie war eine Edelfrau, nahm er an, die königliche Vertreterin eines fremden Volkes, das er noch nicht kannte. Eine Prinzessin, die sich einem einfachen Mann wie ihm niemals schenken würde. Und doch glaubte er ihre Stimme zu hören: »Komm zu mir!«
»Wo bist du die ganze Zeit gewesen?«, fragte ihn Gunnar. Er zupfte an seinem rotblonden Bart. »In der Kirche warst du plötzlich weg. Hast du dir eins von den Mädchen geschnappt und ihr gezeigt, was für ein toller Hengst du bist?«
Hakon öffnete die Augen und blickte ihn an. Er brauchte einige Zeit, um die Worte seines Rudernachbarn zu verarbeiten. »Das viele Töten strengt an.«
Gunnar grinste. »Du gewöhnst dich daran. Wenn du so lange dabei bist wie ich, macht es dir nichts mehr aus. Nicht alle lassen sich so abschlachten wie diese Pfaffen. Wenn sie sich wehren, macht es mehr Spaß.« Er kratzte sich unterm Kinn. »Wir haben reiche Beute gemacht, nicht wahr? Sieh dir die Säcke an, sie sind alle prall gefüllt. Es geht uns prächtig!«
Hakon teilte die gute Laune seines Rudernachbarn nicht. Die Kräfte des Buches zogen ihn in eine Traumwelt, die sich mit spiegelklaren Seen und rauschenden Bäumen vor ihm auftat. Die junge Frau tauchte am Ufer eines dieser Seen auf, lächelte ihm aus der Entfernung zu und hob die Hand zu einem schüchternen Gruß.
Was hatten diese Bilder zu bedeuten? War er zum Opfer eines geheimnisvollen Zaubers geworden, der ihn in eine andere Welt zog? Gaukelte ihm Loki, der Vater aller Lügen, berauschende Trugbilder vor, um ihn in die dunklen Abgründe der Unterwelt von Hel zu locken? Hatte Freya, die Göttin der Fruchtbarkeit, seine Sinne verwirrt und ihn zum Sklaven einer jungen Frau gemacht, der er noch niemals begegnet war?
Die festen Schritte seines Onkels rissen ihn aus seinen Gedanken. Er öffnete die Augen und sah, wie der Schatten des gefürchteten Jarls über ihn fiel. »Was hast du unter deinem Wams?«, fragte der, die Hand am Schwert.
Die lauten Worte brachten jede Unterhaltung auf dem Schiff zum Erliegen. Nur das Rauschen des Windes und der Wellen, das Knarren des Segels und das Ächzen der Planken waren noch zu hören.
Hakon griff sich erschrocken an die Brust. Das Buch unter seinem Wams hatte sich verschoben und drückte das Leder nach außen. Er rückte es rasch zurecht, tat so, als hätte sich nur seine Kleidung aufgebauscht. »Nichts, Onkel«, erwiderte er, während ihm das Blut ins Gesicht schoss, »das ist nur der Wind.« Doch sein schuldbewusster Blick sagte etwas anderes.
»Du lügst!«, fuhr Ivar ihn mit funkelnden Augen an. Er riss ihn von der Seekiste hoch und zog das Buch unter seinem Wams hervor. »Und was ist das?« Er hielt die wertvolle Beute wie eine Trophäe empor. »Dein Proviant?«
Hakon versuchte dem spöttischen Blick des Jarls mit Stärke zu begegnen. »Ich brauche das Buch«, erwiderte er fest. »Ich habe es einem Mönch abgenommen. Es ist wichtig für mich. Die Götter haben es mir geschenkt, um mir die Richtung zu zeigen, in die ich gehen muss. Ich wollte es nicht verkaufen.«
»So, du wolltest es nicht verkaufen.« Der beißende Sarkasmus des Anführers zwang Hakon beinahe in die Knie. »Weißt du überhaupt, was du da sagst?« Er blätterte in dem Buch, warf einen raschen Blick hinein, und schlug es angewidert wieder zu. »Das hier ist ein Pfaffenbuch! Da stehen die albernen Gebete und Lieder drin, die sie von sich geben! Oder hast du dir die Bilder nicht angesehen?« Er schlug das Buch erneut auf und hielt seinem Neffen ein Bild des gekreuzigten Christus hin. »Siehst du diese jämmerliche Gestalt? Das ist ihr Gott, ein schwacher Gott, fürwahr! Er ließ sich an ein Holzkreuz nageln und wie ein Sklave hinrichten, anstatt zur Waffe zu greifen und sich zu wehren. Und dieses Buch sollen dir die Götter geschenkt haben? Willst du dich über mich lustig machen?« Er warf das Buch einem anderen Mann zu und forderte ihn auf, es zu der übrigen Beute in einen der Säcke zu stecken. »Du wolltest das Buch verkaufen! Du wusstest, dass manche dieser Christen viel Silber für das Buch bezahlen würden. Du hast mich und alle deine Verwandten betrogen!«
Hakon wagte nicht, die anderen Männer anzublicken. Er wusste selbst, wie unglaubhaft seine Worte geklungen haben mussten. »Das stimmt nicht«, erwiderte er dennoch. »Du musst mir glauben, Onkel! Ich brauche das Buch!«
»Ein Christenbuch?«, fauchte Ivar. Er war außer sich vor Wut.
Hakon blieb standhaft. »Es war nicht meine Absicht, euch zu betrügen. Und es ist wahr: Ich wollte das Buch nicht verkaufen. Ich lüge nicht. Habe ich nicht tapfer gekämpft und dem Namen unserer Sippe Ehre gemacht?«
»Du bist geflohen«, sagte ein junger Mann zwei Reihen vor ihm. Er hieß Ingolf und war wie alle Männer der Sippe mit ihm verwandt, wenn auch nur sehr entfernt. Anscheinend war er mit Gunnar in der Kirche gewesen. Hakon erinnerte sich daran, ihm im letzten Sommer ein Mädchen ausgespannt zu haben.
Er blickte Ingolf überrascht an. Bisher war er der Meinung gewesen, dass man ein Mitglied der eigenen Sippe nicht verriet, selbst wenn man den Mann oder die Frau nicht leiden konnte. »Warum sagst du so etwas?«, fragte Hakon.
»Als wir aus der Kirche gingen, bist du verschwunden«, ließ Ingolf sich nicht beirren. »Ich bin dir gefolgt und habe gesehen, wie du über die Klostermauer geklettert bist. Nur Feiglinge laufen vor einem Kampf davon.«
Hakon beherrschte sich. »Es ist wahr, ich bin über die Mauer geklettert«, sagte er zu seinem Onkel. »Aber nur, um den Mönch zu fangen, der mit dem Buch fliehen wollte. Ich habe ihn getötet und ihm das Buch abgenommen.«
»Du hast ihn nicht getötet«, sagte Ingolf, »du hast ihn verschont.«
Ingolfs Worte trafen ihn wie Peitschenhiebe. Also hatte doch jemand beobachtet, wie er dem Mönch das Buch weggenommen hatte. Ausgerechnet Ingolf, der Mann, der ihn am wenigsten leiden konnte. Wollte er, dass man ihn auspeitschte oder über Bord warf? Wollte er sich an seinen Qualen erfreuen?
»Ist das wahr?«, fragte Ivar scharf.
Eine Weile war nur das Knarren der Segel zu hören. Der Wind, der über den Wellen sang, das rauschende Meer. »Es ist wahr«, sagte Hakon scheinbar furchtlos, »ich habe ihn am Leben gelassen. Ich weiß auch nicht warum.«
Ivar packte ihn am Wams und zog ihn zu sich heran. In seinen funkelnden Augen erkannte Hakon, dass ihm eine schlimme Strafe bevorstand.
»Du hast ihn am Leben gelassen?«, schrie Ivar. »Du hast einen Pfaffen verschont? Du hast sein Buch genommen und kniest vor dem Gott dieses Christenvolkes?«
»Ich habe dir gesagt, warum ich das Buch wollte.«
»Du hast mich angelogen!«, schrie Ivar. »Du hast uns alle betrogen! Und ich brauche kein Thing und keinen König, um zu erfahren, welche Strafe du verdient hast! Lassen wir die Götter entscheiden, wie lange du noch auf dieser Welt verweilen darfst. Grüß mir die Fische, du verlogener Pfaffenanbeter!«
Mit diesen Worten packte er den entsetzten Hakon und warf ihn über Bord.
Kapitel 3
Hakon tauchte prustend aus dem Wasser, drehte verstört den Kopf und sah gerade noch, wie eine der Seekisten, auf denen sonst die Ruderer saßen, über Bord gestoßen wurde. Sie schaukelte verlockend auf den Wellen. Gunnar wollte ihm wohl helfen und ihm wenigstens eine kleine Chance lassen, in dem aufgewühlten Meer zu überleben.
Er schwamm mit kräftigen Zügen zu der Kiste und klammerte sich mit beiden Händen an einen der eisernen Griffe. Das Schiff entfernte sich rasch und verschwand im bleifarbenen Zwielicht, nur noch das blutrote Segel hob sich gegen den verwaschenen Horizont ab. Entsetzt beobachtete er, wie auch das Segel immer kleiner wurde und sich schließlich ganz in Luft auflöste.
Dennoch starrte er weiter nach Norden, in die Richtung, in der seine Heimat lag, Eisland mit seinen rauchenden Bergen, heißen Quellen und sattgrünen Weiden. Er würde die Insel wohl niemals wiedersehen, konnte von Glück sagen, wenn er mit dem nackten Leben davonkam.
Wie lange er durchhalten würde, wusste er nicht. Sein Glück war, dass er in einem der warmen Ströme trieb, die selbst so weit im Norden noch für erträgliche Wassertemperaturen sorgten. Doch wohin trieb ihn diese Strömung? Hinaus in die Weite des Meeres, ohne jegliche Hoffnung, jemals wieder Land zu sehen? An die rettende Küste eines fremden Landes? Zu einem Schiff, das ihn aufnahm?
Er blickte sich suchend um. Selbst für einen Nordmann wie ihn, der das Meer seine zweite Heimat nannte, war die endlose Weite erdrückend. Wohin er auch blickte, nur Wasser. Von einem Horizont zum anderen, in jeder Himmelsrichtung, bis zum Ende der Welt. Graue Wellen, die sich im Wind kräuselten und wie eine dunkle Decke über den Geheimnissen der Unterwelt lagen. Allein der Gedanke, unter sich ein düsteres Reich mit unheimlichen Wesen zu wissen, machte ihn nervös. Die Ungeheuer konnten jederzeit nach oben kommen, um ihn zu holen.
Er paddelte mit beiden Beinen, um nicht das Gefühl in den Muskeln zu verlieren. Salziges Wasser trieb ihm ins Gesicht, brannte in den Augen und im Mund. Nur mit großer Mühe schaffte er es, sich von seinem schweren Lederwams zu befreien. Mit einer Hand löste er den Gürtel. Die wollene Hose, die Unterwäsche und die Schuhe behielt er an. Den Lederhelm hatte er beim Sturz verloren. »Ungeheuer! Mörder!«, fluchte er laut in einem plötzlichen Wutanfall auf Ivar. »Musste es denn gleich die Höchststrafe sein? Dafür wird dich Thor mit seinem Hammer erschlagen!«
Mit seinem Onkel war er noch nie gut ausgekommen. Schon als Kind hatte Ivar ihn bei jeder Gelegenheit beschimpft und sogar geschlagen, wenn sein Vater und seine Mutter nicht in der Nähe gewesen waren. Bei der Ausbildung mit Kriegsaxt und Speer war Hakon von ihm verspottet und ausgelacht worden. Jeder Jüngling wurde hart rangenommen, um später im Kampf bestehen zu können, aber kein anderer fühlte sich so gedemütigt wie Hakon. Ivar mochte ihn nicht, hasste ihn vielleicht sogar, obwohl es keinen Grund dafür gab. War Ivar nicht der Bruder seines Vaters? Warum sollte er etwas gegen ihn haben?
Nur dem weisen Runenmeister, der große Stücke auf ihn hielt, hatte er es zu verdanken, dass Ivar ihn auf den Kriegszug mitgenommen hatte. Es gab keine andere Möglichkeit für Hakon, sich im Kampf zu beweisen. Nicht, solange er noch jung war und im Langhaus seiner Sippe lebte. Ein Mann zog nur mit dem Jarl seiner Sippe in den Krieg. In Eisland hatte selbst der König nicht mehr Einfluss. Wenn man seiner Sippe entkommen wollte, blieb einem nur die Möglichkeit, die Heimat zu verlassen. So wie seine Eltern, die vor vierzig Wintern aus ihrer alten Heimat in Norwegen weggezogen waren.
Eine Welle schleuderte ihm die Kiste aus den Händen, und er musste einige kräftige Kraulschläge machen, um sie wieder zu erreichen. Der Wind hatte etwas aufgefrischt, zauberte weiße Schaumkronen auf das Meer. Es roch nach Regen. Im Westen hingen dunkle Wolken am Himmel und kamen stetig näher. Noch donnerte Thor nicht mit seinem zweirädrigen Wagen über die Erde, aber lange würde er nicht mehr warten. Wenn es zu einem Unwetter kam, waren seine Chancen, dem Meer zu entkommen, noch geringer. In den stürmischen Wellen würde er die Kiste nicht mehr halten können und rettungslos in den Fluten versinken. »Warum verschonst du mich nicht, Thor?«, rief er dem Gott der Winde und des Regens entgegen.
Er blickte zur blassen Sonne empor und stellte fest, dass er nach Süden getrieben wurde, weg von der feindlichen Küste und seiner Heimat in Eisland. Er trieb in einem riesigen Niemandsland, das keinen Anfang und kein Ende hatte. Keine Möwe und kein treibendes Blatt, die ihm zeigen könnten, dass die Strömung ihn am Festland vorbeitreiben würde. Weder ein feindliches noch ein vertrautes rotes oder rot-weiß gestreiftes Segel tauchte am Horizont auf. Wie lange würde es noch dauern, bis die Nacht hereinbrach und er in tiefster Dunkelheit dahintrieb? Wie lange, bis es zu regnen begann? Wie lange, bis seine Kräfte erlahmten und er die rettende Kiste losließ? Wie lange noch?
Stunde um Stunde verging. Der Wind wurde stürmischer, das Meer unruhiger, seine Kräfte nahmen ab. Es fiel ihm immer schwerer, sich an die Kiste zu klammern. Das Wasser wurde kälter und ließ seine Muskeln steif werden. Anscheinend trieb er in kältere Strömungen ab. Dort würde er nicht lange überleben. Die niedrigen Temperaturen würden seinen Körper erstarren lassen und ihm den Tod bringen. Ein gnadenvoller Tod, wie er gehört hatte, aber wer vermochte das schon genau zu sagen?
Sein Durst nahm zu, wurde gegen Abend beinahe unerträglich und quälte ihn mit Trugbildern von klaren Bergseen und vollen Wasserfässern. Der Wind schien ihn mit seinem Pfeifen, das Meer mit seinem Rauschen zu verhöhnen. Er spürte seine Hände nicht mehr, hatte keine Ahnung, ob er sich noch an der Kiste festhielt oder ohne einen Halt im Wasser trieb. Seine Augen fielen zu. In der Dunkelheit sah er plötzlich ihr Gesicht, die glutvollen Augen, die hohen Wangenknochen, die sanften Lippen, und er hörte ihre Stimme, als sie mit leiser Stimme seinen Namen rief. Ihr Lächeln war so zuversichtlich, dass er neue Kräfte mobilisierte, noch einmal die Augen öffnete und ein fernes Segel in der Dämmerung sah.
Er wollte schreien, um sich bemerkbar machen, doch es kam nur ein leises Krächzen über seine Lippen. Um einen Arm zu heben und zu winken, war er viel zu schwach. Das Schiff fuhr in seine Richtung. Wenn es den Kurs beibehielt, mussten der Mann am Bug oder der Steuermann ihn sehen. Beeilt euch, flehte Hakon in Gedanken, fahrt schneller! Krampfhaft hielt er seine Augen offen, längst schmerzten sie vom anstrengenden Ausschauhalten, vom Salzwasser und von der Müdigkeit. Zu langsam, dachte er besorgt, sie sind zu langsam. Schon kündigte sich die Dämmerung am westlichen Horizont an. Die dunklen Wolken waren näher gekommen und die ersten Regentropfen fielen. »Es ist vorbei«, seufzte er, »es ist vorbei.«
Seine Augen waren längst wieder geschlossen, und er war gerade dabei, das Bewusstsein zu verlieren, als das Schiff ganz nahe kam und eine Stimme rief: »Seht doch! Da schwimmt jemand im Wasser!«
Alles andere nahm Hakon in seiner Benommenheit nur noch undeutlich wahr. Der laute Befehl des Jarls, mit den Rudern gegenzusteuern, die kräftigen Arme des Steuermannes, der ihn an Bord hievte, die groß gewachsene Frau an einem der Ruder, die Männer, die ihn in den Frachtraum der Knorr trugen, ihn auszogen, abtrockneten, ihm eine Hose, ein Arbeitswams und Schuhe anzogen und auf ein Bärenfell legten. Um ihn herum waren Kisten, Fässer und Säcke unter einer Tierhaut gestapelt, und es roch nach Honig, Teer und Gewürzen. Das Schnauben einiger Pferde war zu hören. Das hübsche Gesicht eines Mädchens erschien über ihm, und zarte Hände rieben sein entzündetes Gesicht mit schmerzlinderndem Fett und feuchten Kräutern ein.
»Ich bin Astrid«, hörte er sie sagen. Ihre Stimme war hell und klang wie aus weiter Ferne zu ihm. Er öffnete die Augen, begegnete für wenige Augenblicke ihrem schüchternen Lächeln und schloss sie wieder. »Du bist nur erschöpft. Bis wir die Schafsinseln erreicht haben, geht es dir wieder besser.«
Die Schafsinseln, dachte er benommen, auf halbem Wege zwischen Britannien und dem heimatlichen Eisland gelegen. Weit genug von Ivar entfernt, der ihn wahrscheinlich töten würde. Auf den Schafsinseln könnte er ein neues Leben beginnen, wenn es noch Land gab.
Wie durch einen Schleier nahm er wahr, dass einige Männer ein rot-weiß gestreiftes Segeltuch über den Frachtraum spannten und zu beiden Seiten an der Reling befestigten. Er befand sich auf einem Frachtschiff, auf dem es bloß wenige Ruderer gab. Sie traten nur in Aktion, wenn sie auf kleinstem Raum manövrieren mussten, in einem Hafen oder als sie ihn aus dem Wasser gefischt hatten. Während der Fahrt hielten sich die meisten Ruderer und Passagiere im Frachtraum auf. Sie verließen sich auf das große Segel, das sie sicher durch fast jedes Wetter brachte.
»Trink, mein Freund«, sagte das Mädchen und hielt ihm einen Becher mit frischem Wasser an den Mund. Er trank vorsichtig. »Wie ist dein Name?«
Seine Stimme versagte. Wieder kam nur ein heiseres Krächzen aus seinem Mund, und er brachte lediglich ein Lächeln zustande, das gleich wieder verschwand. Sein Körper entspannte sich und er versank in einen tiefen Schlaf.
Hakon spürte nicht, wie Astrid ein weiteres Bärenfell über ihn legte und ihre Hände länger als nötig auf seinem Körper ruhen ließ. Er war längst in einen Traum geflüchtet: An Bord eines Schiffes glitt er über einen breiten Fluss in ein Sumpfgebiet. In welchem Land er sich befand, wusste er nicht. Das Wasser war spiegelglatt und fast schwarz, die wenigen Bäume ragten wie dunkle Skelette daraus empor. Es roch nach vermodertem Holz. Vereinzelte Blumen leuchteten in der düsteren Umgebung. Der Himmel war so schwarz wie das Wasser im Sumpf, und das einzige Licht kam vom Mond und den Sternen.
Auch im Traum brachte er keinen Ton hervor, nicht mal ein Krächzen. Er stand am Vordersteven seines Schiffes, den forschenden Blick in die Ferne gerichtet, als könnte er die Dunkelheit zwischen den Bäumen durchdringen. Er suchte verzweifelt nach der jungen Frau, die ihm in dem Buch des Mönchs begegnet war, die sein ganzes Leben verändert hatte. Würde er sie auch ohne das magische Buch finden?
Hakon wachte plötzlich auf und blickte in die Dunkelheit. Er brauchte einige Zeit, um sich daran zu erinnern, wo er war. Sie befanden sich immer noch auf offener See. Heftiger Südwestwind fegte über das Meer und schüttelte die Knorr durch. Wie alle Frachtschiffe war auch dieses breiter und stabiler als ein leichtes Kriegsschiff und besser gegen raues Wetter geschützt, doch viel schlimmer durfte das Unwetter nicht werden. Wenn die Knorr mit voller Fahrt in ein Wellental rauschte und gleich darauf auf den Kamm der nächsten Welle getragen wurde, knarrten alle Planken und Spanten, und das Segel aus doppelt gewirkter Baumwolle schlug laut klatschend gegen den Mast.
Hakon hob vorsichtig den Kopf, erkannte die ängstlichen Gesichter einiger Frauen und Kinder, die geduckt unter der Plane saßen, und sank stöhnend auf sein Lager zurück, als heftiger Schmerz gegen seine Schläfen hämmerte. Anscheinend war er im Wasser, ohne dass er es in seiner heftigen Umnebelung gespürt hatte, mit dem Kopf gegen Treibholz gestoßen.
Nur verschwommen nahm er das Mädchen wahr, eine junge Schönheit mit lockigem Haar, das sich lächelnd über ihn beugte und ihn im flackernden Schein einer Öllampe verarztete. Mit ihren weichen Händen legte sie erneut feuchte Kräuter auf eine Beule an seinem Kopf. Sie konnte höchstens fünfzehn Winter gesehen haben, dachte er, sie war fast noch ein Kind. Dann schloss er die Augen und wurde von dem strömenden Regen, der unablässig auf die schützende Plane trommelte, wieder in den Schlaf gewiegt.
Diesmal träumte er von seinen Eltern, einfachen Bauern, die als Freie auf dem Land von Ivar lebten und entscheidenden Anteil daran hatten, dass die Rinder und Schafe auf dessen Hof an der Westküste von Eisland so gut gediehen. Freie Leute wie alle seine Vorfahren. Er sah seinen Vater, einen schlanken Mann mit strohgelbem Bart, aus dem Haus treten und Ivar beschimpfen, der ein Schwert mit funkelnder Klinge in beiden Händen hielt. »Wie kannst du es wagen, meinen Sohn zu töten, ohne ihn vor das Thing zu bringen?«, fuhr er ihn an. »Nicht du gebietest über Leben und Tod. Die Stimmen aller freien Männer entscheiden.«
Ivar antwortete nicht, verriet mit keiner Miene, was er von den Worten seines Bruders hielt. Stattdessen schwang er sein riesiges Schwert mit beiden Händen und schlug ihm den Kopf ab. »Hier hast du meine Antwort!«, rief er höhnisch. Und als Hakons Mutter aus dem Haus gestürzt kam und sich weinend über ihren Mann warf, tötete er auch sie.
Hakon schreckte aus seinem Traum hoch und blickte erneut in das Gesicht des jungen Mädchens, spürte gleich darauf einen feuchten Lappen, mit dem es ihm das schweißnasse Gesicht abwusch. Er beruhigte sich und blinzelte in die Sonne, die inzwischen aus ihrem Versteck jenseits der Erde hervorgekrochen war und einen Platz zwischen den Wolken gefunden hatte. Es hatte aufgehört zu regnen und versprach ein ruhiger Tag zu werden. Die Plane, die während des Unwetters den Frachtraum geschützt hatte, lag zusammengefaltet auf dem Boden. Das Segel bewegte sich unter einer leichten Brise.
»Du hast uns schönes Wetter gebracht«, erklang eine dunkle Stimme. Ein Schatten schob sich vor die Sonne und er sah sich einem furchterregenden Krieger mit gewaltigem Brustkorb gegenüber. Er hatte das lange Haar zu zwei Zöpfen gebunden und trug eine schwarze Klappe über dem linken Auge. Die kunstvollen Stickereien auf seinem Gewand wiesen ihn als wohlhabenden Mann aus. »Ich bin Kolfinn, der Jarl der Schafsinseln.«
»Ich bin Hakon, der Sohn des Knut aus Eisland.« Er wollte sich erheben, um dem Jarl seine Ehrerbietung zu beweisen, war aber noch zu schwach und sank seufzend auf sein Lager zurück. »Verzeih, aber ich war lange im Wasser und brauche noch einige Zeit, bis ich wieder wie ein Mann stehen kann.«
Kolfinn reagierte mit einer abwehrenden Handbewegung. »Was hat dich in diese missliche Lage gebracht, Hakon?«, fragte er.