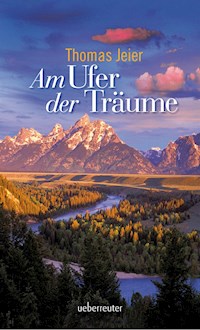4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Das berührende Porträt einer Indianerin, die nicht sein darf, was sie ist: „Wo die Feuer der Lakota brennen“ von Thomas Jeier als eBook bei dotbooks. Sie gewinnen die große Schlacht am Little Bighorn, und doch müssen sie fliehen – ihr Leben lang … Für ihren triumphalen Sieg gegen General Custer im Jahr 1876 müssen die Lakota bezahlen: Sie werden massakriert, in Reservaten zusammengepfercht und ihre Kinder zu Weißen „umerzogen“. Auch Adlerfrau wird auf ein Internat an die Ostküste geschickt, wo sie ihren Namen ablegen und einen neuen wählen muss und wo der Hass und die Abscheu der Weißen allgegenwärtig sind. Doch wie vergisst man seine Kultur, seine Traditionen und Bräuche? Selbst ihre Sprache darf Mary, wie sie nun heißt, nicht mehr sprechen. Für die junge Frau beginnt eine Odyssee in einer ihr fremden Welt, deren Regeln sie schnell lernen muss, um zu überleben. „Eine bewegende Erzählung aus der Geschichte der Indianer; ein Plädoyer für mehr Toleranz und Menschlichkeit.“ ARD Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Wo die Feuer der Lakota brennen“ von Erfolgsautor Thomas Jeier. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie gewinnen die große Schlacht am Little Bighorn, und doch müssen sie fliehen – ihr Leben lang …
Für ihren triumphalen Sieg gegen General Custer im Jahr 1876 müssen die Lakota bezahlen: Sie werden massakriert, in Reservaten zusammengepfercht und ihre Kinder zu Weißen „umerzogen“. Auch Adlerfrau wird auf ein Internat an die Ostküste geschickt, wo sie ihren Namen ablegen und einen neuen wählen muss und wo der Hass und die Abscheu der Weißen allgegenwärtig sind. Doch wie vergisst man seine Kultur, seine Traditionen und Bräuche? Selbst ihre Sprache darf Mary, wie sie nun heißt, nicht mehr sprechen. Für die junge Frau beginnt eine Odyssee in einer ihr fremden Welt, deren Regeln sie schnell lernen muss, um zu überleben.
„Eine bewegende Erzählung aus der Geschichte der Indianer; ein Plädoyer für mehr Toleranz und Menschlichkeit.“ ARD
Über den Autor:
Thomas Jeier wuchs in Frankfurt am Main auf, lebt heute bei München und „on the road“ in den USA und Kanada. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet. Seine über 100 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Bei dotbooks erscheint auch:
Die Tochter des Schamanen
Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: www.jeier.de
Der Autor im Internet: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe April 2018
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Andrei Rybadank (Symbol), Kris Wiktor (Landschaft)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (sh)
ISBN 978-3-96148-161-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Wo die Feuer der Lakota brennen an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Thomas Jeier
Wo die Feuer der Lakota brennen
Roman
dotbooks.
Wenn der Große Geist gewollt hätte,dass ich ein Weißer wäre,hätte er mich gleich dazu gemacht.Er hat bestimmte Absichtenin eure Herzen gepflanzt,in unsere Herzenhat er andere Wünsche gelegt.Im Angesicht des Großen Geistesist jeder ein guter Mensch.Warum wollt ihr Adler in Krähen verwandeln?
Sitting Bull
IAdlerfrau
»Die Worte der Weißen sind auf Wasser geschrieben.«
Sitting Bull
1
Ausgerechnet an dem Tag, als unser Volk seinen größten Sieg errang, träumte ich von einem Donnervogel. Er breitete seine dunklen Schwingen über unserem Lager aus und krächzte so unheilvoll, dass ich aus dem Schlaf schreckte und ängstlich in die Dunkelheit starrte. Ich wartete auf Blitz und Donner, doch vor unserem tipi war alles ruhig und nicht einmal die Hunde regten sich. Gelbe Hand, mein Vater, schlief friedlich und hatte einen Arm um meine Mutter gelegt. Ihr Atem ging regelmäßig. Ich legte mich auf mein Büffelfell zurück und zwang mich zur Ruhe. Aber ich konnte in dieser Nacht nicht mehr schlafen. Ich dachte darüber nach, wovor der Donnervogel mich warnen wollte. Ich gehöre zum Volk der Lakota und wir messen den Träumen große Bedeutung bei. Erst einige Monate später sollte ich erfahren, dass unser Sieg übel Custer und seine Männer dazu beigetragen hatte, die Lakota endgültig in den Untergang zu treiben.
Aber ich will der Reihe nach erzählen. Ich bin die Tochter von Gelbe Hand und Büffelfrau und wuchs bei den Oglala Lakota von Tashunka Uitko auf. Die Weißen nannten ihn Crazy Horse. Er war ein großer Häuptling und hatte entscheidenden Anteil daran, dass wir so lange in Freiheit lebten. Damals hieß ich Adlerfrau, weil während meiner Geburt ein großer Adler über unser Lager geflogen war. In der Sprache der wasicun heißt das Eagle Woman. In der Schule des Weißen Mannes, die ich nach dem Tod meines Vaters besuchte, wurde ich Mary Red Eagle genannt. Ich durfte mir den Namen selbst aussuchen. Während der beiden Jahre, die ich in »Buffalo Bill's Wild West« auftrat, hieß ich Weiße Feder, weil der bekannte Westmann der Meinung war, dass ein solcher Name besser zu meinem hübschen Gesicht passte. Ich muss zugeben, dass die weiße Feder, die ich von Buffalo Bill bekam, ein auffälliger Schmuck in meinen schwarzen Haaren war. Später bekam ich noch einen vierten Namen, aber den habe ich meinem Ehemann zu verdanken, und es ist unhöflich, eine Geschichte zu erzählen, die einen Anfang und kein Ende hat.
Ich zählte erst sechs Winter, als Sitting Bull und Crazy Horse die Blauröcke besiegten, und doch erinnere ich mich an jede Einzelheit jenes denkwürdigen Tages. Schon am Morgen war es drückend heiß. Der Himmel wölbte sich blau und wolkenlos über der hügeligen Prärie am Little Bighorn River. So hieß der Greasy Grass bei den Weißen. Die Sonne schwamm im klaren Wasser des Flusses und im Gras summten Insekten. Ich hatte den Donnervogel aus meinen Gedanken verdrängt und spielte mit Viele Pferde und Badet-ihre-Knie-im-Wasser im Ufersand. Viele Pferde war meine beste Freundin. Ein zierliches Mädchen mit großen Augen und einem viel zu sanften Gemüt. Sie wuchs zu einer wunderschönen Frau heran und verdrehte während unserer Zeit bei Buffalo Bill so manchem Mann den Kopf. Badet-ihre-Knie-im-Wasser war die Tochter von Wolf-der-nie-schläft, der allein in die Jagdgründe der Shoshone geritten war und viele Ponys erbeutet hatte. Sie war etwas eingebildet und ständig damit beschäftigt, ihren Körper zu reinigen und ihre Haare zu kämmen.
Wir wussten nicht, dass Soldaten in der Nähe waren, und benahmen uns so unbeschwert wie am Rosebud River. Dort hatten wir den Sonnentanz gefeiert. Mit dieser Zeremonie ehren wir Wakan tanka. Nach unserem Glauben ist Gott keine Person, sondern ein großes Geheimnis, das in den Menschen, den Tieren, den Bäumen und sogar in den Steinen am Wegesrand lebt. Zum Sonnentanz kommen alle Lakota zusammen. Überall brennen Feuer und der Duft von gebratenem Büffelfleisch weht durch das Lager. Es gibt keine Feinde und keinen Krieg. Die Mädchen necken die jungen Krieger, die sich während des Sonnentanzes besonders stark und unbesiegbar vorkommen. Die weisen Männer erzählen von White Buffalo Calf Woman, der legendären Geisterfrau, die uns die heilige Pfeife gebracht hat. Wir sind fröhlich und ausgelassen.
Selbst am Rosebud dachten wir nicht an die Blauröcke, die irgendwo in den Schwarzen Bergen warteten. Nur Tatanka Yotanka, der als Sitting Bull in die Geschichte einging, vergaß unsere Feinde nicht. Der legendäre Anführer der Hunkpapa war ein heiliger Mann, der in die Zukunft sehen konnte. Er schnitt tiefe Wunden in seine Arme und sagte: »Ich habe gesehen, wie die Soldaten einer wilden Meute gleich in unser Lager stürzten! Sie werden uns angreifen, aber wir werden sie besiegen!«
Am Little Bighorn River holte uns die Wirklichkeit ein. Den Kriegern wurde bewusst, dass die wasicun unsere Schwarzen Berge geraubt hatten und wie die Heuschrecken über das Land herfielen. Sie hatten das gelbe Metall gefunden, das ihnen so wertvoll erschien, und gruben die Erde um, die unsere Mutter war. Ich kann bis heute nichts mit Gold anfangen. Es hatte die Sinne der wasicun verwirrt und ließ sie den Vertrag brechen, den unsere Häuptlinge in Fort Laramie unterzeichnet hatten. Die Paha Sapa sollten uns gehören, solange Gras wächst und Wasser fließt. Die Schwarzen Berge waren der Mittelpunkt unseres Universums, die Heimat von Wakan tanka, dort lag die geheimnisvolle Höhle des Windes, aus der die ersten Büffel gekommen waren. Die Erde dieses Landes war unsere Mutter. »Wie können wir ein Land verkaufen, das unsere Mutter ist?«, fragten die Häuptlinge.
Jetzt hatten die Weißen sich dieses Land einfach genommen und Custer und seine Soldaten waren unterwegs, um uns endgültig den Todesstoß zu versetzen. Erfahrene Krieger wie Crazy Horse und Sitting Bull hatten schon am Rosebud River gewusst, was uns erwartet, und nur geschwiegen, weil sie die Frauen und Kinder nicht verängstigen wollten. Heute weiß ich, dass Sitting Bull die vielen Krieger ganz bewusst am Little Bighorn zusammengezogen hatte. Über viertausend kampferprobte Männer sollen es gewesen sein. Nach dem Sonnentanz waren Boten zu den Shahiyena und zahlreichen anderen Stämmen geritten und hatten sie gebeten, ihr Lager mit unserem zu vereinen. Nur gemeinsam waren wir stark genug, um die wasicun zu besiegen.
Der 25. Juni 1876 war ein schwarzer Tag für die Weißen. Damals wusste ich noch nicht, dass die Weißen einen Kalender haben, aber inzwischen habe ich so viel über die Schlacht am Little Bighorn gelesen, dass mir dieses Datum immer gegenwärtig sein wird. Am Ufer dieses Flusses, der durch das heutige Montana fließt, errangen die vereinigten Sioux und Cheyenne ihren größten Sieg gegen die Armee der Vereinigten Staaten. So steht es in den Geschichtsbüchern. Ich habe sie gelesen, denn während ich diese Zeilen schreibe, lebe ich in Los Angeles und habe in zwei Filmen mitgespielt. Einer heißt »Union Pacific« und schildert den Bau der transkontinentalen Eisenbahn. Ich spiele die Frau eines Häuptlings und darf sogar einen Satz sagen: »Ich habe Angst um die Kinder, Bärenklaue!« Die Geschichte ist von vorne bis hinten erlogen, aber ich habe zwanzig Dollar für meinen Auftritt bekommen und brauche das Geld für meine Kinder.
Vor sechzig Jahren sprachen die Zeitungen von einem Massaker an General George Armstrong Custer und seinen Männern und selbst in den Geschichtsbüchern, die nach der Jahrhundertwende herauskamen, wurde von einem feigen Überfall auf die Soldaten gesprochen. Ich war dabei, als Sitting Bull und Crazy Horse die Blauröcke besiegten, und will berichten, was sich wirklich zugetragen hat. Custer war kein General mehr. Seine Sterne hatte er im Bürgerkrieg getragen. Während des Feldzugs, der zur Schlacht am Little Bighorn führte, war er Lieutenant Colonel und befehligte die Männer nur, weil er gute Beziehungen in Washington hatte und die Regierung einen Dummkopf brauchte, der die dreckige Arbeit für sie übernahm. Custer war tollkühn und ehrgeizig. In einem Buch steht sogar, dass er Präsident werden wollte. Er wollte unsere Krieger ganz allein besiegen. Selbst als er wissen musste, wie viele Indianer am Greasy Grass lagerten, brach er den Angriff nicht ab. Er trieb seine Männer mit gezücktem Säbel an, die blonden Locken im Wind, und war davon überzeugt, uns besiegen zu können. »Wenn es sein muss, reite ich allein durch die ganze Sioux-Nation«, soll er vor dem Feldzug gesagt haben.
Mein Volk wollte keinen Kampf. Selbst Crazy Horse, ein erbitterter Feind der wasicun, wollte nur in Ruhe gelassen werden und auf den weiten Ebenen jagen. Wir wussten, wie stark die Blauröcke waren und dass es so viele Weiße wie Sterne am Himmel gab. Red Cloud, einst ein erbitterter Krieger, hatte längst aufgegeben und lagerte mit seinen Leuten bei der Agentur, die seinen Namen trug. Er ahnte wohl, dass die Büffel verschwinden würden, und lebte von den Rationen des Weißen Mannes. Crazy Horse nannte ihn einen Feigling. Andere Anführer waren der Meinung, dass es keinen anderen Weg für unser Volk gab, und folgten ihm in das »Reservat«. Wir waren die letzten »freien Indianer«. So nannten uns die Zeitungsreporter im Osten, weil wir an der alten Lebensweise festhielten. Ich muss immer lachen, wenn ich diesen Ausdruck lese. In der Sprache der Lakota gibt es kein Wort für Freiheit. Warum sollten wir ein Wort für etwas haben, das so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen ist?
Viele Pferde war gerade dabei, die eitle Badet-ihre-Knie-im-Wasser mit Wasser zu bespritzen, als einige Mütter aufgeregt an den Fluss gerannt kamen und ihre Kinder ans Ufer winkten. »Wasicun! Wasicun!«, schrien sie. »Die Blauröcke greifen an!« Obwohl ich noch sehr jung war, zögerte ich keinen Augenblick. Wer bei den Lakota aufwuchs, wurde schon als kleines Kind darauf vorbereitet, im Augenblick der Gefahr sofort zu handeln. Ich rannte ans Ufer und blieb vor meiner Mutter stehen. Sie hieß Büffelfrau und war eine kräftige Frau mit knochigem Gesicht und tief liegenden Augen. Ihre Zöpfe waren mit Büffelfett eingerieben. Ich war ihr einziges Kind, nachdem mein kleiner Bruder im letzten Winter erfroren war. Noch bevor sie etwas sagen konnte, sah ich den Ausrufer in unser Dorf reiten. Er zügelte seinen Schecken und rief den Frauen und Kindern zu: »Die Soldaten greifen an! Pekin Hanska! Der Mann, den sie Custer nennen! Lauft nach Westen und versteckt euch hinter den Hügeln! Macht schnell!«
Ich half meiner Mutter einige Vorräte zu packen und griff nach meiner Lieblingspuppe. Auch Indianermädchen hatten Puppen. Ich beobachtete, wie mein Vater die Kriegsfarben auflegte und seine bemalte Hand auf den Rücken seines Kriegspferdes drückte. Dieses Zeichen sollte ihm Glück bringen. Er war bis jetzt immer gesund aus einem Kampf zurückgekehrt. »Ate! Ate! Du wirst sie alle töten!«, rief ich ihm zu. Meine Mutter spannte die Schleppbahre an den Wallach, den mein Vater von den Crow gestohlen hatte, und lud die Ledertaschen mit dem Hausrat darauf. Sie griff nach dem Revolver, den sie einem toten Soldaten abgenommen hatte, und steckte ihn hinter ihren Gürtel. Sie wollte bereit sein, falls es den Kriegern nicht gelang, die wasicun zu besiegen. Bevor wir das Dorf verließen, umarmte sie meinen Vater und sagte etwas, das ich nicht verstand. »Ich sehe dich wieder, Mita wicu«, antwortete er. »Wir werden einen großen Sieg feiern!«
Meine Mutter und ich liefen mit den anderen Frauen und Kindern zu den Hügeln im Westen. Von dort konnten wir die große Staubwolke sehen, die sich über dem Flussufer ausbreitete. Das ganze Lager war in Aufruhr. Wie dichter Nebel hing der Staub über den nackten tipi-Stangen. Die meisten Frauen hatten die Büffelhäute von den Gerüsten gezogen und einige der Stangen für eine Schleppbahre abgebaut. Die leeren tipis ragten wie Skelette in den Hitzedunst. Bemalte Krieger rannten zu ihren Pferden und stießen drohend ihre Waffen zum Himmel. Einige junge Männer trieben die Ponyherde davon. Die Frauen und Kinder brachten sich in den Hügeln in Sicherheit. Inmitten der Krieger sah ich die Gestalt von Tashunka Uitko, dem klugen Anführer der Oglala Lakota. Auch meine Mutter und ich waren mit ihm verwandt. Gelbe Hand, mein Vater, war ein Hunkpapa wie Sitting Bull und erst zu den Oglala gekommen, nachdem er meine Mutter geheiratet hatte. Er empfand es als große Ehre, für Crazy Horse zu reiten, und wurde von ihm in die akicita berufen, einen Bund besonders tapferer Krieger, die für die Sicherheit im Lager zuständig waren.
Crazy Horse oder Tashunka Uitko war der tapferste Krieger, den es jemals bei den Lakota gegeben hatte. Das sagten sogar die Soldaten, die gegen ihn gekämpft und überlebt hatten. Er war ein kluger Anführer, der nichts Unüberlegtes tat und immer auf die Sicherheit der Frauen und Kinder bedacht war. Wenn ich mich recht erinnere, nahm er sich auch am Greasy Grass die Zeit, unsere Flucht zu den Hügeln abzusichern. Er bot keinen prunkvollen Anblick. An jenem glorreichen Tag war er nur mit einem Lendenschurz und Mokassins bekleidet und in seinen offenen Haaren hingen der Balg eines Falken und eine einzelne Feder. Sein Oberkörper war mit hellblauer Farbe und weißen Punkten bemalt, auf seiner rechten Gesichtshälfte leuchtete ein greller Blitz. So hatte er sich selbst in einer Vision gesehen. Wakan tanka hatte ihm versichert, dass er unverwundbar war und die Lakota und Shahiyena zu einem großen Sieg führen würde.
Die Schlacht begann im Süden unseres Lagers, bei den tipis der Hunkpapas, und uns wurde später berichtet, dass Sitting Bull bei den jungen Kriegern gewesen war, die den Rückzug der Frauen und Kinder gedeckt und die ersten Schüsse mit den angreifenden Soldaten ausgetauscht hatten. Von einem weisen Mann wie Sitting Bull wurde nicht erwartet, dass er sein Leben riskierte. Wir sahen nichts von diesem Kampf, atmeten nur den Staub, der in dichten Schwaden über den Fluss zog, und hörten das Krachen der Schüsse und das Kriegsgeheul der Männer. Anscheinend gelang es ihnen, die Soldaten zurückzuwerfen, denn plötzlich verstummte der Kampfeslärm und eine trügerische Stille trat ein, bevor erneut geschrien und gekämpft wurde.
Dieses Mal kamen die Blauröcke von Südosten und wir konnten beobachten, wie sie ihre Säbel zogen und durch das kniehohe Büffelgras und den Salbei zum Fluss ritten. Die blonden Locken von Pekin Hanska und sein weißes Hemd leuchteten in der Sonne. Er hatte seine Wildlederjacke hinter den Sattel gebunden. Niemand weiß, von welchem bösen Geist er besessen war, als er seine Einheit teilte und eine vielfache Übermacht von entschlossenen Kriegern mit knapp über zweihundert Soldaten angriff. Nach den vielen Berichten, die ich über die Schlacht am Little Bighorn gelesen habe, bin ich der festen Überzeugung, dass er sich maßlos überschätzte. Er war ein Aufschneider, der tatsächlich glaubte, die vereinigten Sioux, Cheyenne und Arapaho im Alleingang besiegen zu können. Ich war damals noch zu klein, um das ganze Ausmaß der Schlacht begreifen zu können, aber ich wusste, dass unsere Krieger gewinnen würden, als ich hörte, wie das Angriffssignal der angreifenden Blauröcke in einem wahren Kugelhagel erstickte. Der Soldat, der die goldene Trompete geblasen hatte, verschwand schreiend im Staub.
Vom Rest der Schlacht sahen wir nicht viel. Von allen Seiten stürzten sich unsere Krieger auf die Soldaten und der Staub wallte wie unter einer gewaltigen Büffelherde empor. Natürlich hatte ich Angst, obwohl einige Frauen später das Gegenteil behaupteten, doch ich war zu aufgeregt, um mich an meine Mutter zu klammern. Ich starrte wie gebannt auf das Schlachtfeld, glaubte Tashunka Uitko zu sehen, wie er mit erhobener Lanze durch die umzingelten Soldaten sprengte und von keiner einzigen Kugel getroffen wurde. So hatte Wakan tanka es ihm prophezeit. Mein Vater, der zahlreiche Coups schlug und ebenfalls unverletzt aus dem Kampf zurückkehrte, bestätigte mir, dass es sich tatsächlich so zugetragen hatte. Die Blauröcke gerieten in Panik, sprangen von ihren Pferden und flüchteten. Custer und seine letzten Getreuen zogen sich auf den Hügel zurück, der später nach ihm benannt wurde, und kämpften verzweifelt.
Einem der Soldaten gelang es, unverletzt durch die Reihen der angreifenden Krieger zu reiten und den Fluss zu überqueren. Ich sah, dass er in unsere Richtung ritt, und erblickte gleichzeitig, wie Viele Pferde und ihre Mutter ziellos durch den Staub irrten. Ihre Umrisse waren nur schemenhaft zu sehen. Ich erkannte meine Freundin an der silbernen Spange, die sie in ihren Haaren trug. Ihr Vater hatte das Schmuckstück bei einem Händler in Fort Laramie eingetauscht. Irgendetwas musste die beiden aufgehalten haben. »Wasicun! Wasicun!«, schrie ich in panischer Angst. Der Soldat kam immer näher und würde sie niederreiten.
Ich kroch über den Hügel und rannte ihr entgegen. Ohne auf den weißen Soldaten zu achten, lief ich durch die Salbeiwiese und rief: »Lauft schneller!« Viele Pferde und ihre Mutter starrten mich entsetzt an. Ich warf mich zu Boden, um ihnen zu zeigen, dass sie in großer Gefahr waren, und stellte erleichtert fest, dass sie ebenfalls in Deckung gingen. Sie hatten den Blaurock endlich gesehen. Im selben Augenblick fiel ein Schuss und der Soldat fiel getroffen aus dem Sattel. Er stürzte auf den sandigen Boden und überschlug sich mehrmals. Für einen Augenblick blickte ich in seine starren Augen, dann verschwand er im Staub. Ich glaube, er war schon tot, als er den Boden berührte. Ich hörte den triumphierenden Schrei des Kriegers, der ihn erschossen hatte.
Wir liefen auf den Hügel zurück. Die Mutter meiner Freundin umarmte mich und bedankte sich überschwänglich. Viele Pferde legte ihre rechte Hand auf meine Brust. Das war ihre Art, mir ihre Dankbarkeit zu zeigen. Ich winkte verlegen ab. Ich wollte nicht, dass mein Name am abendlichen Feuer besungen wurde, und war froh, als sich der Staub über dem Schlachtfeld lichtete und unsere Aufmerksamkeit von den Kriegern abgelenkt wurde. Wir blickten über den Fluss und stellten erleichtert fest, dass die Schlacht ihrem Ende entgegenging. Die Krieger hatten Langhaar und seine letzten Getreuen in die Enge getrieben. Sie töteten einen nach dem anderen und ich hörte, wie Crazy Horse einen triumphierenden Schrei ausstieß, als Custer getroffen zu Boden fiel. »Hokahey!«, rief der Kriegshäuptling der Oglala Lakota mit emporgehobenem Gewehr. »Dies ist ein guter Tag zum Sterben!« Wir hatten die wasicun besiegt. Noch am selben Abend trennten wir uns von den anderen Stämmen und zogen nach Osten weiter. Im Schatten des Mato Paha, des heiligen Berges der Lakota, tanzten die siegestrunkenen Krieger um die Feuer bis in den Morgen hinein.
2
Nachdem wir vier Tage und vier Nächte am Mato Paha gebetet hatten, zogen wir ziellos über die weiten Ebenen. In unsere angestammten Jagdgründe konnten wir nicht zurück. Die wasicun wussten, wo wir vor dem Sonnentanz am Rosebud River gelagert hatten, und es wäre zu gefährlich gewesen. Die Blauröcke waren uns dicht auf den Fersen. Die Kunde von unserem glorreichen Sieg am Greasy Grass hatte sich wie ein Lauffeuer in den Städten des Weißen Mannes verbreitet und die Soldaten setzten alles daran, sich für diese Schmach zu rächen. Der Graue Wolf, so nannten wir General George Crook, hatte sich mit zweitausend Mann auf den Weg gemacht und geschworen, Crazy Horse als Gefangenen zurückzubringen. Unsere Späher berichteten, dass er über zweitausend Pawnee und Shoshone als Kundschafter dabeihatte. Nur mit abtrünnigen Indianern war es ihm möglich, auf unserer Spur zu bleiben. Unsere Krieger wurden nicht müde, über diese Verräter zu schimpfen, und mein Vater schwor, wenigstens einen der verhassten Kundschafter mit in den Tod zu nehmen, falls sie jemals unser Lager fanden.
Wir blieben kaum lange genug an einem Platz, um die tipis aufzustellen. Meist begnügten wir uns mit einfachen Strauchhütten oder wir schliefen unter freiem Himmel. Die Krieger der akicita ritten mit aufgelegten Pfeilen und schussbereiten Gewehren um unser Lager und passten auf, dass wir nicht von den weißen Soldaten überrascht wurden. Spähtrupps erkundeten das Land um festzustellen, wo sich der Graue Wolf befand. Er war ein fähiger Anführer, viel erfahrener und klüger als Custer, und manche wasicun waren der Meinung, dass er ein Indianerfreund war. Das konnte ich nicht glauben. Erst zehn Winter nach der Schlacht am Greasy Grass, als ich längst in der Schule des Weißen Mannes in Carlisle war, erfuhr ich, dass Geronimo und einige seiner Apachen ihm ihr Leben zu verdanken hatten. Er war kein Indianerhasser, aber damals war wenig davon zu spüren, und es hieß sogar, dass er ein Lager der Shahiyena überfallen und schlafende Frauen und Kinder getötet haben sollte.
Die politischen Zusammenhänge jener Zeit erfuhr ich erst, als ich lesen lernte und die Zeitungen an der Ostküste studierte. Die meisten Weißen in New York oder Philadelphia wollten nicht, dass die Indianer ausgerottet wurden. Ich lernte, dass General William Tecumseh Sherman schon einen Monat nach unserem Sieg am Little Bighorn das Oberkommando übernommen und alle Indianer in den Reservaten zu Kriegsgefangenen gemacht hatte. Damit hatten wir kaum noch Rechte. Der Vertrag von Fort Laramie, den die weißen Goldsucher längst gebrochen hatten, wurde für nichtig erklärt und Red Cloud als Häuptling abgesetzt. Die wasicun wählten ihre Häuptlinge unter den Indianern aus, die in den Reservaten lebten, obwohl diese nur für einen Teil des Volkes sprachen. Sie erklärten Spotted Tail zum Häuptling. Er war den Weißen immer wohlgesinnt gewesen.
Ich hatte keine Ahnung von dieser Entwicklung und hätte die Zusammenhänge auch nicht verstanden. Ich machte keinen Unterschied zwischen Agentur-Indianern und den Familien, die in Freiheit lebten. Wir gehörten alle demselben Volk an. Ich wusste nur, dass uns die Blauröcke verfolgten, und betete jeden Tag zu Wakan tanka, er möge unsere Leute an einen sicheren Ort führen. Bei unserer Gruppe war eine Frau, die das Massaker am Washita River überlebt hatte und jedes Mal verzweifelt schrie, wenn sie aus einem bösen Traum erwachte. Sie sprach nicht über jenen schrecklichen Tag, an dem sie ihre Eltern und ihre beiden Kinder verloren hatte, aber ihr Schmerz war so groß, dass sie geschworen hatte, ihre Haare bis zu ihrem Tod offen zu tragen. Das war die Art einer Lakota-Frau, ihre Trauer zu zeigen.
Crazy Horse war nach dem Triumph über Langhaar und seine Soldaten ruhiger geworden. Er sprach wenig, und selbst wenn er einen ansah, war sein Blick in die Ferne gerichtet. Er dachte viel nach. Einmal beobachtete ich, wie er unbeweglich auf einem Hügel stand und in den morgendlichen Nebel starrte. Er wirkte wie ein Mann, der den Kontakt zur wirklichen Welt verloren hatte und sich danach sehnte, in die Geisterwelt zu reiten. Ich bin sicher, er fühlte damals schon seinen nahen Tod. Er hatte in einem Traum gesehen, wie Soldaten ihn hinterrücks ermordeten, und bereitete sich auf den langen Ritt in die Ewigkeit vor. Es hatte keinen Zweck, sich gegen eine solche Vision zu wehren. Auch in unseren Träumen erfuhren wir die Wahrheit. Er würde einen frühen Tod sterben und auf der anderen Seite des Flusses den Büffel jagen. In Gedanken sah ich, wie er einen mächtigen Bullen mit der Lanze erlegte, ihn zerlegte und die Leber aß.
Seit die wasicun über die weiten Ebenen ritten, ließen sich die Tiere immer seltener blicken. Im vergangenen Frühjahr, als wir unser Winterlager verlassen hatten und zu dem Fluss gezogen waren, der bei den Weißen als Powder River bekannt ist, hatten die akicita eine kleine Herde aufgespürt und die Frauen hatten genug Fleisch getrocknet und zu Pemmikan verarbeitet, dass wir im Sommer keinen Hunger zu leiden brauchten. Pemmikan war getrocknetes Fleisch, das mit frischen Beeren und Fett zu einem schmackhaften Brei verarbeitet wurde. Normalerweise hoben wir das Pemmikan für den Winter auf, wenn die Krieger nicht auf die Jagd gehen konnten, aber unsere vierbeinigen Brüder hatten sich in diesem Sommer kaum sehen lassen und wir waren auf unsere Vorräte angewiesen. Wir mussten unbedingt eine Büffelherde aufspüren, bevor wir ins Winterlager zogen, sonst würden wir verhungern. Oder wir waren gezwungen, ins Reservat zu gehen und von den Rationen der Weißen zu leben. Aber daran wollte zu diesem Zeitpunkt noch niemand denken. Die Büffel waren immer gekommen, auch wenn es nur ein paar Tiere gewesen waren, und Wakan tanka würde uns auch in diesem Herbst nicht im Stich lassen. Crazy Horse war ein mächtiger Krieger. Sein Zauber würde die Tiere in unsere Nähe locken.
Es war nicht einfach, die Büffel zu finden, solange die Blauröcke unseren Spuren folgten. Die akicita waren damit beschäftigt, unser Lager zu schützen, und die jungen Krieger, die sonst immer begierig darauf waren, eine Herde zuerst zu finden, wurden angewiesen, in unserer Nähe zu bleiben. Wenn wir zu einem Kampf gezwungen wurden, brauchten wir jeden Krieger. Es blieb meiner Mutter überlassen, die Tiere aufzuspüren. Sie war zum Beerensuchen über die Hügel gegangen und hatte sich auch durch meinen Vater nicht davon abhalten lassen, den schützenden Ring der akicita zu verlassen. Sie war eine sehr starke und eigenwillige Frau und hatte Gelbe Hand sogar verboten, ihre Schwester als zweite Frau zu nehmen. Die meisten Krieger hatten mehrere Frauen. Die Schwarzkittel in den Reservaten, die uns zum Christentum bekehren wollten, nannten diesen Brauch eine Sünde, ohne zu wissen, dass es bei unserem Volk mehr Frauen als Männer gab und Wakan tanka wollte, dass jede Frau versorgt war. Wir lebten in einem feindseligen Land und es war nicht gut für eine Frau, allein zu bleiben. Meine Mutter hielt wenig von einer Nebenbuhlerin und sorgte selbst dafür, dass ihre Schwester einen anderen Mann fand. »Bin ich dir nicht gut genug?«, fuhr sie meinen Vater an. »Bist du nicht zufrieden?«
Mein Vater war sehr zufrieden. Das nahm ich jedenfalls an, und wenn ich daran denke, wie leidenschaftlich er meine Mutter in die Arme nahm und wie oft die beiden sich liebten, wenn sie glaubten, dass ich eingeschlafen war, hatte er keinen Grund, sich eine zweite Frau zu nehmen. »Mita wicu«, sagte er lachend, »manchmal erinnerst du mich an eine Büffelkuh, der man einen Pfeil ins Hinterteil geschossen hat!« Während sie in den Hügeln nach Beeren suchte, blieb er immer in ihrer Nähe und ich glaube, er hätte sich ganz allein auf die angreifenden Soldaten gestürzt, wenn sie meine Mutter überrascht hätten. Gelbe Hand war ein guter Vater und ein guter Ehemann und ich bedaure jeden Tag, dass er im Reservat dem Alkohol verfiel und daran starb. »Tatanka! Tatanka!«, hörte ich die Stimme meiner Mutter bis ins Lager. »Büffel! Büffel!« Die magischen Worte, auf die wir so lange gewartet hatten, und doch klang etwas in ihrer Stimme mit, das mir große Angst machte. Der verzweifelte Schrei, der ihren Worten folgte, bewies mir, dass ich Recht hatte.
Ich spielte mit Viele Pferde zwischen den Hütten, als meine Mutter schrie. »Ina!«, rief ich entsetzt. »Meine Mutter!« Ich sprang auf und rannte sofort los, dicht gefolgt von meiner Freundin, die wohl mehr Angst hatte, allein im Lager zu bleiben, als mit mir und den meisten anderen Dorfbewohnern über die Hügel zu laufen und nachzusehen, was meine Mutter entdeckt hatte. Die akicita waren verwirrt und unternahmen nicht einmal den Versuch, uns zurückzuhalten. Sie wussten, dass der Schrei meiner Mutter kein Hilfeschrei gewesen war und wir nicht in eine Falle der Blauröcke liefen. »Adlerfrau! Warte auf mich!«, rief Viele Pferde hinter mir. Die Angst um meine Mutter hatte mir ungeahnte Kräfte verliehen und ich hatte einen großen Vorsprung. »Adlerfrau!«, rief sie wieder. Diesmal wartete ich, bis sie nachgekommen war, und griff nach ihrer Hand. Zusammen liefen wir weiter.
Meine Freundin und ich gehörten zu den Letzten, die den Hügelkamm erreichten. Schon aus der Ferne erkannten wir, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Unsere Leute standen wie zu Stein erstarrt im kniehohen Büffelgras, und als wir sie erreichten, hörte ich, wie Crazy Horse beide Arme zum Himmel reckte und rief: »Wie konnte so etwas geschehen, Wakan tanka? Warum hast du die wasicun nicht daran gehindert, unseren heiligen Kreis zu durchbrechen? Was haben wir getan?« Unter den Dorfbewohnern setzte großes Wehklagen ein. Wir beobachteten, wie einige Frauen ihre Haare lösten und sich mit ihren Messern blutige Wunden beibrachten. Das taten die Frauen der Lakota sonst nur, wenn sie um jemanden trauerten.
Wir bahnten uns einen Weg durch die Erwachsenen und blieben erschrocken stehen, als wir freie Sicht hatten. Das Tal war mit toten Büffeln übersät. Weiße Männer hatten sie wegen ihrer Häute gejagt und ihre Kadaver in der Sonne liegen lassen. Die weiße Fettschicht auf ihren leblosen Körpern war mit Blutflecken bedeckt und wurde von Insekten überfallen, die in dunklen Wolken über den toten Tieren schwebten. Beißender Gestank stieg von den Kadavern empor und zwang einen jungen Krieger, sich zu übergeben. Niemand tadelte ihn dafür. Wir hatten gehört, dass weiße Jäger die Büffel abschlachteten, aber nur wenige Lakota hatten einen solchen Anblick jemals ertragen müssen.
Mir schossen Tränen in die Augen. Ich hatte so etwas Furchtbares noch nie gesehen und starrte verzweifelt auf die weißen Kadaver. Der schreckliche Anblick brannte sich tief in meine Seele und ließ mich tagelang nicht schlafen. Manchmal träume ich heute noch davon. Wie konnten Menschen unseren vierbeinigen Brüdern so etwas antun? Büffel waren heilige Tiere. Wie konnte man sie abschlachten und ihr wertvolles Fleisch in der Sonne verfaulen lassen? Wie konnte man zulassen, dass sie entehrt wurden, indem man es versäumte, ihre Leiber mit dem Kopf nach Osten zu ziehen, bevor man sie enthäutete? In der Schule im Osten wollte man uns weismachen, dass Tiere keine Seele haben, und wir nickten brav, weil wir sonst eine schlechte Note bekommen hätten. Dabei glaube ich immer noch, dass alle Dinge eine Seele haben. Wakan tanka lebt in den Menschen und in unseren vierbeinigen und geflügelten Brüdern, sogar in den Bäumen, Sträuchern und Steinen am Wegesrand. Die Weißen sind selbstgefällig, wenn sie glauben, dass sie die einzig wahren Lebewesen seien. Ich glaube, dass es nur einen Schöpfer gibt, egal, wie wir ihn nennen, und ich bin fest davon überzeugt, dass er keinen Unterschied zwischen den Lebewesen macht. Selbst die Crow und die Pawnee waren vom Großen Geheimnis beseelt, sonst hätte Wakan tanka sie nicht zu unseren Feinden gemacht.
An diesem Abend aß niemand etwas. Die weisen Männer reinigten das Lager mit schwelendem Sweet Grass und versuchten den Büffelgeist mit heiligen Liedern zu beschwichtigen, während Crazy Horse die heilige Pfeife unter den tapferen Männern kreisen ließ und zu einem Kriegszug gegen die weißen Jäger aufrief. Einige Frauen und Kinder weinten. Ich hockte stumm auf meinem Büffelfell und hielt die Hand meiner Mutter. Ich spürte die Stärke, die sich während des langen Krieges gegen die wasicun in ihr gesammelt hatte und uns die Kraft gab, die Tränen zurückzuhalten. Sie hatte kein einfaches Leben. Als Frau eines Kriegers musste sie ständig damit rechnen, ihn zu verlieren und allein zu leben. Ich glaubte nicht, dass sie wie die meisten anderen Frauen war und einen neuen Krieger heiraten würde, nur um versorgt zu sein. Sie war stark und konnte sehr störrisch sein.
Noch am späten Abend ritten Crazy Horse und sechs Krieger der akicita, unter ihnen mein Vater, aus dem Lager, um sich an den Büffeljägern zu rächen. Bei jedem anderen Kriegszug hätten sie bis zum frühen Morgen gewartet. Aber dies war ein besonderer Kriegszug und selbst die weisen Männer waren der Meinung, dass man auf gewisse Zeremonien verzichten müsse, um die Büffeljäger einzuholen. Die Büffelgeister konnten nur mit ihrem Tod versöhnt werden. Meine Mutter packte einen Tierdarm mit Pemmikan und einen Behälter mit kühlem Wasser aus dem nahen Fluss auf das Pferd meines Vaters und legte die Farben und das Wapitifett bereit. Auch wenn die Krieger es eilig hatten, nahmen sie sich die Zeit, ihre Kriegsfarben aufzutragen. Ich beobachtete stumm, wie mein Vater seine beste Kleidung anlegte, und versuchte ein Lächeln, als er sich von mir verabschiedete. »Du wirst die weißen Männer töten, nicht wahr?«, fragte ich leise.
»Wir werden sie bestrafen, micunksi«, antwortete er bestimmt.
Wir beobachteten, wie der kleine Kriegstrupp aus dem Lager ritt, und beteten zu Wakan tanka, er möge Crazy Horse und seinen Kriegern beistehen. Einige Männer hatten die Spuren der Büffeljäger untersucht und wir wussten inzwischen, dass sie zu viert und schwer bewaffnet waren. Sie besaßen die schweren Büffelgewehre, die kaum nachgeladen werden mussten und einen ausgewachsenen Bullen mit einer Kugel fällen konnten. Auch Crazy Horse besaß ein solches Gewehr. Seine Begleiter ritten mit einschüssigen Flinten, Lanzen und Pfeil und Bogen in den Kampf. »Wakan tanka«, betete ich leise, »hilf meinem Vater die weißen Männer zu bestrafen! Sie haben den Tod verdient!«
Während der Kriegstrupp unterwegs war, verlegten wir unser Lager nach Nordwesten. Die Späher hatten ein tiefes Tal gefunden, das geschützt zwischen grauen Felsen lag, und Crazy Horse hatte versprochen, uns dort zu treffen. Wir brauchten einen Tag für den Marsch. Ein heftiger Regenschauer sorgte dafür, dass wir kaum Spuren hinterließen und uns in dem neuen Lager einigermaßen sicher fühlen durften. Wir stellten sogar die tipis auf. Die jungen Krieger töteten einige Antilopen und verteilten das Fleisch der getöteten Tiere unter allen Familien. Natürlich wollten sie für ihren Großmut bewundert werden und die Frauen taten ihnen den Gefallen und versprachen feierlich, Crazy Horse davon zu erzählen. Das Fleisch schmeckte köstlich. Ich verschlang eine große Menge und genoss die Wärme, die von unserem kleinen Feuer ausging und sich im ganzen tipi ausbreitete. Der Regen trommelte auf die gespannten Büffelhäute.
Damals waren die Kinder der Lakota den Krieg gewöhnt. Sie lebten mit der ständigen Gefahr, von Blauröcken oder feindlichen Crow oder Pawnee überfallen zu werden. Es war nichts Besonderes für sie, dass ein Vater auf dem Kriegspfad war. Sie mussten damit rechnen, dass er nicht zurückkehrte. Ich glaube nicht, dass die Tochter eines weißen Mannes einer solchen Bedrohung standgehalten hätte. Ich lebte damit und konnte sogar ruhig schlafen. Wakan tanka bestimmte, was auf der Erde geschah. Er wusste, was am besten für uns war. Er würde meinen Vater beschützen, und wenn es nicht so war, konnten wir nichts dagegen tun. Dann mussten wir uns damit trösten, dass ein Krieger der Lakota, der im Kampf seinen Ruhm vermehrt hatte, einen Ehrenplatz auf der anderen Seite des Flusses bekam.
Der Regen ließ nach und die Sonne kehrte zurück. Ihre warmen Strahlen erweckten uns zu neuem Leben und stärkten Crazy Horse und seine Krieger, denn als sie fünf Tage später zurückkehrten, trugen sie die blutigen Skalpe der weißen Büffeljäger an ihren Gürteln. Sie hatten die weißen Männer besiegt. Es war ihnen gelungen, die gemeinen Mörder im Schlaf zu überraschen und zu töten. Am späten Abend tanzten unsere tapferen Krieger mit schwarz bemalten Gesichtern um das Feuer und die Frauen schwenkten die Skalppfähle und sangen fröhliche Siegeslieder.
Die meisten Weißen sind entsetzt, wenn ich von der Sitte des Skalpierens berichte. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass sie mit zweierlei Maß messen, wenn es um die Grausamkeiten des Krieges geht. Unsere Krieger skalpierten einen Feind nicht, um ihn zu demütigen oder ihm besonders große Schmerzen zuzufügen. Der Skalp war ein Zeichen des Lebens. Wir glaubten, dass der Geist eines Menschen in seinen Haaren weiterlebt, und die Krieger wollten nicht, dass ein erbitterter Feind geehrt wurde, indem man ihm seine Geist-Haare ließ. Die Büffelgeister wurden nur gerächt, wenn die Krieger das Leben ihrer Feinde vernichteten und ihre Skalpe ins Lager brachten.
Die Krieger tanzten die ganze Nacht hindurch. Sie hatten die Ehre der heiligen Büffel erneuert und das Leben ihrer feigen Mörder vernichtet. Erst als einige Späher von einem Erkundungsritt zurückkehrten und darüber berichteten, wie nahe uns die Blauröcke waren, wurden wir an die Wirklichkeit erinnert. Die Soldaten waren uns auf den Fersen und wir hatten noch immer keine Vorräte für den Winter. Würden die Büffel zurückkehren? Würden wir uns vor den Soldaten verstecken können, bis wir wieder stark genug waren, um gegen sie zu kämpfen? Nicht einmal Crazy Horse war davon überzeugt. Am Morgen nach seinem Sieg gegen die Büffeljäger beobachtete ich, wie er allein vor seinem tipi stand und mit besorgter Miene in die Ferne blickte.
3
Wir blieben den ganzen Sommer in dem versteckten Tal. Es lag abseits der Trails, die von den weißen Händlern benutzt wurden, und zwischen den Felsen entsprang eine Quelle, die uns genügend Wasser gab. Unsere besten Späher waren ständig unterwegs und suchten nach den Büffeln und kehrten jedes Mal mit bedrückten Mienen zurück. Die zottigen Tiere waren verschwunden. Einmal sprengte ein junger Krieger aufgeregt ins Lager und rief »Tatanka! Tatanka!«, aber er war einem Trugbild erlegen und die Jäger fanden lediglich eine alte Schindmähre, die irgendeinem weißen Siedler davongelaufen war. Der junge Krieger errötete vor Scham und schwor, sich beim nächsten Sonnentanz noch einmal der Mutprobe zu stellen. Wakan tanka schien uns verlassen zu haben. Die einzige Beute, die unsere Krieger ins Lager brachten, bestand aus einem Hirsch und zwei oder drei Rehen. Wir aßen kaum von dem Fleisch. Es wurde getrocknet und zu Pemmikan verarbeitet und für den Winter aufbewahrt.
Unsere Gebete wurden nicht beantwortet. Crazy Horse verbrachte vier Tage und vier Nächte in den nahen Felsen und kehrte enttäuscht in sein tipi zurück. Auch seine Gebete waren nicht erhört worden. »Wakan tanka hat sich von seinen Kindern abgewandt«, sagte er am großen Feuer. »Was müssen wir tun, um seine Gunst zu erlangen?« Niemand wusste eine Antwort und ich erkannte tiefe Niedergeschlagenheit auf den Gesichtern. Wenn die Büffel nicht zurückkehrten, stand uns eine schwere Zeit bevor. Ein alter Mann berichtete von einem besonders strengen Winter: »Das war vor vielen Wintern, noch bevor der Weiße Mann die weiten Ebenen betreten hatte, und es ging uns so schlecht, dass wir Hagebutten und Eicheln essen und einige der Hunde schlachten mussten. Aber im Mond der Erdbeeren kehrten die Büffel zurück und wir hatten genug zu essen.« Diesmal, so ahnte der alte Mann, würden sie nicht mehr kommen.
Die weisen Männer berieten darüber, ob es sinnvoll war, das Lager abzubrechen und mit dem ganzen Stamm über die Prärie zu ziehen, und entschieden dagegen. Ein solcher Marsch wäre zu gefährlich gewesen. Die Soldaten waren überall und die verräterischen Crow oder Pawnee würden uns in den alten Jagdgründen aufspüren. Es war besser, wenn kleine Spähtrupps das Land erkundeten. Solange der Graue Wolf unser Versteck nicht kannte, würde er dort suchen, wo wir die letzten Sommer verbracht hatten. Das bestätigten einige Krieger, die den General und seine Männer am Rosebud River gesehen hatten. »Der Graue Wolf stand mit hängender Zunge zwischen den Hügeln«, lästerte ein junger Krieger, »er wird uns niemals finden!« Mein Vater und die anderen erfahrenen Männer schwiegen. Sie ahnten, dass uns der Graue Wolf bald auf die Spur kommen würde.
Der Donnervogel sorgte dafür, dass wir bis zum Mond der gelben Blätter in unserem Versteck bleiben konnten. Er schlug mit seinen kräftigen Hügeln und schickte mehrere Gewitter, die sich über unserem Tal entluden. Ich fürchtete den Donner und den Blitz und versteckte mich unter meiner Decke. Erst als sich die Wolken verzogen hatten, wagte ich mich wieder hervor. Es ging mir ähnlich wie Einsamer Mann, einem heyoka oder Gegenteilmann, der große Angst vor Gewittern hatte und den Donner im strömenden Regen verhöhnte. Heyoka taten immer das Gegenteil von dem, was sie dachten. Sie gehörten einem religiösen Bund an, der auf einen besonders eindrucksvollen Traum zurückging und ein narrenhaftes Verhalten von ihnen verlangte. Die weißen Blitze, die sie sich auf die Stirn malten, sollten sie vor dem Donnervogel schützen, aber sie nahmen ihnen nicht die Angst. Ganz anders verhielten sie sich im Kampf. Die heyoka gehörten zu den tapfersten Kriegern unseres Stammes und von Einsamer Mann ist bekannt, dass er nur mit einem Stock bewaffnet gegen seine Feinde zog. Wie er es fertig brachte, erst im hohen Alter im Reservat zu sterben, ist mir nicht bekannt.
Ich berichte so ausführlich über die heyoka, weil Einsamer Mann uns in diesem Herbst beinahe an die Soldaten verriet. Meist lachten wir über den seltsamen Mann, wenn er in die verkehrte Richtung tanzte oder sich bei brütender Hitze ein Büffelfell überwarf, doch diesmal kostete uns einer seiner Streiche beinahe das Leben. Es war im Mond der gelben Blätter, dem September. Waziya, der Wettergeist, hatte den ersten Nordwind in unser Dorf geblasen und die weisen Männer schlugen vor, nach Süden zu ziehen und ein Winterlager zu suchen. Damals verbrachten wir die kalte Jahreszeit in den Wäldern, um besser gegen die eisigen Stürme geschützt zu sein. Selbst die Crow und Pawnee verspürten keine Lust, im Winter auf den Kriegspfad zu ziehen, und die Soldaten blieben lieber in ihren Forts und wärmten sich an ihren Kaminfeuern. Nach unserem Sieg am Greasy Grass war alles anders. Die wasicun waren wütend und ließen auch im Winter nicht von unserer Verfolgung ab. Sie hofften, dass der Hunger uns zwang, die Waffen zu strecken und ins Reservat zu ziehen. Diese Hoffnung war begründet. Einige Anführer erkannten, dass die Alten und Schwachen den Winter nicht überleben würden, und gaben niedergeschlagen auf. Sie ergaben sich und lebten von den Rationen, die sie im Reservat bekamen.
Auch Crazy Horse spielte mit dem Gedanken, aus Rücksicht auf einige Familien, die während der Flucht erkrankt waren, seine Waffen niederzulegen. Sein Stolz verbot es ihm, die Worte am großen Feuer auszusprechen, aber ich sah seiner bedrückten Miene an, dass er darüber nachdachte. Der erfahrenste Krieger des Fuchsbundes, ein Mann von über siebzig Wintern, vertrieb diese Gedanken. Mit brüchiger Stimme erklärte er: »Tashunka Uitko, hör mich an! Meine Krieger, hört mich an! Wir haben die wasicun am Greasy Grass besiegt. Wir haben ihre Herzen in den Staub getreten. Wollt ihr vor den Männern, die ihr gedemütigt habt, in die Knie gehen? Ich glaube, ich spreche für alle Alten und Schwachen, wenn ich sage: Wir folgen dir auf den letzten Kriegspfad! Wir kämpfen um die heiligen Berge, die uns der Weiße Mann nehmen will! Lieber sterbe ich auf diesem heiligen Boden, als bei Machpiya Luta einen baldigen Tod herbeizusehnen.« Machpiya Luta war der indianische Name von Red Cloud. »Ich bin dafür, in ein Winterlager zu ziehen. So haben wir es immer getan, meine Brüder. Wakan tanka wird uns helfen, den Winter zu überstehen! Das ist alles, was ich zu sagen habe.«
Niemand widersprach dem weisen Krieger. Wir zogen bereits am nächsten Morgen weiter und dachten wehmütig daran, wie es vor der Ankunft der wasicun gewesen war. Damals hatten die Männer eine große Büffeljagd veranstaltet, bevor sie ins Winterlager gezogen waren. Jetzt gab es keine Büffel mehr, die wir jagen konnten. Wir wurden selbst gejagt. Selbst wenn sich die Soldaten nicht in unmittelbarer Nähe aufhielten, war es besser, so schnell wie möglich zu verschwinden. Wir wollten die Wälder im Süden noch vor dem ersten Schnee erreichen. Wenn der Schnee liegen blieb und Waziya eine Atempause einlegte, waren unsere Spuren deutlich zu sehen und die Soldaten hätten keine Schwierigkeit, uns zu verfolgen und zur Aufgabe zu zwingen. Auch die Krieger unseres Volkes waren nicht stark genug, um gegen die Übermacht der wasicun anzukommen. Crazy Horse hätte dennoch gegen sie gekämpft und nur die Sorge um die Frauen und Kinder hielt ihn davon ab, auf den Kriegspfad zu gehen. Manchmal war es klüger, einem Kampf auszuweichen.
Wir brauchten nicht lange, um die Büffelhäute von den tipi-Stangen zu ziehen und den wenigen Besitz, den wir hatten, in parfleches zu packen. So nannten wir die mit bunten Mustern verzierten Rohhaut-Taschen. Den restlichen Besitz luden wir auf Schleppbahren. Diese travois bestanden aus zwei tipi-Stangen, zwischen die man eine Büffelhaut gespannt hatte, und wurden von den Pferden gezogen. Einige Krieger trieben die Ponyherde zusammen. Außer dem Schnauben der Tiere und dem Scharren der tipi-Stangen war nichts zu hören, als wir unser Versteck verließen. Selbst die Hunde bellten nicht. Wir wussten, wie gefährlich es war, mit so vielen Familien und den Schleppbahren über die Ebenen zu ziehen. Aber uns blieb nichts anderes übrig, wenn wir vor den Winterstürmen sicher sein wollten. Die jungen Krieger versuchten vergeblich unsere Spuren zu verwischen. Die indianischen Kundschafter würden sie finden. Wenn es uns nicht gelang. in den Bergen unterzutauchen, würden die Soldaten uns finden. Dann waren wir gezwungen zu kämpfen.
Wir waren noch keine Tagesreise von unserem Sommerlager entfernt, als der Zwischenfall geschah. Einsamer Mann hatte sich von den anderen Kriegern abgesondert, wie er es meistens tat, wenn wir unterwegs waren, und sprengte durch den Bach, den wir gerade überquerten. Das Wasser spritzte unter den Hufen seines gescheckten Ponys und glitzerte in der Sonne. Er schwang den bemalten Stock, den er als Waffe trug, und rief: »Ich habe keine Soldaten gesehen! Ich habe keine Soldaten gesehen!« Was nur bedeuten konnte, dass er die Blauröcke aufgespürt hatte, denn heyoka sagten immer das Gegenteil von dem, was sie meinten. Er berichtete von einer Patrouille, die ungefähr eine halbe Tagesreise weiter südlich über die Prärie zog, und empfahl uns, durch einen Hohlweg zu reiten, den er im Westen entdeckt hatte. Dort wären wir sicher vor den Blauröcken.
Alle wussten von den derben Scherzen, die heyoka wie Einsamer Mann sich ausdachten, doch niemand rechnete damit, von ihm in eine Falle gelockt zu werden. Nur der Geistesgegenwart von Crazy Horse war es zu verdanken, dass wir an jenem Herbstnachmittag nicht in den Tod ritten. Er schien zu ahnen, was Einsamer Mann im Schilde führte, und schlug uns vor, weiter nach Süden zu reiten und zwischen einigen Felsen zu lagern. Wir folgten ihm. Einsamer Mann lenkte seinen Schecken auf einen Hügelkamm und schwenkte aufgebracht seinen Stock: »Hier seid ihr vor den Soldaten sicher! Hier seid ihr vor den Soldaten sicher!«, wiederholte er immer wieder, was nur bedeuten konnte, dass er uns in großer Gefahr glaubte. Crazy Horse verlor die Beherrschung und herrschte ihn an: »Schweig, Einsamer Mann! Du gefährdest die Frauen und Kinder! Dies sind schwere Zeiten!«
Wir versteckten uns zwischen den Felsen und Crazy Horse schickte einige Späher los. Es dauerte einen halben Tag, bis sie zurückkehrten. Eine lange Zeit, wenn man ständig damit rechnen muss, von Soldaten überfallen zu werden. Selbst die Krieger waren nervös. Manchmal schnaubte ein Pferd oder ein Hund bellte. Ein Baby weinte leise. Mit so vielen Familien war es unmöglich, vollkommene Stille zu bewahren. Wir konnten nur hoffen, dass die Soldaten nicht in unserer Nähe waren, und beteten zu Wakan tanka, er möge seine schützenden Hände über uns halten.
Ich lag im Schatten eines Felsens und streichelte einen unserer Hunde. Meine Mutter nickte zufrieden. Es gehörte zu meinen Aufgaben, die Hunde zu beruhigen, wenn wir in Gefahr waren. Mein Vater war mit den Spähern unterwegs. Crazy Horse hatte die besten Krieger des Stammes losgeschickt, um die Soldaten möglichst schnell zu finden. Einsamer Mann war nicht dabei. Er stand neben seinem Schecken und verriet mit keiner Miene, was er dachte. Die Blitze auf seiner Stirn ließen ihn streng und unnachgiebig erscheinen. Heyoka gehörten zu den mutigsten Kriegern. Sie zogen mit einfachen Waffen in den Krieg und banden sich während eines Kampfes am Boden fest, um die anderen Männer daran zu hindern, vor dem Feind zurückzuweichen. So hatte mein Vater es mir berichtet. Ich war froh, dass er kein heyoka war. Ich liebte ihn sehr und wollte nicht, dass er starb.
Ich stand auf und trat neben einen Felsen, der wie ein steinernes tipi aus dem Boden wuchs. Nachdenklich blickte ich zu den fernen Hügeln empor. Die schwache Herbstsonne war nach Westen gewandert und leuchtete im Salbei. Aufgewirbelter Staub hing in feinen Schleiern über dem Hügelkamm. Mein Herz klopfte schneller, als ich daran dachte, in welcher Gefahr wir schwebten. Wenn Einsamer Mann die Wahrheit gesagt hatte, wären wir den Soldaten vielleicht direkt in die Arme geritten und sie erschienen im nächsten Augenblick auf den Hügeln, um uns zu töten oder gefangen zu nehmen. Wenn er sich einen derben Scherz ausgedacht hatte, war mein Vater in höchster Gefahr. Als Tochter eines Lakota-Kriegers war ich an die Gefahr gewöhnt, aber dies waren keine Crow oder Pawnee, sondern Soldaten, und eine Niederlage konnte bedeuten, dass unser ganzes Volk unterging.
Viele Pferde kam zu mir und griff nach meiner Hand. Ihre Augen waren voller Furcht und sie zitterte. »Was tun die Soldaten, wenn sie uns finden?«, fragte sie nervös. »Bringen sie uns um?«
Ich dachte an die Frau, deren Familie am Washita umgekommen war, und zwang mich den Kopf zu schütteln. »Nein, sie haben genug getötet. Sie treiben uns ins Reservat. Zu Spotted Tail und Red Cloud. Dann sind wir Gefangene. Aber wir dürfen in tipis wohnen und bekommen genug zu essen. Im Reservat müssen wir nicht mehr um unser Leben fürchten.«
»Und warum ergeben wir uns nicht? Spotted Tail und Red Cloud leben schon sehr lange im Reservat, nicht wahr? Warum gehen wir nicht zu ihnen? Ich habe Angst hier draußen.«
Mir fiel keine Antwort auf diese Frage ein. Blieb Crazy Horse auf dem Kriegspfad, weil ihm sein Stolz nicht erlaubte, die Waffen niederzulegen? Glaubte er immer noch, dass Red Cloud ein Feigling war? Sah er sich in seiner Vision als ungebundenen Krieger sterben? Ich wusste es nicht genau. »Wir sind Lakota«, antwortete ich, »wir leben auf den weiten Ebenen.« Ich erinnerte mich an die Worte, die mein Vater am großen Feuer gesprochen hatte. »Solange ich denken kann, sind wir dem Büffel über die Prärie gefolgt. Wir wurden nicht dazu geboren, die Erde umzuwühlen und die gefleckten Büffel zu essen, die der Weiße Mann in das Reservat bringt. Wir sind Jäger. Wir sind Krieger. Überlasst es den Alten und Schwachen, um Gnade zu bitten! Ich werde kämpfen! Wenn das Große Geheimnis ruft, dann sterbe ich als tapferer Krieger! Das ist alles, was ich zu sagen habe.«
Ich hatte die Worte meines Vaters nur in Gedanken wiederholt und sah, dass Viele Pferde mich nicht verstand. Sie blickte mich feierlich an. »Versprich mir, dass du immer bei mir bleibst«, sagte sie. »Wenn du in meiner Nähe bist, kann nichts passieren.«
Ich versprach es und kam mir sehr überheblich dabei vor. Ich hatte erst sechs Winter gesehen. Wie konnte ich meine Freundin vor den Soldaten schützen? Besaß ich übernatürliche Kräfte?
Ich spürte, wie der Händedruck meiner Freundin fester wurde, und erkannte Reiter auf dem Hügelkamm, der unserem Versteck am nächsten lag. Unsere Späher kehrten zurück. Sie ritten im vollen Galopp zwischen die Felsen und sprangen von den Pferden. »Blauröcke!«, berichtete mein Vater. »Sie kommen durch den Hohlweg, in den Einsamer Mann uns schicken wollte!« Er deutete wütend auf den heyoka, der immer noch keine Miene verzog. »Hätten wir auf seinen Vorschlag gehört, wären wir jetzt alle tot!«
»Wie viele Soldaten sind es?«, fragte Crazy Horse, ohne Einsamer Mann eines Blickes zu würdigen. »Wohin reiten sie?«
»Viele Soldaten«, erwiderte mein Vater ernst, »doppelt so viele Gewehre wie wir! Wenn sie die Richtung beibehalten, kommen sie südlich von hier vorbei. Dort gibt es keine Spuren von uns.«
Crazy Horse nickte zufrieden und bedeutete uns, in unserem Versteck zu bleiben. »Keinen Laut!«, warnte er. »Es kann sein, dass die Soldaten dicht an diesen Felsen vorbeireiten!« Er bat meinen Vater und einige andere Krieger der akicita, nach Süden zu reiten und die Soldaten zu beobachten, und stellte die doppelte Anzahl von jungen Kriegern zur Pferdeherde ab. Den Frauen und Kindern befahl er, so ruhig wie möglich zu sein und sich um die Packpferde und die Hunde zu kümmern. »Dies ist kein Tag zum Kämpfen«, sagte er, »noch ist der Augenblick nicht gekommen!«
Obwohl Einsamer Mann uns beinahe in den Tod geführt hätte, wurde ihm kein Vorwurf gemacht. Er war ein heyoka, ein Gegenteil-Mann, der unter dem Einfluss des Donnervogels stand und dazu geboren war, seltsame Dinge zu tun. Bei den Hunkpapa gab es einen Medizinmann, der behauptete, dass jeder heyoka ein kleines Kind töten musste, um die Gnade von Wakan tanka zu erlangen. Diese Krieger waren mit den Geistern verwandt und es stand uns nicht zu, sie zu kritisieren. Geist-Männer taten seltsame Dinge, die normale Menschen nicht verstanden.
Ich kehrte zu meiner Mutter zurück. Viele Pferde blieb bei mir und half mir die Hunde zu beruhigen. Ich bemerkte, wie sie ängstlich zu Einsamer Mann hinüberblickte, und beruhigte sie mit den Worten: »Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Einen solchen Scherz wiederholt er bestimmt nicht. Er ist ein heyoka! Er gehört zu den tapfersten Kriegern unseres Volkes!« Ich erzählte ihr nicht, dass ich mich ebenfalls vor Einsamer Mann fürchtete. »Er ist ein Lakota! Er kämpft an unserer Seite!«
Die Soldaten kamen am frühen Morgen des nächsten Tages. Wir hatten kaum geschlafen und waren sofort hellwach, als mein Vater und die anderen akicita in unser Versteck zurückkehrten. Sie bewegten sich so leise wie Berglöwen. Sie gaben uns durch Zeichen zu verstehen, dass die Soldaten dicht hinter ihnen waren und in nächster Entfernung an den Felsen vorbeiritten, und glitten mit schussbereiten Waffen aus den Sätteln. Ich warf einen Blick auf unsere Hunde und nickte zufrieden. Sie schliefen neben einem Gestrüpp. »Werden sie uns töten?«, flüsterte Viele Pferde nervös. Ich legte einen Finger auf ihren Mund. Mein Lächeln sollte ihr zeigen, dass sie keine Angst zu haben brauchte.
Wir sahen die Soldaten nicht. Sie waren ungefähr eine Meile von uns entfernt, so viel weiß ich heute, und waren durch einige Hügel und Felsen von uns getrennt. Aber wir hörten sie. Das Schnauben ihrer Pferde, das Knarren ihrer Sättel, das Klappern der Metallteile an ihrem Zaumzeug. Ich wusste, wie Soldaten aussahen, und konnte mir vorstellen, wie sie in Zweierreihen über die Ebene ritten, die Köpfe gesenkt und erschöpft von dem langen Feldzug. Ich glaube nicht, dass sie an diesem kühlen Morgen große Lust verspürten, gegen unsere Krieger zu kämpfen, aber danach fragten die weißen Häuptlinge nicht. Wenn sie uns entdeckten, würde es zum Kampf kommen. Crazy Horse war nicht bereit, sich zu ergeben und in das Reservat zu gehen.
Ich umarmte Viele Pferde und ließ sie erst los, als nichts mehr von den Soldaten zu hören war. »Es ist vorbei«, beruhigte ich sie, »die Blauröcke sind weg!« Aber ganz sicher waren wir erst, als unsere Späher ihnen nachritten und meldeten, dass die Soldaten den großen Fluss im Süden überquert hatten. »Wir reiten nach Osten«, sagte Crazy Horse und wir packten erneut unsere Habseligkeiten und zogen der aufgehenden Sonne entgegen.
4
Wir verbrachten den Winter in einem Canyon der Black Hills, mehr als einen Tagesritt von den Siedlungen der weißen Goldsucher entfernt. Zu beiden Seiten der Schlucht wuchsen hellgraue Granitfelsen empor. Ein Eingang wurde von mannshohen Felsbrocken versperrt, der andere war so schmal, dass er leicht zu bewachen war. Ich habe viele Jahre später versucht, unser Versteck in den Paha Sapa wieder zu finden, aber nur die Ranch eines weißen Siedlers gefunden. Ich nehme an, dass er einen Teil der Felswände sprengen ließ, um mehr Platz für seine Rinder zu haben. Weiße Männer tun seltsame Dinge, wenn es darum geht, den eigenen Besitz zu vermehren und mehr Profit zu machen. Wir kannten eine solche Einstellung nicht. Sicher rühmten sich viele Krieger unseres Stammes, viele Pferde zu besitzen, aber das größte Ansehen erreichten sie, indem sie ihr Eigentum verschenkten oder mit den Armen und Schwachen teilten. Der eigentliche Reichtum eines Mannes bestand darin, ein verwegener Krieger oder geschickter Jäger zu sein und sein Wissen zu vermehren. Ein alter Mann war reich, weil er weise war und viele Geschichten kannte. Eine Frau war reich, wenn sie besonders schöne Handarbeiten herstellte und Kinder hatte.
Wir stellten unsere tipis im Schutz der Felswände auf und sicherten die Büffelhäute gegen den stürmischen Nordwind. Innen wurden die tipis mit dicken Fellen ausgepolstert. Waziya würde uns auch in diesem Versteck aufspüren und seinen frostigen Atem in die Zelte blasen. Solange es noch Gras gab, weideten unsere Ponys überall in der Schlucht, später würde man ihnen trockenes Gras geben. In den tipis wurden wärmende Feuer entzündet. Erst wenn die Krieger der akicita, die jeden Tag den Canyon verließen, frische Spuren von Soldatenpferden fanden, würden wir die Flammen löschen. Indianerfeuer brannten fast rauchlos. Unsere Frauen verstanden es, Holz so zu verbrennen, dass man ein Feuer erst bemerkte, wenn man in unmittelbarer Nähe war.
Der erste Schnee kam bereits im Mond der fallenden Blätter. Ein heftiger Sturm, der wie eine Büffelherde durch unser Versteck stob und wütend an unseren tipi-Wänden rüttelte. Als der Wind nachließ, bedeckte eine dicke Schneeschicht den Boden. Die Ponys standen dicht beisammen und wieherten nervös. Wir traten zögernd vor unsere tipis und blickten staunend in den trüben Dunst. Der Sturm hatte einige dunkle Wolken am Himmel zurückgelassen und wir trauten dem Frieden nicht. Normalerweise hätte ich mit den anderen Kindern ausgelassen im Schnee getollt und mein Vater hätte mir einen Schlitten aus Bisonrippen gebaut. Doch diesmal blieben wir in den tipis. Wir hatten Angst, dass der frühe Schnee ein schlechtes Zeichen war und der Graue Wolf und seine Soldaten in der Nähe waren. Der Schnee schien unseren letzten Lebensmut erstickt zu haben und die Unterhaltungen klangen seltsam gedämpft, als hätte man Angst, die bösen Geister zu wecken und die wasicun herbeizuzaubern.
Wenige Tage später war der Schnee wieder verschwunden. Waziya narrte uns mit einem lauen Wind, der noch einmal den Sommer beschwor und uns an die Zeiten erinnerte, als wir den Büffel gejagt hatten. Ich war alt genug, um die Bilder vor Augen zu haben, denn noch im Frühjahr dieses ereignisreichen Jahres hatte ich gesehen, wie mein Vater einen riesigen Bullen mit seiner Lanze erlegt hatte. Wie die Zirkusreiter, die ich später bei Buffalo Bill kennen lernte, hatte er im vollen Galopp auf seinem Pferd gesessen und die Lanze geschleudert. Ich hatte ein Stück von der frischen Leber bekommen, bevor wir die Fleischstücke auf eine Schleppbahre geladen und ins Dorf gebracht hatten.
Es schienen viele Monde vergangen zu sein, seitdem wir am großen Feuer getanzt und den Duft des gebratenen Fleisches gerochen hatten. Der Geschmack der zarten Büffelzunge liegt mir heute noch auf der Zunge. Diese glorreichen Zeiten würden niemals wiederkommen, das war uns damals allen klar, auch den jungen Kriegern, die es nicht zugeben wollten. Selbst wir Kinder spürten, dass ein Zeitalter zu Ende ging. Für die Indianer begann eine neue Epoche, die keinen Platz mehr für den Krieg und die Jagd hatte. Ich habe diese neue Zeit angenommen und sogar einen weißen Mann geheiratet, aber ich bezweifle bis heute, dass der Weg der wasicun besser ist. Die Weißen graben die Erde um, die unsere Mutter ist, und züchten gefleckte Büffel, die viel schlechter schmecken als die Tiere, die wir gejagt haben. Sie überqueren das Große Wasser und bekämpfen ihre Feinde mit tödlichem Gift, das heimtückisch und leise tötet. Sie führen Krieg wie Feiglinge. Ich habe nie verstanden, warum Wakan tanka den Weg des Weißen Mannes für den besseren hält, und warte auf den Tag, an dem die wasicun erkennen, wie sinnvoll es sein kann, zu den Lehren von Wakan tanka zurückzukehren.
Nach dem Schnee kam die Sonne und nach der Sonne hingen schwere graue Wolken über den Felshängen. Dann regnete es so stark, dass die Schwingen des Donnervogels unsere tipi-Stangen berührten. Waziya wusste nicht, was er wollte, oder er hatte sich mit den wasicun