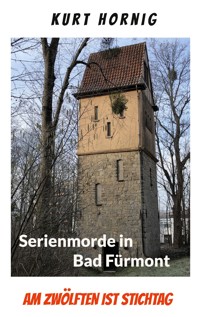Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Streuner, ein Flaschensammler, will für seine Frau kämpfen. Sie ist dement, wohnt in einem Altenpflegeheim und wird eines Nachts weggeschlossen. Der Autor prangert die unzureichenden und zum großen Teil menschenunwürdigen Zustände im Bereich der Altenpflege an, weist auf die Verlogenheit mancher Prüforgane und Ämter hin und kreidet unsinnige Bewertungssysteme an. Er zeigt die Raffgier, fachliche und menschliche Inkompetenz einiger Führungskräfte an einem fiktiven Pflegeheim auf. Dennoch wird die Berechtigung von Pflegeheimen deutlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
1
Felix, er mag etwa fünfundfünfzig bis sechzig Jahre sein, hat sich auf den Weg gemacht, seinen Lebensunterhalt für heute zu sichern. Er trägt alte abgetretene Stoffschuhe, die schon lange keine Pflege mehr bekommen haben. Und seine beige, aus dickem Material bestehende Cordhose ist den ganzen Winter wohl nur kurz für bestimmte Geschäfte herunter gelassen worden. Den Wintermantel, aus billigem Wildlederimitat, hat er mit zwei Knöpfen, die nicht immer zu dem Mantel gehörten, zugeknöpft. Unter der verfilzten Strickmütze lugen seine mittelblonden Haare hervor. Sie passen zu dem Gesamtbild dieser einst so erfolgreichen Persönlichkeit.
Direkt nach dem Abitur studierte er in Hannover Jura, um Rechtsanwalt zu werden. In den Staatsdienst wollte er nie, trotz der damit verbundenen finanziellen Sicherheit.
Eigentlich wollte er Psychologe werden. Der Mensch als solcher interessierte ihn immer schon sehr. Aber er glaubte, ihm als Jurist hilfreicher sein zu können, denn als Psychologe. Psychologie blieb trotzdem sein Hobby, und alles, was er darüber weiß, hat er sich damals in seiner Freizeit angelesen oder im Radio und Fernsehen gehört und gesehen. Das Internet war noch nicht so verbreitet wie heute.
Heute, was ist heute? Wer ist er heute? Wie kam es zu dem heute? Sein heute besteht jeden Tag hauptsächlich daraus, Papierkörbe nach Verwertbarem zu durchsuchen, wobei das Verwertbare manchmal auch aus Lebensmitteln besteht. Zur Tafel, einer sehr sozialen aus engagierten Leuten über das gesamte Land mehr oder weniger dicht verstreut geführten Einrichtung, geht er nicht. Es ist kaum zu glauben, aber sein Stolz verbietet es ihm.
Er sorgt für sich selbst.
Manchmal vergleicht er sich mit Ratten, die keiner will, aber die dennoch für das gesamte Biosystem wichtig sind, wie übrigens jedes Lebewesen und jede Pflanze. Nicht so wichtig sind oft nur die Teile der Gesamtheit, die glauben, es gehe nicht ohne sie, oder sie seien wichtiger oder gar mehr Wert als andere.
Plötzlich hört er das Martinshorn eines Rettungswagens. Es wird schnell lauter und der Ton höher. Diese Melodie lässt immer wieder Erinnerungen an die Zeit vor einigen Jahren in ihm wach werden. Erschreckt lässt er die soeben gefundene Pfandflansche aus Glas fallen. Sie zerbricht mit kurzem, dumpfem Ton auf dem harten Pflaster des Gehwegs an der Bahnhofstraße. Ist das ein Vorzeichen, dieser Ton des Martinhorns, das Bersten der gefallenen Flasche, die Scherben, das Sichtbarwerden des leeren Flascheninneren?
Wieder sind acht Cent Flaschenpfand perdu. Der Krankenwagen rauscht schrill an ihm vorbei, und der Doppler-Effekt lässt die oft unheilvolle Melodie wieder tiefer klingen. Felix sieht dem Wagen nach, bis er vor dem Bahnhof nach links in Richtung Hamstedt verschwunden ist. Er schüttelt mitleidig und bedächtig den Kopf. „Arme Sau“ murmelt er vor sich hin. Notdürftig schiebt er mit seinen stoffschuhbekleideten Füßen die Scherben vom Gehweg in das Gebüsch, während der alltägliche Berufsverkehr langsam zunimmt. Er arbeitet weiter.
Wieder einer dieser trüben Tage, kalt, regnerisch. Dazu bläst ein eiskalter Wind durch die Straßen Schönquells, das sich seit dem ersten 1. April 1913 Bad nennen darf.
Es ist, als ob der kalte Ostwind die Situation in dem einst so beliebten Kurort noch weiter abkühlen wolle. Früher, Mitte des 16.Jahrhunderts, war es ein Bade-Kurort, in dem der europäische Adel, Geldadel und alle, die glaubten, dazuzugehören oder es gerne sein wollten, gerne urlaubten, kurten und wichtige Verbindungen herstellten oder festigten. Es war ein Kurbad ersten Ranges in Europa. So ist es auch nicht verwunderlich, dass zur Hochzeit Schönquells in der Saison Menschen aus ganz Europa kamen. Sie versuchten hier, ihre Wehwehchen und natürlich auch ernsthafte Krankheiten zu kurieren. Badeärzte verordneten ihnen neben dem gesunden Wasser auch sehr viel Bewegung. Alles zusammen muss wohl geholfen haben. Das Wundergeläuf war entstanden.
Aber die Zeiten Zar Peter des Großen, des Alten Fritz, des Dichterfürsten Goethe oder einer Königin sind längst vorbei. Auch einen Nobelpreisträger kann Bad Schönquell zurzeit nicht mehr zu seinen Bürgern zählen. Es gibt heute nur noch das ein oder andere pompöse Haus, das auf die herausragende Stellung als Kurort in Europa, den früheren Wohlstand und vor allem auf den Ihrer damaligen oft honorigen Besucher und Gäste schließen lässt. Viele Häuser sind im Laufe der Jahre verwittert und verfallen. Insofern unterscheiden sich die Baulichkeiten nicht sehr von der derzeitigen Bevölkerung. Die Bevölkerung spiegelt doch letztendlich den Zustand, den des Menschen und den des materiellen Besitzes, insbesondere der Immobilien wider. Dies können Aussichtstürme, Häuser, Wege oder Straßen sein.
All das verkommt immer mehr. Bad Schönquell stellt hier keine Ausnahme dar. Es ist nur ein Beispiel dafür, wohin es kommt, wenn falsche Politik betrieben wird und wenn alte, im Geiste alte, Bürger zu sehr an Vergangenem festhalten und Neuem gegenüber verschlossen sind.
2
„Hast du den Alten gesehen?“. „Ja, die olle Socke ist auch schon wieder unterwegs.“
Die Gespräche zwischen Sven und Maximilian beschränken sich während ihrer Einsatzfahrten meist auf solch kurze Dialoge. Nur montags wird oft richtig diskutiert. Thema ist dann stets der Wochenendfußball. Sven ist Bayern-Fan. Maximilians Verein heißt Hannover 96. Die Roten, so werden die Spieler von Hannover 96 hier in der Region genannt, sind in dieser Spielzeit nicht so erfolgreich wie in vorangegangenen.
„Richtung Hamstedt“ sagt Maximilian leise zu sich selbst und ist in Gedanken schon bei der Unfallstelle auf dieser verrückten Straße zwischen Bad Schönquell und Welsdorf. „Ja, schon das dritte Mal in dieser Woche,“ antwortet Sven mehr zu sich selbst als zu Maximilian. „Wahrscheinlich hat wieder so’n alter Daddy den Verkehr aufgehalten. Wenn die nicht mehr mithalten können, sollen sie sich ‘nen Rollator holen und im Altenheim rumdüsen. Da könn’se trödeln bis zur Fütterung.“
Maximilian wendet seinen Blick langsam Sven zu. Max kann es nicht leiden, wenn so abschätzig und böse über die ältere Generation geredet wird. Vielleicht ahnt er im Unterbewussten, dass dieser Einsatz seine ganze Kraft erfordern würde.
“Mensch, Sven, was soll das denn? Die fahren so wie sie‘s können. Klar rege ich mich manchmal auch über die Trödler auf. Aber die Alten und Unsicheren regen sich andersherum über die Raser auf. Und wer baut schließlich die Unfälle hier an dieser Straße?“
Dann herrscht wieder Ruhe zwischen beiden.
Sie fahren an dem auf der rechten Seite liegenden Fachmarkt vorbei.
Etwas weiter folgen ein paar Geschäfte und ein Einkaufszentrum. Dann geht es aus Schönquell hinaus auf die Hamstedter Landstraße.
„Da hinten ist es. Die Blauen sind auch schon da? Ach du Schande, wie sieht der Wagen denn aus?“ In wenigen Augenblicken erreichen sie die Unfallstelle, die von den auf Streife fahrenden Polizisten bereits abgesperrt worden ist.
„Dieses Mal sind wir schneller. Wir waren gerade auf Streife. Wo ist der Doc? Habt ihr ihn verloren?“ Jonas, der Fahrer, ist ein großer, junger Polizist mit dunkelblondem, gelocktem Haar und seit gut sechs Monaten mit seiner Ausbildung in Holzminden fertig. Manfred, seinen älteren Kollegen kann nichts mehr erschüttern, … sagt er immer.
Jonas war zur Polizei gegangen, weil er Gutes tun, für andere da sein und helfen wollte, wo Hilfe gebraucht würde. Aber er musste schnell feststellen, dass der Alltag mit seinem Papierkram, seinen Gesetzen, Vorschriften und Dienstanweisungen wenig Spielraum für die Umsetzung seiner ehrenhaften Einstellung zuließ.
„Der Doc, der ist auch sofort da. Was ist passiert? Sitzt da noch jemand drin? Wir brauchen die Feuerwehr. Den kriegen wir da so nicht raus. Habt ihr sie schon angerufen?“
Sven, der coole Rettungswagenfahrer, ist ein ausgezeichneter Notfallsanitäter, und er hat schon einiges erlebt, aber dies hier…
„Ja, Manfred hat angerufen… da hinten:“
„Was ist da?“
„Da liegt der andere, ein Motorradfahrer.“
„Was? Wie kommt der denn da hin?“
„Mann, Mann, Mann“.
Unweigerlich müssen die Notfallsanitäter schmunzeln, und Maximilian entweicht ein „Ach, Muschi“.
In diesem Moment fällt Jonas ein Song ein, den Mr.Anderson, eine in der Region bekannte Band aus Bielefeld, vor einigen Jahren komponiert, getextet und gespielt hat.
Er heißt D.O.A., dead on arrival.
Das Martinshorn des Notarztwagens ertönt, und ein, zwei Minuten später ist er am Ort.
Der Notarzt, Dr. Burgel, entsteigt eilig dem rot-weißen Audi.
„Mann, Mann, Mann. Das mir jetzt keiner Muschi sagt.“
„Feuerwehr?“
„Ja, kommt. Da hinten liegt noch einer, ein Motorradfahrer.“
Sven und Dr. Burgel eilen zu dem Motorradfahrer. Es wäre jetzt pietätlos zu sagen: oder zu dem, was von ihm übriggeblieben ist.
3
„Wann kommt Carsten? Schwester, wann kommt Carsten? War Carsten schon da? Wann kommt Carsten? Schwester? Hörn se mal! Hallo, hörn se mal! Schwester, wo ist Carsten?“
„Ja, Schwester, hören Sie das denn nicht? Nun antworten Sie doch mal. Die macht einen ja ganz verrückt,“ bemerkt Herr Falter.
Schwester Ricarda geht um den buntgeschmückten Tisch herum, vorbei an den anderen Bewohnern, auf Frau Tuschort zu.
„Frau Tuschort, Ihr Sohn Carsten war erst gestern hier. Er will heute Nachmittag wiederkommen. Aber er muss erst arbeiten.“
„Dann ist es gut.“
Frau Tuschort, eine der Bewohnerinnen einer Abteilung für Menschen mit demenzieller Veränderung, wie es sachlich korrekt heißt, gibt sich damit zufrieden, bis zum nächsten ‚Schwester, wann kommt Carsten?‘.
Manchmal dauert es eine Stunde oder länger, manchmal aber dreht Ricarda sich um, und es geht schon wieder los: “Schwester, wann …“
Ricarda fragt sich: Was hat sie bloß? Normalerweise ist sie gar nicht so unruhig. Carsten, nach dem hat sie eine Ewigkeit nicht mehr gefragt. Zum Glück merkt sie nicht mehr, dass Ihr Sohn schon lange nicht mehr bei ihr gewesen ist. Sonst fragt sie immer nach Felix. Aber der war auch lange nicht mehr hier. Er wurde hinausgeekelt.
„Hier, hallo, hiiieer!“
Ricarda geht zu Frau Bulde, einer anderen Bewohnerin dieser Station. „Frau Bulde, was kann ich für Sie tun?“
„Sie wissen doch. Ich kriege noch meinen Pelz von der Reinigung. Ich muss doch morgen wieder ins Konzert. Und da brauche ich meinen Pelz.“
„Ja, Frau Bulde, ich habe in der Reinigung angerufen. Den Pelz können wir nachher abholen.“
„Gut, machen Sie das?“
„Eine Kollegin holt den Pelz.“
„Aber nicht vergessen. Die jungen Leute heute sind ja alle so vergesslich. Hier ist die Quittung.“
Frau Bulde reicht Ricarda eine weiße Serviette, die sie vorher von dem kleinen Beistelltisch genommen hat. Ricarda nimmt sie. „Ich werde sie der Kollegin geben.“
„Schwester, wann kommt Carsten?“, kommt es erneut von hinten.
Schwester Ricarda ist einer der guten Geister des Hauses und seit vielen Jahren hier in der Residenz tätig. Das große Haus in der Prof.-Sauerbruch-Straße trägt seinen Zusatz Residenz zu Recht. Es ist eine Einrichtung für pflegebedürftige Menschen jedes Alters. Und dann gibt es einen weiteren Bereich für Menschen, die noch keine Hilfe benötigen, aber trotzdem die Vorteile einer Rundumversorgung nutzen wollen, wenn sie es denn wollen oder es nötig haben. Der gute Ruf hat vor allem in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass insbesondere viele Berliner in Bad Schönquell und speziell in diesem Haus - im betreuten Wohnen - ihren Lebensabend verbringen wollten.
Wenn man vor dem Entree des Hauses steht, und es ist ein Entree und nicht einfach ein läppischer Eingang, kann man feststellen, dass zur Straße liegende Räume Balkone besitzen. Die Blumenkästen sind geschmackvoll mit Blumen bepflanzt, die Fenster besitzen ausnahmslos Gardinen, und da, wo die Räume erleuchtet sind, kann man individuell eingerichtete Zimmer und womöglich ganze Wohnungen erahnen.
Im Inneren wird man von freundlichen Empfangsdamen, die hervorragend auf das etwas spezielle Klientel eingehen, begrüßt. Ein Wasserspiel in der Mitte der Empfangshalle verläuft von der oberen Etage bis hinunter in das Untergeschoss. Das leise Plätschern des Wassers vermittelt unverzüglich heimische, fürsorgliche und behütende Atmosphäre. Die Pastellfarben an den Wänden und in den Bodenbelägen strahlen Helligkeit aus. Man fühlt sich eingeladen und willkommen.
Was man auch fühlt: das hier vorhandene Geld. Man könnte annehmen, sich in einem Fünf-Sterne-Hotel zu befinden. Das Wohnen in dieser Residenz ist nicht für Jedermann. Es kann sich nicht jeder leisten. Dieses Mobiliar, diese Ausstattung, dieses Personal, diese vielfältigen Annehmlichkeiten, dieses Für- und Versorgen müssen einfach teurer sein, als die vielen kommunalen Einrichtungen dieser Art.
Im Leben gibt es nun einmal überall Unterschiede. Das ist ganz natürlich und stellt auch kein Problem dar. Es ist zumindest kein Problem, solange die Menschen der einen Gruppe die der anderen achten und nicht verachten.
Fast keiner der Bewohner macht sich hierüber Gedanken. Die meisten sind bereit, viel Geld auszugeben und können es sich leisten, auch im Alter mit ihren unterschiedlichen Wehwehchen, Zipperlein oder Gebrechen gut behandelt und nicht weggesperrt zu werden.
„Hör‘n se mal! Hallo, Schwester, hör‘n se mal!“
„Ja, Frau Tuschort, was kann ich für Sie tun?“
„Wann kommt Carsten? Schwester, wann kommt Carsten? War Carsten schon da? Wann kommt Carsten, Schwester?“
Schwester Ricarda bleibt ruhig, abgeklärt, hilfreich, liebenswürdig, und was am wichtigsten ist,… menschlich…, menschlich im besten Wortsinn.
„Frau Tuschort, Ihr Sohn Carsten war erst gestern hier. Er will heute Nachmittag wiederkommen. Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, kommt er.“
„Hat er das gesagt?“
„Ja, das hat er gesagt.“
4
Felix geht weiter, den Blick unauffällig auffällig nach unten gerichtet, damit er keine Flasche übersieht. Den großen Stoffbeutel schaukelt er übertrieben stark vor und zurück. Alle zehn bis zwanzig Schritte dreht er sich betont locker mal nach links, mal nach rechts und meint, somit Sorglosigkeit auf andere zur Arbeit fahrende Schönqueller auszustrahlen.
Ausstrahlung besaß er, damals. Als Jurist war er eine Koryphäe und weit über die Grenzen Hannovers bekannt. Eine Bonner Kanzlei hatte ihm Mitte der achtziger Jahre angeboten, auf deren Kosten zu promovieren und bei ihr als Teilhaber einzusteigen. Bonn, damals Regierungssitz, galt bis zur Wiedervereinigung als Toppadresse, nicht nur für Juristen. Politiker haben stets genug rechtliche Probleme zu klären. Nicht selten sind es dann auch private, rechtliche Probleme. Aber er wollte weder promovieren noch nach Bonn. Also blieb er in Hannover. Seine Kanzlei, die er mit vier anderen Anwälten betrieb, lief gut. Ja, man kann sagen, es war die bestlaufende Kanzlei in und um Hannover und eine der besten in Niedersachsen.
Sein Name war, wie erwähnt, auch in Bonn bekannt. Aus diesem Grunde erhielt er immer wieder Aufträge aus Regierungskreisen. Dass Bonn nicht sein Bezirk war, stellte nie ein Hindernis dar. Man konnte einen Strohmann, ähnlich wie beim Fußball, einsetzen. Dort ist es auch nicht ungewöhnlich einen Strohtrainer einzusetzen, wenn der Wunschkandidat keinen Trainerschein besitzt. Der Gewünschte wird einfach Team-Manager, oder er bekommt irgendeine andere Scheinbezeichnung. So wird das Problem behoben.
Vielleicht hat sich der Sport Scheinbezeichnungen ja sogar von der Politik abgesehen. Viele Politiker sind ja sehr erfinderisch, wenn es darum geht, dem Bürger etwas vorzugaukeln, um nicht zu sagen, anzulügen. Anlügen setzt nämlich voraus, dass man bewusst etwas Falsches sagt. Hier kann man zweifeln. Wissen alle Politiker was sie sagen? Nein, viele wissen es nicht. Und manche wissen noch weniger. Sie sind eben auch nur Menschen, auch wenn der gesunde Menschenverstand es manchmal nicht glauben mag.
Die Bahnhofstraße hat er abgearbeitet, und er befindet sich jetzt an der Ampel, bei der die Hauptfahrtrichtung der Bahnhofstraße in die Nordstraße übergeht.
Die nach rechts abzweigende Straße ist die Kantstraße. Hier, an einer Ampel mit Fußgängerüberweg, sind um diese Zeit oft viele Schüler auf dem Weg zum Kant-Gymnasium und zur Realschule, die den Namen des einzigen Nobelpreisträgers Bad Schönquells trägt.
Einige Schüler kommen ihm entgegen. „Ich will mal sehen, was heute alles so abfällt“, sagt er mehr flüsternd zu sich und zuckt etwas zusammen. Dahinten kommt einer dieser Rabauken, die es in jeder Stadt gibt. Ralph hat Felix des Öfteren schon ‚angemacht‘. Zwar ist Ralph noch nie gewalttätig geworden, jedenfalls in körperlicher Hinsicht, aber er beherrscht sein Mundwerk wie kaum ein Zweiter, und das kann zuweilen mehr verletzen und wehtun als körperliche Willkür.
In seiner schlenkernden Art dreht er sich um und geht noch langsamer als gewöhnlich wieder in Richtung Bahnhof. Nach etwa zwei oder drei Minuten blickt er möglichst unauffällig zurück. Ralph ist nicht mehr zu sehen. Felix kehrt nun erneut um und setzt seinen Weg in ursprünglicher Richtung fort. Auf diese Weise ist er einer unschönen Begegnung aus dem Weg gegangen, und er hat ein paar Minuten gewonnen… Minuten, in denen die eine oder andere Flasche der Schüler im Papierkorb nahe der Ampel oder im Gebüsch gelandet ist und ihm ein paar Cent und manchmal sogar ein paar Euro einbringt. Aber heute gibt es nur eine Flasche und eine Cola-Dose.
5
Dr. Burgel und Sven haben den Motorradfahrer erreicht.
„Hallo, hören Sie mich?“
Nichts.
„Können Sie mich hören. Ich bin der Arzt.“
Beide ahnen, dass sie plötzlich alle Zeit der Welt haben. Dennoch beeilen sie sich, einen Ansatzpunkt zum Helfen zu finden. Der schwarze mit roten Ornamenten verzierte Integralhelm steht ganz seltsam zum Oberkörper. Der Doc kann ihn nicht abnehmen oder aufschneiden. Aber irgendetwas muss er doch tun. Wo soll er beginnen?
Aus der linken Seite des Lederoveralls in Höhe der Schulter tritt Blut aus. Es läuft frei in das Gras und färbt es rot.
„Hast du den Arm gesehen?“ fragt Dr. Burgel Sven, der aber nur den Kopf schüttelt.
Der Doc sieht Sven bei der Frage nicht an und bemerkt somit auch nicht Svens Kopfschütteln. Dr. Burgel herrscht ihn an: „Sind Sie taub? Ich habe Sie gefragt, ob Sie den Arm gesehen haben. Ich habe schon hundertmal gesagt, dass ich klare Antworten will. Ist das so schwierig zu verstehen?“
„Nein, ich hab‘ ihn nicht gesehen.“ Kommt es dann kleinlaut zurück.
„Mensch, dann such ihn endlich!“
„Max, wir brauchen den Heli. Veranlassen Sie alles Notwendige. Heli nach Hannover“, bestimmt der Arzt jetzt wieder relativ leise, aber über jeden Zweifel erhaben.
Der Motorradfahrer liegt auf dem Bauch. Der Kopf ist leicht zur Seite gedreht. Somit ist Erstickungsgefahr kaum gegeben. Dr. Burgel versucht, die Halsschlagader zu finden, was bei dieser Ledermontur nicht einfach ist. Jetzt, da er näher herankommt, stellt er fest, dass ein Bein wesentlich länger als das andere ist. Ein kurzer Blick und dann ein vorsichtiger Griff an eine Stelle in Knienähe, an welcher der Overall komisch abgeflacht, gestreckt und verformt ist, zeigt ihm unmissverständlich, dass das rechte Bein abgerissen sein muss.
Er fragt erneut: “Hallo, hören Sie mich?“ Reaktion gleich null.
Der Arzt wendet sich dem Kopf zu, ist in Gedanken aber schon bei dem eingeklemmten Autofahrer. „Wo bleibt denn bloß die Feuerwehr? Wir sind schon eine Ewigkeit hier,“ sagt er sich. Es sind aber erst zwei oder drei Minuten seit seinem Eintreffen vergangen.
„Seht zu, dass ihr in das Auto kommt, wir brauchen das Übliche, Halskrause und so weiter.“
Dr. Burgel beugt sich vor das Visier des Helms. ‚Ich muss seine Augen sehen. Ich muss sie sehen. Ich muss sicher sein. Seine Augen, wo sind die Augen?‘ denkt er hastig. Da, endlich.
Das Kunststoffvisier ist unversehrt. Der Doc kann ein Auge des Motorradfahrers sehen. Das andere ist durch die Lage des Kopfes nicht zu erblicken. Dr. Burgel sieht in ein offenes, gebrochenes Auge, das keinerlei Reaktionen zeigt. Als erfahrener Chirurg und Unfallarzt kann er die richtigen Schlüsse ziehen. Für ihn steht fest: Der Motorradfahrer ist tot.
Sven kommt zurück, mit dem abgetrennten Arm in Leder.
„Sven, hast du den Heli angefordert?“
„Ja, er ist frei und sollte eigentlich umgehend starten.“
Dr. Burgel will sich wieder aufrichten und zu dem Unglückswagen gehen, plötzlich.
„Hey, er lebt ja doch noch. Er hat sich bewegt. Ich habe mich geirrt, ein Glück.“ Der Notarzt wird in seinen Gesten und Anweisungen noch schneller als er ohnehin schon gewesen ist.
Im selben Moment ist dem Doc aber klar, dass er den Motorradfahrer berührt und selbst bewegt haben muss. Seine Erfahrung aus -zig Unfällen täuscht ihn nicht, der Motorradfahrer ist tot.
„Dann muss ich mich jetzt um den Autofahrer kümmern. Manfred, können Sie das Fenster irgendwie öffnen? Ich muss an den Verletzten.“
„Nein, wie stellen Sie sich das vor? Wenn ich die Scheibe einschlage und ihn dann noch mehr verletze, bekomme ich es vielleicht mit den Verwandten und dann mit dem Staatsanwalt zu tun. Das Risiko ist mir zu groß. Dafür sind Sie oder die Feuerwehr zuständig.“
„Sie sehen, dass wir genug mit den Apparaturen zu tun haben, und wenn Sie jetzt nicht, wie auch immer, den Wagen öffnen, schicke ich Ihnen persönlich den Staatsanwalt auf den Pelz. Also fangen Sie an. Ich übernehme die Verantwortung.“
„Unter Protest und unter Zeugen,“ willigt Manfred ein.
„Doktor,“ sagt Sven, der glaubt, etwas gut machen zu müssen, „ich glaube, die Feuerwehr kommt.“
„Ja, ich hab das Martinshorn auch gehört.“
„Sollen wir warten bis die hier ist?“ fragt Manfred hoffnungsvoll.
„Mann, jetzt machen Sie sich nicht in die Hose. Öffnen Sie das Auto. Hier geht es um Menschen und nicht um Falschparker, jede Sekunde ist wichtig. Los, jetzt.“
Der Unglückswagen ist, warum auch immer, von der Straße abgekommen, hat sich mehrmals überschlagen, ist in einen wasserlosen Bachlauf gerutscht und dort vor einen Baum geprallt. Die Fahrerseite ist so stark eingedrückt, dass sie nicht zu öffnen ist.
Jonas, der jüngere Polizist, hat mittlerweile die Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die umliegenden Dörfer umgeleitet.
Der Feuerwehrwagen kommt an. Die Feuerwehrmänner klettern eilig aus ihrem Fahrzeug, verschaffen sich einen Überblick und beginnen schleunigst und zielgerichtet die hydraulische Schere anzuschließen und das Luftkissen bereit zu machen. Der Kompressor im Feuerwehrfahrzeug dröhnt los und baut den erforderlichen Druck auf.
„Kissen nicht, Schere reicht. Wir versuchen es so,“ gibt Kevin, der Einsatzleiter, kurz und präzise seine Anweisungen. Er ist Anfang vierzig und mit Leib und Seele Feuerwehrmann.
„Hallo, Manfred, na du hast ja schon Vorarbeit geleistet!“ Er zeigt auf das eingeschlagene Seitenfenster. „Sollen wir weitermachen, oder versucht ihr es so?“ fragt Kevin den Arzt.
„Ist gut. Wir versuchen es erst einmal so. Max, kommst du so an ihn ran?“
„Ja, es müsste gehen“.
Maximilians Oberkörper zwängt sich durch die eingeschlagene Scheibe.
„Hallo, ich heiße Maximilian. Ich bin Notfallsanitäter. Können Sie mich hören? Hallo?!“
Er lauscht, hört aber kein Atmen. „Zwei Tote? Der Tag fängt ja gut an.“
„Ich kann nichts hören. Der Wagen mit dem Kompressor ist zu laut.“
Er fühlt den Puls am Handgelenk, auch nichts.
„Ich komm so nicht an seinen Hals. Oooh, Mann.“
Jetzt ist er soweit im Wagen, dass er an die Halsschlagader herankommen kann.
„Ich bin dran, Moment,…“ Sekunden verrinnen wie Stunden.
„Ich fühle nichts.“
„Hast du die richtige Stelle?“
„Jetzt, jetzt, ganz schwacher Puls. StifNeck?“ fragt er aus dem Wagen heraus.
„Ja. Und dann Crash-Rettung, das Risiko muss ich eingehen,“ bestimmt der Notarzt.
Die Halskrause wird angelegt.
„So, Kevin, jetzt bist du dran. Ihr könnt den Wagen auftrennen. Wir müssen ihn,“ Max blickt zu dem Unfallfahrer, „so gut es geht in dieser Haltung herausnehmen. Du siehst ja, das Blut.“
Blut läuft aus seinem Mund.
Der Wagen wird mit Keilen gesichert, so dass er sich beim Aufschneiden nicht unkontrolliert bewegen kann. Dann schneidet Kevin den Sicherheitsgurt durch. Das Füllgas ist schon längst aus dem Airbag entwichen. Der Fahrer sitzt ohnmächtig, vollkommen bewegungslos hinter seinem Lenkrad. Seine Hände sind verkrampft, halten aber nicht das Steuer. Die Arme sind leicht gebeugt, als wolle er damit sein Gesicht schützen.
Durch Mark und Bein geht das dumpfe Knacken als die A-Säule durchgeschnitten wird.
„Er bewegt sich,“ sagt einer der Feuerwehrmänner.
„Ich hab nichts bemerkt,“ meint ein anderer.
„Seid vorsichtig, macht weiter. Ich hab auch etwas gesehen,“ meint Kevin.
„Ich hab’s auch gesehen,“ haucht Dr. Burgel. „Sven, was ist mit dem Hubschrauber? Frag noch mal nach und mach Druck. Wo kann der hier denn überhaupt landen?“
„Ein-, zweihundert Meter in Richtung Hamstedt auf einer Wiese.“
„Zweihundert Meter?“ ganz schön weit.
Insgesamt mögen vielleicht zehn bis fünfzehn Minuten seit dem Eintreffen des Notarztes vergangen sein. „Endlich, da ist er.“ Der Rettungshubschrauber bringt mit seinen Rotoren die Luft zum Vibrieren.
Sven weist den Helikopter an der Landestelle ein.
Der Unglückswagen ist aufgeschnitten, und der Fahrer, etwa achtzig Jahre alt, wird aus dem Wagen befreit. Kevin hört den Mann leise, sehr leise röcheln. Obwohl es so leise ist, entgeht Kevin nicht, wie schmerzgeschwängert das Stöhnen aus der Kehle kommt. Wieder rinnt Blut aus seinem Mund.
„Wir sind da. Wir helfen Ihnen. Können Sie etwas sagen?“
„Lass‘ mich mal ran.“
„Ich bin Dr. Burgel. Können Sie mich hören? Wie heißen Sie? Können Sie sich bewegen?“
Nach jeder seiner kurzen Testfragen macht der Arzt eine kleine Pause, um Reaktionen zu testen, aber es kommen keine. Vorsichtig und behutsam hält der Doc den Verletzten so, dass er in seinem Sitz sitzen bleibt, bis die Trage geholt wird. Und da wird gesagt: Chirurgen seien alle Metzger.
„Seid vorsichtig. Er wird starke innere Verletzungen und wahrscheinlich ein paar Brüche haben. Er lebt. Er hat einen Schock.“
Plötzlich fragt Sven: “Was ist denn mit dem Motorradfahrer?“
„Exitus,“ lautet die kurze Antwort.
Der Unfallfahrer wird in den Rettungswagen gelegt. Dr. Burgel untersucht ihn und entscheidet dann: „Heli, nach Hannover.“
Jetzt wendet sich der Notarzt noch einmal dem Motorradfahrer zu und untersucht ihn eingehender.
Puls ist nicht festzustellen, die Kopfhaltung ist tödlich eindeutig, und in Verbindung mit dem leeren Blick des Auges wird Dr. Burgels erste Vermutung bestätigt.
Er kann den Totenschein ausstellen.
Der Notarzt und die Notfallsanitäter haben hier ihre Arbeit erledigt und fahren wieder zu ihren Stützpunkten. Schreibarbeit wartet.
Jetzt ist es Sache der Polizei, den Unfallhergang zu rekonstruieren.
6
Ralph, der Rabauke aus der zwölften Klasse des Gymnasiums, ist mit seinen Mitschülern auf dem Schulhof angekommen. Er ist Klassenbester, sogar Jahrgangsbester, und das ist auch der Grund, warum er sich mehr herausnehmen kann als andere. Und Schulsprecher ist er auch noch. Hin und wieder spricht ihn der eine oder andere auf seine manchmal verletzende und arrogante Art zu sprechen und zu provozieren an. Aber Ralph tut das meistens ab mit einem Überheblichen: „Weil ich kann, du nicht?“
Aber ist er wirklich überheblich und arrogant? Ist es nicht mehr ein Schutz?
7
Etwa zwei Stunden sind vergangen seit Felix den Rettungswagen hat vorbei rasen sehen. Sein Weg führt ihn heute wieder einmal in die Nähe der Residenz.
‚Hier wohnt sie. Wie es ihr wohl geht. Diese geldgierigen Bonzen. Solange man Geld hat ist alles in Ordnung. Ob er sie wohl noch besucht? Wie geht es ihm wohl?‘
Seine Gedanken kreisen um dieses Haus, um die Pfleger, die fast alle Tag für Tag ihr Bestes geben, um die überforderte Pflegedienstleitung, um die kaltherzige Direktorin. Nein, das ist nicht korrekt. Seine Gedanken kreisen um Hanna. Aber damit ist zwangsläufig seit den letzten Jahren dieses Wohnheim, Altenheim, diese so genannte Residenz verbunden.
‚Warum? Warum Hanna? Sie war doch noch so jung,‘ sinniert er.
Felix macht sich immer noch Vorwürfe, Hanna nicht in die Uni-Klinik nach Hannover gebracht zu haben. Aber sie hatten sich damals für ein anderes Krankenhaus in der Landeshauptstadt entschieden. Jetzt ist es müßig darüber nachzudenken, ob die Operation in der Uni-Klinik besser verlaufen wäre. Aber seine Selbstvorwürfe kann er nicht vertreiben.
„Ob ich noch einmal versuche hineinzukommen? Aber der Eisklotz soll ja noch da sein. Wie kann man einen solchen Menschen nur mit derartigen Aufgaben betreuen? Die in Berlin, oder sitzt die ‚Mutter‘ in Hannover, müssen das doch sehen. Nein, ich versuche es nicht. Hanna, bist du noch da oben? Geht es dir gut? Ist Schwester Ricarda auch noch da?“ Häufig führt er ähnliche Selbstgespräche.
Er sieht zu einem der Fenster in der fünften Etage, wo sie vor einigen Jahren ihre Wohnung bezogen hat.
Im Sommer stehen häufig verschiedene Wohnungsfenster des Hauses offen, und man kann fürsorgliche Betreuerinnen hören. Selten hingegen dringen flehende, schmerzverzerrte und resignierte Bewohnerstimmen hinaus auf die Straße. Die Fenster jener Wohnungen sind meist verschlossen.
„Ich will, dass die Fenster geschlossen bleiben. Wir wollen die Nachbarn nicht stören,“ ist die offizielle Begründung der Direktion.
Diese Begründung hätte damals zum Stil des Hauses gepasst. Allerdings hätte sie dann geheißen: Ich möchte, dass bitte…“
Zu der Zeit gab es noch eine Direktion, eine Direktorin, die stets für Bewohner und Personal da war. Zu der Zeit gab es klare Richtlinien. Zu der Zeit wurde die Direktion wegen der sozialen und fachlichen Kompetenz respektiert und akzeptiert. Zu der Zeit war die Arbeit auch schon hart, aber man fühlte, Mensch zu sein. Egal auf welcher Stufe manch Angestellter oder Bewohner stand, es herrschte Respekt gegenüber jedem.
Plötzlich, von hinten. Da kommt sie wieder, ganz leise, fast schleichend. Ihre Hände hat sie in Richtung Ricarda vorgestreckt. Vor Erregung treten Schweißperlen in ihr Gesicht. Sie hat sich jetzt nicht im Griff und fühlt, dass sie es wieder tun muss. Die anderen Demenzkranken in diesem Raum warnen Ricarda nicht vor ihr. Der ein oder andere sieht zwar ängstlich zu der Heranschleichenden, vermag aber die Situation nicht einzuschätzen. Jetzt, da ihre immer noch starken Hände Ricarda sofort erreicht haben werden, beginnen auch sie zu zittern und setzen langsam und zielgerichtet ihren Weg fort. Das mittlerweile leichte Stöhnen und schwere Atmen dieser Demenzkranken ist kaum zu hören.
Ricarda merkt einen aus dem Nichts kommenden, fest nach unten ziehenden Griff und dreht sich langsam um. Sie sieht in die Augen von Frau Riek. „Na, hat mein Pullover wieder nicht richtig gesessen?“ „Ja, so ist es besser,“ bestätigt Frau Riek.
Beim ersten Mal hatte Ricarda sich zu Tode erschreckt. Aber nach all der Zeit kennt sie die meisten Marotten ihrer Bewohner. Die meisten an Demenz Erkrankten sitzen teilnahmslos auf ihren Stühlen rundum den in der Raummitte stehenden liebevoll geschmückten Tisch und warten. Ricarda hat das Liederbuch gefunden. Sie stimmt die alten Lieder an, die die Bewohner noch von früher kennen. Manche singen mit, andere lauschen erwartungsvoll. Hans Albers, Rudi Schuricke und noch viele andere sind plötzlich wieder voll im Geschäft.
„Herr Träsch,“ die Stimme der Direktion hallt frostig über den Flur im Souterrain und lässt die Bewohner erschaudern. Der Pflegedienstleiter bleibt stehen und wartet bis die Direktorin bei ihm ist.
„Ich komme gerade aus dem Leseraum. Da draußen läuft wieder dieser Mann von der einen Bewohnerin rum. Ich will nicht, dass der ins Haus kommt. Sagen sie dem Hausmeister Bescheid. Der soll sich darum kümmern“.
„Der Hausmeister ist krank, und mit dem Streuner da draußen werde ich selbst fertig.“
Es sind Welten, die in diesem System aufeinandertreffen, und Abgründe tun sich auf.
Felix fängt sich wieder und geht weiter in Richtung Kurpark.
8
„Rufst du die Zentrale an? Die sollen alles Weitere in die Wege leiten. Wir können schon nach seinen Personalien sehen.“
Jonas und Manfred bewegen sich langsam zu dem Toten, weil jeder dem anderen den Vortritt lassen will. Sie sind froh, dass der Doc den Integralhelm bereits abgezogen hat und sie somit nicht in die starren Augen des Toten blicken müssen.
„Mann die Karre. Der muss ja gerast sein wie sonst wer; oder der Wagen hat den so zugerichtet. Lass uns erst die Maschine nach Papieren durchsehen, vielleicht finden wir da etwas. Ich hab keinen Drang, den am Körper zu durchsuchen.“
Jonas versucht, den flachen Beutel auf dem Tank zu öffnen und findet die gesuchten Papiere: Fahrerlaubnis, Personalausweis, Blutspendeausweis.
„Was ist? Ist dir nicht gut? Kennst du ihn?“
Jonas ist beim Blick auf den Ausweis leichenblass geworden.
„Wir haben gestern noch zusammen bei den alten Herren gespielt.“
„Ist er verheiratet, hat er Kinder?“
„Nein, er lebt seit einigen Jahren allein, in Schönquell.“
„Eltern?“
„Nein, das heißt doch. Aber zu denen hat er, hatte er, schon länger keinen Kontakt mehr. Die Mutter ist dement und wohnt in der Residenz. Sie erkennt den Sohn angeblich nicht mehr. Wahnsinn, wenn ich mir das vorstelle, dass meine…, na, ja. Ja, und der Vater, das ist so eine Geschichte. Den kennst du aber auch.“ „Wieso, woher, wer ist das denn?“
In diesem Moment kommt ein Ruf von der Zentrale und Manfred geht zum Polizeiwagen.
„Wanne 03,“ meldet er sich.
„Zentrale, wir haben den Halter festgestellt. Alter: dreiundvierzig Jahre, männlich, Name: Tuschort, Carsten. Wohnort: Bad Schönquell, Begonienstraße 11. Die Kollegen sind unterwegs und lösen euch gleich ab. Bestatter ist auch informiert und kommt auch gleich. Ist sonst noch etwas?“
„Nein, alles klar, danke.“
In Gedanken ist Manfred wieder bei seinem Kollegen. „Ich kenne niemanden, dessen Sohn ein Motorrad fährt, und Peter? Nee, der hat ja eine Tochter. Allerdings..., die rast auch so.“
Jetzt wird Manfred heiß und kalt. Der kalte Schweiß tritt auf seine Stirn. Der Motorradfahrer, wieso der? Niemand hat das Gesicht oder den Körper an aufklärenden Stellen gesehen. Ist er männlich? Die Zentrale hat den Halter festgestellt. Aber sind Halter und Fahrer identisch?
Wenn das die Tochter seines Freundes ist. Wie soll er es Peter und seiner Familie beibringen? Als kleines Mädchen hat er es oft bei gemeinsamen Ausflügen auf seinen Schultern getragen. Seine und Peters Tochter gingen in dieselbe Klasse und waren damals richtige Freundinnen. Nach der Schulzeit verlief das allmählich im Sande. Die Jungs waren schuld daran.
„Jonas,“ ruft Manfred aus einiger Entfernung, „Jonas, was hast du gesagt? Ist es ein Mann oder eine Frau?“
Jonas antwortet. Die Antwort kann Manfred nicht mehr verstehen. Denn gerade in diesem Augenblick setzt der Hubschrauber zum Abflug an und verbreitet einen Höllenlärm.
Manfred geht hastig zu Jonas. „Ich hab dich nicht verstanden. Ist der Tote ein Mann oder eine Frau?“
„Ja,“ antwortet Jonas.
„Mensch, lass den Quatsch. Was ist es?“
„Hab ich das nicht gesagt? Es ist ein Mann. Wir haben gestern noch Fußball gespielt. Das habe ich doch schon gesagt!? Alles in Ordnung? Probleme?“
„Ja, alles gut“. Jetzt fällt es Manfred auch wieder ein.
„Aber wieso, und woher kenne ich den Vater?“
„Das ist der Alte, der bei jedem Wetter die Papierkörbe durchsucht.“
„Wie, und seine Frau wohnt in der Residenz? Die leistet sich die Residenz, und er muss Papierkörbe leeren? Wie passt das denn zusammen?“
„Der Tuschort war mal ein ganz bekannter Rechtsanwalt in Hannover. Hatte gut zu tun für den Landtag und so. Seine Frau wurde dann irgendwann krank. Genaues weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall musste Frau Tuschort wohl wieder einen Ihrer Anfälle bekommen haben, und er war nicht zu Hause. Er war irgendwo in Südamerika als das geschah. Der Sohn hatte sofort den Notarzt gerufen, sie wurde ins Krankenhaus gebracht und noch am selben Abend operiert.“
„Ja und? Das ist doch kein Grund so abzustürzen.“
„Das alleine nicht. Aber die Narkose war wohl nicht richtig dosiert; oder bei der eigentlichen Operation ist etwas anderes schief gelaufen. So genau weiß ich das auch nicht. Aber Carsten, also sein Sohn, der Motorradfahrer, hat dem Vater große Vorwürfe gemacht, weil der nicht da war. Aber das konnte niemand voraussehen. Jedenfalls hat sie einige Zeit im Koma gelegen und war danach nicht mehr ganz richtig im Kopf. Der Alte hat daraufhin seine Anteile an der Kanzlei und dem Haus sofort verkauft und ist mit ihr nach Schönquell in die Residenz gezogen. Jeder hatte dort seine eigene Wohnung. Ihr Zustand hat sich dann immer weiter verschlechtert. Die besten Ärzte kamen, und er hat viel Geld dafür ausgegeben. Irgendwann war nichts mehr da. Er musste dann aus der Residenz ausziehen. Und die Ärzte kamen auch nicht mehr. Jetzt wohnt er in einer kleinen Wohnung. Aber,… er ist nie auf die schiefe Bahn gekommen, kein Alkohol oder so.“
„Und was ist mit dem Sohn?“
„Der konnte das Ganze einfach nicht mehr ertragen. Er hat seine Mutter nicht mehr besucht, seit…, ich weiß nicht wann. Und von dem Vater will, wollte er nichts mehr wissen, obwohl der sich sehr um seine Frau bemüht und gekümmert hat. Der Sohn hat auch nie die Wohnung seines Vaters in der Residenz bezahlt, obwohl das für ihn nur ein Butterbrot gewesen wäre. Für die Mutter, ja. Aber hingehen konnte er nicht mehr. Sie hat ja ihren eigenen Sohn auch nicht mehr erkannt. Später, als eine neue Direktion kam, hat der Alte noch Hausverbot für die Residenz bekommen. Er passte plötzlich nicht mehr ins Bild. Die jetzige Direktion bringt das Ansehen der Residenz, und zwar nicht nur dieser Residenz, das der gesamten Branche, bringt die runter.“
„Und wer ist der Betreuer der Frau? Ihr Mann, …nee, …nicht? Sag jetzt nicht ‚der Sohn‘.“
„Doch,“ frag mich nicht wie die das hinbekommen haben. Vielleicht waren Papas Verbindungen damals dabei ganz hilfreich. Ich weiß es nicht. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Benachrichtigen? Müssen wir beide informieren? Die Mutter merkt doch nichts mehr.“
„Du, sag das nicht.“
9
Felix durchquert den Weg durch die Liegewiesen der Reha-Kliniken. Hier findet er oft noch Flaschen, die am Vorabend von den Kurgästen in die Papierkörbe gesteckt wurden. Auf seinem Weg zur Residenz hat er die heute Morgen gefundenen Flaschen im Supermarkt an der Natrupstraße abgegeben, so dass sein Stoffbeutel wieder aufnahmefähig ist. Er hat etwas mehr als acht Euro dafür bekommen.
Der große Brunnen am Fontainenplatz wird noch nicht von der Fontaine gespeist, weshalb sich hier bei diesem kalten Wetter auch kaum Kurgäste aufgehalten haben. Flaschen? Fehlanzeige. Langsam setzt wieder Regen ein, und Felix geht die von noch unbelaubten Bäumen flankierte Allee schneller entlang, damit er trocken die Wandelhalle erreicht.
„Guten Morgen, Kollege. Bist du schon lange hier?“ fragt er Helmut.
„Gut zehn Minuten. Wie es aussieht, werden wir wohl noch etwas länger hierbleiben. Bei dem Regen kriegt mich hier keiner raus. Woher bist du heute so gegangen?“
„Erst den üblichen Weg, die Bremer Straße runter, Bahnhofstraße Richtung Bahnhof, an der Ampel über die Straße und die Bahnhofstraße auf der anderen Seite zurück, Richtung Natrupstraße. So etwa Hälfte der Bahnhofstraße kam ein Rettungswagen daher geknallt. Er bog Richtung Hamstedt ab.
Wahrscheinlich hat es wieder auf der Hamstedter Landstraße geknallt.“
„Felix, was ist los mit dir? Du bist ja ganz blass,“ sorgt sich Helmut.
„Ich weiß auch nicht. Ich habe plötzlich so ein komisches Gefühl im Bauch. Mir wird ganz warm.“
„Soll ich Hilfe holen?“
„Nein, lass man gut sein. Es wird schon wieder werden, und wenn nicht…, dann ist es auch egal… und vorbei.“
„Du sagst, Richtung Hamstedt. Ich bin die Arkaden hochgekommen, und in Höhe vom Radiostudio habe ich gehört, wie jemand von einem schweren Unfall gesprochen hat. Einen Toten und einen Schwerverletzten soll es gegeben haben. Der eine ist mit dem Hubschrauber abtransportiert worden. Na ja, und der andere. Mensch, Felix, was ist los mit dir? Du zitterst ja wie verrückt. Ist dir kalt? Ich hole jetzt Hilfe.“ „Nee, lass. Ich weiß nicht. Ich bin so unruhig. Ich weiß auch nicht woher das kommt. Das kenne ich doch seit Jahren nicht mehr. Ich muss nach Hause. Irgendetwas ist los.“
„Du kannst bei dem Regen jetzt doch nicht raus. Du holst dir sonst was.“
„Doch, ich muss. Ich muss nach Hause.“
„Dann komme ich mit.“
„Nein, ich muss alleine gehen. Wir sehen uns morgen.“
Felix eilt aus der Wandelhalle Bad Schönquells und geht durch die Fußgängerzone in Richtung Heimat. Ihm schwant Böses. Er erinnert sich wieder an dieses seltsame Bauchgefühl. Er hat es schon einmal gehabt. Das war damals als seine Frau operiert wurde. Über Tausende von Kilometern in Südamerika hatte er es zum ersten Mal erlebt.
‚Was ist mit Hanna? Ist ihr etwas passiert? Und ich bin wieder nicht da. Wieder nicht bei ihr, wie damals. Ich muss zurück. Ich muss zu Hanna. Was hat Helmut gesagt? Ein Toter?! Diese Unruhe habe ich seit ich von dem Rettungswagen gesprochen habe. Was hat das zu bedeuten? Ich bin doch nicht verrückt. Ich habe doch keine Halluzinationen. Ich gehe zu Hanna. Und wenn die mich wieder rausschmeißen…, dann lernen die mich kennen.‘
Für einen kurzen Moment ist er wieder der alte Rechtsanwalt, kämpferisch, selbstbewusst, Verantwortung übernehmend, zielgerichtet.
Er dreht sich um und geht zurück. Das heißt: Er will zurückgehen.
Aber ein unwiderstehlicher und noch nicht zu erklärender Zwang drängt ihn, nach Hause zu gehen. Er gibt seinem Bauchgefühl nach und eilt wieder in Richtung Oesede, wo sich seine kleine Souterrainwohnung befindet. Noch nie ist ihm die Bergstraße so lang vorgekommen wie jetzt in diesen Minuten.
‚Blaulicht? Polizeiwagen? Polizei? Stehen die bei mir vor der Wohnung? Ist eingebrochen worden? Was ist denn los heute? Was ist denn bloß los heute mit mir? Hanna!‘
10
„Ick gloob, ick krich ‘ne Krise,“ sagt Peppy, die seit heute Morgen mit Ricarda Dienst tut. „Jetzt sollen wir den ganzen Kram noch einmal machen. Alles wieder umschreiben. So, wie letzten Monat, nur anders. Blickt hier denn keiner durch? Im nächsten Halbjahr kommt wieder ‘ne andere, und dann geht alles wieder von vorn los…, nur dann zur Abwechslung anders rum. Ick beeß mer inne Beene. Ich möchte mal wissen, wer hier dement ist, die Bewohner oder wer.“
Peppy ist laut, hastig in ihren Bewegungen, manchmal aufbrausend und hat so gar nichts von der feineren, zurückhaltenden und stets ruhigen und beruhigenden Art Ricardas. Dennoch verstehen sich beide sehr gut. Jede akzeptiert die andere, denn sie wissen gegenseitig, dass sie versuchen, den ihnen anvertrauten Alten den Alltag so verträglich wie möglich zu machen. Ricarda ist die Ruhe selbst. Sie braust nicht auf. Sie ist bestimmt, und sie ist bestimmend im positiven Sinne. Sie kann es sich leisten, denn sie weiß was sie kann und was getan werden muss. Und das tut sie.
John Wayne, der alte Filmheld zahlreicher Western, sagte einmal in einem seiner Streifen: „Manchmal muss ein Mann eben tun, was ein Mann tun muss!“ Es könnte das Motto der beiden Kolleginnen sein.
„Lass man. So ist das eben. Wir können es doch nicht ändern. Aber Recht hast du schon. Das Schlimme ist nur, dass die Alten darunter leiden müssen. Ich glaube, irgendwann, wenn mir das alles … ach, was soll’s.“
Wieder einmal eines dieser langen, ausgedehnten Gespräche während der Arbeitszeit. Doch für mehr ist zwischendurch keine Zeit. Wie auch, wenn noch nicht einmal die Pausen konform eingehalten und genommen werden können.
Mit diesem Problem, und das ist nur ein kleineres von vielen und viel größeren, haben alle im Altenbereich Tätigen zu kämpfen. Es ist nicht nur ein Problem in der Residenz, nein andere sind zum Teil viel ärger dran. Es ist ein Problem des Systems. Es ist ein Problem, das viele Politiker nicht sehen oder nicht sehen wollen. Also müssen…
„Da sind sie ja, Schwester, endlich! Ich muss heute doch noch in den OP. Können Sie mich hinbringen? Die Patienten warten auch nicht ewig.“
„Müssen Sie heute noch operieren, Frau Doktor Bäcker?“
„Bäcker mit ä. Das habe ich Ihnen doch schon ein paar Mal gesagt, Schwester. Können Sie sich das nicht endlich einmal merken? Manchmal glaube ich, ich bin im Irrenhaus.“
„Ach ja, Frau Doktor Bäcker, jetzt fällt es mir wieder ein. Stimmt, Sie haben es mir gestern gesagt.“
„Was, was habe ich gestern gesagt? Ich hab nichts gesagt. Mir hört ja sowieso nie einer zu. Wir müssen noch zur Reitstunde. Wenn ich nicht zum Reiten gehe, wird das Pferd geschlachtet.“
„Hallo, Sie, kommen Sie mal her. Wissen Sie wo das Pferd steht? Ich muss heute noch operieren.“
„Nein, das weiß ich nicht. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit. Wenden Sie sich bitte an die Schwester. Die wird Ihnen helfen.“
Mit einem leichten Kopfnicken in Richtung Ricarda, aber ohne jegliche Emotion, geht die Direktion an beiden vorbei. Gedanken und Aufmerksamkeit der Direktorin sind zum Empfang vorausgeeilt.
„Wissen Sie,“ fragt sie die Empfangsdame an der Rezeption „was die Polizei hier will? Ich habe den Wagen von meinem Büro aus gesehen.“
Die Direktorin hat möglicherweise Grund, beim Anblick der Polizei nervös zu werden. Aber das wissen wir nicht, und es geht uns vielleicht auch nichts an. Andererseits, was war das in der letzten Woche mit dem Auto an der roten Ampel und auf dem Fußgängerüberweg? Sie tritt unmerklich ein paar Schritte von der Rezeption zurück, um unauffällig den Fragen der herankommenden Polizisten zu lauschen.
„Guten Tag,“ meldete sich ein Mittfünfziger bei der Empfangsdame, „das ist mein Kollege Polizeiobermeister Stark, und ich bin Kommissar Feindaut. Wir möchten zu Frau …“ Er greift in seine Jackentasche und zieht ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. „Moment.“ Der Kommissar faltet das Blatt auf und liest: “Wir möchten zu Frau Tuchort.“
„Tuschort“, korrigiert die Rezeptionistin.
Feindaut blickt auf sein Blatt Papier.
„Richtig, Tuschort. Hanna Tuschort. Die wohnt doch hier, oder?“
„Ja, worum geht es denn?“
„Kann ich Ihnen helfen?“ Frau Malice, die von der Rezeption zurück getreten ist und in sicherer Entfernung gelauscht hat, kommt jetzt wieder in ihrer unnahbaren Art und ihrem bisweilen verächtlichen Blick heran. „Ich bin die Direktorin. Worum geht es?“
Ihre zur Schau gestellte, übertrieben gerade Haltung soll allen Anwesenden signalisieren: Seht her, hier habe ich das Sagen.
Kommissar Feindaut wiederholt die Vorstellungszeremonie und dann: „Wir möchten zu Frau Hanna Tuschort. Die wohnt doch in diesem Altenpflegeheim.“
„Residenz.“
„Bitte?“
„Residenz,“ die Direktion macht eine kurze bedächtige Pause und fährt dann fort: „Wir haben verschiedene Abstufungen. Und dies ist eine Residenz.“
„Ist das nicht dasselbe wie ein Altenpflegeheim?“
„Ich bitte Sie, Herr Wachtmeister!“
„Kommissar!“
„Bitte?“
„Ich bin Kommissar!“
„Ach, ist das nicht das gleiche wie Wachtmeister?“
Die Fronten sind geklärt, die Höflichkeitsfloskeln beendet.
„Das deckt sich mit dem, was in der Stadt erzählt wird.“
„Wie, was meinen Sie?“
„Ich meine nichts. Wir müssen mit Frau Hanna Tuschort sprechen, schnellstmöglich. Bringen Sie uns bitte zu ihr.“
„Warten Sie einen Augenblick. Ich werde Frau Tuschort ausrichten lassen, dass sie kommen soll. Bitte nehmen Sie Platz.“
Frau Malice deutet auf zwei der zahlreich vorhandenen Ledersessel.
Zur Empfangsdame gewandt bestimmt sie: „Rufen Sie Frau Tuschort an. Die soll kommen.“
„Frau Malice, Frau Tuschort ist dement. Die ist bei Frau Firless in der Betreuung. Die kann nicht kommen,“ meint die Empfangsdame, Frau Kallone, leise zur Direktion, damit niemand der Außenstehenden deren mangelndes Interesse an den Bewohnern merkt.