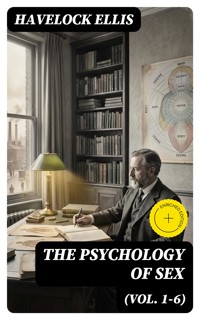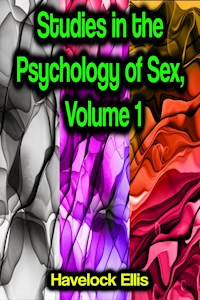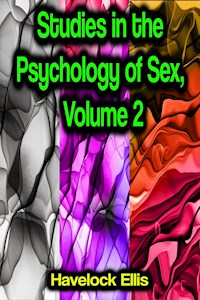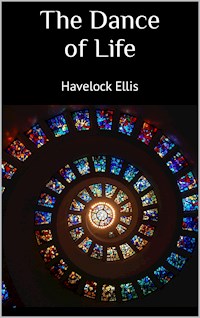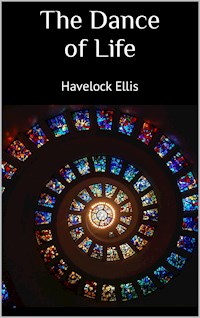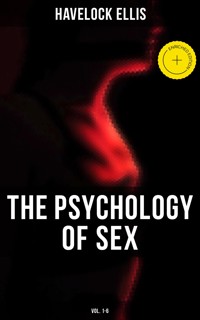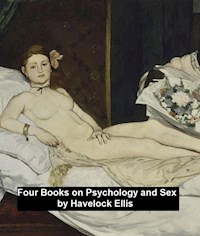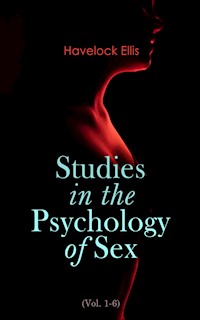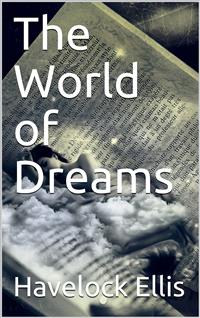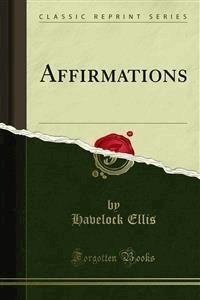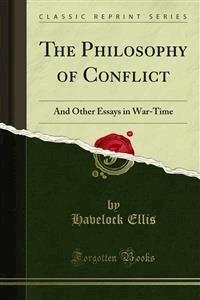3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Diese Ausgabe ist einzigartig;
- Die Übersetzung ist vollständig original und wurde für das Ale. Mar. SAS;
- Alle Rechte vorbehalten.
Der Tanz des Lebens war das meistverkaufte Buch von Havelock Ellis, das erstmals 1923 veröffentlicht wurde. Hier vertritt er in einer Reihe von Essays eine Philosophie der Entwicklung des Selbst durch die Kunst des Tanzes, die Kunst des Denkens, die Kunst des Schreibens, die Kunst der Religion und die Kunst der Moral. Mit vielen einzigartigen Standpunkten und Einsichten in die Literatur und den kreativen Prozess.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Vorwort
Kapitel 1. Einführung
Kapitel 2. Die Kunst des Tanzens
Kapitel 3. Die Kunst des Denkens
Kapitel 4. Die Kunst des Schreibens
Kapitel 5. Die Kunst der Religion
Kapitel 6. Die Kunst der Moral
Kapitel 7. Schlussfolgerung
Der Tanz des Lebens
HAVELOCK ELLIS
Übersetzung und Edition 2021 Ale. Mar. sas
Vorwort
Dieses Buch wurde schon vor vielen Jahren geplant. Was die Idee betrifft, die es durchzieht, kann ich nicht sagen, wann sie entstanden ist. Ich habe das Gefühl, dass sie mit mir geboren wurde. Wenn ich darüber nachdenke, scheint es in der Tat möglich, dass die Saat unmerklich in der Jugend gefallen ist - vielleicht von F. A. Lange und aus anderen Quellen - um unbemerkt in einem kongenialen Boden zu keimen. Wie dem auch sei, die Idee liegt vielem zugrunde, was ich geschrieben habe. Sogar das vorliegende Buch wurde bereits vor mehr als fünfzehn Jahren geschrieben und in einer vorläufigen Form veröffentlicht. Vielleicht ist es mir erlaubt, Trost für meine Langsamkeit zu suchen, wenn auch vergeblich, in dem Spruch von Rodin, dass "Langsamkeit Schönheit ist", und sicherlich sind es die langsamsten Tänze, die für mich am schönsten zu sehen waren, während im Tanz des Lebens die Errungenschaft einer Zivilisation in Bezug auf Schönheit umgekehrt zur Schnelligkeit ihres Tempos zu sein scheint.
Darüber hinaus bleibt das Buch unvollständig, nicht nur in dem Sinne, dass ich mir wünschen würde, jedes Kapitel noch zu ändern und zu ergänzen, sondern sogar unvollständig durch das Fehlen vieler Kapitel, für die ich Material gesammelt hatte und vor zwanzig Jahren überrascht gewesen wäre, sie nicht zu finden. Denn es gibt viele Künste, die nicht zu denen gehören, die wir üblicherweise als "schön" bezeichnen, und die mir für das Leben grundlegend erscheinen. Aber jetzt lege ich das Buch so vor, wie es ist, absichtlich, ohne Reue, und bin damit zufrieden.
Früher wäre das nicht möglich gewesen. Ein Buch muss so vollendet werden, wie es ursprünglich geplant war, fertig, abgerundet, poliert. Wenn ein Mensch älter wird, ändern sich seine Ideale. Gründlichkeit ist oft ein bewundernswertes Ideal. Aber es ist ein Ideal, das mit Unterscheidungsvermögen angenommen werden muss, unter Berücksichtigung der Art der Arbeit, um die es geht. Ein Künstler, so scheint mir jetzt, muss sein Werk nicht immer bis ins kleinste Detail vollenden; wenn er dies nicht tut, kann es ihm gelingen, den Betrachter zu seinem Mitarbeiter zu machen und ihm das Werkzeug in die Hand zu geben, um das Werk fortzuführen, das sich, so wie es vor ihm liegt, unter seinem Schleier aus noch teilweise unbearbeitetem Material noch ins Unendliche erstreckt. Wo die meiste Arbeit ist, ist nicht immer das meiste Leben, und indem er weniger tut, kann der Künstler mehr erreichen, wenn er nur weiß, wie er es gut machen kann.
Ich hoffe, dass er keine völlige Konsistenz erreichen wird. In der Tat gehört es zur Methode eines solchen Buches, das über einen langen Zeitraum von Jahren geschrieben wurde, eine ständige leichte Inkonsistenz aufzuzeigen. Das ist kein Übel, sondern eher die Vermeidung eines Übels. Wir können nicht mit der Welt im Einklang bleiben, es sei denn, wir werden inkonsequent gegenüber unserem eigenen vergangenen Selbst. Der Mensch, der konsequent - wie er gerne annimmt, "logisch" - an einer unveränderlichen Meinung festhält, hängt an einem Haken, den es nicht mehr gibt. "Ich dachte, sie sei es, und sie dachte, ich sei es, und als wir uns näher kamen, war es keiner von uns" - diese metaphysische Aussage enthält, mit einem Hauch von Übertreibung, eine Wahrheit, die wir uns immer vor Augen halten müssen, was das Verhältnis von Subjekt und Objekt betrifft. Sie können beide keine Beständigkeit besitzen; sie haben sich beide verändert, bevor sie aufeinander treffen. Nicht, dass diese Inkonsistenz ein zufälliger Fluss oder ein oberflächlicher Opportunismus wäre. Wir verändern uns, und die Welt verändert sich entsprechend der zugrundeliegenden Organisation, und die Widersprüchlichkeit, die durch die Wahrheit des Ganzen bedingt ist, wird zur höheren Konsistenz des Lebens. Ich kann daher die Tatsache anerkennen und akzeptieren, dass ich in diesem Buch immer wieder auf das gestoßen bin, was oberflächlich betrachtet dieselbe Tatsache zu sein schien, und jedes Mal einen etwas anderen Bericht zurückgebracht habe, denn sie hatte sich verändert und ich hatte mich verändert. Die Welt ist vielfältig, von unendlich schillerndem Aussehen, und bis ich zu einer entsprechend unendlichen Vielfalt von Aussagen gelange, bleibe ich weit entfernt von allem, was in irgendeinem Sinne als "Wahrheit" bezeichnet werden könnte. Wir sehen nur einen großen Opal, der niemals so aussieht, wie wir ihn das letzte Mal gesehen haben. "Er hat nie so gemalt, wie er gestern gemalt hat", sagt Elie Faure über Renoir, und es scheint mir natürlich und richtig, dass es so war. Ich habe nie zweimal dieselbe Welt gesehen. Das ist in der Tat nichts anderes als die Wiederholung des Spruchs von Heraklit - ein unvollkommener Spruch, denn er ist nur die Hälfte der größeren, moderneren Synthese, die ich bereits zitiert habe -, dass kein Mensch zweimal in demselben Fluss badet. Dennoch - und diese gegenteilige Tatsache ist genauso bedeutsam - müssen wir wirklich einen kontinuierlichen Strom annehmen, wie er sich in unseren Köpfen konstituiert; er fließt in dieselbe Richtung; er kohäriert in einer mehr oder weniger gleichen Form. Das Gleiche gilt für den sich ständig verändernden Badenden, den der Strom aufnimmt. So gibt es schließlich nicht nur Vielfalt, sondern auch Einheit. Die Vielfalt des Vielen wird durch die Stabilität des Einen ausgeglichen. Deshalb muss das Leben immer ein Tanz sein, denn das ist es, was ein Tanz ist: immerwährende, leicht variierte Bewegungen, die aber immer der Form des Ganzen treu bleiben.
Wir stehen an der Schwelle zur Philosophie. Das ganze Buch steht an der Schwelle zur Philosophie. Ich beeile mich, hinzuzufügen, dass es dort bleibt. Hier werden keine Dogmen aufgestellt, die eine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Nicht einmal die technischen Philosophen wollen diesen Anspruch immer erheben. F. H. Bradley, einer der einflussreichsten englischen Philosophen der Neuzeit, der zu Beginn seiner Karriere schrieb: "In allen Fragen, wenn man mich weit genug drängt, ende ich derzeit in Zweifeln und Ratlosigkeit", sagt vierzig Jahre später immer noch, dass er, wenn man ihn bittet, seine Prinzipien streng zu definieren, "verwirrt wird". Denn selbst eine Käsemilbe, so stellt man sich vor, könnte nur mit Mühe eine adäquate metaphysische Konzeption eines Käses erreichen, und wie viel schwieriger ist die Aufgabe für den Menschen, dessen alltägliche Intelligenz sich auf einer Ebene zu bewegen scheint, die der einer Käsemilbe so ähnlich ist, und der doch ein so viel komplexeres Netz von Phänomenen zu synthetisieren hat.
Es ist klar, wie zögerlich und zaghaft die Haltung eines Menschen sein muss, der, nachdem er seine Lebensaufgabe anderswo als auf dem Gebiet der technischen Philosophie gefunden hat, zufällig das Bedürfnis verspürt, wenn auch nur spielerisch, über seine Funktion und seinen Platz im Universum zu spekulieren. Solche Spekulationen sind lediglich der instinktive Impuls des gewöhnlichen Menschen, nach den weiterreichenden Implikationen zu suchen, die mit seinen eigenen kleinen Aktivitäten verbunden sind. Es ist Philosophie nur in dem einfachen Sinne, in dem die Griechen Philosophie verstanden, nämlich als eine Philosophie des Lebens, des eigenen Lebens in der weiten Welt. Der technische Philosoph tut etwas ganz anderes, wenn er die Schwelle überschreitet und sich in sein Arbeitszimmer zurückzieht.
"Möchten Sie die Welt entdecken?
Ferme tes yeux, Rosemonde"-
und taucht mit großen Bänden auf, die schwer zu kaufen, schwer zu lesen und, seien wir sicher, schwer zu schreiben sind. Aber von Sokrates, wie auch von dem englischen Philosophen Falstaff, wird uns nicht gesagt, dass er etwas geschrieben hat.
Wenn es also einigen so vorkommen mag, dass dieses Buch den weitreichenden Einfluss der großen klassisch-mathematischen Renaissance offenbart, in der zu leben wir das große Privileg haben, und dass sie hier die "Relativität" auf das Leben angewandt finden, bin ich mir nicht so sicher. Manchmal habe ich den Eindruck, dass in erster Linie wir, die gemeine Herde, die großen Bewegungen unserer Zeit prägen, und erst in zweiter Linie sie uns. Ich glaube, das war schon in der großen früheren klassisch-mathematischen Renaissance so. Wir assoziieren sie mit Descartes. Aber Descartes hätte nichts bewirken können, wenn nicht eine zahllose Menge auf vielen Gebieten die Atmosphäre geschaffen hätte, durch die er den Atem des Lebens atmen konnte. Wir können uns hier mit Gewinn all das vor Augen halten, was Spengler über die Einheit des Geistes gezeigt hat, die den verschiedensten Elementen in der Produktivität eines Zeitalters zugrunde liegt. Roger Bacon hatte das Genie in sich, eine solche Renaissance drei Jahrhunderte zuvor zu schaffen; es gab keine Atmosphäre für ihn, in der er leben konnte, und er wurde unterdrückt. Aber Malherbe, der Zahl und Maß so hingebungsvoll verehrte wie Descartes, wurde ein halbes Jahrhundert vor ihm geboren. Dieser schweigsame, kolossale, wilde Normanne - den uns Tallement des Réaux anschaulich vor Augen führt, dem wir eher als Saint-Simon das wahre Bild des Frankreichs des 17. Jahrhunderts verdanken - war vom Genie der Zerstörung besessen, denn er hatte den natürlichen Instinkt des Wikingers, und er hat den ganzen lieblichen romantischen Geist des alten Frankreichs so vollständig hinweggefegt, dass er bis zu den Tagen von Verlaine kaum wiederbelebt worden ist. Aber er hatte den klassisch-mathematischen, architektonischen Geist der Normannen - er hätte wie Descartes sagen können, so wahrhaftig, wie es in der Literatur jemals gesagt werden kann: Omnia apud me mathematica fiunt - und er führte in die Welt eine neue Regel der Ordnung ein. Einem Malherbe konnte ein Descartes kaum entgehen, eine französische Akademie musste fast zeitgleich mit dem "Discours de la Méthode" entstehen, und Le Nôtre musste bereits die geometrischen Entwürfe für die Gärten von Versailles zeichnen. Man darf nicht vergessen, dass Descartes nicht ohne Unterstützung hätte arbeiten können; er war ein Mann von zaghaftem und nachgiebigem Charakter, obwohl er einst Soldat gewesen war, und nicht von dem heroischen Temperament eines Roger Bacon. Hätte man Descartes an die Stelle von Roger Bacon setzen können, hätte er viele von Bacons Gedanken gedacht. Aber wir hätten es nie erfahren. Er verbrannte nervös eines seiner Werke, als er von der Verurteilung Galileis erfuhr, und es war ein Glück, dass die Kirche nur langsam erkannte, welch schrecklicher Bolschewist mit diesem Mann in die geistige Welt eingetreten war, und erst nach seinem Tod begriff, dass seine Bücher auf den Index gesetzt werden mussten.
So ist es auch heute. Auch wir sind Zeugen einer klassisch-mathematischen Renaissance. Sie bringt uns eine neue Vision des Universums, aber auch eine neue Vision des menschlichen Lebens. Deshalb ist es notwendig, das Leben als einen Tanz zu bezeichnen. Dies ist nicht nur eine Metapher. Der Tanz ist die Regel der Zahl und des Rhythmus und des Maßes und der Ordnung, des kontrollierenden Einflusses der Form, der Unterordnung der Teile unter das Ganze. Das ist es, was ein Tanz ist. Und dieselben Eigenschaften machen auch den klassischen Geist aus, nicht nur im Leben, sondern, noch klarer und eindeutiger, im Universum selbst. Wir haben vollkommen recht, wenn wir nicht nur das Leben, sondern auch das Universum als einen Tanz betrachten. Denn das Universum besteht aus einer bestimmten Anzahl von Elementen, weniger als hundert, und das "Periodengesetz" dieser Elemente ist metrisch. Sie sind nicht willkürlich aneinandergereiht, nicht in Gruppen, sondern nach Anzahl, und die Elemente gleicher Qualität erscheinen in festen und regelmäßigen Abständen. So ist unsere Welt auch im Grunde ein Tanz, eine einzige metrische Strophe in einem Gedicht, das uns für immer verborgen bleiben wird, es sei denn, die Philosophen, die heute auch hier die Methoden der Mathematik anwenden, mögen glauben, dass sie ihm den Charakter einer objektiven Erkenntnis verliehen haben.
Ich nenne diese Bewegung von heute, wie die des siebzehnten Jahrhunderts, klassisch-mathematisch. Jahrhunderts, klassisch-mathematisch. Und ich betrachte den Tanz (unbeschadet einer später in diesem Band vorgenommenen Unterscheidung) als ihr wesentliches Symbol. Damit sollen die romantischen Elemente der Welt nicht geschmälert werden, die ebenfalls zu ihrem Wesen gehören. Aber die überbordenden Energien und unermesslichen Möglichkeiten des ersten Tages lassen sich vielleicht am besten ermessen, wenn wir am sechsten Tag der Schöpfung ihr endgültiges Ergebnis erreicht haben.
Wie dem auch sei, die Analogie zwischen den beiden in Frage stehenden historischen Perioden bleibt bestehen, und ich glaube, dass wir sie insofern für gültig halten können, als die streng mathematischen Elemente der späteren Periode nicht die ersten sind, die auftauchen, sondern dass wir uns in der Gegenwart eines Prozesses befinden, der in vielen Bereichen seit einem halben Jahrhundert in subtiler Bewegung ist. Wenn es bedeutsam ist, dass Descartes einige Jahre nach Malherbe auftrat, so ist es ebenso bedeutsam, dass Einstein das russische Ballett unmittelbar vorausging. Wir bewundern den Künstler, der an der Orgel sitzt, aber wir haben den Blasebalg geblasen; und die Musik des großen Künstlers wäre unhörbar gewesen, wenn wir nicht gewesen wären.
Das ist der Geist, in dem ich geschrieben habe. Wir alle - nicht nur ein oder zwei prominente Personen hier und da - sind an der Schaffung der geistigen Welt beteiligt. Ich habe nie mit dem Gedanken geschrieben, dass der Leser, auch wenn er es nicht weiß, bereits auf meiner Seite ist. Nur so konnte ich mit jener Aufrichtigkeit und Einfachheit schreiben, ohne die es mir nicht lohnend erscheint, überhaupt zu schreiben. Das zeigt sich in dem Spruch, den ich meinem frühesten Buch "Der neue Geist" voranstellte: Wer seine intimsten Gefühle am weitesten trägt, ist einfach der Erste in der Reihe einer großen Zahl anderer Menschen, und man wird typisch, indem man in höchstem Maße man selbst ist. Diesen Spruch habe ich mit Bedacht und voller Überzeugung gewählt, weil er den Kern meines Buches trifft. Vordergründig bezog er sich natürlich auf die großen Gestalten, mit denen ich mich dort beschäftigte und die das repräsentierten, was ich - keineswegs im armseligen Sinne der bloßen Modernität - als den Neuen Geist im Leben betrachtete. Sie alle hatten sich in die Tiefen ihrer eigenen Seele begeben und von dort aus intime Impulse und Emotionen an die Oberfläche gebracht und zum Ausdruck gebracht, die, so schockierend sie damals auch erschienen sein mögen, heute als die einer unzähligen Schar von Mitmenschen angesehen werden. Aber es war auch ein Buch der persönlichen Bekenntnisse. Hinter der offensichtlichen Bedeutung des Mottos auf dem Titelblatt verbarg sich die eher private Bedeutung, dass ich selbst geheime Impulse zum Ausdruck brachte, die eines Tages auch die Gefühle anderer zum Ausdruck bringen könnten. In den fünfunddreißig Jahren, die seither vergangen sind, ist mir der Spruch immer wieder in den Sinn gekommen, und wenn ich vergeblich versucht habe, ihn mir zu eigen zu machen, finde ich keine angemessene Rechtfertigung für mein Lebenswerk.
Und nun, wie ich eingangs sagte, bin ich sogar bereit zu glauben, dass dies die Funktion aller Bücher ist, die echte Bücher sind. Es gibt noch andere Klassen von sogenannten Büchern: die Klasse der Geschichtsbücher und die Klasse der forensischen Bücher, d.h. die Sachbücher und die Argumentationsbücher. Niemand möchte diese beiden Arten von Büchern schmälern. Aber wenn wir an ein Buch im eigentlichen Sinne denken, in dem Sinne, dass eine Bibel ein Buch bedeutet, meinen wir mehr als das. Wir meinen damit die Offenbarung von etwas, das in der Seele des Verfassers, die letztlich die Seele der Menschheit ist, latent, unbewusst, vielleicht sogar mehr oder weniger absichtlich unterdrückt geblieben war. Diese Bücher sind dazu angetan, uns abzustoßen; nichts ist so geeignet, uns zunächst zu schockieren, wie die offenkundige Enthüllung unserer selbst. Deshalb müssen solche Bücher vielleicht immer wieder an die verschlossene Tür unseres Herzens klopfen. "Wer ist da?", rufen wir unvorsichtig, und wir können die Tür nicht öffnen; wir bitten den aufdringlichen Fremden, was immer er sein mag, wegzugehen; bis wir endlich, wie in der Apologie des persischen Mystikers, die Stimme draußen zu hören scheinen, die sagt: "Du selbst bist es."
H. E.
Kapitel 1. Einführung
I
Es war für den Menschen immer schwierig zu erkennen, dass sein Leben eine Kunst ist. Es ist schwieriger gewesen, es so zu begreifen, als es so zu handeln. Denn so hat er es immer mehr oder weniger gehandhabt. Zu Beginn kam der primitive Philosoph, der sich mit dem Ursprung der Dinge befasste, in der Regel zu dem Schluss, dass das gesamte Universum ein Kunstwerk sei, das von einem Höchsten Künstler nach Art der Künstler aus einem Material geschaffen wurde, das praktisch nichts war, sogar aus seinen eigenen Ausscheidungen, eine Methode, die, wie Kinder manchmal instinktiv spüren, eine Art schöpferische Kunst ist. Die bekannteste dieser primitiven philosophischen Aussagen - und in der Tat eine Aussage, die so typisch ist wie jede andere - ist die der Hebräer im ersten Kapitel ihres Buches Genesis. Dort lesen wir, wie der gesamte Kosmos aus dem Nichts entstand, und zwar in einem überschaubaren Zeitraum durch die Kunst eines Jehovas, der methodisch vorging, indem er ihn zunächst im Groben formte und dann allmählich die Details, die feinsten und zartesten letzten, einarbeitete, so wie ein Bildhauer eine Statue gestalten könnte. Wir können viele Aussagen dieser Art finden, sogar so weit entfernt wie der Pazifik.1 Und - sogar in der gleichen Entfernung - der Künstler und Handwerker, der dem göttlichen Schöpfer der Welt glich, indem er die schönsten und nützlichsten Dinge für die Menschheit schuf, hatte auch selbst Anteil an derselben göttlichen Natur. So nahm in Samoa wie auch in Tonga der Zimmermann, der Kanus baute, eine hohe und fast heilige Stellung ein, die der des Priesters nahekam. Selbst bei uns, mit unseren römischen Traditionen, bleibt der Name Pontifex oder Brückenbauer der einer imposanten und hieratischen Persönlichkeit.
Aber das ist nur die primitive Sicht der Welt. Als der Mensch sich entwickelte, als er wissenschaftlicher und moralischer wurde, blieb seine Praxis zwar im Wesentlichen die des Künstlers, aber seine Vorstellung wurde viel weniger davon geprägt. Er lernte, das Geheimnis des Messens zu entdecken; er näherte sich den Anfängen der Geometrie und der Mathematik; gleichzeitig wurde er kriegerisch. So sah er die Dinge geradliniger und starrer; er formulierte Gesetze und Gebote. Das war, so versichert Einstein, der richtige Weg. Aber er war, jedenfalls in erster Linie, höchst ungünstig für die Auffassung des Lebens als Kunst. Das ist auch heute noch so.
Dennoch gibt es immer einige, die bewusst oder instinktiv die immense Bedeutung des Kunstbegriffs für das Leben erkannt haben. Das gilt insbesondere für die besten Denker der beiden Länder, die, soweit wir es erahnen können - so schwierig es auch sein mag, hier positiv und nachweislich zu sprechen -, die besten Zivilisationen hatten, nämlich China und Griechenland. Die weisesten und anerkanntermaßen größten praktischen Philosophen dieser beiden Länder haben geglaubt, dass das ganze Leben, sogar die Regierung, eine Kunst ist, die den anderen Künsten, wie der Musik oder dem Tanz, durchaus ähnlich ist. Wir können uns zum Beispiel einen der typischsten Griechen in Erinnerung rufen. Von Protagoras, der von Platon verleumdet wurde - obwohl es interessant ist zu beobachten, dass Platons eigene transzendentale Ideenlehre als ein Versuch angesehen wurde, dem lösenden Einfluss von Protagoras' Logik zu entkommen -, kann der moderne Philosophiehistoriker sagen, dass "die Größe dieses Mannes kaum gemessen werden kann". Sein berühmtester Ausspruch bezog sich auf das Messen: "Der Mensch ist das Maß aller Dinge, derer, die existieren, und derer, die keine Existenz haben. Sein Beharren auf dem Menschen als dem aktiven Schöpfer von Leben und Wissen, dem Künstler der Welt, der sie nach seinem eigenen Maß formt, macht Protagoras für uns heute so interessant. Er erkannte, dass es keine absoluten Kriterien gibt, nach denen man Handlungen beurteilen kann. Er war der Vater des Relativismus und des Phänomenalismus, wahrscheinlich der Initiator der modernen Doktrin, dass die Definitionen der Geometrie nur annähernd wahre Abstraktionen von empirischen Erfahrungen sind. Wir müssen und sollten wahrscheinlich nicht annehmen, dass er mit der Untergrabung des Dogmatismus einen individuellen Subjektivismus begründete. Es war eher die Funktion des Menschen in der Welt als die des Individuums, die er im Sinn hatte, als er sein großes Prinzip formulierte, und es war die Reduktion der menschlichen Aktivität und des menschlichen Verhaltens auf die Kunst, die ihn hauptsächlich beschäftigte. Seine Projekte für die Kunst des Lebens begannen mit der Sprache, und er war ein Pionier der Sprachkunst, der Initiator der modernen Grammatik. Er schrieb Abhandlungen über viele spezielle Künste sowie die allgemeine Abhandlung "Über die Kunst", die zu den pseudohippokratischen Schriften gehört - wenn wir sie ihm mit Gomperz zuschreiben dürfen - und die den Geist der modernen positiven Wissenschaft verkörpert.
Hippias, der Philosoph von Elis, ein Zeitgenosse des Protagoras, und wie dieser gemeinhin zu den "Sophisten" gezählt, pflegte das größte Ideal des Lebens als einer Kunst, die alle Künste umfasst, die allen Menschen als eine Gemeinschaft von Brüdern gemeinsam ist und die mit dem Naturrecht, das über die Konvention der menschlichen Gesetze hinausgeht, eins ist. Platon machte sich über ihn lustig, und das war nicht schwer, denn ein Philosoph, der die Lebenskunst als so groß auffasste, konnte sie unmöglich in jedem Punkt adäquat spielen. Aber aus dieser Entfernung ist es sein Ideal, das uns in erster Linie interessiert, und er war in vielen der vielfältigen Aktivitäten, die er unternahm, wirklich sehr erfolgreich, sogar ein Pionier. Er war ein bemerkenswerter Mathematiker; er war Astronom und Geometer; er war ein ausgiebiger Dichter in den verschiedensten Formen und schrieb darüber hinaus über Phonetik, Rhythmus, Musik und Mnemotechnik; er diskutierte die Theorien der Bildhauerei und der Malerei; er war sowohl Mythologe und Ethnologe als auch ein Student der Chronologie; er beherrschte viele der künstlerischen Handwerke. Einmal, so heißt es, erschien er bei der olympischen Versammlung in Gewändern, die von den Sandalen an seinen Füßen bis zum Gürtel um seine Taille und den Ringen an seinen Fingern von seinen eigenen Händen gemacht worden waren. Ein solches Wesen von kaleidoskopischer Vielseitigkeit, bemerkt Gomperz, nennen wir verächtlich einen Tausendsassa. Wir glauben an die Unterordnung des Menschen unter seine Arbeit. Aber andere Zeitalter haben anders geurteilt. Die Mitbürger des Hippias hielten ihn für würdig, ihr Botschafter auf dem Peloponnes zu sein. In einem anderen Zeitalter immenser menschlicher Aktivität, der Renaissance, wurde die weitreichende Energie von Leo Alberti gewürdigt, und in einem noch späteren, ähnlichen Zeitalter zeigte Diderot - der Phantophile, wie Voltaire ihn nannte - eine ähnlich feurige Energie weitreichender Interessen, obwohl es nicht mehr möglich war, das gleiche Niveau weitreichender Leistungen zu erreichen. Natürlich war die Arbeit von Hippias von ungleichem Wert, aber einiges davon war von solider Qualität, und er scheute keine Mühe. Er scheint eine liebenswürdige Bescheidenheit besessen zu haben, ganz im Gegensatz zu der eingebildeten Aufgeblasenheit, die Platon ihm gerne zuschrieb. Er maß der Hingabe an die Wahrheit mehr Bedeutung bei, als bei den Griechen üblich war, und er war kosmopolitisch eingestellt. Er war berühmt für seine Unterscheidung zwischen Konvention und Natur, und Platon legte ihm die Worte in den Mund: "Euch alle, die ihr hier anwesend seid, betrachte ich als Verwandte und Freunde und Mitbürger, und zwar von Natur aus, nicht durch das Gesetz; denn von Natur aus ist Gleiches mit Gleichem verwandt, während das Gesetz der Tyrann der Menschheit ist und uns oft zu vielen Dingen zwingt, die gegen die Natur sind." Hippias stand in der Reihe derer, deren höchstes Ideal die Totalität der Existenz ist. Odysseus war, wie Benn bemerkt, im griechischen Mythos der Repräsentant dieses Ideals, und sein oberster Repräsentant im wirklichen Leben ist in der Neuzeit Goethe gewesen.2
II
Aber ist das Leben in Wirklichkeit eine Kunst? Schauen wir uns die Sache genauer an und sehen wir uns an, wie das Leben aussieht, wie die Menschen es gelebt haben. Dies ist um so notwendiger, als es heute einfältige Menschen gibt - wohlmeinende, ehrliche Menschen, die wir nicht ignorieren sollten -, die eine solche Idee ablehnen. Sie verweisen auf die exzentrischen Individuen in unserer westlichen Zivilisation, die ein kleines Idol erschaffen, das sie "Kunst" nennen, und vor ihm niederfallen und es anbeten, ihm zu Ehren unverständliche Gesänge singen und die meiste Zeit damit verbringen, die Menschen zu verachten, die sich weigern anzuerkennen, dass diese Anbetung der "Kunst" das Einzige ist, was für das, was sie die "moralische Erhebung" des Zeitalters, in dem sie leben, nennen mögen oder nicht. Wir müssen den Fehler der guten, einfältigen Leute vermeiden, in deren Augen diese "Kunst"-Leute so groß erscheinen. Sie sind nicht groß, sie sind nur die krankhaften Symptome einer sozialen Krankheit; sie sind die phantastische Reaktion einer Gesellschaft, die als Ganzes aufgehört hat, sich auf dem wahren Weg jeder echten und lebendigen Kunst zu bewegen. Denn das hat nichts mit den Exzentrizitäten einer kleinen religiösen Sekte zu tun, die in einem Little Bethel verehrt; es ist die große Bewegung des gemeinsamen Lebens einer Gemeinschaft, ja einfach die äußere und sichtbare Form dieses Lebens.
So ist der gesamte Kunstbegriff bei uns so verengt und entwertet worden, dass einerseits der Gebrauch des Wortes in seinem großen und natürlichen Sinn entweder unverständlich oder exzentrisch erscheint, während er andererseits, selbst wenn er akzeptiert wird, immer noch so unvertraut bleibt, dass seine ungeheure Bedeutung für unsere gesamte Lebensauffassung in der Welt kaum auf den ersten Blick erkannt wird. Das liegt nicht nur an unserer natürlichen Verstocktheit oder am Fehlen einer angemessenen Ausmerzung subnormaler Bestände unter uns, so sehr wir diesen dysgenischen Faktor auch gerne zuschreiben mögen. Sie scheint weitgehend unvermeidlich zu sein. Das heißt, was uns in unserer modernen Zivilisation betrifft, ist es das Ergebnis eines zweitausendjährigen sozialen Prozesses, das Resultat der Aufspaltung der klassischen Denktradition in verschiedene Teile, die unter nachklassischen Einflüssen getrennt voneinander weitergeführt wurden.3 Die Religion oder das Verlangen nach dem Heil unserer Seelen, die "Kunst" oder das Verlangen nach Verschönerung, die Wissenschaft oder die Suche nach dem Grund der Dinge - diese Geisteshaltungen, die in Wirklichkeit drei Aspekte desselben tiefgreifenden Impulses sind, durften jeweils ihren eigenen schmalen, separaten Kanal furchen, in Entfremdung von den anderen, und so wurden sie alle in ihrer größeren Funktion der Befruchtung des Lebens behindert.
Es ist interessant zu beobachten, wie ein Phänomen einen völlig neuen Aspekt annehmen kann, wenn es von einem anderen Kanal in den der Kunst überführt wird. Nehmen wir zum Beispiel dieses bemerkenswerte Phänomen namens Napoleon, eine so beeindruckende individualistische Erscheinung, wie wir sie in der Menschheitsgeschichte der letzten Jahrhunderte kaum finden konnten, und betrachten wir zwei zeitgenössische, fast gleichzeitige Einschätzungen dazu. Ein angesehener englischer Schriftsteller, Herr H. G. Wells, hat in einem bemerkenswerten und sogar berühmten Buch, seinem "Abriss der Geschichte", ein Urteil über Napoleon in einem ganzen Kapitel niedergelegt. Nun bewegt sich Herr Wells auf dem ethisch-religiösen Weg. Es heißt, er wache jeden Morgen mit einer Lebensregel auf; einige seiner Kritiker sagen, es sei jeden Morgen eine neue Regel, und andere, die Regel sei weder ethisch noch religiös; aber wir befassen uns hier nur mit dem Kanal und nicht mit der Richtung des Stroms. In der "Outline" spricht Wells sein ethisch-religiöses Anathema gegen Napoleon aus, "diese dunkle kleine archaische Persönlichkeit, hart, kompakt, fähig, skrupellos, nachahmend und ordentlich vulgär". Das "archaische" - das altmodische, überholte - Element, das Napoleon zugeschrieben wird, wird später noch einmal betont, denn Mr. Wells hat eine äußerst niedrige Meinung (kaum gerechtfertigt, wie man nebenbei anmerken kann) vom primitiven Menschen. Napoleon sei "eine Erinnerung an alte Übel, ein Ding wie die Bakterie einer Seuche"; "die Figur, die er in der Geschichte macht, ist eine von fast unglaublicher Selbstüberheblichkeit, von Eitelkeit, Gier und Gerissenheit, von gefühlloser Verachtung und Missachtung aller, die ihm vertrauten." Es gibt keine Figur, so Wells, die der Figur des Jesus von Nazareth so völlig entgegengesetzt ist. Er war "ein Schurke, hell und vollkommen".
Es gibt keinen Anlass, diese Verurteilung in Frage zu stellen, wenn wir uns in die Richtung von Herrn Wells begeben; sie ist wahrscheinlich unvermeidlich; wir können sie sogar von Herzen annehmen. Doch wie richtig diese Linie auch sein mag, sie ist nicht die einzige Linie, auf der wir uns bewegen können. Darüber hinaus - und das ist der Punkt, um den es uns geht - ist es möglich, eine Sphäre zu betreten, in der es nicht nötig ist, zu einer so rein negativen, verurteilenden und unbefriedigenden Schlussfolgerung zu gelangen. Denn natürlich ist sie unbefriedigend. Es ist schließlich nicht hinnehmbar, dass ein so überragender Protagonist der Menschheit, der von Millionen bejubelt wurde, von denen viele gern für ihn starben, und der in der menschlichen Vorstellung immer noch einen so großen und ruhmreichen Platz einnimmt, am Ende als bloßer Schurke abgetan werden soll. Denn ihn so zu verurteilen, hieße den Menschen zu verurteilen, der ihn zu dem gemacht hat, was er war. Er muss die Antwort auf einen lyrischen Schrei des menschlichen Herzens gewesen sein. Die andere Sphäre, in der Napoleon ein anderes Gesicht trägt, ist die Sphäre der Kunst im größeren und grundlegenden Sinne. Élie Faure, ein französischer Kritiker, ein hervorragender Kunsthistoriker im gewöhnlichen Sinne, ist auch in der Lage, die Kunst im weiteren Sinne zu erfassen, weil er nicht nur ein Mann der Literatur, sondern auch der Wissenschaft ist, ein Mann mit medizinischer Ausbildung und Erfahrung, der in der offenen Welt gelebt hat und nicht, wie der Kritiker von Literatur und Kunst so oft zu sein scheint, ein Mann, der in einem feuchten Keller lebt. Kurz nachdem Wells seinen "Abriss" veröffentlicht hatte, veröffentlichte Élie Faure, der wahrscheinlich nichts davon wusste, da er kein Englisch liest, ein Buch über Napoleon, das manche für das bemerkenswerteste Buch über dieses Thema halten, das ihnen je begegnet ist. Denn für Faure ist Napoleon ein großer lyrischer Künstler.
Es ist schwer zu glauben, dass Faure Wells' Kapitel über Napoleon vor sich aufgeschlagen hatte, so sehr bringt er es auf den Punkt. Er betitelt das erste Kapitel seines "Napoléon" mit "Jesus und er" und stößt sofort zu dem vor, was auch Wells als den Kern der Sache erkannt hatte: "Vom Standpunkt der Moral aus ist er nicht zu verteidigen und sogar unverständlich. In der Tat bricht er das Recht, er tötet, er sät Rache und Tod. Aber er diktiert auch das Recht, er verfolgt und vernichtet das Verbrechen, er sorgt überall für Ordnung. Er ist ein Meuchelmörder. Er ist auch ein Richter. Auf den Rängen würde er den Strick verdienen. An der Spitze ist er rein, verteilt mit fester Hand Belohnung und Strafe. Er ist ein Ungeheuer mit zwei Gesichtern, wie wir alle vielleicht, auf jeden Fall wie Gott, denn sowohl diejenigen, die Napoleon gelobt haben, als auch diejenigen, die ihn getadelt haben, haben nicht verstanden, dass der Teufel das andere Gesicht Gottes ist." Vom moralischen Standpunkt aus gesehen, sagt Faure (genau wie Wells), ist Napoleon der Antichrist. Aber vom Standpunkt der Kunst aus betrachtet, wird alles klar. Er ist ein Dichter der Tat, wie Jesus es war, und wie dieser steht er abseits. Diese beiden, und nur diese beiden unter den ganz großen Männern der Welt, von denen wir etwas Genaues wissen, haben "ihren Traum gelebt, anstatt ihre Tat zu träumen". Möglicherweise war Napoleon selbst in der Lage, den moralischen Wert dieses gelebten Traums zu schätzen. Als er einmal vor dem Grab von Rousseau stand, bemerkte er: "Es wäre besser für die Ruhe Frankreichs gewesen, wenn dieser Mann und ich nie existiert hätten." Doch wir können nicht sicher sein. "Ist die Ruhe nicht der Tod der Welt?", fragt Faure. "Hatten Rousseau und Napoleon nicht gerade die Aufgabe, diese Ruhe zu stören? In einem anderen der tiefgründigen und fast unpersönlichen Sprüche, die ihm manchmal über die Lippen kamen, bemerkte Napoleon mit einer noch tieferen Intuition für seine eigene Funktion in der Welt: "Ich liebe die Macht. Aber ich liebe sie als Künstler. Ich liebe sie, wie ein Musiker seine Geige liebt, um ihr Töne, Akkorde und Harmonien zu entlocken. Ich liebe sie als Künstler." Als Künstler! Diese Worte waren die Inspiration für diese fein erhellende Studie über Napoleon, die, obwohl frei von jeglichem Wunsch, Napoleon zu verteidigen oder zu bewundern, dennoch Napoleon zu erklären scheint, um im weiteren Sinne sein Recht auf einen Platz in der menschlichen Geschichte zu rechtfertigen und so eine endgültige Befriedigung zu vermitteln, von der wir glauben, dass Wells, hätte er sich von den Fesseln der engen Vorstellung vom Leben, die ihn fesselte, befreien können, in ihm den Geist und die Intelligenz gehabt hätte, auch uns zu beschenken.
Aber es ist an der Zeit, sich davon abzuwenden. Es ist immer möglich, über einzelne Personen zu streiten, selbst wenn ein so glückliches Beispiel vor uns steht. Wir haben es hier nicht mit außergewöhnlichen Personen zu tun, sondern mit der Interpretation der allgemeinen und normalen menschlichen Zivilisationen.
III
Ich nehme, fast willkürlich, das Beispiel eines Naturvolkes. Es gibt viele andere, die ebenso gut oder besser geeignet wären. Aber dieses ist zufällig zur Hand, und es hat den Vorteil, nicht nur ein primitives Volk zu sein, sondern eines, das auf einer Insel lebt und so bis vor kurzem seine eigene, wenig beeinträchtigte einheimische Kultur besaß, die räumlich so weit wie möglich von der unseren entfernt ist; die Aufzeichnung wurde außerdem, so sorgfältig und unparteiisch, wie man es erwarten kann, von der Frau eines Missionars gemacht, die aus einem Wissen spricht, das sich über zwanzig Jahre erstreckt.4 Es ist fast überflüssig hinzuzufügen, dass sie ebenso wenig mit irgendeiner Theorie der Lebenskunst befasst ist wie das Volk, das sie beschreibt.
Die Loyalitätsinseln liegen östlich von Neukaledonien und gehören seit mehr als einem halben Jahrhundert zu Frankreich. Sie befinden sich somit auf demselben Breitengrad wie Ägypten auf der Nordhalbkugel, jedoch mit einem durch den Ozean gemäßigten Klima. Wir befassen uns hauptsächlich mit der Insel Lifu. Auf dieser Insel gibt es weder Flüsse noch Berge, aber ein Gebirgskamm aus hohen Felsen mit großen und schönen Höhlen enthält Stalaktiten und Stalagmiten und tiefe Becken mit frischem Wasser; diese Becken waren vor der Ankunft der Christen der Aufenthaltsort der Geister der Verstorbenen und wurden daher sehr verehrt. Ein sterbender Mann sagte zu seinen Freunden: "Ich werde euch alle in den Höhlen wiedersehen, wo die Stalaktiten sind."
Die Loyalty Islanders, die von durchschnittlicher europäischer Statur sind, sind eine hübsche Rasse, abgesehen von ihren dicken Lippen und geweiteten Nasenlöchern, die jedoch viel weniger ausgeprägt sind als bei afrikanischen Negern. Sie haben weiche, große braune Augen, gewelltes schwarzes Haar, weiße Zähne und eine reiche braune Haut von unterschiedlicher Tiefe. Jeder Stamm hat sein eigenes, genau abgegrenztes Territorium und seinen eigenen Häuptling. Obwohl sie hohe moralische Qualitäten besitzen, sind sie ein lachfreudiges Volk, und weder ihr Klima noch ihre Lebensweise verlangen nach langer, harter Arbeit, aber sie können genauso gut wie der durchschnittliche Brite arbeiten, wenn es sein muss, mehrere Tage hintereinander, und wenn die Notwendigkeit vorbei ist, faulenzen oder wandern, schlafen oder reden. Die Grundlage ihrer Kultur - und das ist zweifellos die wichtigste Tatsache für uns - ist künstlerisch. Jeder von ihnen hat Musik, Tanz und Gesang gelernt. Daher ist es für sie selbstverständlich, bei allen Handlungen des Lebens auf Rhythmus und Anmut zu achten, und es ist fast eine Frage des Instinkts, Schönheit in allen sozialen Beziehungen zu pflegen. Männer und Jungen verbrachten viel Zeit damit, ihre braune Haut zu tätowieren und zu polieren, ihr langes, gewelltes Haar zu färben und zu frisieren (goldene Locken, die in Europa seit jeher sehr bewundert werden, erhält man durch die Verwendung von Kalk) und ihren Körper zu salben. Diese Tätigkeiten beschränkten sich natürlich auf die Männer, denn der Mann ist von Natur aus das schmückende Geschlecht und die Frau das nützliche Geschlecht. Die Frauen kümmerten sich nicht um ihr Haar, außer dass sie es kurz hielten. Es waren auch die Männer, die Öle und Parfüm benutzten, nicht die Frauen, die jedoch Armbänder oberhalb des Ellenbogens und schöne lange Jadeperlenschnüre trugen. Bis zum Alter von fünfundzwanzig oder dreißig Jahren wird keine Kleidung getragen, und dann sind alle gleich gekleidet, außer dass die Häuptlinge den Gürtel anders befestigen und aufwändigere Verzierungen tragen. Diese Menschen haben süße und musikalische Stimmen und kultivieren sie. Sie sind gut im Erlernen von Sprachen und sind große Redner. Die Sprache der Lifuan ist weich und flüssig, ein Wort geht für das Ohr angenehm in das andere über, und sie ist so ausdrucksstark, dass man die Bedeutung manchmal schon am Klang erkennen kann. Auf einer dieser Inseln, Uvea, ist die Beredsamkeit der Menschen so groß, dass sie die Redekunst einsetzen, um Fische zu fangen, die sie in ihren Legenden tatsächlich als halb menschlich ansehen, und man glaubt, dass ein Fischschwarm, wenn er vom Kanu aus so höflich mit Komplimenten bedacht wird, schließlich und ganz spontan in den Bann gezogen wird.
Für ein primitives Volk ist die Lebenskunst notwendigerweise zu einem großen Teil mit dem Essen verbunden. Man weiß, dass niemand hungern muss, wenn sein Nachbar etwas zu essen hat, und so wurde niemand aufgefordert, eine große Dankbarkeit zu zeigen, wenn er ein Geschenk erhielt. Die Hilfe, die man einem anderen leistete, war eine Hilfe für sich selbst, wenn sie zum Gemeinwohl beitrug, und was ich heute für dich tue, wirst du morgen für mich tun. Es herrschte uneingeschränktes Vertrauen, und Güter wurden ohne Angst vor Diebstahl zurückgelassen, der selten war und mit dem Tod bestraft wurde. Es war jedoch kein Diebstahl, wenn man einen Gegenstand, den man haben wollte, mitnahm, als der Besitzer gerade hinsah. Auch das Lügen mit der Absicht zu täuschen, war ein schweres Vergehen, obwohl es entschuldbar war, zu lügen, wenn man Angst hatte, die Wahrheit zu sagen. Die Lifuaner lieben das Essen, aber beim Essen wird viel Etikette geübt. Das Essen muss anmutig, zierlich und gemächlich zum Mund geführt werden. Jeder bediente sich an den Speisen, die unmittelbar vor ihm standen, ohne Eile, ohne nach den leckeren Häppchen zu greifen (die oft den Frauen angeboten wurden), denn jeder kümmerte sich um seinen Nachbarn, und jeder fühlte sich natürlich als Hüter seines Bruders. So war es üblich, die Vorübergehenden herzlich einzuladen, sich an der Mahlzeit zu beteiligen. "In Sachen Essen und Trinken", fügt Mrs. Hadfield hinzu, "könnten sie viele unserer Landsleute in den Schatten stellen. Man darf nicht nur nicht schnell essen oder Leckereien bemerken, die nicht in der Nähe sind, sondern es wäre unhöflich, in Gegenwart von Leuten zu essen, die nicht selbst essen. Man muss immer teilen, auch wenn die eigene Portion noch so klein ist, und man muss es auf angenehme Weise tun; man muss auch annehmen, was einem angeboten wird, aber langsam, widerwillig; wenn man es angenommen hat, kann man es, wenn man will, offen an jemand anderen weitergeben. In alten Zeiten waren die Lifuaner gelegentlich Kannibalen, nicht, wie es scheint, aus Notwendigkeit oder irgendeinem rituellen Grund, sondern weil es ihnen, wie einigen anderen Völkern, gefiel, ja, sie hatten zuweilen eine Art Verlangen nach tierischer Nahrung. Wenn ein Mann zwanzig oder dreißig Frauen und eine große Familie hätte, wäre es völlig in Ordnung, wenn er ab und zu eines seiner eigenen Kinder kochte, obwohl er es vermutlich vorzog, das Kind eines anderen zu wählen. Das Kind wird im Ganzen gekocht, eingewickelt in Bananen- oder Kokosnussblätter. Die sozialen Unannehmlichkeiten dieses Brauchs sind inzwischen erkannt worden. Aber sie empfinden immer noch größten Respekt und Ehrfurcht vor den Toten und finden nichts Anstößiges oder Abstoßendes an einem Leichnam. "Warum auch, sie war doch einst unsere Nahrung." Auch vor dem Tod haben sie keine Angst. Gegen Ungeziefer scheinen sie wenig einzuwenden zu haben, aber ansonsten haben sie einen ausgeprägten Sinn für Sauberkeit. Der Gedanke, Dung in der Landwirtschaft zu verwenden, erscheint ihnen ekelhaft, und sie verwenden ihn auch nie. "Das Meer war der öffentliche Spielplatz". Mütter nehmen ihre Kleinen mit ins Meer, lange bevor sie laufen können, und kleine Kinder lernen schwimmen, wie sie laufen lernen, ohne Unterricht. Mit der Ehrfurcht vor dem Tod geht auch eine Ehrfurcht vor dem Alter einher. "Das Alter ist ein Begriff des Respekts, und jeder freut sich, wenn er für älter gehalten wird, als er ist, denn das Alter wird geehrt." Doch die Achtung vor den anderen war allgemein - nicht auf die Alten beschränkt. In der Kirche sitzen heutzutage die Aussätzigen auf einer separaten Bank, und wenn die Bank von einem Aussätzigen besetzt ist, bestehen gesunde Frauen manchmal darauf, bei ihm zu sitzen; sie konnten es nicht ertragen, den alten Mann allein sitzen zu sehen, als hätte er keine Freunde. Es wurde viel demonstriert, wenn man nach der Abwesenheit Freunde traf. Ein Lifuan sagte immer "Olea" ("Danke") für jede gute Nachricht, auch wenn sie ihn nicht persönlich betraf, als wäre sie ein Geschenk, denn er war froh, sich mit einem anderen freuen zu können. Da die Menschen in kleine Stämme unterteilt waren, von denen jeder sein eigenes, selbstherrliches Oberhaupt hatte, war ein Krieg manchmal unvermeidlich. Er war mit viel Etikette verbunden, die stets streng eingehalten wurde. Die Lifuaner kannten nicht den zivilisierten Brauch, Regeln für die Kriegsführung aufzustellen und sie zu brechen, wenn der Krieg tatsächlich ausbrach. Der Beginn von Feindseligkeiten musste mehrere Tage im Voraus angekündigt werden. Frauen und Kinder wurden im Gegensatz zu den Gepflogenheiten der zivilisierten Kriegsführung nie belästigt. Sobald ein halbes Dutzend Kämpfer einer Seite außer Gefecht gesetzt war, gab der Häuptling dieser Seite den Befehl, die Kämpfe einzustellen, und der Krieg war beendet. Eine Entschädigung wurde dann von den Eroberern an die Besiegten gezahlt, und nicht, wie bei zivilisierten Völkern, von den Besiegten an die Eroberer. Man war der Meinung, dass eher der Besiegte als der Eroberer Trost brauchte, und es schien auch wünschenswert zu zeigen, dass keine Feindseligkeit zurückblieb. Dies war nicht nur ein zartes Zeichen der Rücksichtnahme auf die Besiegten, sondern auch eine sehr gute Politik, wie einige Europäer durch die Vernachlässigung dieses Verhaltens vielleicht lernen mussten. Diese ganze Lebensweise der Lifuaner ist jedoch durch die Ankunft des Christentums mit seinen üblichen Begleiterscheinungen untergraben worden. Die Lifuaner ersetzen ihre eigenen Tugenden durch europäische Laster. Ihre Einfachheit und ihre Zuversicht schwinden, obwohl sie, wie Mrs. Hadfield sagt, immer noch durch ihre Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, ihren guten Humor, ihre Freundlichkeit und Höflichkeit auffallen und ein mannhaftes und intelligentes Volk bleiben.
IV
Die Lifuaner liefern ein Beispiel, das entscheidend zu sein scheint. Aber sie sind Wilde, und aus diesem Grund kann ihr Beispiel ungültig sein. Es ist gut, ein anderes Beispiel von einem Volk zu nehmen, dessen hohe und lang anhaltende Zivilisation heute unbestritten ist.
Die Zivilisation Chinas ist uralt, das ist seit langem bekannt. Aber mehr als tausend Jahre lang war sie für die Westeuropäer nur eine Legende; niemand hatte China je erreicht, oder wenn doch, waren sie nie zurückgekehrt, um davon zu berichten; es gab zu viele wilde und eifersüchtige Barbaren zwischen dem Osten und dem Westen. Erst gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts, mit Marco Polo, dem venezianischen Kolumbus des Ostens - es war ein Italiener, der sowohl die Alte als auch die Neue Welt entdeckte -, nahm China endlich konkrete Gestalt an, als konkrete Tatsache und als wunderbarer Traum. Später beschrieben italienische und portugiesische Reisende das Land, und es ist interessant zu sehen, was sie zu sagen hatten. So schildert Perera im 16. Jahrhundert in einem Bericht, den Willes für Hakluyt's "Voyages" übersetzt hat, das chinesische Leben in allen Einzelheiten und mit einer Bewunderung, die umso eindrucksvoller ist, als man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, wie fremd diese Zivilisation dem katholischen Reisenden war und wie viele Schwierigkeiten er selbst zu bewältigen hatte. Er staunt nicht nur über die Pracht des Lebens der Chinesen in materieller Hinsicht, sowohl im Großen als auch im Kleinen, sondern auch über ihre feinen Manieren in allen gewöhnlichen Lebensbereichen, über die Höflichkeit, in der sie ihm alle anderen Völker zu übertreffen schienen, und über den fairen Umgang, der den aller anderen Heiden und Mauren bei weitem übertraf, während er sie in der Ausübung der Gerechtigkeit sogar vielen Christen überlegen fand, da sie unbekannten Fremden gegenüber Gerechtigkeit walten ließen, was in der Christenheit selten ist; Außerdem gab es in jeder Stadt Krankenhäuser, und es waren keine Bettler zu sehen. Es war ein Anblick von Pracht, Zartheit und Menschlichkeit, wie er ihn vielleicht hier und da an den Fürstenhöfen Europas gesehen hatte, aber nirgendwo im Abendland in so großem Ausmaß wie in China.
Das Bild, das Marco Polo, der erste Europäer, der China erreichte (jedenfalls in der heutigen Zeit), im 13. Jahrhundert zeichnete, war noch beeindruckender, und das muss uns nicht überraschen, denn als er China sah, befand es sich noch in seinem großen augusteischen Zeitalter der Sung-Dynastie. Er schildert die Stadt Hang-Chau als die schönste und prächtigste der Welt, und wir dürfen nicht vergessen, dass er selbst aus Venedig stammte, das bald als die schönste und prächtigste Stadt Europas bekannt werden sollte, und dass er sich nicht wenig Wissen über die Welt angeeignet hatte. Wenn er das Leben dieser Stadt beschreibt, das so exquisit und raffiniert in seiner Zivilisation ist, so menschlich, so friedlich, so fröhlich, so geordnet, so glücklich, dass es von der gesamten Bevölkerung geteilt wird, wird uns klar, dass hier der höchste Punkt der städtischen Zivilisation erreicht wurde, den der Mensch je erreicht hat. Marco Polo kann kein anderes Wort dafür finden - und das immer wieder - als Paradies.
Das China von heute erscheint dem Westler weniger fremd und erstaunlich. Es mag ihm sogar - teils durch seinen Niedergang, teils durch seinen eigenen zivilisatorischen Fortschritt - aufgrund seines unmittelbaren und praktischen Charakters verwandt erscheinen. Dies ist die Schlussfolgerung eines sensiblen und nachdenklichen Reisenden in Indien, Japan und China, G. Lowes Dickinson. Er ist beeindruckt von der Freundlichkeit, der tiefen Menschlichkeit, der Fröhlichkeit der Chinesen, von der unvergleichlichen Selbstachtung, Unabhängigkeit und Höflichkeit des einfachen Volkes. "Die Grundeinstellung der Chinesen zum Leben ist und war schon immer die des modernsten Westens, der uns heute näher steht als unseren mittelalterlichen Vorfahren, der uns unendlich viel näher steht als Indien. "5
So weit mag es kaum als Künstler erscheinen, dass diese Reisenden die Chinesen betrachten. Sie betonen ihre heitere, praktische, soziale, gutmütige, tolerante, friedfertige und humane Art, das Leben zu betrachten, den bemerkenswert erziehbaren Geist, in dem sie bereit und leicht fähig sind, selbst alte und tief verwurzelte Gewohnheiten zu ändern, wenn es ihnen günstig und vorteilhaft erscheint; sie sind bereit, die Welt leicht zu nehmen, und scheinen keine jener hartnäckigen konservativen Instinkte zu haben, von denen wir in Europa geleitet werden. Der "Resident in Peking" sagt, sie seien das unromantischste aller Völker. Er sagt dies mit einer Nuance der Missbilligung, aber Lowes Dickinson sagt genau das Gleiche über die chinesische Poesie, und zwar ohne eine solche Nuance: "Sie ist von allen Gedichten, die ich kenne, die menschlichste und die am wenigsten symbolische oder romantische. Sie betrachtet das Leben so, wie es sich darstellt, ohne jeden Schleier von Ideen, ohne Rhetorik oder Sentiment; sie räumt einfach das Hindernis beiseite, das die Gewohnheit zwischen uns und der Schönheit der Dinge errichtet hat, und lässt diese in ihrer eigenen Natur erscheinen." Jeder, der gelernt hat, chinesische Poesie zu genießen, wird die feine Präzision dieses Kommentars zu schätzen wissen. Die Qualität ihrer Poesie scheint mit der einfachen, direkten, kindlichen Qualität übereinzustimmen, die alle Beobachter bei den Chinesen selbst feststellen. Der unsympathische "Resident in Peking" beschreibt die bekannte Etikette der Höflichkeit in China: "Ein Chinese wird Sie fragen, von welchem edlen Land Sie sind. Sie erwidern die Frage, und er wird sagen, seine bescheidene Provinz sei so und so. Er wird Sie einladen, ihm die Ehre zu erweisen, Ihre kostbaren Füße in sein unwürdiges Haus zu führen. Du antwortest, dass du, ein diskreditierter Wurm, in seinen prächtigen Palast kriechen wirst." Das Leben wird zum reinen Spiel. Zeremonien - die Chinesen sind unübertroffen, was Zeremonien angeht, und es gibt eine Regierungsbehörde, das Board of Rites and Ceremonies, die sie verwaltet - sind nichts anderes als mehr oder weniger kristallisiertes Spiel. Das Zeremoniell ist hier nicht nur "fast ein Instinkt", sondern, so wurde gesagt, "ein Chinese denkt in theatralischen Begriffen". Wir nähern uns der Sphäre der Kunst.