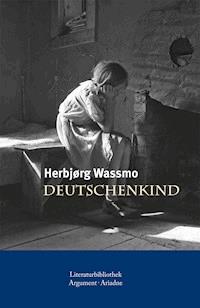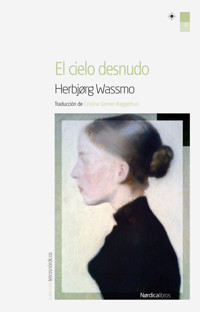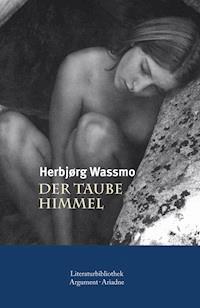
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tora-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ganz allein hat die fünfzehnjährige Tora Johansen in Breiland, weit weg von zu Hause, ihre Schwangerschaft geheim gehalten, ihr Kind zur Welt gebracht und es vergraben. Tora ist fast daran zerbrochen. Dann ist es – wie schon so oft – ihre klarsichtige Tante Rakel, die ihr hilft, aus dem Abgrund herauszufinden. Es gelingt Rakel, Tora aus ihrer traumatischen Starre zu lösen. Doch den Kampf gegen den Krebs verliert sie: Sie, die Unerschrockene, Aufrechte, spürt nur allzu deutlich, dass sie den kommenden Winter nicht mehr erleben wird. Rakels Tod reißt eine Lücke in die Gemeinde auf Toras Heimatinsel. Und in ihr Leben. Tora versucht die Lücke zu schließen, indem sie selbst zu Rakel wird …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbjørg Wassmo
Der taube Himmel
Tora-Trilogie Band 3
Deutsche Neufassung von Gabriele Haefs
Literaturbibliothek
Argument · Ariadne
Diese Neuübersetzung entstand mit finanzieller Unterstützung von NORLA.
Titel der norwegischen Originalausgabe:
Hudløs himmel
© Gyldendal Norsk Forlag AS 1986. All rigths reserved
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 2015
Umschlaggestaltung: Martin Grundmann
Foto: © Francesca Woodman, Untitled,
Boulder, Colorado 1972–1975,
courtesy George and Betty Woodman
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
ISBN 978-3-86754-870-0
Erste Auflage 2015
Für Hjørdis – meine Mutter
1
Es schneite in Breiland. Große flauschige Flocken blieben wie frisch geschorene nasse Wolle überall liegen. Einige unsichere Fußspuren von dem steinigen Hang bis zu den ersten Häusern mussten versteckt werden. Sie mussten vor Elisifs Gott versteckt werden. Der war zwar weit weg und hatte sich mit so vielem herumzuschlagen, und bisher hatte er kein besonderes Interesse an Fußspuren gezeigt, aber man konnte nie wissen. Deshalb – und nur deshalb schneite es stark und anhaltend. Weiche dichte Flocken, die auf dem warmen Gesicht zerflossen. Ein mildes dampfendes Tauwetter umgab sie und ließ die Eiszapfen in den roten Haaren schmelzen, drehte feuchte Locken um einen unsichtbaren Finger.
Irgendwo ließ sie sich zum Ausruhen auf die Knie sinken. Ihre roten, geschwollenen Hände steckten in dem Schneehaufen. Sie hatte sie noch nie gesehen. Wie ein Messerstich traf sie die Erinnerung, dass sie die Handschuhe oben am Hang vergessen hatte. Oder auf dem Weg verloren? Sie beruhigte sich, so wie es Tante Rakel machte, wenn etwas passiert war: »Das ist nicht schlimm, Tora. Niemand weiß, dass es deine Handschuhe sind!«
In dem leeren Rucksack schlug der hölzerne Schöpflöffel hin und her, als sie dann weiterging. Er jammerte und jammerte. Dass er nie Steine und Erde gegraben habe, und er leugnete, ihr jemals geholfen zu haben. Und Tora bat ihn stumm, sich ruhig zu verhalten. Denn irgendwer könnte seine Behauptungen doch hören.
»Es schneit. Alles ist jetzt vorbei.«
Trotzdem verstärkte sich das Geräusch des Holzes gegen das Segeltuch, bis von überallher ein Echo kam. Sie kniete abermals nieder, damit es Frieden gäbe. Schloss die Augen und war in sich selbst versunken.
Als sie wieder aufschaute, war das Moor voller Gänseblümchen. Mit gelben Köpfen in der Mitte. Staubgefäße im schwachen Wind. Das ganze Moor wogte. Das Licht aus den Häusern lag ruhig über dem Ganzen. Sie spürte, dass sich etwas im Mund und in den Nasenlöchern sammelte. Aber es wollte nicht heraus. Der Löffel war jetzt still. Eine gewisse Freude stach ein Loch nach dem anderen in sie hinein. Alles war vorüber. Und sie lebte noch!
Während sie durch ein Meer von Gänseblümchen wanderte, begriff sie, dass sie nicht in ihrem Körper war. Sie hörte keinen Laut, spürte nicht, dass die Füße auf der Straße gingen. Der Himmel wölbte sich mächtig und weiß über ihr. Der Rauch aus den Schornsteinen malte grobe Zeichen in das viele Weiß.
Bald standen die Torpfosten zu beiden Seiten der Straße. Ein paarmal sah sie menschliche Gestalten weiter vorn. Sie verschwanden, ehe sie sie erreichte. Sie wäre am liebsten losgerannt. Aber sie hatte blutverkrustete Einlagen zwischen den Beinen, auch wenn sie nichts davon merkte. Hatte gelernt, dass Dinge eben da sind, auch wenn man sie nicht spürt.
Sie bog automatisch ein, als sie zu Frau Karlsens Haus kam. Sie war auf das Schlimmste gefasst: Frau Karlsen stand auf der Treppe, schloss die Haustür ab und drehte ihr in dem braunen Mantel den Rücken zu. Sie ließ die Arme entsetzlich langsam am Körper herabsinken, die braune Handtasche in der rechten Hand. Die Tasche baumelte wie ein Pendel, während sie sich zu Tora umwandte.
Ein überraschtes Lächeln ließ das blutleere Gesicht aufleuchten, als sie Tora erblickte.
»Ach, du warst fort? Ja, ich hab wohl gemerkt, dass du nicht da warst, weil du auf mein Klopfen nicht geantwortet hast. Wollte dich zu Tee und Kuchen einladen. Ich hab den Eindruck, dass du’s mit dem Essen nicht so genau nimmst. Du gehst ohne Mütze? Bei dem Wetter! Meine Liebe, du musst ein bisschen besser auf dich aufpassen. Na ja, es geht mich ja eigentlich nichts an.«
Sie machte eine Handbewegung zu dem Schneewetter hin und seufzte tief, beinahe entzückt. Dann zog sie langsam ihre Handschuhe an.
»Alles ist fertig für die Beerdigung. Es wird eine schöne Beerdigung, davon bin ich überzeugt. Eine richtige Feierstunde für uns alle. Du musst auf jeden Fall runterkommen.«
Sie bürstete ein wenig Schnee von dem Mantelsaum, der an dem verschneiten Treppengeländer vorbeigestrichen war. Dann floss sie unendlich langsam durch Tora hindurch und verschwand in der Blumenwiese. Tora kam es vor, als ob eine Tür geöffnet würde und der Blumenduft zu ihr hereinströmte, als Frau Karlsen hindurchstrich.
Sie hatte Frau Karlsen bestimmt noch nie vorher gesehen. Sie bekam direkt Lust, ihr hinterherzulaufen und sich ein bisschen zu wärmen. Aber sie rettete sich in ihr eigenes Elend und lief nirgendwohin. Mühsam stieg sie die Treppen hoch. Sie wusste, dass der Spiegel da hing und ihr alles enthüllen würde, falls sie sich umdrehte.
Während sie in der Tasche nach dem Schlüssel suchte, verschwand alles, was gewesen war. Die Menschen, die Blumenwiese, das Bündel in der Geröllhalde, der Löffel. Es blieb bei der Tür stehen und kam nicht weiter.
Weil sie es nicht mitnehmen wollte.
Es war ineinander verstrickt. Alles. Wenn sie das eine ablehnte, würde sie auch das andere ablehnen. Sie konnte nicht einfach das Schlimmste abwählen.
Der Hahn über dem Ausguss im Flur tropfte stetig. Sie wankte dorthin. Die solide Brandmauer, an der man den Ausguss befestigt hatte, war warm. Sie legte beide Hände und die Stirn dagegen. Blieb vornübergebeugt stehen. Dann trank sie langsam von dem herben Wasser. Sah, wie es durch die Löcher verschwand. Das moorhaltige Wasser hatte ekelhafte braune Flecken in dem emaillierten Becken hinterlassen. Ein ewiger Schlund nach unten. Der alles, was sie nicht schlucken konnte, hinaus ins Meer schickte.
Als sie den Hahn zudrehte, floss sie fort. Hielt sich an der widerlichen Gummikante des Beckens fest. Aber das nützte nichts. Sie wurde in den Schlund gezogen. Dicke schwarze Tropfen trafen sie in den Nacken und drückten sie hinunter. Schließlich lag sie am Rand eines der Löcher und konnte sich nicht mehr festhalten. Die Rohre waren viel weiter, als sie gedacht hatte. Sie fiel und fiel. Schwerelos wie eine Schneeflocke. Es war feucht und warm in der Kloake. Beinahe sicher. Sie ließ sich los. War gewiss auf dem Weg zum Meer. Es spielte irgendwie keine Rolle mehr. Sie fiel und floss.
Der Raum zeichnete sich ab, als sie in der Türöffnung stand. Die Fensterkreuze teilten den Fußboden in acht graue Vierecke, obwohl die Vorhänge zugezogen waren. Es war fast dunkel hier drinnen. Nur die Lichter von der Straße drangen durch die verschneiten Fenster. Sie öffnete die Ofentür, bevor sie das Licht einschaltete. Es war noch Glut im Ofen. Keine Spur von der blutigen Wachstuchdecke.
Tora begriff, dass sie sich mit den Dingen anfreunden musste, um alles zuzudecken. Sie hatte sich bei dem Ausguss mit einem Geschmack nach Blei und Kloake im Mund wiedergefunden. Es war noch nicht Schluss.
Sie tastete nach dem Schalter neben der Tür. Kaltes Licht flammte auf. Wie ein Urteil. Blutflecken auf dem Boden? Sie hatte doch geputzt, ehe sie weggegangen war. Warum hatte sie sie nicht gesehen? Sie kamen ihr entgegen. Direkt vom Boden herauf. Saugten sich fest in den Augen, so dass sie wie geblendet war. Sie fand draußen im Gang einen Putzlappen und wischte die Flecken weg. Spülte den Putzlappen in dem eiskalten Wasser im Ausguss gut aus und hängte ihn wieder auf. Niemand sollte merken, dass sie ihn benutzt hatte.
Dann zog sie vorsichtig die Jalousien herunter. Der Raum wurde gelb, wie gewöhnlich. Es war jedes Mal so, wenn sie die Jalousien herunterzog. Jetzt fand sie einen gewissen Trost darin.
Sie schloss die Tür zu und zog sich langsam aus. Die Mütze und der Schal, die sie sich in den Schritt gelegt hatte, zeigten alle nur möglichen Schattierungen in Rot. Sie stand zögernd damit vor der offenen Ofentür. Dann legte sie sie schnell in die Flammen. Das Feuer kam gleichsam aus dem Ofen heraus und über sie. Brannte ihr im Gesicht, wurde in ihren Kopf hineingesaugt. Der Kopf weitete sich zu einem Ballon und schwamm im Zimmer herum, mit allem in sich.
Und alles war in dem gelben Licht. Das sich immer im Kreis bewegte.
Tora legte sich ins Bett und dachte an Frau Karlsens Mann, der tot war. Er lag steif und still in dem Altersheim, in dem er mehrere Jahre gewohnt hatte. Er hätte der alte Vater von Frau Karlsen sein können, dachte Tora. Oder – vielleicht war es das offene Grab, das sie so erschreckt hatte, dass sie nicht gewagt hatte, die Leiter hinunterzusteigen und das kleine Loch zu graben, um das Bündel zu verstecken?
Das Bündel? Das Vogeljunge? Das aus ihr herausgeglitten war, als sie auf der Wachstuchdecke vor dem Bett lag und sich in Stücke reißen ließ. Aber das Bett hatte sie gerettet. Es war genauso sauber und ordentlich, wie es immer gewesen war. Und die alte Wachstuchdecke existierte nicht mehr. Die Flammen hatten sie verzehrt. Sie hatte im Bauch des Ofens gejammert, lange.
Das Grab – oder Frau Karlsens Mann – hatte sie gezwungen, das kleine Bündel in die Geröllhalde zu legen und Steine darüber zu rollen. Und sie hatte vergessen, die Leiter wieder an ihren Platz zu hängen! Hatte solche Angst vor dem offenen Grab gehabt.
Der Totengräber von Breiland watete bis zu den Waden im nassen Schnee und sah so aus, als ob er wenig von den Sommerplänen des Herrn begriff. Vermutlich hatte er Regen erwartet, denn er hatte das frisch ausgehobene Direktoren-Grab nicht zugedeckt. Und jetzt konnte man sich gut vorstellen, dass der Schnee da unten in der Tiefe einen ruhigen Platz gefunden hatte. Ansonsten hatten sich die Leute angestrengt, an diesem verflixt kalten Ende eines langen Winters am Leben zu bleiben.
So eine Idee konnte auch nur ein Totengräber an einem solchen Außenposten haben, dass nämlich der Frühling zeitig kommen würde. Aber das Leben war nicht immer einfach. Er blieb stehen und betrachtete die alten Haken an der weißen Wand des Geräteschuppens. Leer. Die Leiter war weg! So weit entfernt von Haus und Hof brauchte doch wohl kein Mensch eine Leiter?
Der Totengräber starrte den Neuschnee an, als ob er glaubte, dass die Leiter über den Boden geflogen sei, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er war kein ängstlicher Mann – bei Tageslicht. Und so viel wussten alle: dass es einer Leiter unmöglich war, sich von allein zu bewegen! Er wischte sich übers Kinn und schüttelte seinen wuchtigen, windgepeitschten Körper. Eine Bewegung, die eine Art verwirrte Einsamkeit widerspiegelte.
Dann ließ er den Blick über den Friedhof schweifen. Als ob er den Wind für den Entführer hielte. Blinzelnde Augen in dem leicht nebligen Licht. Zögernd ging er zu dem offenen Grab, als sein Fuß auf einmal gegen etwas Hartes und Unfreundliches stieß, das ihn beinahe zu Fall gebracht hätte. Er heftete schließlich den Blick auf die quadratischen Erhöhungen unter ihm im Neuschnee. Die Leiter. Er trat dagegen, so dass die Eiskruste abfiel und das weiße Holz zum Vorschein kam. Er lud sich die Leiter auf die Schulter und schielte stirnrunzelnd in das Grab, als ob er zu sich selbst sagte: »Dieser Bursche geht da nicht hinunter, und wenn es bis zum Rand hinauf schneit. Es bleibt allemal Platz für einen abgemagerten Alten und seinen Sarg.«
Der Totengräber hängte die Leiter an ihren Platz und schob sich einen Priem unter die Oberlippe. Dann trottete er zum Gemeindehaus und in die Kaffeestube. Die Männer bekamen die Geschichte von der Leiter erzählt. Sie wechselten Blicke und sagten nichts. Sie hatten schon häufiger vom Totengräber Gespenstergeschichten gehört. Wussten, wie sehr sie ihn durch höhnische Worte verletzen konnten, deshalb schwiegen sie. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, um einen windschiefen alten Totengräber zu demütigen. Zwei Zwangsauktionen standen bevor, außerdem waren Milch und Butter teurer geworden. Zehn Öre pro Liter und eine Krone und fünfundzwanzig Öre pro Kilo.
Von nun an würde er sein Brot ohne Butter und Milch herunterwürgen müssen, bei dem Lohn, den so ein armer Kerl bekam. Allein davon konnte man schon eine Gänsehaut kriegen.
2
Die Geräusche kamen durch Schichten von Wirklichkeit zu ihr. Ein Klopfgeräusch? Der Schmerz einer verrenkten Schulter. Schaler Geschmack von altem Durst. Ein Gefühl, dass jemand sie anfasste. Oder die Tür?
Tora schlug die Augen auf. Die Türklinke bewegte sich langsam nach unten und wieder rauf. Dann stand sie still, und ein vorsichtiges Klopfen erfüllte ihren Kopf mit einem ohrenbetäubenden Lärm.
Sie versuchte sich umzusehen. Die offene Ofentür, aus der keine Wärme mehr kam. Der muffige Geruch. Die Steppdecke halb unter dem Bett. Der Flickenteppich. Wo war der Flickenteppich?
»Biste zu Haus, Tora?«
Die Stimme war deutlich. Als ob sie aus ihr selbst käme.
Sie holte tief Luft, während sie versuchte, die Zunge zu bewegen und das Gehirn zum Funktionieren zu bringen. Aber es ging nicht. Die Stille lag wie eine Mauer zwischen der Tür und ihr.
»Ich hab dir was zu essen gemacht, wenn du überhaupt was magst.«
Frau Karlsens Stimme hallte wie ein vorwurfsvolles Echo aus allen Ecken wider.
»Es geht mir nicht gut, wissen Sie …«
Ihre Stimme trug. Erstaunlich. Sie kroch über den Boden und legte sich Frau Karlsen zu Füßen. Demütig.
Die Klinke bewegte sich wieder nach unten.
»Willste nicht aufschließen, damit ich nach dir sehen kann? Haste Fieber?«
»Nein, ich möcht mich nur ein kleines bisschen ausruhn.«
»Ja, aber willste nicht, dass ich dir was zu essen bring?«
»Nein, ich hab keinen Hunger … Vielen Dank!«
»Na gut.«
Die Stimme auf dem Flur wurde verschlossen und mürrisch. Aber sie nahm die ganze Frau Karlsen die Treppe mit hinunter. Die Stille tat so gut. So gut.
Sie öffnete mit Mühe das vereiste Fenster und atmete den Abend in langen Zügen ein.
Die Bewegungen waren langsam und lautlos.
Am nächsten Morgen ließ sie Frau Karlsen zu sich herein.
Frau Karlsen stand mit dem Tablett in den Händen in der offenen Tür und war ein Mensch. Nicht mehr und nicht weniger.
»Du bist krank«, stellte Frau Karlsen ohne zu zögern fest. Die Stimme war trocken und sicher und ohne Misstrauen. Tora konnte aufatmen. Kaffeeduft und Frühstück. Frau Karlsen hatte den Kaffeekessel unten aus der Küche mitgebracht und ließ ihn auf einem dicken schwarz-rot karierten Topflappen neben dem Bett stehen. Sie hätte gerne mit Tora zusammen Kaffee getrunken, aber es war so viel zu tun.
Außerdem hatte sie ein wenig Angst, sich anzustecken. Ja, Tora solle das nicht missverstehen, aber sie könne sich bei der Beerdigung doch nicht krank ins Bett legen.
»Du hast ’nen Brief bekommen. Und ich hab auch die Zeitung mitgebracht«, sagte sie und las mit feierlicher Stimme vor: »Mordtragödie in Hollywood. Die vierzehnjährige Cheryl erstach den Gangster, der das Leben ihrer Mutter Lana Turner bedrohte! Fürchterlich, was die Jugend in Hollywood alles anstellt. Ja, sie ist nicht viel jünger als du. Du kannst froh sein, dass du in friedlicheren Verhältnissen lebst. Das muss ich schon sagen.«
Am Rand des Tabletts lag Ingrids Brief.
»Haste Fieber? Das kommt davon, dass du immer halbnackt gehst. Auch wenn man jung ist, kann man doch nicht nackt draußen rumlaufen. Es ist noch nicht Frühling, das weißte doch. Es ist eiskalt. Bleib nur ruhig liegen! Du gehst heut auch nicht in die Schule! Ich werd anrufen und sagen, dass du krank bist!«, erklärte sie schon in der Tür – und war weg.
Ingrid lag in dem Brief. Tora konnte heute ihre Worte nicht ertragen.
Mit jedem Mundvoll Brot und Käse wurde eine zarte Freude in ihr entfacht. Alles fügte sich zusammen, bis sie auf das Kissen sank und es wagte, sich selbst zu berühren.
Im Laufe des Vormittags musste sie mehrmals aus dem Bett, weil ihre Brüste zu zerspringen drohten. Sie flossen über, so dass sie ein Handtuch auflegen musste. Einmal sah sie sich in dem Spiegel im Treppenhaus: eine unbeholfene, lächerliche Gestalt mit ausgestopfter Brust unter dem Nachthemd. Sie ähnelte Ole in Været, als er sich beim Schulabschluss in irgendeinem Sketch in dem großgeblümten Kleid seiner Mutter als Frau ausgestopft hatte. Sie wünschte sich so sehr, dass sie es nicht sei, die da stand, damit sie hätte lachen können. Lachen – viel und laut.
Einmal war sie auf der Toilette und glaubte zu weinen. Ihre Brüste fühlten sich wund an. Sie versuchte, selbst zu saugen. Aber sie kam nicht dran. Sie drückte vorsichtig, damit die Milch herauslaufen sollte. Manchmal tauchte das Bild des kleinen Wesens vor ihr auf.
Es war fast nicht auszuhalten.
Bei Frau Karlsen unten klappten ab und zu die Türen. Sie stellten sicher Möbel um. Einmal rief sie zu ihr herauf, wie es gehe. Und Tora holte tief Luft und antwortete. Es gehe gut.
Frau Karlsen kam nicht oft. Trotzdem war es eine Erleichterung, als Tora endlich das bekannte Geräusch vernahm, das ihr sagte, dass Frau Karlsen die Haustür abschloss und zu Bett ging.
Da erst konnte Tora den Schlaf zu sich hereinlassen. Ihr Kopf war den ganzen Nachmittag eine schmerzende Eiterbeule gewesen. Sie hatte sich mit Mühe durch das Zimmer geschleppt, um alle Details nachzuprüfen, das Ganze mit den Augen zu ordnen – bis Frau Karlsen das nächste Mal erschien. Sie überlegte, ob sie nachts die Tür zuschließen sollte. Was würde Frau Karlsen sagen, wenn sie mit dem Frühstückstablett kam, ehe sie zur Bank ging? Aber sie musste. Ertrug es nicht, dass einfach jemand kam und sie sah. Die Decke könnte heruntergerutscht sein, so dass die Milchflecken von der überquellenden Brust sichtbar würden. Sie könnte ein Detail übersehen haben, das Frau Karlsen dann auffallen würde.
Nachts nähten Randi und sie die Lappen des Bettüberwurfs zusammen, den Randi ihr geschenkt hatte. Alle Nähte waren aufgegangen. Randi tröstete sie und meinte, sie würden es schon wieder hinkriegen, aber Tora war so beschämt, dass sie Randi kaum anzusehen wagte. Und während sie so saßen, kam Onkel Simon mit einem dicken Seil, band sie zusammen und lachte gutmütig. Trotzdem stimmte etwas nicht, und als sie an sich hinuntersah, war das Tau aus gedrehter Haut gemacht und fühlte sich kalt und tot an den Armen an. Ein Netz von Blutadern wuchs aus dem Tau in ihren Kopf hinein. Aber die anderen merkten nichts. Schließlich konnte sie keinen einzigen Lappen mehr annähen. Die Arme waren wie gelähmt.
Tora wurde wach und machte Licht.
Sie schlug die Decke zur Seite und sah an sich hinunter.
Es war vier Uhr.
Sie zwang die Füße, bis zum Schrank zu gehen, und holte die Strickdecke heraus. Die Blutflecken waren wie getrocknete dunkle Schollen in dem vielen Rot. Als ob die Decke schon immer dazu bestimmt gewesen wäre, ein schmuddeliges Vogeljunges einzuhüllen. Tora wickelte sich in die Decke. Steckte die Füße in die Filzpantoffeln und setzte sich an den Tisch.
Die Hand fuhr mechanisch zum Schalter und knipste die Schreibtischlampe an. Ein Buch nach dem anderen landete auf der Tischplatte.
Dann fing sie an, englische Vokabeln zu lernen.
Die Beerdigungsgäste brachten eine unwahrscheinliche Habgier mit ins Haus. Die laute, schrille Stimme von Frau Karlsen versuchte gleichsam, die Gäste daran zu hindern, ganz in ihre Seele einzudringen. Aber es nutzte wenig. Sie hatte bestimmt genauso viel Angst vor der Familie ihres Mannes wie Ingrid vor den Rechnungen, die mit der Post kamen. Tora ertappte sich dabei, dass ihr Frau Karlsen leidtat.
Aber die Gäste wurden auch zu einer Bedrohung für Tora. Sie konnten irgendwann im oberen Flur und auf der Toilette auftauchen. Es war besonders eine Frau, die sich wie ein Gespenst bewegte. Lautlos. Das Knirschen ihrer Schritte hörte man erst, ein paar Minuten nachdem sie vorbeigegangen war. Sie öffnete die Schränke im Dachgeschoss, wenn Frau Karlsen zum Einkaufen fort war. Tora hörte, wie sie sich an den Türen bis zu ihrem Zimmer entlangdrückte. Dann wurde es still. Sie sah ihr leuchtendes, bösartiges Auge durch das Schlüsselloch bis zu ihrem Bett.
Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde ihr bewusst, wie wenig sie die Menschen mochte. Das Dachgeschoss hatte ihr allein gehört, außer wenn der Mann, der auf dem Frachtschiff fuhr, für ein oder zwei Tage nach Hause kam. Jetzt wurde es von raschelnden, schwatzenden, murmelnden Wesen in Beschlag genommen – die nur eine Sache im Auge hatten: den alten Karlsen unter die Erde zu bringen und herauszufinden, was er in den Schränken und Schubladen hinterlassen hatte. Die Trauergäste redeten, als ob sie vorhätten, auch Frau Karlsen zu beerdigen. Die Worte strömten durch die Wände direkt in Toras Ohr. Sie hatte das schreckliche Gefühl, dass sie einen Mord planten.
Einer von den Männern redete ununterbrochen davon, dass das Haus keinen Pfifferling wert, das Grundstück aber eine Goldgrube sei. Er hatte eine Stimme wie das auflaufende Wasser unter dem Plumpsklo im Tausendheim. Die Stimme leckte feucht und schlabbernd durch die Wände, so dass Tora sie in ihrem Gesicht spürte, während sie mit geschlossenen Augen dalag. Sie war die ganze Zeit vor lauter Angst in Schweiß gebadet.
Die Geräusche ihrer Körper auf den knackenden Matratzen, das Wasser, das in die Waschschüsseln lief, die Stimmen, die quer durch die Wände bis zu ihr drangen, worüber sie sich nicht im Klaren waren, das Schnarchen, Atmen – alles war ihr so widerlich, dass sie sich am liebsten bei Frau Karlsen ausgeweint hätte, als die abends heraufkam und fragte, wie es mit ihrer Grippe stehe.
Aber natürlich sagte sie nichts davon. Sie verkündete stattdessen mit bleichem Lächeln, dass sie am nächsten Tag in die Schule gehen wolle. Ob Frau Karlsen ihr eine Entschuldigung schreiben könne?
Tora segnete die spitzen Ellenbogen, die aus den schwarzen Kleiderärmeln herausstachen, und den schmalen Mund in dem gequälten Gesicht, als Frau Karlsen eine gehaltvolle Entschuldigung schrieb, die sie ausführlich mit Fieber und Halsschmerzen und Grippe begründete. Und darunter: Stella Karlsen, Zimmerwirtin.
Stella! Was für ein sonderbarer Name. Für eine wie Frau Karlsen! Stella! Hieß so nicht ein Stern? Oder ein Schiff? Das Pferd vom Pastor auf der Insel hieß auch Stella.
»Es ist besser, du gehst morgen nicht mit auf den Friedhof!«
Frau Karlsens Stimme wurde von den Wänden aufgesaugt, und das Gesicht wuchs und wuchs. Tora schüttelte den Kopf und schluckte. Hätte so gerne etwas gesagt – etwas Nettes. Aber es war nicht möglich.
»Es ist zu kalt für dich, wo du gerade krank warst. Aber komm zum Kaffee runter. Um vier!«
Tora schloss die Tür hinter ihr ab und suchte ihre Kleider für den nächsten Tag zusammen. Zögernd zog sie die Jeans an. Der Reißverschluss ging wieder zu! Merkwürdig, dass ein Körper wieder so wurde wie vorher. Sie stand mitten im Zimmer und sah an sich hinunter. Traute sich nicht auf den Flur, um sich im Spiegel zu betrachten. Es könnte doch jemand kommen. Noch zitterte sie ein wenig, wenn sie länger stand. Aber morgen würde es besser sein. Viel besser! Sie versuchte, sich in dem kleinen Spiegel zu betrachten, den sie an der Wand hängen hatte, fühlte sich schwindlig und elend. Aber die Neugier war zu groß. Sie kletterte unsicher auf einen Stuhl und hielt sich an der Wand fest. Der Hose war deutlich anzumerken, dass zuletzt ein anderer Körper sie getragen hatte. Sie schien von jemandem geliehen zu sein, der ein paar Nummern größer trug.
Während sie sich so musterte, ging es ihr auf, dass sie – abgesehen von den laufenden und schmerzenden Brüsten und den Blutungen – ungeschoren davongekommen war.
Konnte sie es wagen, daran zu glauben? Sie drehte sich ein bisschen, um ihren eingesunkenen Hosenbund auch von der Seite sehen zu können. Sie kletterte vom Stuhl herunter und sank mit den Jeans ins Bett. Die Augen liefen über. Ein Strom der Erleichterung.
Aber das kalte, tote Bündel im Geröll?
»Was für ein Bündel?«
Weit draußen auf dem Fjord glitt das Tauwetter heran. Nasskalt und lauernd und ohne eine andere Hoffnung, als dass es ein fremder Frühling aus dem Süden war.
3
Tora ging nach der Schule in den Supermarkt und kaufte zwei Pakete Binden. Sie steckte sie schnell in das Plastiknetz zu den Schulbüchern. Erst als sie auf dem Weg nach draußen war, fiel ihr ein, dass sie sich etwas zu essen hätte kaufen sollen. Aber sie konnte einfach nicht noch einmal hineingehen. Es roch da drinnen so stark nach Fleisch.
Den ganzen Tag hatte sie durch die Menschen hindurchgesehen. Sie lösten sich vor ihr auf.
Jeder hatte seinen Lichtschimmer. Meistens in bläulichen Nuancen. Aber auch in roten und gelben. Besonders um die Köpfe. Das machte sie unnahbar und unwirklich. Tora hielt sie von sich fern. Einmal strich Jon im Korridor an ihr vorbei. Er hatte ein weißes Licht um sich. Sie fühlte sich verschwitzt und schmutzig. Er hob eine Hand, als ob er sie anfassen wollte. Sie floh hinter die Toilettentür.
Sie fühlte wieder so etwas wie Einsamkeit. Saß dort, bis es zur Stunde schellte.
Alle standen in Gruppen oder zu zweit da. Ein paarmal streifte sie der Gedanke, dass sie nur in irgendeinen Kreis hineinzugehen und so zu tun brauchte, als ob sie dazugehörte. Aber es wurde nichts daraus.
In den beiden ersten Stunden war es ganz gut gegangen. Sie hatte die Entschuldigung abgeliefert. Die Pausen waren schlimmer. Meistens hielt sie sich auf der Toilette auf. Hoffte, der aufsichtführende Lehrer würde nicht merken, dass sie immer von dort kam, wenn es klingelte.
Frau Ring, die sie in Englisch hatten, kommentierte laut, dass sie noch nicht gesund aussehe. Ob sie nicht zu früh aufgestanden sei? Und das Licht um Frau Rings Kopf explodierte. Frau Ring fragte vorsichtig, ob sie Aufgaben gemacht habe, ob jemand mit den Aufgaben bei ihr gewesen sei.
Tora räusperte sich und sagte, dass sie ab den Aufgaben für Samstag drei Seiten weiter gelernt habe. Sie wurde starke Verben abgefragt. Konnte antworten. War froh, dass sie irgendwie mit dabei war.
»Danke!«, sagte Frau Ring und machte hinter Toras Namen ein Zeichen.
Die Wände beugten sich über Tora. Lange. Als sie aufsah, war sie nicht mehr im Kreis. Ihre Minute war vorüber. Alle Blicke hafteten an dem, der jetzt abgefragt wurde.
Da entdeckte sie es: dass die Telefondrähte, die von der Hauswand zu dem Pfosten bei der Eingangspforte führten, voller Spatzen waren. Spatzen! Winzig kleine Vögel, die zurückgekommen waren. Warum? Wozu kamen sie? Wussten sie nicht, was für ein Leben Vogeljunge heutzutage zu erwarten hatten? Und das Licht um Frau Rings Kopf wurde zu einem kleinen roten Nest aus Handtüchern, in dem ein bläulicher kleiner Vogel saß. Er pfiff ein bisschen heiser. Als ob er nicht genug Luft bekäme.
Tora dachte nicht an die englischen Verben.
Die Stimmen kamen und gingen, sie sah die Münder sich wie in einer Welle bewegen. Sie fing bei Frau Ring an und pflanzte sich durch die ganze Klasse fort. Aber sie konnte nicht hören, was gesagt wurde. Sie dachte an Frits. Er hörte auch nichts. Zum ersten Mal verstand sie, wie das war. Die Kugellampen schwankten leicht über ihrem Kopf. Im Takt, als ob jemand sie in Bewegung gesetzt hätte. Anne drehte sich zu ihr um, öffnete den Mund, und es wogte und wogte. Und es galt nicht ihr. Sie hatten alle ihr Licht, ihre Wellen.
Es war die letzte Stunde. Die Augen: Sandpapier auf einer Wunde. Sie trödelte lange, nachdem es geklingelt hatte. Wartete, bis alle gegangen waren. Als sie nach draußen an die Luft kam, hatte sie das Gefühl, tagelang die Treppen im Tausendheim geputzt zu haben, während die Haustür zu dem eiskalten Schnee hin offen stand, und hinter jeder Schmutzspur, die sie weggeputzt hatte, wurde neuer Schmutz gemacht.
Sie war in ihr Zimmer gegangen, hatte sich angezogen hingelegt und war eingeschlafen. Um vier Uhr kam Frau Karlsen in einem neuen schwarzen Kleid herauf und lud sie zum Kaffee ein. Tora hatte die Tür nicht abgeschlossen. Sie schaute schnell an sich hinunter, wie es ihr zur Gewohnheit geworden war, bevor sie Frau Karlsen bat hereinzukommen. Ob sie noch nicht gesund sei? Frau Karlsens Stimme klang aufgesetzt teilnahmsvoll. Ob sie ein paar Schnittchen nach oben haben wolle? Tora zwang sich zu antworten. Sie setzte sich auf und klagte, dass sie sich noch ziemlich elend fühle. Frau Karlsen möge bitte entschuldigen, aber sie könne nicht nach unten kommen …
Eine fremde Frau mit einem harten, stechenden Blick kam mit einem Tablett. Sie war in Schwarz, wie Frau Karlsen, und trug um beide Handgelenke schwere Armbänder. Sie sagte »Bitte« und »Lass dir’s gut schmecken« und versuchte ein paar Worte mit Tora zu wechseln, während ihre Augen wie Motten umherschwirrten – Tora erkannte ihre Stimme wieder. Sie hatte sie durch die Wand gehört. Sie glich einer der bösen Gestalten aus Alice im Wunderland. Oder war sie eine der Figuren, die auf den Spielkarten abgebildet waren?
Tora aß.
Noch hatte sie Ingrids Brief nicht geöffnet. Sie fasste den Entschluss, nie mehr auf die Insel zurückzukehren. Kaute die sorgfältig zurechtgeschnittenen Brote und dachte immer wieder daran.
Dann setzte sie sich an den Tisch und holte die Bücher hervor. Brauchte viel Zeit. Es flimmerte und barst vor ihren Augen. Ingrids Brief wuchs aus der Tischschublade und klebte sich an alles, was sie in die Hand nahm. Schließlich zog sie ihn langsam heraus und schlitzte ihn mit einer Stricknadel auf.
Ingrid schrieb vom Wetter. Vom Ausbleiben der Fische, so dass sie ohne Verdienst sei und Tora ein wenig auf das Geld warten müsse, das sie zum Leben brauche. Eine Woche? Die Buchstaben kamen ihr entgegen wie einsame blaue Spuren im Schnee. Kreisten um ihre Arme. Sie baten Tora zu sparen, so dass sie jedenfalls Ostern nach Hause kommen könne. Die Buchstaben schwebten um ihre schmerzenden Schultern, die sie bis zu den Ohren hinaufgezogen hatte. Sie musste den Kopf schützen. Warum las sie diesen Brief? Er hatte nichts mit ihr zu tun. Sie konnte und wollte diese Ingrid nicht erreichen.
Tora wechselte die Binde und lernte Geschichte.
Gegen Abend stiegen sie in Grüppchen die Treppe herauf, klapperten mit den Kofferdeckeln und raschelten in ihren Zimmern mit irgendwelchen Sachen. Sie war sich nicht ganz sicher, wie Frau Karlsen alles überstanden hatte. Sie hörte sie nicht, zunächst. Ein ungutes Gefühl beschlich Tora. Trugen sie nicht schwere Gegenstände durch die Halle? Schleppten sie nicht etwas hinter sich her? Überall war Durcheinander, und endlich hörte Tora Frau Karlsens erregte Stimme, die »gute Fahrt« wünschte. Dann fiel die Haustür ins Schloss, und die letzten Gäste verschwanden wie unwillige Krebse die Treppe hinunter und in ihren Autos. Kurz darauf hörte sie jemanden pfeifen, Love me tender, love me true. Es war Frau Karlsen.
Sie stand auf dem Gipfel des Veten und stürzte den Berg hinunter. Sie sah sich selbst in der Geröllhalde liegen. Nein, es war Almar! Ganz zerschlagen. Sie näherte sich ihm sehr schnell, und gerade als sie auf die großen grauen Steine stieß, sah sie das Vogeljunge. Jemand hatte es ausgegraben.
Sie kämpfte eine Weile mit der Decke, ehe sie ganz wach wurde. Dann ging sie zum Fenster, das nur einen Spaltbreit offen war, und öffnete es weit gegen die dunkle Nacht. Die Luft kam wie ein Schmerz auf sie zu. Eine Erinnerung an etwas, das sie früher empfunden hatte.
Allmählich wurde sie ruhig. Und die Wiese mit den Gänseblümchen wuchs vertrauensvoll bis hinauf an das Fensterbrett der ersten Etage. Sie nahm deutlich den Geruch wahr. Es tropfte gleichmäßig aus der Dachrinne.
Als sie sich wieder zum Raum umdrehte, sah sie direkt auf die Wand über dem Bett. Das abscheuliche Gemälde von dem Schiff im Sturm. Düstere Farben. Hässlich mit der polierten, verschönernden Gischt. Sie war augenblicklich beim Bett, nahm das Bild von der Wand, hielt es einen Moment vor dem Fenster hoch, bereit, es hinauszuwerfen. Sie stand ratlos vor dem offenen Fenster, das Gemälde über den Kopf haltend.
Es wurde ihr schwindlig vor Anstrengung. Die Arme sanken herunter.
Sie stellte das Bild mit der Vorderseite zur Wand draußen im Gang neben die Tür.
Sie hätte nach dem Vogeljungen in der Geröllhalde sehen sollen, aber es ging nicht. Denn da hätte sie alle Blumen zertreten müssen. Dass jemand das kleine Grab gefunden hatte, war wohl unmöglich. Der Löffel hatte gründliche Arbeit geleistet. Jedes Mal, wenn sie auf den Löffel schaute, der in der Schublade lag, war sie ihrer Sache sicher. Das Vogeljunge war gut verborgen. Niemand sollte es schänden können. Jedes Mal, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit durch den Himmel fiel und das offene kleine Grab sah, gelang es ihr, sich zu wecken, ehe es zu spät war.
Der Himmel war überall so offen. Das war ihr unangenehm. Die Luft war so klar. Alles war durchsichtig und lastete wie ein Druck auf ihr. Jede Nacht jagte sie über den Himmel und hinunter auf die Geröllhalde. Jede Nacht endete sie vor dem offenen Fenster. Der Abfluss war so groß. Während sie dahinraste, spürte sie den Wind auf der Haut. Im Gesicht. War leer wie ein flatterndes Kopfkissen auf der Leine im Wind.
Sie stand in Frau Karlsens Badewanne. Das Wasser strömte an ihr herunter. Warmes Wasser. Ihr schwindelte in endlosen Augenblicken.
Langsam seifte sie sich ein. Die Haare. Den Körper. Spülte sich ab und seifte sich erneut ein. Es war schon lange her, dass sie etwas als so wohltuend empfunden hatte. Man konnte sich darin ausruhen. Die Muskeln und die Haut bekamen wieder Leben. Unter dem Wasserstrahl. Sie wärmte sich. Erfrischte sich. Sie war sie selbst, so wie sie es vorher nie gewesen war.
Ein paarmal spürte sie den Boden unter sich weichen, wenn sie in das Loch sah, durch welches das Seifenwasser mächtig schäumend und ruckweise in den Abfluss gesaugt wurde. Rosa. Sie konnte sich nicht an das viele Blut gewöhnen. Einmal musste doch Schluss sein. Sie sollte sich doch wohl nicht zu Tode bluten.
Seifengeruch. Sie spülte die Haare, die sich spröde und sauber anfühlten, wenn sie mit den Fingern durchfuhr. Der Dampf stand wie eine Wolke vor dem kleinen halboffenen Fenster hoch oben an der Wand. Der Plastikvorhang mit seinen grellen violetten Blumen hing steif herunter. Alles war fremd, aber schön. Sie hatte das Gefühl, es vorher nie gesehen zu haben.
Sie trocknete sich sorgfältig ab. Zog frische Wäsche an. Ließ das weite Hemd über den Jeans hängen. Hatte eine richtige Binde im Schritt, als ob sie ganz normal ihre Tage hätte.
Sie riss das Fenster wegen des Dampfes weit auf, wagte aber nicht, die Tür zur Küche zu öffnen. Frau Karlsen war nur einkaufen gegangen, sie konnte jederzeit zurückkommen. Tora hatte die Erlaubnis zu baden. Trotzdem durfte Frau Karlsen sie nicht im Bad sehen. Es half auch nichts, dass sie angezogen war. Die Spuren könnten sie verraten. Unerwartet. Katastrophal. Nur ein winzig kleines Detail.
Das Mädchen von der Insel spürte die Blicke im Nacken – auf dem Schulhof, in den Fluren oder auf der Straße. Sie war nie gesprächig gewesen. Aber jetzt schien sie die Sprache vollkommen verloren zu haben. Nur wenn sie die Aufgaben abgefragt wurde, brachte sie eine Art an sich selbst gerichtetes Flüstern zustande. Eine Stimme, die so wenig benutzt wurde, dass sie immer von neuem versuchen musste, einen Klang zu finden. Die Sätze kamen direkt aus dem Buch, durch das Mädchen hindurch und in den Raum. Es war, als ob ein Tonbandgerät in ihrem Magen säße. Aber im Übrigen konnte man von ihr nichts hören.
Vor allem Anne versuchte, Kontakt zu ihr zu bekommen. Ob sie ins Kino gehen wollten? Ins Café? Tora hatte tausend Entschuldigungen. Man kam nicht an sie heran. Seit sie damals im Herbst ohnmächtig geworden war, war in den Augen der anderen etwas Geheimnisvolles an ihr hängen geblieben. Sie sprach nie über sich selbst. Die anderen wussten kaum, wo sie wohnte. Sie war glatt wie ein Aal. Saß an ihrem Tisch. Ging in den Pausen hinaus. Erhob sich auf Kommando wie ein Soldat und leierte ihre Aufgaben herunter. Schrieb, was ihr diktiert wurde. Alles gleichermaßen ausdruckslos, wie ein Roboter.
4
Ingrid wartete auf Post von Tora. Schließlich wusste sie sich keinen anderen Rat mehr, als nach Bekkejordet zu gehen und Simon und Rakel zu fragen, ob sie das Telefon benutzen dürfe.
Nach Worten suchend, erklärte sie, dass sie Ingrid Toste sei. Toras Mutter. Ob Tora krank sei, weil sie nicht schreibe.
Frau Karlsen zeigte freundliche Teilnahme. Ja, Tora habe eine unangenehme Grippe gehabt und im Bett gelegen, aber das sei schon eine Woche her. Die Schulaufgaben hätten sie wohl am Schreiben gehindert. Sie sei immer zu Hause, immer ruhig und ordentlich. Ja, die beste Untermieterin, die sie je gehabt habe. Es sei schön, einen Menschen im Haus zu haben, wenn man Witwe geworden sei. Sie habe ja viele Jahre allein gelebt, natürlich, weil der Mann krank und bettlägerig und im Altersheim gewesen sei. Und das sei gutgegangen. Aber es sei doch etwas anderes, zu wissen, dass man allein war. Ingrid machte vorsichtig, aber entschieden Schluss und legte auf.
»Was hat sie gesagt?«, fragte Rakel und sah die Schwester fragend an.
»Dass sie Witwe geworden ist.«
»Witwe?«
»Ja, Frau Karlsen. Aber die Tora war nicht da. Sie lernt sicher so viel, dass sie keine Zeit zum Schreiben hat … Sie hat die Grippe gehabt …«
»Aber hat sie dir nicht gesagt, wann die Tora nach Haus kommt?«
»Ich hab vergessen zu fragen. Sie hat so viel geredet. Ich hab direkt Kopfschmerzen davon.«
Rakel lachte und schenkte noch mehr Kaffee ein. »Ja, ja, nun kommt sie Ostern wohl, du wirst schon sehn.«
Ingrid schaute auf die Tischdecke. »Ich glaub fast, dass sie nicht kommt!«
»Warum sollte sie denn nicht kommen?«
»Sie ist seit Weihnachten nicht mehr zu Haus gewesen. Ja, sie hat natürlich auch nicht genug Geld, um zu fahren. Geld hat sie von mir nicht grad viel bekommen.«
»Liebe Ingrid, da hätt sie ja wohl schreiben können, wenn sie blank ist.«
»Nein, die Tora nich.«
»Soll ich ihr denn ’n paar Kronen schicken?«
»Nein, was ich ihr geschickt hab, reicht bestimmt bis Ostern.«
Rakel fasste Ingrid am Arm. »Aber da haste doch getan, was du konntest. Und wenn sie nur Geld bis Ostern hat, dann muss sie ja nach Haus kommen.«
»Sie schreibt ja auch nicht.«
»Vielleicht hat sie sich verliebt.«
»Die Wirtin hat gesagt, dass sie nie fortgeht. Ich bin ganz unruhig deswegen. Ich denk überhaupt an nichts andres mehr, als was die Tora macht.«
»Das versteh ich gut.«
Wie so oft, wenn sie zusammensaßen und redeten, hielt Ingrid den Blick gesenkt. Es irritierte Rakel auch diesmal. Aber sie ließ es sich nicht anmerken. Ingrid hatte ihre Gründe.
Und Rakels Kümmernisse wurden dagegen zu einer Bagatelle. Wirklich kein Grund, sich wichtig zu machen. Das Geschäft blühte in dieser Saison wie noch nie. Den Schafen ging es gut im Stall, und der Frühling und der Almauftrieb standen bereits vor der Tür.
Rakel hatte weniger Schmerzen. Sie wusste wohl, dass das Übel noch da saß. Aber die Ärzte hatten ihr Leben und Gesundheit so gut wie versprochen. Sie reiste immer wieder zur Behandlung nach Oslo. Hatte sich schon fast ans Reisen gewöhnt.
Sie stellte sich vor, es sei eine Ferientour. Versuchte, nicht daran zu denken, dass sie ins Krankenhaus musste, zu Bestrahlung und Untersuchungen, Proben. Übernachtete in Bodø im Hotel, bevor sie das Flugzeug nach Süden nahm. Ging in Geschäfte. Ins Kino. Hatte in sich einen versiegelten Raum, in dem sie alles versteckte, was ekelhaft und krank war. Aber jedes Mal, wenn sie in den breiten Türen des Krankenhauses stand, war die Gerichtsverhandlung im Gange.
Auf dem Heimweg graute ihr bereits vor der nächsten Tour. Die Sehnsucht nach Simon war ein Garten voller Früchte, von denen sie nicht zu essen wagte. Sie schien sich einzubilden, dass sie dafür bestraft würde. Deshalb kaufte sie sich etwas zum Anziehen, statt ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Satinblusen. Moderne Faltenröcke mit glattem Hüftteil. Alle Arten von Schuhen. Je mehr Warnungen sie über die Krankheit bekam, umso mehr suchte sie Zuflucht in diesen Nichtigkeiten. Sie war sich selbst klar darüber. Lächelte bitter über ihr eigenes Verhalten.
Aber wenn sie Ingrids Sorgen sah, ihre Plackerei, damit es vorne und hinten reichte, wurden ihre eigenen Kümmernisse so klein.
Sie wünschte, sich in Ingrids Schoß ausweinen und Erleichterung finden zu können. Aber das war unmöglich. Ingrid würde auch das noch auf sich nehmen und Rakels Krebs der langen Kette von Schicksalsschlägen hinzufügen, die sie jeden Tag im Tausendheim in sich verschloss. Hätte Ingrid doch etwas mehr Fähigkeit zur Freude gehabt!
»Soll ich mal nachhören, wie es ihr geht? In der Schule anrufen?«, fragte sie vorsichtig.
»Nein«, sagte Ingrid müde.
»Ich find, du solltest das hier nicht so schwernehmen. Du wirst schon sehn, da ist irgendein Grund. Mach dir doch nicht solche Sorgen. Davon wird’s auch nicht besser.«
»Du hast gut reden«, murmelte Ingrid. Sie zog sich den verschlissenen Mantel an. »Du hast kein Kind, an das du denken musst.«
»Nein, da haste recht, Ingrid«, sagte Rakel mit flammenden Wangen.
Es erstaunte sie jedes Mal, wenn Ingrid sie verletzte. Es war jedes Mal der gleiche Schock. Sie glaubte immer, es sei unmöglich, so etwas von Ingrid gesagt zu bekommen. Aber sie konnte ihr nicht widersprechen. Konnte es nicht, weil sie überzeugt war, dass die andere gar nicht ahnte, was sie Schlimmes gesagt hatte. Manche Menschen merkten nie, dass sie eine tödliche Lawine auslösen konnten.
Und Rakel, die sonst über alles ungeniert redete, sank in sich zusammen und verbarg ihre Wunden vor ihrer einzigen Schwester.
Rakel legte den Napfkuchen auf einen geblümten Teller mit gebogenem Rand. Sie hielt den Teller gegen das Licht und betrachtete ihn einen Augenblick. Als ob sie ihn auf Katzenhaare oder eine andere Unreinlichkeit hin inspizieren wollte. Dann stellte sie ihn entschlossen ab.
»Der Henrik sagt, das ist der Dank dafür, dass ich sie auf die Schule nach Breiland schick. Es steigt ihr zu Kopf. Zu Haus ist ihr nichts mehr gut genug. Er meint, dass sie schon Weihnachten bockig und trotzig war«, murmelte Ingrid.
»Ach so, der Henrik sagt das.« Rakel grinste nicht einmal.
Ingrid verstand trotzdem die Spitze und senkte den Kopf. Hatte gelernt, den Kopf zu beugen. Das konnte sie am besten.
»Ja, ich weiß, was du vom Henrik hältst. Er trägt in alle Zukunft einen Stempel. Aber du kannst ihm ja wohl gönnen, eine Meinung über die Sache zu haben.«
»Ich gönn dem Henrik alles Gute, meine Liebe. Und ich hab den Henrik bis zum Geht-nicht-mehr verteidigt, ob das nun bei dem Gerichtsverfahren war oder zu Haus, wenn ich mit dem Simon gestritten hab. Jetzt will ich davon nichts mehr hören. Aber ich hab nie gesehn, dass der Henrik sich bemüht hätte, anderen das Leben zu erleichtern. Das muss ich doch mal sagen, wenn wir schon dabei sind.«
»Was meinste?«
»Stell dich nicht so dumm! Hat er jemals auch nur den kleinen Finger gerührt, um für dich oder Tora irgendetwas zu tun? Das weißte wohl. Wie ihr miteinander auskommt, wenn ihr allein seid, das geht mich nichts an … Ich mein nur, du solltest dich von ihm scheiden lassen!«
Sie hatte es ausgesprochen. Ohne Einleitung. Hart. Ohne Umschweife. Der Nachklang war das Schlimmste.
Von Ingrid kam kein Laut.
»Ja! Liebste ihn denn etwa?«
Rakel schrie es heraus wie eine Anklage. Stand da, die Hände in die Seiten gestemmt. Mit halb offenem Mund. Bereit, den nächsten Satz herauszuschleudern. Bereit, Ingrid in Grund und Boden zu reden, wenn sie sich verteidigte. Sie zu überzeugen. Sie von sich selbst zu erlösen. Zum ersten Mal störte sie die schnurrende Katze auf der Torfkiste.
Ingrid legte den Kopf auf den Tisch, schützte ihn mit ihren dünnen Armen, so gut sie konnte.
Rakel betrachtete sich selbst. Sie fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut. Sie schämte sich so, dass ihre Wangen brannten. Wusste nicht, was schwerer wog: ihr eigener Hochmut – oder dass sie ihn dazu benutzt hatte, sich für einen gedankenlosen Satz über ihre Kinderlosigkeit zu rächen. Es ging ihr auf, dass es vielleicht nur wenige gab, die bereit waren, Mensch für andere Menschen zu sein. Dass sie da keine Ausnahme bildete. Aber sie war nicht fähig, die Hand auszustrecken und Ingrid zu berühren. Es war, als ob etwas sie festhielte.
Sie ging zögernd durch den Raum und wischte die Krümel vom Küchenschrank, um Zeit zu gewinnen.
»Kümmer dich nicht um das, was ich sag, Ingrid.«
»Ich weiß nicht, was mit mir los ist, dass ich so wenig aushalte …« Ingrid hielt die Tränen zurück und zog ein Taschentuch hervor.
»Du hast es nicht gut, Ingrid. Du hast zu viel Verantwortung, zu viel Schinderei. Du solltest einen Mann haben, der ’n bisschen auf dich aufpasst, nicht einen, der kritisiert, dass die Tora auf die Schule geht, und der dir das Leben sauer macht.«
»Der Henrik hat’s auch nicht so leicht …«
Rakel hat plötzlich das ekelhafte Gefühl, sich zu langweilen. Sie weiß, dass sie ein paar tröstende Worte finden müsste. Ablenken davon, dass Tora weit weg und Henrik ewig schlechter Laune ist – bis irgendetwas Ingrids Stimmung wieder aufhellt. Aber sie steht einfach da und langweilt sich. Hat das Gefühl, dass sie mit Ingrid nicht wie mit einer Ebenbürtigen reden kann. Weiß nicht, warum sie sich doppelt so alt fühlt, obwohl Ingrid älter ist und viel, viel mehr erlebt hat. Sie hat immer mit Erstaunen festgestellt, dass Ingrid nie etwas aus all dem lernt, durch das sie hindurchmuss. Ingrid wird nur immer tüchtiger bei ihrer Arbeit. Hat keinen Drang zur Auflehnung, keinen Trotz, schluckt Hass und Groll herunter – und lässt sich immer wieder schlagen.
Ingrid raffte den alten Mantel um sich, stand auf und war bei der Tür. Sie sah Rakel mit einem seltsamen Blick an. »Nein, ich muss jetzt machen, dass ich wegkomm, es ist schon spät …«
Ihre Stimme klang wie gewöhnlich.
Rakel blieb stehen.
Sie sah, wie Ingrid die Gartentür öffnete und wieder schloss, ohne ein Auge auf das Haus oder das Küchenfenster zu werfen. Sah sie die Hügel hinuntergehen. Langsam. Stetig. Alles war gesagt.
Nichts war gesagt. Nichts war entschieden.
Kurz bevor Ingrid in dem Wäldchen verschwand, kam Rakel zu sich. Sie riss die Tür zum Windfang auf und ergriff das erste Beste, was sie da draußen fand. Simons Stalljacke. Schlüpfte in ein Paar abgeschnittene Stiefel und stürmte taumelnd auf dem matschigen Weg Ingrid nach. Erreichte sie schnell. Sprang sie von hinten an und hielt sie fest.
»Ich bin einfach schrecklich, Ingrid!«
Ingrid fuhr sich mit steifen Händen über das Gesicht. »Du willst doch nur in allem Ordnung haben. Ordnung …«
Rakel begleitete Ingrid die Hügel hinunter bis zu den ersten Häusern. Da kehrte sie um, weil sie nur die Stalljacke und die abgeschnittenen Stiefel anhatte. Sie zeigte an sich hinunter und lachte. Sie lachten beide ein wenig.
»Ich versuch, mehr über Tora zu erfahren, dann komm ich zu dir runter.«
Ingrid nickte. »Ich bin’s ja nur, die sich aufregt. Du hast ja recht. Was soll denn hier auf der Insel aus Tora werden? Ich bin auch mal von hier geflohn … Danach war’s zu spät. Es ist, als ob alles mich erstickt hätte – und es mir ermöglichte zu leben, ohne zu atmen.«
Sie hob die Hand zum Gruß. Eine schwerelose Bewegung. Ein heimliches Verstehen. Wie damals, als sie junge Mädchen gewesen waren und sich stritten, aber genötigt gewesen waren, wieder Freundinnen zu werden, weil sie nur einander hatten. Gemeinsamen Kummer. Gemeinsame Geheimnisse. Gemeinsame Schrammen und Träume.
Der Schnee war trotz allem zusammengeschrumpft auf den Wiesen und Äckern. Er schmolz am Waldrand und in den Gräben. Aber der Frost biss Rakel in die Ohren.
5
Jeden Tag brach sie eine Scheibe Brot in Stücke und legte sie auf die Fensterbank. Winzig kleine Bissen. Dann setzte sie sich auf einen Hocker und wartete. Die schwarze Krähe. Die schimmernde, glänzende Elster. Sie kamen. Drehten jäh im Flug ab, wenn sie sie sahen. Verstanden, dass sie Wache hielt. Dass die Bröckchen nicht für sie waren. Es war nicht deren Junges, das sie in die Geröllhalde gelegt hatte.
Oh nein, wirklich nicht. Sie wussten sicher, mit wem sie die Bröckchen teilen wollte.
Sie zog langsam das Gummi von ihrem Pferdeschwanz und schüttelte die Haare aus. Sie lüftete sie, während sie dasaß. Sie wartete wohl auf ein Rotkehlchen. Oder einen Finken. Einen Wintervogel. Einen, der nicht vor dem Winter flüchtete.
Sie aß ihr eigenes Brot und trank Milch. Die Nachmittagssonne zitterte und lebte wie ein offenes Feuer. Rollte das Licht zu ihr hin und machte sie schwindlig. Der Himmel war eine Feuerglut. Die Abende wurden so hell. Waren nichts, um sich darin zu verstecken. Das Glas stand schwankend auf einem Hocker neben ihr. Das Brot hielt sie in der Hand. Es krümelte gleichmäßig auf ihren Pullover. Sie konnte den schwachen Wollgeruch wahrnehmen, der sich mit dem Geschmack von Brot und Käse und Milch mischte.
Zeitweise vergaß sie sich und vergaß, warum sie da saß. Kaute nur. Aber jedes Mal, wenn sie anfing zu frieren, erinnerte sie sich an den Vogel. Wollte er sich nicht bald sein Essen holen? Auch heute nicht?
Sie nahm die Bröckchen um genau zehn Minuten nach vier von der Fensterbank und schloss das Fenster. Gleich darauf hörte sie immer, dass Frau Karlsen die Haustür aufschloss.
Manchmal erinnerte sie sich an Ingrid. Oder an Onkel Simon und Tante Rakel. Frau Karlsen hatte erzählt, dass Ingrid angerufen habe. Dass sie auf einen Brief von Tora warte. Sie hatte das ganz streng gesagt, so wie der Pastor auf der Insel, als sie in den Konfirmandenunterricht ging. Frau Karlsen war zur Stiefmutter in dem Märchen vom Schneewittchen geworden. Sie schwatzte Tora Ermahnungen auf, die ebenso rot und giftig waren wie der Apfel, den Schneewittchen aß, bevor sie umfiel.
Den erhobenen Zeigefinger hin- und herbewegend, sagte Frau Karlsen: »Man darf nie vergessen, seiner Mutter zu schreiben.«
Und Tora blendete das Geräusch ihrer Stimme aus.
Die anderen hatten die Osterprüfungen an den Tagen gehabt, an denen Tora krank zu Hause gelegen hatte. Der Oberlehrer ließ etwas von einem ärztlichen Attest verlauten. Sie hatten ihn in Mathematik. Tora saß mit geradem Rücken und blassen Wangen da. Der Pullover verhüllte ihre Hüften. Schützte sie jetzt noch immer, obwohl sie nichts mehr zu verbergen hatte. Auch das war gefährlich.
Er sah vom Klassenbuch auf und versuchte, dem Blick des Mädchens zu begegnen. Aber Tora hatte bereits Blickkontakt mit der Weltkarte über der Tafel.
Schließlich ergriff Anne die Initiative: »Tora hat eine Entschuldigung abgegeben. Von der Wirtin. Liegt sie nicht im Klassenbuch?«
»Ja, aber sie hat mehr als drei Tage gefehlt«, bemerkte der Oberlehrer ungerührt.
»Das ist doch nie so genau genommen worden. Hauptsache, die Zimmerwirtin oder die Eltern haben unterschrieben. Sie kann doch jetzt nicht mehr vom Doktor ein Attest erbitten. Sie ist schließlich wieder gesund.«