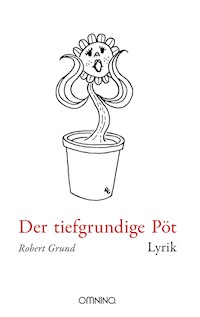
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wohin ich will. Ach, ganz egal, ich gehe erst einmal. „Der tiefgrundige Pöt“ gibt die ernsteren Themen des menschlichen Daseins aus lyrischphilosophischer Sicht wieder, ohne dabei den Blick für komische Situationen zu verlieren und diese mit einem Augenzwinkern zu kommentieren. Der 2. Gedicht-Band des Berliner Gelegenheitslyriker Robert Grund nach „Ein Grund zum Reimen“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-150-2 (Print) / 978-3-95894-151-9 (E-Book)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2020
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
Wer das Licht der Welt erblickt,wird das Dunkel schon noch kennenlernen.
Joachim Ringelnatz
Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst,solange du nicht stehenbleibst.
Konfuzius
Nur der Denkende erlebt sein Leben,an Gedankenlosen zieht es vorbei.
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach
Für meine Familie und meine Lieben –und zum Andenken an Heike – du warst mein treuester Fan.
Mein Dank gilt Anna für die Unterstützung beiZeichensetzung und Rechtschreibung sowie meinem Verleger,der zum wiederholten Male an mich glaubt.
Vorvers
Dies Werk, das Sie in Händen halten,
wirkt leider etwas zwiegespalten.
Tiefgründigkeit bestimmt sein Sein,
doch lädt es auch zum Schmunzeln ein.
Vielleicht können Sie ja was entdecken
aus Ihrem Leben, was mit Schrecken
und es neu bewerten dann,
auf das man es vergessen kann.
Wie auch immer es Ihnen geht,
es grüßt Sie herzlichst der Poet.
Sprach-Gewandt
Wenn Deutsch die meine Sprache wär,
was würd’ ich wohl beschreiben?
Irgendwas, von ungefähr
muss in Erinnerung bleiben.
Vielleicht auch hinkend Humpelding,
in fröhlich melancholisch.
Wer mit wem, wohin, mal ging,
in realistisch metaphorisch.
Von fast beinah bis ganz genau,
so ziemlich dicht daneben,
und strunzendumm zu furchtbar schlau
wär’ dann mein Schreiberleben.
Total erfüllt an leeren Orten,
käm’s dann nicht von ungefähr,
leise, laut, mit andern Worten -
wenn Deutsch die meine Sprache wär.
Lebensschaum
Leben ist wie das Sterben der kleinen Seifenblasen
des Badeschaums auf meiner Haut -
stetig fortschreitend, unaufhaltsam,
schillernd bunt und farbenfroh,
zufällig und spontan
und immer wieder ein winziger Tod,
bis nichts mehr ist.
Zwischending
Ich bin wie angetautes Eis,
’ne Melange, nicht schwarz, nicht weiß.
Ich glaub’, ich könnte noch entwischen,
doch ich bin ja nur dazwischen.
Ich gehöre nirgendwo so richtig hin.
Bin oft weit weg, wo ich grad bin,
besetze lieber alle Nischen
und bin nur irgendwo dazwischen.
Ich denke mehr als alle andern
und das im Stehen, nicht im Wandern.
Wie der Wind in den Gebüschen,
fahr’ ich so eben mal dazwischen.
Ich tanze so, als wär ich jung,
geb’ meinen Hüften zu viel Schwung,
stech’ hervor aus all den Ischen
und bin doch nur irgendwo dazwischen.
Ich glaub’, ich sollt mich mal verlieben,
den Horizont einfach verschieben,
die Grenzen meines Lebens sich verwischen,
dann bin ich irgendwann dazwischen.
Fühlingsgefühl
Der Himmel hängt so voller Geigen,
so herrlich schön ist diese Welt.
Sie kann sich vor der Liebe nur verneigen,
als wäre die ihr Himmelszelt.
Sommerabend
Silberstreif am Horizont,
die Ferne liegt dir nah,
entschwindest derweil ganz gekonnt,
so formlos wunderbar.
Schwalben schwirren durch die Luft,
die Ruh’ besiegt die Stadt,
alles Laute nun verpufft
und nichts zu melden hat.
Heißes Licht des Tages geht,
das Dunkel bricht herein,
ein leises Lüftlein nur noch weht,
so schlaf’ und träume fein.
Gewitter
Donnerhall und Blitze zucken,
Wind tost durch das Laub.
Bäume biegen sich ohne mucken,
Nebel gelb aus Staub.
Über allem Regenrauschen,
Tropfen machen Rhythmus.
Diesem könnt’ ich ewig lauschen,
Lied, mit dem ich mit muss.
Unverständliche Bekanntschaft
Ich spreche deine Sprache nicht,
sie ist mir völlig fremd.
Nicht zu lesen dein Gesicht,
so bin ich nur gehemmt.
Mir wird nie klar, wo liegt dein Ziel.
Du sprichst, es kommt nichts an.
Letztendlich spielst du nur ein Spiel,
dem ich nicht folgen kann.
Vermutlich ist dir nie bewusst,
wie unbekannt du bleibst,
dass du nun was ändern musst
und mich nicht vertreibst.
Mit etwas Glück gelingt dir das,
vorausgesetzt, du willst.
Und du in deinem Eigenhass
nicht irgendwann überquillst.
Vielleicht wird eines Tages dann
dein Wort mir noch geläufig.
Ich dich dann verstehen kann -
nicht immer, aber häufig.
Regensegen
Der Regen fällt,
in Tropfenform,
ganz ohne Norm,
herab auf unsere Welt.
Dann wird’s nass,
fast überall,
durch Wasserfall,
welch’ ein feuchter Spaß.
Doch recht schnell,
regiert voll Wonne
dann die Sonne -
sie brennt so furchtbar hell.
Und der Regen
ist vergessen,
wie aufgefressen,
bringt woanders Segen.
Sternenschweif
Wie schön ist doch die unsere Welt,
wenn ein Stern vom Himmel fällt.
In Schnuppenform tut er entschweifen,
ich würd’ ihn liebend gern ergreifen.
Doch ist er leider schon verglüht,
wie wenn im Mai die Kirsche blüht.
Drum wandle ich auf dieser Erde,
hoff’, dass sie noch schöner werde
und guck hinauf zum Himmelszelt,
auf das ein Stern vom Himmel fällt.
Winterzauber
Der Schneeflöckchentanz,
ist wirklich ganz
wunderschön,
mit anzusehen.
Verfressene Welt
Das Fressen und Gefressen werden,
bestimmt das Sein bei uns auf Erden.
Wer unten steht, ja der wird meist
vom Obendrüber stumm verspeist.
Und wer sich wehrt, dem sei gesagt,
die Futterei wird nur vertagt.
Nur selten steigt ein niederer Wicht,
empor hinein bis rein ins Licht.
Doch wer da denkt, derjenige sei
nun sicher vor Verspeiserei,
der denke dran, wer runter schielt,
dass über ihm schon jemand zielt.
Umtriebige Nacht
Ein Nachtfalter, er kommt im Dunkeln,
sonst wär’ er ja ein Schmetterling.
Im Hellen schließlich ist schlecht munkeln,
denn das, das ist sein Ding.
Zahlendreher
Dreht man die Zahl 8
um 90 Grad, so ergibt sich
das Zeichen der Unendlichkeit ∞.
∞ der Lust,
∞ der Geilheit,
∞ der Zweisamkeit,
∞ der Nähe,
∞ der Liebe,
∞ der Gefühle,
∞ der Bedürfnisse.
Bist du bereit zur ∞,
oder muss ich 8 geben?
Greises Ende
Sie werden sich nicht mehr verändern.
Nur noch wandeln in staubigen Gewändern.
Einsam warten auf Ende und Tod.
Fühlen sich letztlich vom Leben bedroht.
Haben Neugier mit Gleichmut getauscht.
Ihre Vergangenheit hat sie berauscht.
Im Hier und im Jetzt gibt’s nichts mehr,
es kommt auch kein Zufall daher.
Monoton vergeht Tag um Tag.
Die Kräfte, sie schwinden nun stark.
Vergessen bestimmt bald das Sein
und sterben muss dann jeder allein.
Meerestraum
Stell’ dir vor,
du bist am Meer.
In deinem Ohr,
da rauscht es sehr.
Die Möwen schreien,
die Wellen tanzen.
Ein Gläschen Wein,
kommt zu dem Ganzen.
Die salzige Luft,
fein körniger Sand,
ein wohliger Duft
umgibt den Strand.
Musik spielt fern,
mit buntem Treiben.
So hast du’s gern,
hier willst du bleiben.
Azurblau und wolkenlos
der Himmel über dir.
Fröhlichkeit bei klein und groß,
du bist sehr gerne hier.
Du träumst dich still
im Schlaf hierher.
Ein jeder will
einen Tag am Meer.
Fluss der Verwandlung
Ein Meischen mit ’nem „A“ vorn dran,
krabbelte durch die Gegend,
bis sie an ’nem Fluss ankam -
dies fand sie sehr bewegend.
Sie wollte so gern drüber weg,
doch wusste sie nicht, wie.
Das Wasser – reißend, gar mit Dreck,
ihr in die Äuglein spie.
Da dacht’ sie dran, wie sie ja hieß.
Das „A“ war ihr längst über.
Sie es drum von dannen stieß,
schon flog sie zwitschernd drüber.
Wenn ihr ab jetzt ein Meislein seht,
in fiedrigen Gewändern,
ihr sicher besser nun versteht,
man kann sich immer ändern.
Abendmahl
Wir machen uns jetzt Abendbrot.
Dafür schießen wir zehn Tauben tot,
jagen uns ein wildes Schwein
und klauen uns ein Fass voll Wein.
Nun fehlen bloß Kartoffeln noch,
woraus ich uns ’ne Suppe koch’.
Vielleicht, und das ist hier die Frage,
taugen die noch zur Beilage.
Doch zu unserem Leibeswohl,
fehlt ein wenig leckerer Kohl.
Den hol ich von des Nachbarn Feld,
gebührenfrei, ganz ohne Geld.
Zu guter Letzt den Tisch gedeckt,
alles herzhaft abgeschmeckt,
aufgetafelt wie im Lokal -
fertig ist das Abendmahl.





























