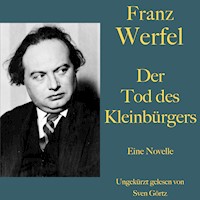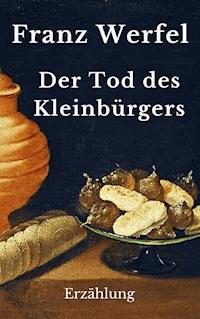
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Karl und Marie Fiala bewohnen mit ihren beiden Kindern eine enge Wohnung in Wien. Trotz der beengten Verhältnisse haben sie Maries Schwester Klara bei sich aufgenommen. Es sind die wirtschaftlich knappen Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Sohn Franz ist Epileptiker. Die Fialas sind sich uneinig über die Frage, ob Franz besser zu Hause oder einer spezialisierten Anstalt aufgehoben wäre. Karl setzt sich schließlich mit seinem Wunsch durch, den Jungen zu Hause aufwachsen zu lassen. Doch damit ist die Auseinandersetzung über das Thema längst nicht beendet. Die Wiener Wohnung der Familie Fiala in »Der Tod des Kleinbürgers« ist für Franz Werfel die Bühne, auf der er die familiäre Gruppendynamik einer verunsicherten Generation darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Tod des Kleinbürgers
TitelseiteIIIIIIIVVVIVIIImpressumFranz Werfel
Der Tod des Kleinbürgers
Erzählung
I
Die Wohnung besteht aus Zimmer, Küche, Kabinett im vierten Stock eines Hauses der Josefstädterstraße, dicht am Gürtel. Das Ehepaar Fiala schläft im Kabinett, Klara, Frau Fialas Schwester, hat einen Strohsack in der Küche, in der allerdings kein Raum mehr für ein zweites Lager wäre, und Franzl darf sich im Zimmer auf dem Wachstuchsofa betten. Dieses Zimmer geht nicht auf die Straße hinaus, sondern auf einen größeren Lichthof. Aber wenn der lichtspendende Hof seinem Namen auch keine Ehre macht, so behaupten geduldige Anwohner doch, daß in seiner sagenhaften Tiefe ein Akazienbaum sein Fortkommen finde und die Wohnräume zwar finster, aber dafür ruhig seien. Heute übrigens, da frischer Winter die Straßen füllt, hat die Sonne hierher einen Vorstoß unternommen und ein paar fiebrische Flecken Lichts an die Wand des Zimmers geworfen im Augenblick, da es Herr Fiala betritt.
Der Mieter mustert seinen Raum nicht unbefriedigt. Andern geht es schlechter. Wie viele liegen auf der Straße! Und Herrschaften, die unendlich höher gestanden haben als er: Offiziale und Majore! Was da geschehen ist in diesen Jahren, wer kann das verstehen?! Stillhalten muß man, das ist das Einzige. Und ein Glück ist es, wenn einer mit Vierundsechzig noch einen Posten hat. Es ist zwar nur eine Halbtagsarbeit, aber die Firma baut täglich ihre Angestellten ab. – Gott ist gnädig und der Lohn eines Magazinaufsehers zu klein zum Abbauen! – Alles geht ja ganz gut. Ein Vierundsechziger und eine Zweiundsechzigjährige haben nicht viel Hunger. Die Klara, das Luder, verköstigt sich in den Häusern, wo sie bedient. Bleibt nur das Unglück mit dem Franzl.
Der Gedankenablauf Herrn Fialas, täglich und nächtlich der gleiche, ist an sein Ende gekommen. Und nun schickt er sich an zu tun, was er immer tut, wenn er nach Hause und in das Zimmer tritt. Zuerst geht er zu dem Ständer mit den Pfeifen. Er fährt mit der Hand über die Porzellanköpfe. Niemals hat er Pfeife oder etwas anderes geraucht. Der Ständer ist das Geschenk eines früheren Vorgesetzten, der auf diese Weise seine Wohnung von der ominösen Rauch- und Schmuckgarnitur befreien wollte. Herrn Fiala freuts, die Glasur der Pfeifen zu berühren. Es fühlt sich kostbar und gemütlich an. Man greift bessere und langvergessene Zeiten mit der streichelnden Hand. Von den Ständern weg wendet sich nun der Alte und tritt zum Tischchen, das vor dem Fenster steht. Es ist dem Anschein nach ein Nähtisch, dessen Zweckmäßigkeit durch allerlei kühne Architekturen getrübt ist. So laufen die vier Kanten der Platte in vier Fabeltiere aus, Seepferdchen oder gotischen Wasserspeiern ähnlich. Auf dem Tische liegt aber kein Nähzeug, sondern eine Schreibmappe und daneben eine Löschpapierwiege. Auf diese Wiege stützt sich Herr Fiala ein wenig, als ginge von dem gebildeten Gegenstand ein leises Wohlbehagen aus, das ihn stets erquicken möchte. Die zwei Armsessel hingegen am Nähtisch beachtet er nicht. Denn er steht jetzt stolz vor seiner Kredenz. Sie hat er nicht hergegeben beim Verkauf der anderen Möbel. (Ehedem hatten Fialas vier eingerichtete Zimmer besessen, von denen sie zwei vermieteten.) Die Kredenz kann sich sehen lassen. Mit Säulen, Köpfen, Türmen steht sie da wie eine Festung. Sie stammt noch aus dem reichen Zuckerbäckerhause in Kralowitz, wo er seine Frau hergeholt hat. Wer diese Kredenz sein nennt, ist nicht verloren. Wenn er sie verkauft hätte, wären wohl zwei Millionen Kronen zu dem übrigen Erlös hinzugekommen. Aber man will doch ein Mensch bleiben. Ein schönes Geld hat ja der Verkauf seiner alten Wohnung getragen, Gott sei Dank! Aber wer kann in diesen Zeiten dem Gelde trauen? So dumm war er nicht, wie seine dumme Frau meint, es auf ein Sparkassenbuch zu legen. Was seine zwei Sparkassabücheln wert waren, das hatte er erleben müssen! Wenn das Letzte verlorenging, was würde dann die Zukunft sein, was würde aus der Frau werden, was aus dem Franzl!? Für Marie das Versorgungshaus in Lainz, für den Buben die Anstalt am Steinhof! Was das heißt, weiß Herr Fiala sehr wohl. Haben die älteren Leute nicht immer von den Leiden der Versorgung gemunkelt? So schrecklich soll das Leben draußen sein, daß die alten Menschen aus dem Fenster springen, nur um ein Ende zu machen! ›Tag und Nacht fahren die Leichenwagen hin und her.‹ Wenn das auch nur dumme Geschichten sein mögen, so ist und bleibt das Versorgungshaus Schande. Seinen Eltern, die anständige Leute waren und etwas gehabt haben, will er diese Schande nicht antun. Er war niemals ein Bettler und hatte immer zu essen. Seine Familie soll nicht in Lainz enden!
Hier ist Fiala, während die knorpeligen Hände über den Bord der Kredenz wischen, bei seinem Geheimnis angelangt. Herr Schlesinger hat ihm den Weg gewiesen, Herr Schlesinger, Versicherungsagent bei der ›Tutelia‹, ehemaliger Landsmann und seit Jahren Wohnungsnachbar. Die zufriedene Stimmung Fialas hängt an dem Geheimnis, das er mit Schlesinger teilt. Ein Rest von Unruhe ist wohl der Zufriedenheit beigemischt. Aber sein Kopf ist müd und mürbe, das Mundwerk Schlesingers hingegen rasch und geübt. Und dann, Geheimnisse vor Weibern bewahren, ist das denn eine leichte Sache? Schlesinger hat recht gehabt: Nur sich nichts dreinreden lassen! Das Dümmste an den Weibern ist ihr Mißtrauen.
Herr Fiala reißt sich von der Kredenz los, um seinen gewohnten Zimmerrundgang dort zu beschließen, wo sein Herz sich am wohlsten fühlt, wenn es allein ist.
Ziemlich niedrig hängt die Gruppenphotographie, von uralten Zweigen umkränzt, deren braun-gläsernes Laub den Flügeln riesiger Insekten gleicht. In goldenen Lettern trägt sie den Aufdruck: ›Herrn Karl Fiala, die Beamten der Finanzlandesprokuratur, Wien 1910.‹ Diese Gabe ist keine Gewöhnlichkeit, denn in der Regel lag es nicht, daß die vorgesetzten Herren ihr Bild einem Subalternen zum Geschenke machten. Wie oft dürfte es vorgekommen sein, daß die beiden mißgelaunten Hofräte selbst, mit geduldig-lächelnder Nachsicht zu einem ähnlichen Zweck ihr Antlitz dem Photographen überlassen haben? Aber an der Auszeichnung berauscht sich Herr Fiala jetzt nicht. Auch der Rechtfertigung, die ihm durch diese Photographie zuteil geworden ist, weiht er nur einen flüchtigeren Gedanken als sonst. Schuld an der vorzeitigen Pensionierung ist gewiß der Personaldirektor und Oberoffizial Pech gewesen. Wer weiß, wenn der Herr Oberoffizial damals sein Protektionskind nicht hätte unterbringen wollen!? Mit fünfzig Jahren geht man doch nur gezwungenermaßen in Pension. Und wäre er damals wirklich so krank gewesen, würde er dann heute noch leben? Hätte der Arzt, dem er auf Schlesingers Geheiß sich gestern vorstellen mußte, trotz findigster Auskultation ihn sonst für gesund erklärt? Nun, Gott weiß, ob Herr Pech, der böse Mensch, samt seinem Protektionskind nicht tiefer gestürzt ist als er!
Diese Dinge aber beschweren im Augenblick den Betrachter der photographischen Abschiedsgabe wenig. Er ist leidenschaftlich ins Anschauen der Person vertieft, die zwischen den beiden mageren Hofräten dasitzt, üppig und pomphaft. Diese Person hat als einzige auf dem ganzen Bilde den Kopf bedeckt, und zwar mit einem großen, silberbetreßten Dreispitz. Die Person trägt ferner einen dicken und verschnürten Pelz am Leib, der ihr Ansehen verdoppelt und verdreifacht. Die Manschetten des Pelzes sind goldgebortet wie bei einem General. Zu alledem halten die dickbeschuhten Hände der Person einen langen schwarzen Stab, der mit einer Silberkugel gekrönt ist. Im ganzen wirkt die Person wie ein stattlicheres Ebenbild einer anderen und allerhöchsten Person, die in jenen streng geregelten Zeiten das Reich regiert hatte. Und dieser Mann sollte damals ein Kranker gewesen sein? Er, der ruhig und gemessen aus seiner Portierloge trat, um wachsam fast das ganze Torbild des Amtsgebäudes zu füllen? Er, zu dessen einsamer Höhe die vorbeiwandelnden Schulkinder nur scheu emporblickten, er, der sich schon in seiner Kraft und Herrlichkeit leicht verletzt fühlte, wenn er in Ausübung seines Dienstes von den Parteien nach Stiege und Stockwerk und Büro gefragt wurde? Er, der seine Auskünfte nur mit eisig gedämpfter Stimme gab, nachdem er vorher dem Frager ein schmerzlich-nachsichtiges Ohr geneigt hatte?
Herr Fiala saugt den Nachhall dieser Majestät ein. Er denkt nicht daran, den alten abgeschabten Menschen, der vor dem Bilde steht, in Beziehung zu setzen zur breiten Prachtgestalt von einst. Die Prachtgestalt und der Magazinaufseher heute, der im geflickten Kittel von Anno dazumal schlottert, das ist zweierlei Menschheit. Nur daß diese beiden Wesen dieselbe Barttracht noch tragen! Aber wer dürfte den weitausgezogenen, selbstbewußten Kaiserbart des Uniformierten vergleichen mit den demütigen Bürstenbüscheln rechts und links, die heute dünn und grau von den Backen hängen?
Fiala selbst tut es am allerwenigsten. Er schaut nur und schaut. Das Bild ist ein Altar. Kraft und Freude strömt es aus. Darum auch schämt er sich und hat immer Angst, in seiner Versunkenheit betreten zu werden. Auch heute und jetzt dreht er sich furchtsam um, ob die Tür zur Küche nicht plötzlich aufgehe.
Und nun erst gewahrt er, daß eine festliche Veränderung in seinem Zimmer vorgegangen ist. Denn der Tisch vor dem Wachstuchsofa ist gedeckt. Mit einem feinen roten Kaffeetuch gedeckt. Servietten liegen sogar auf und die schönen Tassen sind hervorgeholt, die der Schwiegermutter gehört haben, der Zuckerbäckerin in Kralowitz.
»Wo die Weiber das Zeug nur immer versteckt haben?«