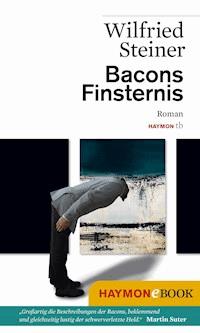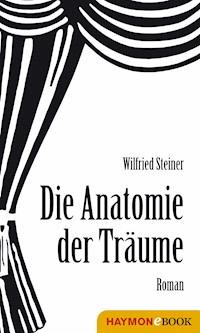Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Vergeltung: atmosphärisch dicht, packend, bildgewaltig. Blick in den Kosmos: den Sternen so nahe Nacht für Nacht beobachtet Adrian durch sein kleines Fernrohr den Himmel und notiert akribisch den Stand der Jupitermonde. Mit seiner Frau Karin führt er in Wien ein beschauliches, wenig aufregendes Leben. Als Adrians Vater stirbt, löst sich die Erstarrung: Der Hobbyastronom möchte sich endlich seinen großen Lebenstraum erfüllen und auf der Kanarischen Insel La Palma das Gran Telescopio Canarias besichtigen. Als die beiden dort ankommen, erwarten sie Strände schwarzen Lavasands, der gewaltige Roque de los Muchachos, Blüten in allen erdenklichen Farben - und Sara. Düstere Schatten der Vergangenheit Sara ist Ornithologin und verweilt auf La Palma, um die endemischen Vogelarten der Insel zu erforschen. Die gebürtige Chilenin war schon in den 1970ern nach Deutschland gekommen. Während Karin sich die Zeit mit Surfstunden beim attraktiven Ricardo vertreibt, verfällt Adrian immer mehr dem geheimnisvollen Reiz von Sara. Je näher sie sich kommen, desto mehr tut sich ein düsterer Abgrund auf: Was hat die rätselhafte Frau auf La Palma wirklich vor? Und was hat ihre Vergangenheit in Chile damit zu tun? Packende Spannung vor der atemberaubenden Kulisse La Palmas Am sternenklaren Atlantikimmel tauchen finstere Ahnungen auf: Vor dem geschichtlichen Hintergrund der Militärdiktatur in Chile unter Pinochet erzählt Wilfried Steiner die fesselnde Geschichte einer Vergeltung. Ein sogkräftiger Roman, klug und mit beklemmender Dramaturgie erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Wilfried Steiner
Der Trost der Rache
Roman
Für Josefina
Das Verschwinden
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Albert Einstein
EINS
Der schönste Dialog über die Unendlichkeit stammt von Hamlet und seinem Vater.
Nicht vom Dänenprinzen und dem Geist, sondern von Hägar dem Schrecklichen und seinem Sohn.
Sie stehen auf einem Feld, versunken in die Betrachtung des Firmaments.
„Kommst du nicht ins Staunen, Papa“, fragt Hamlet, „wenn du all die Sterne am Himmel siehst?“
„Ja“, sagt Hägar. „Sie sind so klein und so mickrig und wir sind so groß.“
Karin hat mir den Strip einmal geschenkt, hinter Glas und hübsch gerahmt. Ich vermute, sie wollte damit andeuten, dass ihr meine Nächte auf dem Balkon langsam ein wenig barbarisch vorkamen. Vielleicht hegte sie aber auch heimliche Sympathien für mein Staunen über den Himmel und sah mich eher als kindlichen Hamlet mit winzigem Wikingerhelm, der seinem Vater zu erklären versucht, dass da draußen noch etwas ist. Etwas Erhabenes, Ehrfurcht Gebietendes, das seinen zu eng gezogenen Horizont übersteigt.
Mein Teleskop ist nicht sehr groß, und außer dem Orionnebel, den Mondkratern und den Umrissen der Andromedagalaxie kann ich nicht viel beobachten. Aber wenn ich einen beliebigen Ausschnitt des Himmels anvisiere, sehe ich das Funkeln von hunderten Glutnestern auf einem schwarzen Tuch, hin und wieder den aufgleißenden Schweif einer Sternschnuppe, und fühle mich auf unvernünftige Weise getröstet und den Niederungen des Alltags enthoben. Bis hierher bin ich in Karins Augen nur ein Eskapist. Verzeihlich: Wer flüchtet nicht gerne aus der Wirklichkeit, in der wir leben? Was sie irritiert, ist die Beharrlichkeit, mit der ich in jeder klaren Nacht den Stand der vier großen Jupitermonde in ein A3-Notizheft eintrage, selbst bei Februarfrost, unermüdlich und präzise: Jupiter ein kleiner runder Klecks, die Trabanten vier Punkte. Io, Europa, Ganymed und Kallisto: Bevor ich nicht aufgezeichnet habe, in welchem Abstand und Winkel zum Planeten sie stehen, Datum und Zeit hinzufüge, die Skizze mehrmals überprüfe und bei Fehlern von vorne beginne, bis alles seine Richtigkeit hat, kann ich nicht schlafen. Wenn der Stand des Jupiter die Beobachtung verhindert, was oft über Monate hinweg der Fall ist, werde ich unruhig. Als Therapeutin fallen Karin da schon böse Begriffe ein, analer Charakter ist noch einer der harmlosen. Doch immer, wenn sie sie verwendet, lächelt sie dabei milde.
Nun aber sitze ich hier an diesem ungastlichen Ort und überlege, ob es nicht angebrachter wäre, die Vergangenheitsform zu verwenden. Wer weiß, wann ich sie wiedersehen werde, Karin und mein Teleskop.
Mit zehn Jahren bekam ich mein erstes Buch über Astronomie geschenkt. Es hieß schlicht „Sterne“, war ein kleines Taschenbuch mit unscharf gedruckten Fotos und verzerrten Himmelskarten und entfachte in mir die erste kosmische Begeisterung. Ich erfuhr, dass es Fixsterne, Planeten, Galaxien und Nebel gab, dass eine Zündholzschachtel voller Materie eines weißen Zwerges auf der Erde sieben Tonnen wiegen würde und dass der Umfang des roten Überriesen Beteigeuze größer war als die Umlaufbahn des Mars um die Sonne. Ein Freund meines Vaters, den ich damals Onkel Martin nannte, hatte mir das Päckchen überreicht, mit geheimnisumwobener Miene, als enthielte es Schatzkarten, die nur er und ich je zu Gesicht bekommen würden. Seit diesem Moment musste er jedes Mal, wenn er bei uns zu Gast war, mit mir eine halbe Stunde auf dem Balkon verbringen. Mit ausgestreckter Hand zeigte ich auf Lichtpunkte und nannte stolz Namen, Entfernungen, Farben und Spektralklassen. Er nickte stumm und klopfte mir auf die Schulter. Irgendwann besuchte er uns nicht mehr, und ich machte mir Vorwürfe. Erst später erfuhr ich, dass der Bruch meines Vaters mit Onkel Martin mehr mit meiner Mutter als mit mir zu tun gehabt hatte.
Aber die eigentliche Geschichte begann mit dem Tod meines Vaters vor fünf Monaten. Es ging alles sehr schnell. Eines Abends rief er an und fragte, ob er zu uns kommen könne. Sofort.
Er sah müde aus. Zuerst dachte ich, er sei noch ein wenig mitgenommen von dem Essensgelage, das er drei Tage zuvor anlässlich seines fünfundsiebzigsten Geburtstages veranstaltet hatte. Für jedes gelebte Jahr einen geladenen Gast. Er hatte sich seine alte Motorradlederjacke über ein weißes Hemd mit offenem Kragen gezogen und die Gäste bis zwei Uhr früh mit seinem finsteren Humor bei Laune gehalten. Erst als wir ihn mit vereinten Kräften die Stufen zu seiner Wohnung hochgetragen hatten, befiel ihn wieder die Melancholie und er rief nach meiner Mutter, die seit zehn Jahren tot war. Nachdem er sich in mehreren Konvulsionen erbrochen hatte, legten wir ihn ins Bett und deckten ihn zu.
„Adrian“, sagte er, als er eine Viertelstunde nach seinem Anruf an unserem Küchentisch saß, „ich muss dir etwas mitteilen.“ Karin wusste sofort, dass etwas Bedrohliches geschehen war. Mein Vater liebte sie, und wenn er nur mich ansprach, war das immer ein Zeichen dafür, dass er aus Ratlosigkeit Zuflucht zu den Blutsbanden suchte, die ihm im Vollbesitz seiner Kräfte immer verdächtig waren.
„Ich war gestern und heute bei Stefan“, sagte er. „Er hat mich von oben bis unten durchgecheckt. Du weißt schon, Gastroskopie, Endoskopie, die üblichen Foltermethoden.“ Er holte tief Luft und nahm einen Schluck von dem Cognac, den Karin vor ihn hingestellt hatte. Seine weißen Haarsträhnen standen in wilden Bögen seitlich von den Ohren ab. In diesem Moment erinnerte er mich an das Foto eines Lisztäffchens, das ich einmal in einem Bildband über den Amazonas gesehen hatte.
„Meine Übelkeit kommt nicht von der schlechten Ernährung. Oder vom Alkohol. Sie kommt von einem kleinen Stück Scheiße, das sich in meiner Bauchspeicheldrüse eingenistet hat.“
Karin, die eben noch damit beschäftigt war, einen Teller Schinken mit Melonen zu garnieren, ließ sich auf den Stuhl neben mir fallen. Ich spürte, wie sie dagegen ankämpfte, doch sie konnte ihr Aufschluchzen nicht unterdrücken.
„Na, na, so schlimm ist es auch wieder nicht“, sagte mein Vater und tätschelte ihren Handrücken. „Ein alter Onkologe, der vom Krebs gefällt wird, das hat doch was, oder?“
„Wie lange noch?“, fragte ich hilflos, was mir einen vernichtenden Blick von Karin eintrug.
„Drei Monate“, sagte mein Vater. „Falls sich der alte Quacksalber nicht irrt und ich ihm nicht doch noch von der Schaufel springe.“ Er lachte hell auf, wie ein ungestümer junger Mann, der stolz darauf ist, sich in einem Kreis Erwachsener mit obszönen Reden wichtig zu machen.
Karin schaffte es, ihre Gesichtsmuskeln zu kontrollieren, und lächelte. Gegen die Tränen hatte sie aber keine Chance.
„Wir werden dir in allem helfen. Was immer du brauchst“, sagte sie tapfer.
„Ich weiß, Kleines“, sagte mein Vater. „Wenn ich ganz in Stefans Gewalt bin und nicht mehr reden kann, erinnere ihn bitte an sein Versprechen.“
„Welches Versprechen?“
Noch ein Schluck Cognac.
„Es besteht nur aus einem Wort.“ Er blickte sich in der Küche um und blähte die Nasenflügel. „Es riecht hier so unangenehm frisch. Sag bloß, du rauchst nicht mehr, alter Hasenfuß.“
„Doch, doch.“ Ich holte das Päckchen aus meiner Tasche und hielt es ihm hin. „Wir lüften nur öfter.“
Er zog eine Zigarette heraus, brach den Filter ab und zündete sie sich an.
„Was machen die Sterne? Nachwuchs bei Jupiters? Oder immer noch die vier gleichen Bälger?“
Ich weiß nicht, warum ich das sagte, was ich sagte. Karin hätte sicher eine treffende Bezeichnung dafür. Hortend, fixiert, was weiß ich.
„Jupiter ist ein Planet, kein Stern. Und die Bälger werden immer mehr. Siebenundsechzig Monde sind es inzwischen.“
„Aber du siehst immer nur vier!“ Er lachte und hustete gleichzeitig.
Ich konnte nicht antworten, weil Karin ihren Arm ausgefahren hatte und mir mit ihren schmalen Fingern den Mund fest verschloss.
„Wie lautet das Wort“, fragte sie.
„Morphium“, sagte mein Vater.
Am nächsten Morgen sprach ich mit Stefan Höller, Onkologe wie mein Vater und sein bester Freund. Er hatte die Leitung der Abteilung im Allgemeinen Krankenhaus nach der Pensionierung meines Vaters von ihm übernommen.
Im dunklen Korridor der Station kam mir Stefan mit abwesendem Blick entgegen.
Seine Miene trübte sich, als er mich wahrnahm.
„Es tut mir so leid“, sagte er zur Begrüßung.
„Wie schlimm ist es?“, fragte ich.
Er nahm mich am Arm, zog mich ins Schwesternzimmer und drückte mich auf einen Stuhl.
„Es ist ein besonders aggressiver Tumor“, sagte er. „Wir können nicht operieren, und dein Vater hat eine Chemotherapie strikt abgelehnt.“
„Er wird sterben“, sagte ich dumpf.
Stefan nickte und legte seine Hand auf meinen Unterarm. „Er kann noch ein, zwei Wochen zu Hause bleiben, dann werden die Schmerzen ihn zwingen, zu uns zu kommen.“
Wir unternahmen Ausflüge mit meinem Vater, an seine Lieblingsorte. Es war ein sonnendurchfluteter Spätherbst. Karin fuhr, er saß neben ihr, ich im Fond. Der Semmering, das Waldviertel, die Wachau.
Einmal spätabends hielt uns die Polizei an. Karin kurbelte das Fenster herunter, der Beamte beugte sich herein. Mein Vater packte ihn am Kragen.
„Hauen Sie ab“, sagte er. „Das hier ist ein Leichentransport.“
Wir standen lange am Straßenrand, bis Karin alles erklärt hatte.
Mein Vater sträubte sich lange dagegen, ins Krankenhaus zu gehen. Als die Schmerzen kamen, bekämpfte er sie mit allem, was die Pharmazie zu bieten hatte. Einmal, als er mit verzerrtem Gesicht auf der Bettkante hockte und ich den Arm um ihn legte, um ihn sanft davon zu überzeugen, dass es nun Zeit wäre, stieß er mich brüsk von sich.
„Ich lass mich doch nicht von meinen eigenen Kindern deportieren!“, schrie er. Dann besann er sich, nahm meine Hand, zog mich zu sich heran und flüsterte mir ins Ohr: „Du weißt doch, dass ich da nie wieder rauskomme.“
Was ihn am meisten davon abschreckte, in die Klinik zu gehen, war, dass er sie so gut kannte. Bis zu seinem Abschied vor zehn Jahren war er einer der renommiertesten Krebsspezialisten Wiens gewesen, und auch danach wurde er immer wieder von jüngeren Kollegen kontaktiert und um seine Meinung gefragt. Was er wirklich dachte, behielt er meistens für sich.
„Ich habe so viele Menschen kämpfen sehen, und am Ende sind sie doch fast alle krepiert“, sagte er bei seiner Geburtstagsfeier, als nur noch eine Handvoll Leute am Tisch saßen und seine Augen schon glasig waren.
„Das Schlimmste ist, dass du sie in ein Leiden schicken musst, das so oft umsonst ist. Sie klammern sich daran, sie nehmen es auf sich, weil sie lieber kotzen und schreien und sich winden, als schnell zu sterben. Die demütigende Macht des letzten Strohhalms, auch wenn er noch so dünn ist: Das ist das wahre Wesen der Chemo. Ich bete zu Gott, an den ich nicht mehr glaube, dass mich eines Tages der Schlag trifft.“
So redete er, drei Tage vor seiner Diagnose. Erst zwei Monate später, im Dezember, gab er auf.
Im Moment seines Todes saß ich an seinem Bett. Zuerst lag er ruhig auf dem Rücken und starrte an die Decke. Plötzlich ging ein Ruck durch seinen Körper und er begann zu röcheln. Er bäumte sich auf, aber nur kurz, dann fiel er zurück und schnappte nach Luft. Das Röcheln wurde lauter und langsamer. Ich drückte den Knopf für die Schwester. Mein Vater hob den Kopf und schaute mich an. Es war mir nicht klar, ob er mich erkannte. Sein Kopf sank auf den Polster zurück. Er klappte den Mund auf, gab einen rasselnden Laut von sich. Von einer Sekunde zur anderen änderte sich die Farbe seines Gesichts, als würde es jemand mit einer dünnen Schicht Wachs überziehen. Er vergilbt, dachte ich. Seine Pupillen kippten nach hinten, die Augen waren nur noch zwei weiße Löcher. Der Blick hatte die Richtung gewechselt, um hundertachtzig Grad, weg von der Welt, hin zu einem Abgrund, den Lebende nicht sehen können.
Die Schwester flog herein, stieß einen Schrei aus, rannte wieder hinaus auf den Korridor. Stefan fand mich neben meinem toten Vater, von einem Schluchzen geschüttelt, das erst abebbte, als er mich mit seinen Sportlerarmen so fest an sich drückte, dass ich keine Luft mehr bekam.
Ich habe oft mit Karin über diesen Moment gesprochen. Es war nicht allein die Trauer um meinen Vater, die mich so erschüttert hatte. Seine herablassende Art hatte eine wirkliche Nähe zwischen uns immer verhindert, und meine Liebe zu ihm war von Ärger und Enttäuschung vergiftet.
Vielleicht war es die Begegnung mit dem Tod selbst, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Dieses Grauen, das man manchmal bei Begräbnissen beobachten kann, wenn Menschen vor dem offenen Grab von einem Zittern gepackt werden, das sicher nicht von dem Schmerz um den entfernten Verwandten herrührt, der da unten in seiner Holzkiste liegt. Wenn das Aufschlagen der Erdbrocken auf dem Sarg jene an der Gurgel packt, die sich eben noch über die Menüfolge des Leichenschmauses unterhalten haben.
Wahrscheinlich hatte der Tod seinen Vogelkopf aus den Augenhöhlen meines Vaters gezwängt, hatte sich auf seiner Stirn hockend zu voller Größe entfaltet, war hochgestiegen, über mich hinweggebraust und hatte mir dabei mit seinen gelben Schwingen eins übergezogen.
Wir sterben immer mit, wenn jemand stirbt, sagt Karin. Sie habe immer wieder Klienten, die über den Tod eines Elternteils nicht hinwegkämen, gleichgültig, wie groß die Nähe davor gewesen sei. Die Eltern seien die letzte Barriere zwischen dem Einzelnen und dem Tod, ihr Verschwinden blockiere den Verdrängungsmechanismus, das eigene Sterbenmüssen entfalte dann seinen ganzen Schrecken. Es klang überzeugend, aber auch wieder nicht. Nein, es klang professionell. Ich musste ständig auf der Hut sein, nicht in die Rolle eines ihrer Patienten zu rutschen.
„Was denkst du wirklich?“, fragte ich sie. Wir saßen nebeneinander auf der Couch und schauten auf den ausgeschalteten Fernsehapparat.
„Ich glaube, es war deine Wut.“
„Wie meinst du das? Natürlich war ich zornig auf ihn, aber –“
„Nicht auf ihn“, unterbrach mich Karin, „auf dich selbst. Weil du ihm bis zum Schluss nicht gesagt hast, was du ihm immer sagen wolltest. Und dann war es zu spät.“
Psychologie, Psychologie.
Von irgendwo hinter mir vermeinte ich das dröhnende Lachen meines Vaters zu hören.
„Hasenfuß!“, rief er, „Hasenfuß, Hasenfuß!“
„Wusstest du eigentlich“, sagte ich zu Karin, „dass Hamlets Vater auch Hamlet hieß?“
Doch es war noch etwas anderes, das ich dem Geist meines Vaters entgegensetzen konnte. Es stieg in einer Nacht, in der ich wie eine Holzplanke in meinem Bett lag und mich vergeblich nach Schlaf sehnte, langsam in mir hoch, erst noch verschwommen, dann mit schärferen Konturen. Es war eine seltsame Art von Gewissheit, ebenso banal wie überraschend.
Ich würde auch sterben. Unausweichlich, unvermeidbar, und wie die Worte der Einsicht alle lauteten. Jeder Widerstand zwecklos.
Doch die Konsequenz daraus war in diesem Augenblick für mich nicht etwa Resignation. Im Gegenteil, etwas an dieser Unerbittlichkeit spornte mich an, stieß mich mit der Nase auf mein Leben zurück.
Ich wollte vor meinem Tod noch ein paar Dinge erledigen. Zum Beispiel mir endlich meine ungelebten Träume erfüllen. Ein wahr gewordener Wunsch ist ein kleiner Triumph über die Vergänglichkeit. Oder so.
Diese Erkenntnis würde Karin erfreuen, so viel war sicher. Ich rüttelte sie sanft. Dann ein wenig heftiger. Sie schlug die Augen auf.
„Ich weiß jetzt, was ich tun muss“, sagte ich.
„Wie spät ist es?“, fragte Karin schlaftrunken.
„Noch nicht zu spät. Karin, ich werde eine lang gehegte Sehnsucht in die Tat umsetzen.“
„Hat das nicht bis morgen früh Zeit?“ Sie drehte sich zur Seite und schlief wieder ein.
Bis der Wecker läutete, saß ich aufrecht im Bett.
Ich würde eine kleine Reise unternehmen. Seit seiner Inbetriebnahme träumte ich davon, das Gran Telescopio Canarias zu sehen. Es befand sich im Observatorium Roque de los Muchachos auf La Palma, sein Spiegel war mit 10,4 Metern Durchmesser der größte der Welt.
Dorthin würde ich aufbrechen, so schnell wie möglich.
Näher konnte man auf der Erde dem Himmel nicht sein.
ZWEI
Die Fotos, die mich in meinem ersten Buch über Sterne am meisten beeindruckten, stammten vom damals größten Spiegelteleskop der Welt auf dem kalifornischen Mount Palomar. Der Durchmesser des Spiegels war mit fünf Metern nur halb so groß wie der des Gran Telescopio Canarias. Mount Palomar wurde 1949 eröffnet, das Observatorium auf dem Roque 2009. Sechzig Jahre astronomische Forschung schafften also gerade einmal eine Verdoppelung der Möglichkeiten. Angesichts anderer wissenschaftlicher Fortschritte kann einen das bescheiden anmuten. Erst wenn man die Aufnahmen miteinander vergleicht, wird die Entwicklung deutlich.
Nie werde ich das Schaudern vergessen, das durch meinen Körper lief, als ich zum ersten Mal ein Bild des Orionnebels sah. Ich hatte bis dahin keine Vorstellung, was ein Nebel sein konnte außer dieser undurchdringlichen grauen Masse, die bei manchen Autofahrten von der Straße aus die Windschutzscheibe hochkroch, meinen Vater nervös machte und meine Mutter dazu veranlasste, ständig „Langsamer!“ zu rufen. Solche Farben und Formen hatte ich noch nie gesehen, ich fand keine Begriffe dafür und finde sie noch immer nicht. Ein purpurner Schleier, der eine Schar von wimmelnden Lichttierchen verhüllt. Die Falten eines rosa Nachthemds, wie meine Mutter es trug, wenn sie mit meinem Vater allein sein wollte. Doch aus dem Halsloch wuchs der Kopf eines schrecklichen Pelikans. Auseinanderklaffende Gliedmaßen einer Kröte oder Eidechse, auf die sich der Schädel einer Kreuzotter zubewegt; ein schreiendes Menschengesicht mit sieben Augenschlitzen, jeder einzelne senkrecht ins schwarze Fleisch geschnitten. Doch alles war aufgehoben in einer Art erhitzter Luft, die alles umschloss und alles zum Fliegen brachte.
Heute kenne ich zwar die wissenschaftlichen Bezeichnungen für viele Phänomene, die sich in M 42 ereignen, aber wenn ich mein altes Buch von 1972 aufschlage, vorsichtig, damit es sich nicht in seine Bestandteile auflöst, höre ich immer noch Echos dieser ersten krächzenden Stimmen aus dem All, spüre Reste des wohligen Entsetzens, das mich damals packte. Ich konnte hier sein und gleichzeitig woanders, verschwinden in einer Welt, in der riesige Wesen aus Gas und Staub ihre Flügel ausbreiteten, um mich fortzutragen, weit weg von den Dingen, die mir Angst machten.
Durch das Okular meines Balkonteleskops sehe ich den Orionnebel nur als violetten Klecks, doch das mindert das Vergnügen nicht, ihn jede Nacht aufs Neue zu betrachten.
Endlich piepte der Wecker.
Nachdem Karin aufgestanden war und einen Espresso getrunken hatte, schenkte sie mir ihre volle Aufmerksamkeit. Man durfte sie nur nicht zu früh wecken; sie hasste den Morgen, und vor elf Uhr öffnete sie ihre Praxis nie.
„Vor meinem ersten Kaffee“, pflegte sie zu sagen, „hab ich nichts Menschliches an mir. Da bin ich nur eine gestaltlose Biomasse, die in der Ursuppe herumschwimmt.“
Ich erzählte ihr von meinem Plan.
Sie lauschte interessiert; manchmal umspielte ein Lächeln ihren Mund. Als ich fertig war und sie erwartungsvoll anschaute, sagte sie nur: „Gute Idee.“ Ich hätte eher einen ironischen Kommentar erwartet, sagte innig „Danke!“ und küsste sie auf die Stirn. Sie hob ihren Kopf, bis unsere Münder nur mehr durch Millimeter voneinander getrennt waren. „Darf ich mitkommen?“, fragte sie. Ich umarmte sie und nickte länger als nötig, wobei mein Kinn rhythmisch gegen ihren Rücken stieß.
Sie entwand sich mir. „Wir reden später weiter. Meine Spinnenphobikerin wartet.“
Karins psychotherapeutische Praxis hatte sich in den letzten Jahren erstaunlich entwickelt. Obwohl sie noch keine vierzig war, galt sie in Wien als eine Koryphäe für Mediation und Supervision. Sie wäre ständig ausgebucht gewesen, hätte sie nicht rigoros eine gewisse Stundenanzahl für ihre „speziellen Schützlinge“ freigehalten. So nannte sie Klienten, die ihr von ihren Freundinnen am Sozialamt vermittelt wurden und die sie meist zu symbolischen Tarifen behandelte. Das wiederum sprach sich in der Szene herum, wurde ihr dort hoch angerechnet, und so schraubte sich die Spirale ihres Ansehens stetig nach oben. Über ihre Methoden wurde viel diskutiert; zwar hatte sie eine klassische Lehranalyse über sich ergehen lassen, doch in der Praxis verwendete sie eine eigenwillige Mischung aus verschiedenen Therapieformen, von der Individualpsychologie über Charakteranalyse und Familientherapie bis hin zur Biodynamik. Dieser wilde Eklektizismus hatte ihr unter Kollegen den Spitznamen „Frank Zappa der Psychologie“ eingetragen. Ihr Säulenheiliger aber war Wilhelm Reich. Sie bewunderte sein frühes Werk, vor allem die „Massenpsychologie des Faschismus“, und seine unermüdliche politische Arbeit für die Befreiung der Sexualität. Aber auch seine spätere Lebensphase, in der er begann, seine berüchtigten Orgonakkumulatoren zu bauen – die nichts weiter waren als simple, innen mit Metall verkleidete Holzkästen –, und am Ende Wolken mit Orgonkanonen beschoss, um Regen zu erzeugen, betrachtete sie nicht mit Spott, sondern mit trauriger Sympathie. Gerne erzählte sie die Geschichte des Spaziergangs, den die Psychoanalytikerin Edith Gyömrői mit Wilhelm Reich und Otto Fenichel unternommen hatte. „Er sprach endlos über seine neue Theorie, die magische Energie des Orgon“, habe Gyömrői berichtet. „Fenichel und ich wagten nicht, uns anzuschauen, denn kalte Schauer liefen uns den Rücken hinab. Plötzlich hielt Reich inne und sagte: ‚Kinder, wenn ich meiner Sache nicht so sicher wäre, würde es mich anmuten wie eine schizophrene Fantasie.‘“ Ihren Mediationskunden aus der Wirtschaft, die sie eigentlich nicht leiden konnte, erzählte Karin derlei Anekdoten nicht; stattdessen verlangte sie horrende Honorare, die anstandslos bezahlt wurden.
Mein Beitrag zum Familienbudget war bescheidener. Die Versuche in jungen Jahren, mit Zeichnungen und Bildern meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, waren fehlgeschlagen. Wohl deshalb, weil ich auch in meinen künstlerischen Bemühungen nicht von meiner Obsession für astrale Themen lassen konnte. Meine Visionen von kollidierenden Galaxien oder der Todesstunde von Hypernovae hatten bei berufenen Betrachtern bestenfalls ein Hüsteln hervorgerufen, ein pikiertes Schulterklopfen, ein Lächeln mit schmalen Lippen. Ein paar Semester lang wollte ich Kunsterzieher werden, ehe sich meine pädagogischen Anwandlungen jäh verflüchtigten. Durch Zufall war ich als Beamter in der Magistratsabteilung MA 7 gestrandet und durfte bei Fördervergaben an Kunstschaffende mitdiskutieren. Hätte mir mit achtzehn jemand erzählt, dass ich mit fünfzig zum Beamten verkommen sein würde, hätte ich ihm eine Zeile von TheWho entgegengeschleudert: I hope I die before I get old.
Doch es war, wie es war, und unser Leben verlief unspektakulär, aber harmonisch. Niemand konnte absehen, welche Folgen unsere kleine astronomische Expedition haben würde. Die Ereignisse trafen uns völlig unerwartet, rissen uns mit, oder besser: Sie schlugen über uns zusammen.
Wenn ich wie jetzt stundenlang auf die Tür starre, erwarte ich manchmal, dass plötzlich mein Vater quicklebendig den Raum betritt, flankiert von zwei Herren in weißen Kitteln, die mir mitteilen, dass das psychologische Experiment nun abgeschlossen sei und ich gehen könne.
In diesem Moment öffnet sich die Tür tatsächlich. Jemand bringt mir mein Essen. Es ist eine grüne Brühe, in der aufgeweichte Weißbrotstücke schwimmen. Vermutlich Erbsensuppe.
Hin und wieder stelle ich mir die Frage, ob ich hierhergekommen wäre, wenn ich gewusst hätte, was mit uns geschehen würde.
Ich weiß es nicht. Ich hoffe es.
DREI
Am Abend nach der Nacht, in der ich meinen Entschluss gefasst hatte, kam Karin später als üblich nach Hause. Einer ihrer Klienten war in eine Krise geraten und Karin hatte ihm eine Doppelstunde angeboten.
„Endlich allein mit meinem Privatneurotiker“, rief sie schon in der Tür, warf ihre Tasche in eine Ecke, lief auf mich zu und umarmte mich.
Als wir dann am Küchentisch saßen und die Spaghetti aßen, mit denen ich sie überraschen hatte wollen und die mir ziemlich missglückt waren, wirkte sie erschöpft und niedergeschlagen.
„Manchmal weiß ich nicht, ob es richtig ist, was ich mache“, sagte sie und schob die Nudeln auf dem Porzellan hin und her.
„Tut mir leid“, sagte ich und zeigte auf ihren Teller. Erst verstand sie nicht, was ich meinte, dann stand sie wortlos auf, holte sich ein Joghurt aus dem Kühlschrank und setzte sich wieder hin.
„Du verstehst nicht, was ich meine, oder?“
„Erklär es mir doch einfach.“
Sie löffelte das Joghurt in sich hinein, dann blickte sie auf. Die Hand mit dem Becher schwebte reglos über dem Tisch.
„Ich habe immer öfter das Gefühl, auf der falschen Seite zu stehen.“
„Aber warum? Du hilfst doch so vielen Menschen, noch dazu fast umsonst. Was soll daran falsch sein?“
Karin warf den Becher in hohem Bogen durch die Küche in den Abfallkübel.
„Ich repariere sie nur. Sie kommen zu mir, völlig überfordert von den erbarmungslosen Gesetzen des Dschungels da draußen. Ausgebrannte, gemobbte, ausgesaugte Existenzen, voller Zorn und Verzweiflung. Nach ein paar Stunden bei mir beruhigen sie sich wieder und werden nicht auffällig. Ich helfe dem System, nicht den Menschen.“
„Du bist zu streng mit dir selbst.“ Ich nahm die Teller vom Tisch, entsorgte die Nudeln, stellte mich hinter Karin und massierte ihre Schultern.
„Was soll ich da sagen? Ich verteile ein paar Almosen, das ist alles.“
„Immerhin unterstützt du Künstler“, sagte sie.
„Ich verteile nur Geld, das ihnen ohnehin zusteht. Ich arbeite im Bauch des Leviathan.“
Sie seufzte. „Vielleicht vergeuden wir ja beide unser Leben. Aber du hast wenigstens deinen Urknall.“
Ich hockte mich neben sie und legte meine Hand auf ihre Wange.
„Du mochtest ihn sehr, nicht wahr?“
Sie nickte und wandte ihr Gesicht ab.
Ein paar Minuten lang schwiegen wir. Ich setzte mich wieder ihr gegenüber. Sie fuhr mehrmals mit den Fingern durch ihr blondes Haargestrüpp, als müsste sie Spinnweben daraus entfernen. Dann bildete sie mit ihren Handflächen ein V, stützte den Kopf darauf und schaute mich an. Das helle Grau ihrer Iris flackerte kaum merklich. Ich kannte diesen Blick. Er schnitt durch meine äußere Schale wie ein Messer durch einen Pudding. Karin Rauch, die Frau mit den Röntgenaugen.
„Und du gehst jetzt unter die Reisenden?“
Da war er, der sanfte Spott, den ich schon am Morgen erwartet hatte. Ich konnte ihn gut nachvollziehen. Grundsätzlich hielt ich Reisen ja für eine Seuche des gelangweilten Bürgertums. Das war kein sonderlich origineller Gedanke, aber er passte gut zu meinem Unwillen, mich den Prozeduren eines Ortswechsels zu unterziehen. Allein das Wort Packen löste bei mir sofort Übelkeit und Kopfschmerzen aus. Dieser widernatürliche Vorgang, Gegenstände, die zum Überleben nötig waren und die sich an vertrauten Plätzen befanden, in Koffern zu verstauen, um sie dann ein paar hundert Kilometer weiter südlich herauszunehmen und irgendwohin zu legen, wo man sie garantiert nicht wiederfand! Und wozu das alles? Nur um dann an einem Ort, der zufällig am Wasser oder in den Bergen lag, die Einwohner mit Geld dazu zu bewegen, ihre zu Recht feindselige Haltung gegenüber Touristen hinter einer Maske der Untertänigkeit zu verstecken. Und die invasiven Horden nannten dann ihre Opfer auch noch „Einheimische“, ein niederträchtiges Wort; es weckte Assoziationen an Marmeladegläser und eingelegtes Gemüse, an Anstalten für schwer erziehbare Kinder oder an Lebewesen in Formaldehyd, die in den Vitrinen verfallender Museen den Blicken Neugieriger ausgesetzt waren.
Die sogenannte Urlaubsreise, hatte ich Karin einmal verkündet, ist nichts als eine camouflierte Form der Eroberung. Neokolonialismus im Mäntelchen aufgeklärten Interesses.
Karin fand das hysterisch; sie betonte gerne, wie anregend es sei, auf Reisen neue Leute kennenzulernen. Dem musste ich widersprechen. Was war daran anregend, sich mit unbekannten Menschen stundenlang in zähem Smalltalk zu ergehen, solange man nur einen einzigen Roman von Cortázar oder Julian Barnes noch nicht gelesen hatte?
Aber du kannst ja am Strand lesen, sagt Karin. Wozu soll das gut sein, wenn ich jedes Mal beim Umblättern ein halbes Kilo Sand aus den Seiten schaufeln muss? Außerdem reagiert mein Körper feindselig auf die Kombination von Sonne, Sand und Salz, die Folgen reichen von Konjunktivitis bis zu einer Vorstufe von Gürtelrose.
Karin behauptet, meine liberale Oberfläche verberge ein weitverzweigtes Netz aus Ängsten und Vorurteilen, wie bei einem alten Möbelstück, unter dessen glänzendem Furnier Holzwürmer ihre Gänge gegraben hatten. Schon saß ich wieder in der psychologischen Falle.
„Ja“, sagte ich. „Ich gehe unter die Reisenden. Und ich bin sehr froh, dass du mitkommst.“
Sie lächelte. „Ich werde mir doch nicht entgehen lassen, dabei zu sein, wenn mein Mann seine alten Neurosen über Bord wirft. Wenn schon nicht für mich, dann wenigstens für die Sterne.“
„Das siehst du falsch“, begann ich, aber Karin unterbrach mich sofort.
„War nicht ganz ernst gemeint“, sagte sie und streifte mit ihren Zehen mein Schienbein. „Wann soll es denn losgehen?“
„Ich muss mich erst vorbereiten. Flüge und Hotelzimmer suchen. Und vor allem das Observatorium kontaktieren. Ich weiß ja noch gar nicht, ob irgendwelche Hobbyastronomen da überhaupt Zutritt haben.“
„Schön, dann find es heraus. Aber beeil dich. Ich bin schon ganz wild darauf, die Praxis für ein paar Wochen zuzusperren.“
„Morgen früh fange ich an.“
„Fein“, sagte Karin. „Und gleichzeitig kannst du ja zur Sicherheit schon zu packen beginnen.“
VIER
Mein Vater besuchte mich nach seinem Tod regelmäßig. Oder besser: seine Stimme. Sie redete in meinem Kopf. Man nennt das, sagt Karin, eine akustische Halluzination. Das leuchtete mir ein, ich glaubte nicht an Geister. Und doch war sie an manchen Tagen verblüffend klar vernehmbar, diese Stimme.
So schnell, wie ich gehofft hatte, wurde ich dann doch nicht zum Reisenden. Flüge hatte ich rasch gefunden, man konnte zweimal pro Woche von München aus direkt die Inselhauptstadt Santa Cruz de La Palma erreichen. Für die Hotelsuche benötigte ich schon mehr Zeit; ich hatte eine ganze Liste an Kriterien, die eine Unterkunft erfüllen musste, bevor ich einen Fuß in sie setzte. Insbesondere die Schlafstatt musste sorgfältig geprüft werden. Wenn ich schon riskierte, Nächte in fremder Umgebung zu verbringen, so wollte ich ganz genau wissen, wie das Ding beschaffen war, auf dem ich um Schlaf ringen würde.
Karin hatte extra für mich das Wort Bettenkontrollfreak erfunden.
Ich war ein wenig aus der Übung, aber am Ende entdeckte ich ein zwei mal zwei Meter zwanzig großes Doppelbett samt Allergikerbettwäsche in einem Aparthotel nahe der Hauptstadt.
Als ich mich endlich in die Homepage des Observatoriums vertiefen konnte, fragte ich mich, weshalb ich bisher noch nie herauszufinden versucht hatte, ob es für die Öffentlichkeit zugänglich war. Vielleicht war mir bisher der Gedanke, einfach dorthin reisen und es besuchen zu können, zu bedrohlich erschienen. Und auch jetzt verbrachte ich eine Stunde mit der Betrachtung der Fotos und Webcam-Bilder, dem Abspielen der Videos und dem Lesen der neuesten Forschungsberichte, ehe ich es wagte, auf den Button VISITS zu klicken.
Das Erste, das ich erfuhr: Das Observatorium war open to the general public.
Das Zweite: Nocturnal visits are not permitted.
Diesen Rückschlag nahm ich mit einer Gelassenheit, die mich selbst überraschte. Gut, dann also nicht bei Nacht. Den gewaltigen Spiegel konnte ich auch bei Tageslicht bewundern. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dorthin zu fahren, also fuhr ich dorthin. Die Gravitation des Gran Telescopio Canarias hatte mich erfasst wie ein schwarzes Loch ein flüchtiges Photon, ich konnte nicht mehr entkommen. Auch von einem Kalender des kommenden Monats mit einunddreißig durchgestrichenen Besichtigungstagen ließ ich mich nicht entmutigen. Ich fand eine E-Mail-Adresse und verfasste eine höfliche Anfrage. Die automatische Antwort kam prompt:
Dear Sir/Madam,
we regret to inform you that there are no available visits with guide for the next months at this moment to the Roque de los Muchachos Observatory.
We are sorry about any inconvenience.
Yours faithfully
Roque Visits.
Ich sank in meinen Sessel zurück und ließ die Arme fallen.
Hätte ich in diesem Moment aufgegeben, das Mobiliar meines Aufenthaltsortes wäre heute weniger karg. Und Karin könnte weiterhin ihren Schützlingen Trost spenden, einen zerbrechlichen Trost, leicht und süß wie Windgebäck. Doch bevor ich mich endgültig geschlagen gab, kam mir die rettende Idee: Roland. Wozu hat man einen besten Freund? Mit seiner Hilfe würde es vielleicht doch noch funktionieren.
Roland Gerber war der Leiter der Urania und der Kuffner-Sternwarte und ich verbrachte mindestens zweimal in der Woche ein paar Stunden mit ihm. Er war ein hochaufgeschossener, spindeldürrer Mann mit einem schier unerschöpflichen Reservoir an Energien. Unentwegt zappelte und fuchtelte er mit den Händen, als stünde er unter Strom, schien es aber selbst nicht wahrzunehmen. Er gab gerne Tipps wie „nur die Ruhe bewahren“ oder „ja keine Hektik“, während selbst der ausgeglichenste Mensch in seiner Gegenwart nervös und fahrig wurde. Seine Leidenschaft für die Astronomie hatte messianische Züge, und seine Sternwarten-Führungen waren ein Ereignis. Als ich ihm vor etwa zehn Jahren zum ersten Mal begegnete, hielt er vor einer Schar pubertierender Jugendlicher einen Vortrag über die Dimensionen des Weltalls; er trug einen rosafarbenen dreiteiligen Anzug wie Eric Idle in „Sinn des Lebens“ und begann damit, den Galaxy-Song aus dem Monty-Python-Film mit beachtlicher Stimme zu schmettern. Den Dreizehn-, Vierzehnjährigen war anzumerken, dass sie mit so etwas nicht gerechnet hatten. Einige kicherten und feixten, zwei kannten das Lied und summten mit. Nach seiner Gesangseinlage verbeugte sich Roland, nahm den Applaus entgegen und erklärte dann akribisch jedes einzelne astronomische Detail aus dem Songtext. Die Schüler lauschten ergeben, ich stellte mich hinter sie und hörte ebenfalls zu.
Nach dem Vortrag kam Roland auf mich zu und schüttelte mir die Hand. Er hielt mich für den Lehrer und lobte die Aufmerksamkeit meiner Klasse. Als ich ihm erklärte, dass ich mit den Jugendlichen nichts zu tun hatte und nur seinen Ausführungen folgen wollte, lachte er geschmeichelt und lud mich auf einen Espresso in die Bar der Urania ein. So begann unsere Freundschaft.
Noch am selben Tag ließ er mich zum ersten Mal einen Blick durch das große Teleskop der Urania-Sternwarte werfen. Es war erst später Nachmittag, aber Roland konnte es nicht erwarten, mir sein Lieblingsspielzeug vorzuführen. Wir stiegen die steile Treppe zum Herzstück der Anlage hinauf, ich kam schnell ins Schwitzen und gab vor, den Ausblick auf den Donaukanal und den Prater genießen zu wollen, das im flachen Lichteinfall aufgleißende Wasser, den angestrahlten Ring über den Dächern, doch Roland duldete keine Pause und trieb mich hektisch nach oben. Als wir angekommen waren, sperrte er eine schmale Tür auf und ließ mich eintreten.
„Na“, fragte er, „was sagen Sie?“
Auf einem schweren Sockel, dessen Basis einer Badezimmerwaage für Riesen ähnelte, waren drei parallele Rohre montiert. An der Wand des kreisförmigen Raumes standen ein paar Monitore auf Schreibtischen und Regalen. Eine vierstufige Holztreppe mit Geländer, auf Rollen. Über uns eine gewaltige Metallkuppel.
„Schön“, sagte ich, noch ein wenig außer Atem vom Aufstieg.
„Ich werde Ihnen zuerst die Sonne zeigen“, sagte Roland. Er drückte auf einen Knopf, und mit lautem Ächzen öffnete sich das Kuppeldach und gab ein Stück Himmel frei. Roland tippte etwas in eine Tastatur, ich schaute nach oben, und mit einem Mal verlor ich das Raumgefühl. Etwas begann sich zu drehen, bis die Fernrohre genau auf den Himmelsstreifen gerichtet waren. „Was bewegt sich hier eigentlich“, fragte ich, „der Boden oder die Kuppel?“
Roland sah mich entgeistert an. „So was fragen normalerweise nur die Kinder. Was, glauben Sie, lässt sich einfacher drehen, ein Haus oder ein Dach?“
„Verstehe“, sagte ich leise.
Roland nahm drei silberne Scheiben aus einem Regal und hielt sie mir hin.
„Sonnenfilter“, erklärte er. „Die werden Sie brauchen, sonst brennt das Licht ein Loch in Ihren Kopf.“ Er stieg auf die Treppe und montierte die Scheiben auf den Rohren. Nach prüfenden Blicken durch alle drei Okulare winkte er mir, und ich stellte mich neben ihn auf die Plattform der Treppe. Er zeigte auf das kleine Fernrohr.
„Das hier“, sagte er, „braucht Sie nicht näher zu interessieren. Es ist nur der Sucher.“ Seine Hand flog hoch und verharrte ein paar Sekunden in der Luft, ehe sie auf dem Schaft des mittleren Teleskops landete. „Dieser Refraktor“, verkündete er feierlich, „kann schon etwas mehr.“ Er trat zur Seite, und ich beugte mich zum Okular hinunter. Ein erster Blick.
Die Sonne, eine gelbflackernde Scheibe mit klar konturiertem Rand. In der oberen Hälfte waren deutlich drei schwarze Flecken zu erkennen, Melanome auf vergilbter Haut. Jeder einzelne sicher größer als die Erde.
Ich hatte vor, den Anblick auf mich wirken zu lassen, doch Roland nahm meine Schulter und zog mich wieder hoch.
„Jetzt der Reflektor!“, befahl er. „Der Spiegel hat zwar nur dreißig Zentimeter Durchmesser, aber für Protuberanzen reicht es. Schauen Sie auf neun Uhr!“
Durch das Spiegelteleskop erschien die Sonne als scharlachrot leuchtender Kreis. Und tatsächlich, aus der Mitte ihrer rechten Seite schoss eine orangefarbene Flamme in den Himmel, zuerst schmal, dann breiter werdend, am Ende um neunzig Grad gekrümmt. Ein riesiges Insekt mit glühenden Flügeln, das seinen Stachel in die Oberfläche der Sonne stieß.
Roland fand meinen Enthusiasmus für die Schönheit des Weltalls irgendwie rührend, meine mangelnden Kenntnisse der Kosmologie hingegen erschütternd. So versuchte er mir zu erklären, dass die Wissenschaftler am CERN-Institut im Teilchenbeschleuniger Bleikerne mit annähernder Lichtgeschwindigkeit aufeinanderschossen, nach fast fünfzig Jahren Suche das Higgs-Boson entdeckt hatten und der Weltformel auf der Spur waren, die die Gesetze der Gravitation und der Quantenmechanik vereinen sollte. Ich verstand gar nichts und war auch kein gelehriger Schüler, bei Weltformel dachte ich nur an meinen verbiesterten Mathematiklehrer und vom Urknall verstand ich gerade so viel, dass es ihn wohl einmal gegeben hatte und dass sich kein Mensch vorstellen konnte, wie aus einer Art heißem Stecknadelkopf die Galaxienhaufen entstanden waren, die ich von der Website des Weltraumteleskops Hubble kannte. Roland gab nicht auf, er schüttelte abwechselnd den Kopf, lachte und vergrub seine Stirn zwischen den Händen.
„Als das All so groß war wie ein Stecknadelkopf“, sagte er einmal, „war schon alles gelaufen.“ Wir saßen im Café Museum und ich wollte eigentlich zu ganz anderen Themen seine Meinung hören. Er nahm ein Blatt Papier und einen Stift aus der Rocktasche und notierte mit großen runden Nullen eine Zahl: 0,0000000000000000000000000000000001. „Schau“, sagte er und hielt mir den Zettel hin, „das ist der Zeitpunkt nach dem Urknall, ab dem wir schon glauben, Bescheid zu wissen. In Sekunden. Wir können noch nicht alles experimentell beweisen, aber zumindest beschreiben. Da hatte der Kosmos noch nicht einmal den Durchmesser eines Atomkerns. Nur was davor war, ist noch ein Rätsel.“
„Und“, fragte ich ohne den Funken einer Einsicht, „was war vor dem Urknall?“
„Oh mein Gott“, seufzte Roland, „du bist doch nicht einer von diesen ambitionierten Katholiken? Sag bloß, du hast heimlich Theologie studiert?“
„Kunstgeschichte“, sagte ich. „Abgebrochen.“
„Sehr gut. Beides sehr gut. Also hör zu: Über die Phase zwischen dem Urknall und der Planck-Zeit, einer Zahl, in Sekunden ausgedrückt, mit einer Null vor und vierundvierzig Nullen hinter dem Komma –“
„Halt“, sagte ich schwach.
„In Ordnung, keine Zahlen mehr. Über diese sehr kurze Periode“ – er betonte sehr wie ein Schauspieler in einer schlechten Kindertheater-Aufführung, seine Hände vollführten dabei bizarre Bewegungen – „wissen wir so gut wie nichts, wir können nur spekulieren. Aber eines ist sicher: Die Dimensionen von Raum und Zeit, wie wir sie heute kennen, existierten noch nicht. Eine lineare Zeit gab es nicht. Daher hat die Frage, was vor dem Urknall war, keinen Sinn. Alles klar?“
Nach meinem Fehlschlag mit den Roque Visits rief ich also Roland an und bat ihn um ein Treffen. Noch am selben Abend saßen wir in einem Gasthaus im vierten Bezirk, das er vorgeschlagen hatte. Es hieß schlicht Wolf und ich fürchtete, wieder einmal mit seltsamen Gerüchen in Kontakt zu kommen, denn Roland hatte ein abartiges Faible für Innereien aller Art. Keine Drüsen, keine Zotten, keine Darmverschlingungen, die er nicht schon probiert hatte.
Das Wolf