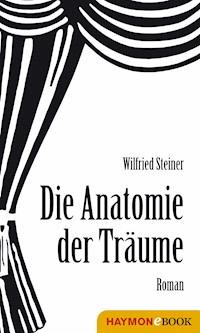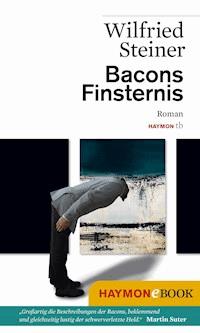
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über die Liebe und die Leidenschaft zur Kunst – leichtfüßig, raffiniert, rasant. Brillante Mischung aus Kunst-, Liebes- und Spannungsroman Arthur Valentin, Antiquar und Kunstliebhaber mit Hang zur Lethargie, wird nach fünfzehn Ehejahren von seiner Frau verlassen und fällt in ein tiefes Loch aus Selbstmitleid und Resignation. Ein gewöhnlicher Fall von Midlife-Crisis? Nicht, wenn Francis Bacon ins Spiel kommt! Als Arthur eines Tages eher zufällig in eine Ausstellung des weltberühmten Malers stolpert, ist er sofort wie elektrisiert von dessen apokalyptischer Bilderwelt. Er beginnt, der Ausstellung quer durch Europa hinterherzureisen und trifft so überraschend auf seine Ex-Frau mit ihrem neuen Verehrer - der offenbar einen Kunstraub plant … Den Kunsträubern auf der Spur! Arthur nimmt die Verfolgung auf, unterstützt von seiner liebenswerten Kollegin Maia aus dem Antiquariat, die ihm seit der Trennung eine moralische Stütze ist. Gemeinsam tauchen sie immer tiefer in die Welt von Kunstraub und -fälschung ein und scheinen sich dabei näherzukommen - wäre da nicht noch Maias alte Liebe Thomas, der ihnen bei den Nachforschungen hilft, was Arthur ein Dorn im Auge ist! Ein Buch für Kunstliebhaber und Bacon-Fans "Großartig die Beschreibungen der Bacons, beklemmend und gleichzeitig lustig der schwerverletzte Held", zeigt sich Starautor Martin Suter begeistert. Mit "Bacons Finsternis" ist Wilfried Steiner eine romantische Komödie und ein genialer Kunstroman in einem gelungen. Ein Muss für Kunstliebhaber und Bacon-Fans - und alle, die es noch werden wollen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried Steiner
Bacons Finsternis
Roman
I Ein Abschied
September –Dezember 2003
Eins
„Wenn wir nach Hause kommen“, sagte Isabel, „müssen wir uns trennen.“
„Gute Idee“, sagte ich und lachte. Wir saßen in einer Taverne am Strand, Isabels nackte Zehen gruben sich in den Sand, es roch nach Salzwasser und altem Frittieröl. Ich hatte gerade den letzten Bissen Dorade mit einem Schluck dieser Weine hinuntergespült, die in Griechenland so gut schmeckten. Aber wehe, man nahm sie mit nach Hause. Da offenbarten sie schonungslos ihre Mittelmäßigkeit. Allerdings schmeckten sie auch in Griechenland nur gut, wenn man Griechenland mochte. Ich mag Griechenland nicht besonders.
Die letzten beiden Wochen mit Isabel in einem von zahlreichen Kakerlaken bewohnten Apartment in Matala waren nicht ganz reibungslos verlaufen. Nicht gerade zweite Flitterwochen. Aber es war nicht wichtig. Morgen würde ich wieder in meinem Antiquariat sein, Isabel in ihrem Filmclub, Kreta würden wir nicht vermissen. Und Kreta uns auch nicht. Wir verbrachten unsere Zeit, wir bewohnten unsere Welten, wir liebten uns, wie man sich eben liebt nach fünfzehn Jahren. Wir hatten einander. Das war nicht wenig. Mehr konnte man vom Leben nicht verlangen.
Isabel nahm meine Hand. Entwand mir das Weinglas, energisch, und stellte es neben den Grätenteller. Irgendetwas hatte ihre Augen verdunkelt, das Blaugrau wich einem düsteren Anthrazit. Brach ein Sturm herein über Kreta? Oder war da nur eine winzige Wolke, direkt über ihrer Stirn?
„Hör mir zu“, sagte Isabel. „Es ist mein Ernst.“
Doch eine Sturmflut im Anmarsch. Der Boden unter meinem lächerlichen Tavernenstühlchen schwankte. Ich begriff gar nichts. Nur die Bedrohung.
„Es tut mir leid“, sagte Isabel. „Aber ich kann nicht mehr.“
Der Kellner kam, stellte zwei Gläser Ouzo vor uns auf den Tisch. Er sagte ein Wort, das man erwidern musste. Es bedeutete so viel wie „manchmal bin ich froh, dass Leute, die ich zutiefst verachte, für meinen Lebensunterhalt aufkommen“. Auf Griechisch hieß das „Jamas!“
„Jamas“, sagte ich.
„Jamas“, sagte Isabel.
Dann schwiegen wir.
Es war wohl an mir, etwas zu sagen. Aber was? „Ist das dein Ernst?“ kam nicht in Frage, das hatte sie ja schon gesagt. Es war ihr Ernst. Aber es konnte nicht ihr Ernst sein. Undenkbar. Ich trank den Ouzo in einem Schluck aus und sprach aus dennoch rostiger Kehle den dümmsten aller möglichen Sätze:
„Geht es um jemand anderen?“
Gut, ich hätte auch „hast du dich verliebt?“ sagen können, die pathetischere Variante, oder mit einem kühnen Sprung, der die selbstgebastelte Hürde gleich mitüberwunden hätte, „wer ist es?“
Aber ich sagte eben, was ich sagte. Die kretische Flut zischte herein, spritzte mir ein wenig Salzwasser ins Auge. Dort gehörte es auch hin, mittlerweile. Salz zu Salz, Wasser zu Wasser. Ich war froh, wenn wir endlich heimkamen.
„Du hast nichts begriffen“, sagte Isabel. Das wusste ich. Das war mir klar. Das stand außer Zweifel.
„Wir führen doch“, sagte ich schwach, „ein angenehmes Leben, gehen uns selten auf die Nerven, und manchmal haben wir viel Spaß miteinander.“
„Das ist genau das Problem, Arthur“, sagte Isabel. „Dass du allen Ernstes glaubst, das würde reichen. Aber mir ist das zu wenig. Ich bekomme keine Luft mehr.“ Sie fischte die Zigaretten aus ihrer Tasche und zündete sich eine an.
„Dann rauch eben nicht so viel“, sagte ich. Ich wollte sie zum Lachen bringen. Oder mich. Mittlerweile trank ich den Fusel aus der Karaffe, was meinen Würdefaktor nicht erhöhte. Isabel lachte nicht, sie stieß den Rauch so heftig aus, dass es klang, als bliese sie durch ein Bambusrohr einen Curare-Pfeil in meine Richtung. Zack! steckte er mir schon mitten in der Brust.
„Ist es“, ich versuchte es erneut, „der Altersunterschied?“ Hätte ja sein können. Immerhin zwölf Jahre. War es aber wohl doch nicht, wenn ich ihren Blick richtig deutete.
Wir schwiegen wieder ein bisschen. Das Meer hatte sich mittlerweile seinen dunkelgrauen Schlafanzug angelegt und wälzte sich unruhig von einer Seite auf die andere. Ich nahm die Gabel und trennte den Kopf der Brasse vom Rückgrat. Henker eines toten Fisches. Ich würde wieder zu rauchen beginnen, so viel war klar.
„Was ist es denn, was dir fehlt?“ Einen hatte ich noch. „Ein Abenteuer?“
„Vielleicht“, sagte Isabel, und etwas wie Verbitterung huschte über ihre Züge. Und Mitleid, das auch. „Aber nicht so, wie du dir das vorstellst.“
Woher wollte sie wissen, was ich mir vorstellte? Gut, in fünfzehn Jahren Ehe begegnete man so mancher Spukgestalt aus der Alptraumzone des anderen. Manche Ungeheuer konnten sich einfach nicht so lange verstecken. Aber was wusste man wirklich voneinander? Nichts, wie ich gerade feststellen musste. Absolut nichts.
„Was“, fragte ich, „stell ich mir denn vor?“
„Schau“, sagte Isabel, und jetzt wurde ihr Tonfall milder, aber nicht weniger bedrohlich. Ihre Studenten mussten diese Stimmlage kennen. Vor allem die unterbelichteten unter ihnen. Die unbelehrbaren. Die hoffnungslosen Fälle.
„Es ist mir alles zu eng geworden. Spießig, ritualisiert, vorhersehbar, verstehst du? Immer der gleiche Trott. Nichts Aufregendes mehr, keine Überraschungen.“
Der Kellner freute sich, dass ich noch eine Karaffe bestellt hatte. Er schleppte etwas aus dem Schuppen in die Taverne. Es war ein Plattenspieler. Der Mann fing an, Musik aufzulegen. Die erste Nummer war Owner of a Lonely Heart. Ich schwöre. Isabel ist meine Zeugin. Der Kellner hatte eine Begabung als Discjockey. Fingerspitzengefühl.
„Wie schön“, sagte ich, nahm eine Zigarette aus Isabels Packung und zündete sie an. „Sie spielen unser Lied.“
Isabel sah mich fassungslos an. Mir war nicht ganz klar, ob es an meinem Satz lag oder an der Tatsache, dass ich im Begriff war, nach zehn Jahren meine erste Zigarette zu rauchen. „Das war nicht sehr klug“, sagte Isabel, und ich war mir immer noch nicht sicher, was sie damit meinte. Die ersten Züge fuhren mir mit glühenden Dolchen in die Lunge, ich hustete, aber der Schmerz war gut, so tröstlich konkret. Verständlich, nachvollziehbar, dem Ursache-Wirkungs-Prinzip folgend, et cetera.
Hinter einem Felsen kroch der Mond hervor, diese nachtaktive Kellerassel. Auch am Funkeln der ersten Sterne konnte man sich erfreuen, wenn man wollte.
„Eigentlich doch ganz schön hier“, sagte ich. „Wollen wir nicht noch eine Woche dranhängen?“
„Ach Arthur“, sagte Isabel, „sei nicht kindisch. Komm, lass uns gehen.“
Aber ich wollte nicht gehen. Ich hielt mich an meiner Karaffe fest. Starrte abwechselnd auf Isabel und die Glut meiner Zigarette. War kurz davor, den Kopf in den Sand zu stecken. Buchstäblich. Dann hätte ich allerdings die wunderbare Musik nicht mehr gehört. I Only Have Eyes for You. Der Mann an den Tellern zog sein Pärchenbeschallungsprogramm durch, ohne Erbarmen. Isabels Gemütslage schien sich nicht ganz damit zu decken. Verliebt war sie jedenfalls nicht. Sie winkte dem Kellner, sie wollte zahlen. Ich wollte noch Wein. Der Kellner blickte von ihr zu mir und wieder zu ihr. Er wartete auf eine Entscheidung. Isabel und ich stritten. Vor allem ich stritt. Es war schön. Es war ein richtiger Ehestreit. Die Chancen, dass es unser letzter war, standen nicht schlecht.
Wir zahlten natürlich, ich bekam keine neue Karaffe mehr. „Es hat doch keinen Sinn, Arthur. Das macht es doch nicht besser.“ Isabel wollte mich stützen, als ich mich erhob, doch ich ließ es nicht zu. „Schau“, sagte ich in einer letzten Aufwallung von Trotz und streckte meine bebende Rechte in Richtung eines besonders hellen Sterns, „Venus!“
„No Venus“, sagte der Kellner. „Wega. Venus tomorrow morning.“
Ich wollte ihm gegen sein Hobbyastronomenschienbein treten, verfehlte es aber knapp und schlug der Länge nach hin, mit dem Gesicht voran in den Sand. Schmeckte nicht schlechter als der Wein, der Sand. Isabel stöhnte entnervt, es war ein dem venusfreien Himmel entgegengeschleudertes Ich-habe-die-richtige-Entscheidung-getroffen-Stöhnen, ein Stöhnen als Zeugenanrufung, das keinen Widerspruch duldete.
Sie zog mich hoch, es ging ganz leicht, ich hatte mich ergeben.
Auf dem Weg zurück ins Apartment sagte ich nichts. Es war anstrengend genug, meine Schritte zu koordinieren. Fuß vor Fuß, langsam und würdevoll, die Choreografie eines Verlorenen.
Isabel ließ mich vor der Haustür auf den Boden sinken wie eine Einkaufstasche, die zu schwer war, und schloss die Tür auf. Ich sah sofort, dass das zwei Wochen lang vergeblich verlangte, dann erbetene, am Ende geradezu erflehte Kakerlakenvernichtungsmittel endlich zum Einsatz gekommen war. Nicht, dass die Viecher jetzt weg waren. Eher im Gegenteil. Sie waren von der chemischen Attacke nur derart geschwächt, dass sie nicht mehr flüchten konnten, als das Licht anging. So war es uns vergönnt, zu sehen, wie viele es wirklich waren.
Isabel reagierte nicht. Es war erstaunlich. Sie schien sie nicht wahrzunehmen. Wie ein Luftkissenboot schwebte sie über das Gewimmel, hin zum Kühlschrank. Stützte sich für einen Moment, unendlich müde, mit beiden Händen auf, ließ den Kopf nach vorne fallen und atmete durch. Eins der Tiere kroch über ihr rechtes Handgelenk. Sie öffnete die Kühlschranktür, nahm eine Flasche Wasser heraus und leerte sie in einem Zug. Die Kakerlaken waren nicht da. Ich war nicht da.
Lag es an mir? Hatte ich schon Halluzinationen? Ich trat auf ein wuselndes Häufchen, es knirschte. Zog den Turnschuh aus und betrachtete die Sohle. Da war was, zweifellos. Braungelb, verschmiert. Ein Chitinpanzer, mit herausgeplatzten Eingeweiden am Sohlengummi festgeklebt.
Isabel streifte Hose und T-Shirt ab, faltete sie sorgfältig zusammen und legte sie auf die Arbeitsplatte der Küche. Einfach drauf auf die Brut. Sie zog die Tür zu unserem Schlafzimmer auf und schloss sie wieder hinter ihrem.
Das Schöne an einem Apartment ist das Extrazimmer. WoGefahr ist, wächst das – ach, vergiss es, Arthur. Ich legte michjedenfalls nicht gleich auf die rettende Zwergencouch. Es gab auch noch Arbeit.
Ich ging auf Kakerlakenjagd, bewaffnet mit beiden Turnschuhen, entfesselt vor Wut. Erwischte sie überall, selbst auf unserem, ihrem, meinem Frühstücksbrot. Egal, ich brauchte kein Frühstück mehr, nicht in diesem Leben. Ich war der Rächer meiner selbst. Bis Isabel von innen an die Schlafzimmertür klopfte, als wollte sie einen amoklaufenden Nachbarn zur Räson bringen.
Irgendwann rollte ich mich auf dem Küchenboden inmitten der kleinen Leichen zusammen, schluchzte ein bisschen und entsorgte im Liegen unsere Ouzo- und Wein-Reste, bis ich Isabel und mich eng umschlungen auf dem Rücken einer strahlend weißen Riesenassel in den kretischen Morgenhimmel fliegen sah, dem Venusaufgang entgegen.
To-morrow, and to-morrow, and to-morrow. Wie, was, Wega?
Zwei
Zurück in Wien, ging alles ganz schnell. Isabel zog aus, mit einer Entschlossenheit, als hätte sie mich in flagranti mit ihrer besten Freundin auf der Toilette ihres Lieblingsrestaurants erwischt. Sie stapelte ihre Sachen in Bananenkisten, die sie gemeinsam mit mir völlig unbekannten Menschen, die mich stets freundlich grüßten, aus der Wohnung trug. Ich grüßte höflich zurück, meist unrasiert, mit einem Glas in der Hand, an irgendeine Tür gelehnt, schwankend schon am Vormittag. Ich war die Gelassenheit in Person. Als der Lieferwagen mit der letzten Schachtel außer Sichtweite war, winkte ich ihm nach, rittlings auf dem Fensterbrett. Der Termin bei unseren Anwälten eine Woche später dauerte keine halbe Stunde. Schließlich waren wir beide Anhänger der Vernunft, Gegner jeglicher Sentimentalität.
„Also dann“, sagte Isabel danach, die Herren Juristen hatten sich bereits zurückgezogen.
„Bis irgendwann“, sagte ich. Sie ließ ihre Hand in meiner liegen, länger als erwartet. Ein Blattschuss für meine Contenance. So ließ ich mich hinreißen und sagte doch noch was.
„Sehen wir uns wieder?“ Meine Stimme klang gar nicht gut. Untrocken-unmännlich, irgendwie tränendurchweicht.
„Vielleicht“, sagte Isabel, ihre Hand schnellte zurück. „Als Freunde. Wenn du dazu bereit bist.“
Das war zu viel. Selbstinduzierte Niederlage, wider besseres Wissen, Knieschuss stehend aus eigener Waffe, et cetera. Wenigstens drehte ich mich nicht noch einmal um, als ich elegant davonkroch, nach Aktivierung meiner spärlichen Restwürde, hocherniedrigten Hauptes.
Der Vorteil von Isabels Verschwinden: mehr Raum für mich. Die Löcher, die sie hinterließ, erweiterten mein Territorium. Im Badezimmer, wo der Kampf um die besetzten Gebiete immer am heftigsten getobt hatte, durfte ich mich endlich ausbreiten. Die Frage war nur: womit? Die Plätze, die ihre Videos und DVDs in unseren labyrinthischen Regalsystemen belegt hatten, waren frei. Kein Ridley Scott, kein John Carpenter mehr zwischen meinen Büchern. Endlich musste ich meinem Tod des Vergil, limitierte Sonderauflage, nicht mehr zumuten, sein Dasein an der Seite von Bad Taste zu fristen.
Isabel schrieb und lehrte über Film. Spezialgebiete: Fantastik, Horror, Science-Fiction. Hoher Glamourfaktor. Ihre wissenschaftliche Karriere hatte zwar höchst unscheinbar begonnen (Studium der Publizistik), doch vor fünf Jahren kam der Durchbruch: Ein ebenso kleiner wie legendenumrankter Verlag, spezialisiert auf poststrukturalistische Theorien, hatte ein Manuskript von ihr angenommen. Der Einbruch des Entsetzens. Versuch über Alien I–III. Auf dem Umschlag des Bandes war ein Foto von ihr abgedruckt, auf dem sie aussah wie Sigourney Weaver. Seither nannten ihre Freunde sie Ripley. Ich auch, gelegentlich. Für mich hatte sie allerdings immer schon ausgesehen wie Sigourney Weaver, nur schöner.
Isabel erhielt Lehraufträge an Filmakademien, wurde interviewt, wann immer es um Entsetzen ging, schrieb Kritiken zu allen Filmen, in denen irgendein Element auftauchte, das den altvorderen Cineasten nicht ganz geheuer war. Ihr größter Stolz war eine nahezu regelmäßige Kolumne in einer Hamburger Wochenzeitung. Ihre Freunde wurden jünger und dandyhafter, Sonnenbrillen in stockdunkler Nacht, Lederjacken bei Bruthitze; ich wurde mitgeschleppt zu überfüllten Splatterabenden bei Carpaccio, Blutwurst und Sashimi. Wir saßen auf plüschbezogenen Sofas in Videotheken, in die sich tagsüber kein Schwein verirrte.
Ich mochte ihre neuen Freunde ganz gern. Vor allem aber mochte ich es, wenn sie zu Hause war. Mir ihre Filme vorführte, mir ganz allein. Eine Hand verirrte sich immer wieder zu mir, die andere gehörte der Fernbedienung. Zwanzigmal konnte sie manche Szenen zurücklaufen lassen, um mir ein bestimmtes Detail aus The Thing oder Braindead zu erklären. Es gab Momente, da verhalf uns das Grauen auf dem Bildschirm zu wohligen Schauern. Zwei Teenager im Horrorkino, aneinandergeschmiegt, dem Verbotenen hingegeben. Nur die Tüte Popcorn ersetzten wir durch die Ergebnisse meiner Küchenambitionen, das große Cola durch eine Flasche Bordeaux oder Chardonnay. In Elephant Man von David Lynch, einem von Ripleys Lieblingsfilmen, gab es eine Szene, in der John Merrick, das deformierte Wesen, vom Mob durch einen U-Bahn-Schacht gejagt und in einem Pissoir in die Ecke gedrängt wird. Als alle Fluchtwege von der Meute versperrt sind, öffnet der Elefantenmensch sein Maul und schreit: „Ich bin kein Tier! Ich bin ein menschliches Wesen!“ Überwältigt von Mitgefühl, rückten wir noch ein wenig näher zusammen. Wenn am Ende John Merricks Tod als Seelenreise durch den Sternenhimmel über den Bildschirm flimmerte, konnte es vorkommen, dass unsere Positionen auf dem Sofa schon ziemlich durcheinandergeraten waren. Danach wurde oft auch noch mein Geist verwöhnt – mit einem kleinen Vortrag über die Bloßstellung bürgerlicher Heuchelei im Werk David Lynchs zum Beispiel.
Keine Ahnung, was an solchen Abenden spießig sein sollte.
Drei
Das Antiquariat Maldoror war zweigeteilt, vorne betrieb ich meine Verkaufsgespräche mit allerlei geistreichen Müßiggängern über den Wert von nicht ganz echten Erstausgaben der Duineser Elegien oder die Editionsgeschichte der Leaves of Grass, hinten saß Maia im Kosmos ihrer Kunstbände und verdiente unser Geld. Oder besser: Sie sorgte dafür, dass mein durch Lungenkrebs ererbtes Kapital sich nicht verflüchtigte. Arthur, pflegte Maia zu sagen, versprich mir, dass du nie wieder anfängst zu rauchen. Das bist du ihm schuldig. Mein Vater allerdings hatte selbst im Endstadium, mit einer Plastikkanüle durch den Hals, eine heimlich gerauchte Camel einem Diskurs über die Gefährlichkeit des Nikotinmissbrauchs vorgezogen. Erstickt war er aber jämmerlich, keine Frage. Was er mir hinterließ, reichte für ein Geschäftslokal in der Margaretenstraße.
Für die Bewirtung sorgte ich selbst. Es gab eine Art Küchennische zwischen unseren Bereichen, mit einem kleinen Herd, einer Espressomaschine, einem englischen Teekocher und einem Weinregal mit viel zu warm gelagerten Burgenländer Cuvées. Kurz: Wir waren schick und ignorant, zeitlos und ziellos gleichermaßen.
Maia Schütz hatte während ihres Kunstgeschichtestudiums zu malen begonnen; ihre Malerei erregte in Kennerkreisen Aufsehen. Schon bald kamen die ersten Ausstellungen, erste verkaufte Bilder. In der Nacht nach einer Vernissage fuhr Maia, schon ein wenig berauscht, mit dem Fahrrad nach Hause. Die Bänder des Rucksacks, den sie in den Gepäckträger gestopft hatte, gerieten in die Speichen, Maia wurde vom Sattel gerissen und fiel so unglücklich, dass sie sich beide Arme brach. Beim Eingipsen der rechten Hand unterlief dem Arzt im UKH ein Fehler; das Handgelenk wurde steif, die Beweglichkeit konnte selbst durch nochmaliges Brechen nicht völlig wiederhergestellt werden. Bei alltäglichen Verrichtungen sah man es der Hand kaum an, aber gewisse Bewegungen waren unmöglich geworden. Maia musste die Malerei aufgeben. Eine schwere Depression befiel sie, sie wurde antriebslos und experimentierte mit Schlaftabletten.
Zwei Jahre nach dem Unfall tauchte sie in meinem Antiquariat auf und bewarb sich um eine Stelle. Ich mochte sie auf Anhieb, war begeistert von ihren kunstgeschichtlichen Kenntnissen und bot ihr schon nach ein paar Monaten an, meine Teilhaberin zu werden. Wir arbeiteten nun schon seit mehreren Jahren zusammen; es war mir jedoch nie gelungen, Maia zu überreden, mir eines ihrer Bilder zu zeigen. Sie schien es vielmehr zu bereuen, mir diesen Aspekt ihrer Vergangenheit erzählt zu haben – als wäre die Malerei ihr finsterstes Geheimnis.
„Die Sache ist vorbei“, pflegte sie in solchen Momenten zu sagen. „Tu mir den Gefallen und lass mich damit in Ruhe.“ Ihre Beharrlichkeit war unverrückbar – ich durfte nicht einmal erfahren, ob sie die Bilder irgendwo gelagert oder längst zerstört hatte. Nur ein einziges Mal fiel ein kurzer Lichtstrahl in die verbotene Kammer. Eine Freundin Maias besuchte sie im Antiquariat, wir sprachen reichlich dem Roten zu, und ich konnte mich einmal mehr nicht zurückhalten und fragte Maia nach ihren Bildern. Wortlos stand sie auf und verließ den Raum. Als sie weg war, flüsterte mir ihre Freundin ins Ohr: „Wunderschöne Gemälde. Alles Porträts. Was für ein Jammer.“ Das war’s.
Nach dieser Episode musste ich Maia schwören, sie nie wieder mit diesem Thema zu belästigen. Widerwillig legte ich die rechte Hand aufs Herz und hob ihr die Linke mit ausgestrecktem Mittel- und Zeigefinger entgegen. Wortlos.
„Sprich es aus!“, sagte Maia unerbittlich.
Meinen letzten Schwur hatte meine Mutter von mir verlangt. Ich war zwölf und sollte mich von den Mädchen der Parallelklasse fernhalten. Ich hatte mich daran gehalten – immerhin zwei Tage lang.
„Also gut. Ich schwöre.“
Maia schnappte sich meine ausgestreckten Finger mit ihrer linken Hand, drückte sie heftig und verschwand wieder in ihrem Reich.
Damit waren Maias Bilder aus unseren Gesprächen getilgt.
Vier
Nach der Scheidung betrat ich das Antiquariat wochenlang nicht.
Ich verließ die Wohnung nur, um mir Essen zu besorgen. Essen und Trinken. Nuri-Sardinen, Thunfisch mit Gemüse, manchmal eine Pizza. Budweiser in Kisten. In manchen Momenten dachte ich daran, Sebastian in Linz anzurufen. Ließ es dann aber bleiben: Ich war niemandem zumutbar, nicht einmal meinem besten Freund.
Maia versuchte in regelmäßigen Abständen, mich in den Alltag zurückzulocken. Sie rief an, sagte Sätze wie „ein bisschen Arbeit wird dir guttun“, aber sie sagte sie halbherzig. Sie wusste: Nichts würde mir guttun. Nichts außer Isabels Rückkehr.
Einmal kam sie vorbei, brachte mir indisches Essen. Sie hatte sich telefonisch angemeldet, damit das Läuten keine falschen Hoffnungen weckte. „Keine hysterischen Attacken“, so Maia. Ich ließ sie nicht herein, nahm nur dankend die Plastikbox in Empfang und wollte die Wohnungstür wieder schließen. Maia steckte den Kopf durch den Türstock, ließ sich nicht sofort vertreiben. Sie zog die Luft ein und prüfte sie wie eine, deren Profession es ist, Düfte zu analysieren. Es war nicht stickig bei mir, die Fenster waren stets offen. Doch Maias Nase war nicht zu täuschen. Es roch wohl nach Stillstand. Nach An-die-Wände-Starren.
„Warum gehst du nicht raus?“
„Sie ist mir geblieben. Ich darf sie behalten.“
„Du fantasierst, Arthur. Isabel ist weg. Sieh das doch ein.“
„Ich rede nicht von Isabel. Ich rede von unserer Wohnung.“
Sie biss sich auf die Lippen, als wäre ihr eine Schamlosigkeit herausgerutscht. Ihre Augen irrten auf dem Muster meines Bademantels herum, dann sah sie mir in die Augen. Gütige Strenge. Heimleiterin.
„Verstehe. Aber was machst du denn den ganzen Tag?“
Das ging sie nichts an. Ihre Fürsorge verursachte mir Übelkeit. Meine Stimme wurde ein wenig schrill.
„Ich warte, Maia, was sonst.“
„Na dann viel Glück.“ Das klang weder zynisch noch mitleidsvoll. Sie zeigte mir ihre gedrückten Daumen, als ginge es um einen Abend im Casino. Im Treppenhaus drehte sie sich nicht mehr um.
Sie gab auf. Ihre Anrufe blieben aus. Ich vermisste sie nicht. Mir war nicht zu helfen.
Isabels Abwesenheit verwandelte sich von einem Nichts in ein Tier. Das Tier hatte viele Gestalten: Manchmal war es ein Saugwurm, der sich von der Bettkante, auf die ich mich nur kurz niederlassen wollte, in mein Rückgrat bohrte, sodass ich sitzen bleiben musste, aufgerichtet wie ein ausgestopftes Murmeltier, mehrere Stunden lang. Dann wieder war es eine Python, die mir durch den offenen Mund in den Rachen fuhr, die Speiseröhre hinunter, und sich an meinem Magen festbiss.
Nachts ging ich oft auf den Balkon und suchte die Wega.
Der Parkettboden glänzte, ich wischte ihn täglich, er war präpariert für ihren Auftritt. Wenn sie aus dem schmutzigen Regen draußen, aus der Welt des kurzfristigen Irrtums, zu mir hereinstürmen würde, wäre alles bereit. Ein Boden, der beide trägt, für immer.
Ich saß und trank und aß und wartete. Gelegentlich fasste ich Mut und griff mir ein Buch. Hier waren sie doch, meine privaten Gegenwelten, jahrzehntelang durchstreunt, gesicherte Hochplateaus für den Flüchtling aus den Niederungen des Alltäglichen. Ich musste nur wieder dort hinauf, schon wäre ich gerettet! Doch beim Lesen verlor ich rasch den Halt, rutschte auf den Sätzen aus, kollerte über Absätze hinweg und kam erst auf dem Grund der Seite zum Liegen. Dort lag ich dann, auf dem Rücken; Ärmchen und Beinchen zappelten dem fernen Himmel entgegen. Kletterte über einzelne aus den Textblöcken ragende Wörter wieder nach oben, hielt mich kurz fest an einer wundervollen Wendung, zog mich hoch an einem Bild, war wieder ganz oben, bereit für den kontrollierten Abstieg, schön langsam, ein Schritt, ein Gedanke nach dem anderen, doch schon brach wieder ein Stein weg, und eine Lawine aus Geröll riss mich zurück ins Tal.
Das einzige Buch, das ich noch verstehen konnte, war Isabel Valentins Der Einbruch des Entsetzens. Zumindest der Titel leuchtete mir ein.
Irgendwann begann ich mir ihre Filme anzusehen. Zum ersten Mal allein, aber was konnte mir noch passieren? Durchseucht von Erinnerungen war ich sowieso.
Manche Bilder verfolgten mich bis in die Träume. Coppolas Dracula. Winona Ryder und Gary Oldman streicheln den weißen Wolf, in seinem Fell berühren sich ihre von schwarzen Handschuhen verhüllten Hände zum ersten Mal. Schnitt. Mina trinkt schwarzes Blut aus der Brust des Vampirs, er verheißt ihr ewiges Leben, sie schwört ewige Treue. Schnitt. Mina hackt dem Grafen den Kopf ab. Fertig. Nachspann, Aufwachen.
In einer strahlenden Novembernacht erlitt ich einen unkontrollierbaren Anfall von Zahlenmystik und sah mir hintereinander The Fifth Element, The Sixth Sense und Seven an. Saß danach lang auf dem Balkon, in unsere Fernsehdecke gewickelt, suchte ihre Haare in der Wolle und nähte mit ihnen die Sterne zu Achtern zusammen. Als es dämmerte, landeten Bruce Willis und Milla Jovovic in einem sardinendosenartigen Raumschiff auf der Brüstung und brachten mir Isabel zurück, den Händen des Todsündenmörders im letzten Augenblick entrissen. Ich versuchte sie zu küssen, aber es ging nicht. Ich war schon tot.
Mittags Frühstück. Zwieback, Kamillentee, Zeitung wegwerfen. Abends Bier und saudade, die Sehnsucht, angerichtet mit ausençia, der Abwesenheit. Einzelne Wörter, herausgefischtaus Isabels Langenscheidt-Bänden, verstand ich ja noch. Verlorengegangen waren mir nur die Zusammenhänge.
Es klingelte. Ich öffnete die Tür. Da war sie.
Raus aus den Schuhen, schneidige Bewegung, in vollendeter Flugbahn landen die Pumps am unteren Ende der Parabel, auf dem Fernseher. Mantel weg, Arme hochgefahren, auf meine Schultern zu, Lippen, aufgeplatzt vor Reue, nach meinen schnappend, ja, ist ja gut, Isabel, ich verzeihe, alles ist gut, jetzt, wo wir wieder sind, wie wir immer waren, unentzweibar, festgeschmiedet aneinander, abgeschottet von den Unwägbarkeiten der äußeren Welt –
Nach derlei Erscheinungen hielt ich den Kopf meist unter kaltes Wasser, bis meine Halsschlagadern zu vereisen drohten. Zwei Bier noch, mindestens zwei Valium. Nicht drei, denn sie könnte ja kommen, morgen früh. Da musste ich dann wach sein, richtig wach.
Fünf
An meinem Geburtstag rief Isabel an.
Ich war nicht überrascht. Isabel liebte bestimmte Konventionen, an die sie sich unbeirrbar hielt, selbst wenn ihre ganze Welt aus den Fugen geraten war. Sie besaß ein kleines kobaltblaues Notizbuch, in das die Geburtstage sämtlicher Menschen, die ihr das Datum verraten hatten, eingetragen waren. Völlig unerheblich, ob sie die Personen mochte oder nicht: An ihren Geburtstagen wurden sie angerufen. Meinem Vater, den Isabel nicht ausstehen konnte, hatte sie einmal am Tag nach einem entsetzlichen Streit gratuliert, als wäre nichts geschehen. Auch Leute, mit denen sie während des Jahres kaum Kontakt hatte, entgingen den Glückwünschen nicht. Das Notizbuch war voll, und so verstrich kaum ein Tag, an dem Isabel nicht irgendeine Nummer anrief und dem oft verblüfften Gegenüber ihre herzlichsten Geburtstagswünsche darbrachte. Über das tiefere Geheimnis dieses Rituals war ihr nichts zu entlocken; fragte ich danach, bekam ich einen Satz zu hören, der übersetzt lautete: Lass mich damit ja in Ruhe. In Isabels Sprache hieß das: „So bin ich eben.“ Auf rätselhafte Weise korrespondierte dieser Geburtstagskult mit einer Besessenheit vom Tod. Wenn es mit jemandem zu Ende ging, erwachte in Isabel eine fast wütende Fürsorge, die zwar vordergründig dem Todgeweihten galt, in Wahrheit aber durch ihn hindurchging. Vorübergehend hatte sie sogar in einem Sterbehospiz gearbeitet; in dieser Zeit sah ich sie kaum noch. Sie verbrachte ihre Nächte im Hospiz, ich in Bars. Dann kam, völlig überraschend, der Moment, in dem ihr klarwurde, dass sie sich zu verlieren drohte. Sie kündigte, und als ich sie, in der Hoffnung, schöne Sätze über die Priorität unserer Ehe zu hören, nach dem Grund dafür fragte, sagte sie nur: „So bin ich eben.“
Als mein Vater im AKH rettungslos an seinen Schläuchen hing, war es Isabel, die ihn Tag für Tag besuchte. Sie saß am Bett eines Mannes, dessen haltloses, sämtlichen Süchten anheimgefallenes Leben sie zutiefst verachtete, des Mannes, dem sie die Schuld an der Verkorkstheit und Lebensuntüchtigkeit seines Sohnes gab, und erzählte ihm mit entrückter Stimme Geschichten aus ihrem Leben, die sie mir stets verschwiegen hatte.
Im Augenblick seines Todes waren wir beide bei ihm. Als das Röcheln aufhörte und die Augen nach hinten kippten, das Gesicht binnen Sekunden von einem wächsernen Gelb überzogen wurde, heulte Isabel auf, als hätte sie ein Speer in die Flanke getroffen.
Endlich zu Hause, musste sie dann noch telefonieren. Ein Cousin ihres ehemaligen Chefs hatte Geburtstag.
Vielleicht war es so: Wie kein anderer Mensch, den ich kannte, war Isabel verstört vom bloßen Faktum der verrinnenden Zeit. Für sie war die Tatsache, dass es eine Kraft gab, die sich allen Sinnen entzog und dennoch unweigerlich zu deren Auslöschung führte, ein himmelschreiender Skandal, eine pure Bösartigkeit der Schöpfung. „Beeil dich bitte“, pflegte sie zu sagen, „die Zeit vergeht, und du merkst es nicht.“ Dabei wollte ich nur mein Schuhband sorgfältig binden oder die Schuppen von meinem Jackett klopfen, bevor wir essen gingen oder in einen ihrer Clubs. Eine Angelegenheit von ein paar Sekunden. Eine leere Ewigkeit für Isabel. Ihre Ungeduld war nicht launenhaft oder herrisch, sie war durchtränkt von einer Angst, die sie durchs Leben hetzte. Ich dachte lange, sie erlebe die Zeit als Sturm, der ihr von vorne ins Gefieder blies und sie nach hinten wehte, wo sie doch nichts mehr wollte, als voranzukommen und die Trümmer zu ordnen. Die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Seit ich Isabel kenne, habe ich mir Benjamins Engel der Geschichte nicht mehr ohne ihr Gesicht vorstellen können, auch wenn ich dafür nur Kopfschütteln erntete. „Darum geht es doch nicht“, sagte sie einmal müde, als ich ihr die Passage vorgelesen hatte, „verstehst du das denn nicht, Arthur? Es gibt keinen Sturm.“ Ich verstand es nicht, sie wollte kein Wort mehr darüber verlieren, und so wurde es ein Abend zwischen zwei Fremden, die sich das Bett teilen mussten. Und irgendwann den unteilbaren, unmitteilbaren Tod.
Isabels Angst war auch keine Spielart des hysterischen Hedonismus, der in ihrer Clique so verbreitet war. Es ging ihr nicht darum, möglichst viel zu erleben, bevor es vorbei war. Einen Freund, der ihr bei einem dieser Gesellschaftsspiele, denen sie paradoxerweise gerne stundenlang beiwohnte – Charade oder chinesisches Roulette –, als Lebensmotto „Carpe diem“ in den Mund gelegt hatte, würdigte sie danach keines Blickes mehr.
„Was soll das heißen, nütze den Tag“, sagte sie, als wir endlich zu Hause waren, „morgen ist der Tag vorbei, ob wir ihn nützen oder nicht.“
„Na ja“, sagte ich und zog ein bisschen an einem der Spaghettiträger, kardinalrot, die ihre hinreißenden Schlüsselbeine im Hier-und-Jetzt überwölbten.
„Ach, Arthur“, sagte Isabel, schob meine Hand weg, zog ihren Pyjama an und vergrub sich in ihren Teil des Doppelbetts.
Sie fluchte noch ein wenig vor sich hin, bevor sie einschlief, während ich den zu Ende gehenden Tag zu nützen versuchte. Es gab noch einen Tatort im WDR, einen zeitlosen Chateau Margaux und die stets griffbereiten Schlusssätze aus dem Tod des Vergil.
Plötzlich hörte ich Isabel weinen. Ich sprang von der Couch hoch. Ich musste etwas tun.
Ich setzte mich wieder hin. Ich wusste, ich konnte ihr nicht helfen.
Etwas, das sie nicht spüren konnte, würde sie töten. Nichts konnte es aufhalten.
„Hallo, Arthur“, sagte Isabel.
„Hallo“, sagte ich, mit so wenig Verzweiflung wie nur irgend möglich in der Stimme.
„Alles Gute zum …“
„Danke“, sagte ich schnell, aber Isabel ließ sich nicht beirren.
„… Geburtstag!“ Sie atmete durch. Die Mission war erfüllt. Bald würde es vorbei sein.
„Geht’s dir gut?“ Da war keine Sehnsucht in der Stimme, kein Bedauern, nichts. Nur ein Knistern in der Leitung. Sie musste weit weg sein.
„Ach“, sagte ich, „schon, ja, durchaus.“ Zigarette in der Linken, Budweiser in der Rechten, Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt.
„Fein“, sagte Isabel.
So ging das nicht. Ich dämpfte die Zigarette aus und nahm den Hörer in die Hand. Er war feucht. Sie musste den Schweiß schon riechen.
„Wo bist du?“, fragte ich. Irgendwo musste noch Cognac sein, aber ich kam nicht hin. Das Telefonkabel war zu kurz. Da war eine Pause jetzt, wieso sagte sie nichts?
„São Miguel“, sagte Isabel. Ehrlichkeit war eine ihrer Stärken. Jetzt hörte ich den Wind, den ich so gut kannte.
„Die Bar?“, fragte ich, ein Strohhalm, ein dünner, durchweichter, lächerlicher Strohhalm. Es gab sie tatsächlich, diese Bar, in der Bäckerstraße. Ich hasste sie, Isabel hasste sie. Wir beide kannten niemanden, der sie nicht hasste. Überteuerter Rotwein, unfreundliche Kellner, versnobte Gäste. Ja, musste Isabel jetzt sagen, ich bin so allein ohne dich, mir ist nichts Besseres eingefallen als das São Miguel. Sofort würde ich hinkommen und sie in die Arme schließen.
„Nein“, sagte Isabel. Rauschte die Leitung oder war es tatsächlich das Meer? Isabel auf den Azoren, ohne mich, das war undenkbar.
Sie war dort. Sie konnte nicht dort sein. Nicht ohne mich. „Allein?“, fragte ich.
„Ach, Arthur“, sagte Isabel. Es klickte. Das Rauschen war verschwunden.
Mehr als von ihren Filmen, mehr als von den Sätzen, mit denen sie die Visionen der Regisseure zu umzingeln versuchte, mehr als von den kleinen Konventionen, die ihr dabei halfen, die Zeit in Scheiben zu schneiden, viel mehr als von mir selbstverständlich, erhoffte Isabel sich Linderung vom Meer. Ein gemeinsamer Urlaub, der nicht an einen Strand führte, war unvorstellbar. Es musste aber unbedingt ein Meer sein, in dem man schwimmen konnte. Norwegische Fjorde oder der Finnische Meerbusen – zuweilen war es auch ich, der Vorschläge machen durfte – entlockten ihr nur ein verständnisloses Lächeln. Isabel musste da rein.
Sobald sie Sand zwischen den Zehen spürte, huschte ein Ausdruck der Dankbarkeit über ihr Gesicht, als dürfte sie nach Jahren im Exil endlich wieder heimatlichen Boden betreten. Wurden ihre Knöchel vom Meerwasser umspült, wich alle Angestrengtheit aus ihrem Gesicht. Was immer sie noch Minuten zuvor gequält haben mochte: Es war verschwunden. Wohin wir auch fuhren, der erste Weg führte sie ins Wasser. Der Ablauf war immer der gleiche: Isabel kommt an, fahrig, ungeduldig, mich im Windschatten; die Willkommensworte an der Rezeption kann sie nicht richtig hören, sosehr sie sich auch bemüht, höflich zu sein, sie riecht schon das Salz; ich trage unsere Daten ins Empfangsformular ein, während sie sich die Koffer ins Zimmer bringen lässt, mir immer uneinholbar voraus; als ich endlich selbst im Zimmer bin, ist Isabel schon wieder weg. Auf dem Boden ihr aufgerissener Koffer; vom Balkon aus sehe ich sie, bis zur Hüfte im Wasser, sie winkt mir zu, ein gelandeter Engel.
Für mich bleiben die Arbeiten des Bodenpersonals: Lage sondieren, Schränke suchen, Wäsche einschlichten. Ungeziefer orten und gegebenenfalls die Vorhut vernichten. Im Katalog versprochene Extras prüfen und, falls nicht vorhanden, an der Rezeption einfordern: ein Konglomerat von minderen, aber notwendigen Prozeduren.
Vor Isabel mochte ich das Meer auch ganz gern. In den ersten fünf Jahren unserer Ehe redete ich mir sogar ein, es zu lieben. Isabel und ich auf den Liparischen Inseln, auf Lanzarote, in Taormina, auf Madeira: Was konnte es Schöneres geben? Warum ich das Meer am Ende hasste, weiß ich nicht genau. Vielleicht lag es daran, dass ich mich betrogen fühlte. Wenn Isabel mit mir am Meer war, liebte sie mich ungestüm und halbverloren, wann immer ihr danach war; kein Grund zur Klage also. Doch sie schaute dabei durch mich hindurch.
Manchmal, wenn ich versuchte, auf dem Sand oder den Steinen eine Position einzunehmen, in der ich ohne Schmerzen auf dem Badetuch ein Buch lesen konnte, während sich Isabel jauchzend gegen die Brecher warf, als könnte sie ihren Körper der Zeit entgegenstemmen und sie endlich aufhalten, träumte ich mich weit weg. Ich sah mich auf einer Couch in einer meerfernen Großstadt. Draußen vor dem Fenster brennt der Asphalt. Ein Herr sitzt am Kopfende, tadellos gekleidet, kardinalrote Krawatte. „Eifersucht auf den Ozean selbst, Herr Valentin“, sagt er, „ist weniger ungewöhnlich, als Sie glauben. Denken Sie nur an die Griechen.“ Er seufzt, er zündet sich eine Zigarre an, er schaut mit gemeinen kleinen Äuglein an mir vorbei, hinaus auf die immer brennenden Schlote einer verfluchten Stadtlandschaft.
Nur ein einziges Mal fühlte ich mich mit ihr am Meer nicht allein: auf den Azoren, im vierzehnten Jahr unserer Ehe, dem Jahr, in dem ich alle meine Zweifel an uns feierlich im Eisenbad versenkt hatte, um endlich abzuheben mit meinem Engel, der Benjamin nicht leiden konnte, das Prinzip der Geschichte verabscheute und niemals sterben wollte.
Ein Jahr später war Kreta.
Nachdem Isabel aufgelegt hatte, kam ich endlich an meinen Cognac. Man muss sich festhalten an kleinen Siegen, und ich hielt mich an meinem Cognac fest, so lang ich konnte.
In der folgenden Nacht spukten die Küsten von São Miguel durch meine Träume. Isabel und ich tauchten durch das überirdische Grün des Lagoa do Fogo, schwebten über den Fumarolen von Furnas, nach Schwefel stinkend, Hortensien hinter den Ohren, die Backen verschmiert vom Fett des Cozido, und schlugen uns unsere Schneidezähne gegenseitig in die Hälse, besoffen vom Pakt des Nicht-enden-Wollens, bis es rot regnete auf die Küste von Ponta Delgada.
Hoch oben auf dem Vista do Rei, zwischen dem Lagoa Azul und dem Lagoa Verde, saß mein Vater in einem wachsgelben Anzug, inhalierte seine angezündeten Schläuche in tiefen Lungenzügen und schrie dem schönen falschen Paar ein „Carpe diem!“ entgegen.
Am nächsten Mittag wachte ich anders auf als in den vergangenen Monaten. Mein Geist war rebellisch und ich hegte frische Gedanken. Obwohl ich die Außenwelt immer noch fürchtete, die Menschen ebenso wie das Tageslicht, fasste ich, fahl im Gesicht und flau im Magen, den Entschluss, die Wohnung endlich zu verlassen. Ich kam mir vor wie ein Untoter, den der Geruch des Blutes aus seiner Grabkammer treibt.
Sechs
So tauchte ich also, ausgerechnet Mitte Dezember, unangemeldet im Maldoror auf. Maia rutschte ein Buch von dem Stapel mit Bildbänden, den sie gerade zur Verkaufstheke schleppen wollte. Der Laden war voll hektischer Kunden mit Schneematsch auf den Mantelkrägen. Vor dem Schaufenster sackten die nassen Flocken zu Boden, die dahinrasenden Autos auf der Margaretenstraße bespritzten die Passanten, die bei ihren Ausweichmanövern gelegentlich ineinanderkrachten. Man sah ihre Lippen Flüche formen, Regenschirme wurden von Schutzschildern zu Angriffswaffen, hin und wieder landete ein stilvoll verpacktes Geschenk im Dreck.
„Arthur“, sagte Maia im ersten Schreck, „was zum Teufel machst du hier?“
„Ich bin wieder da“, sagte ich schüchtern.
„Schön“, sagte sie und deutete mit dem Kopf auf das Buch, das ihr zu Boden gefallen war. „Dann mach dich gleich nützlich.“
Folgsam hob ich den Band auf. Krippendarstellungen aus zweiJahrtausenden las ich, rümpfte die Nase und legte das Buch mitzwei Fingern auf den Stapel zurück.
Maia teilte meine Abneigung gegen die alljährlich ausbrechende Weihnachtsepidemie, aber sie konnte besser rechnen als ich. Also führten wir in der Adventszeit Titel im Sortiment, für die wir uns während der restlichen Zeit des Jahres schämen würden. Manchmal, wenn Maia schon Mitte November begann, unser Schaufenster mit Beschaulichkeitskitsch vollzuräumen, verfluchte ich ihre Geschäftstüchtigkeit.
Ich sah das Antiquariat vor mir, wie es ohne Maia aussehen würde: eine leuchtende Bastion der Kunst und des Geistes, uneinnehmbar vom bleichen Banausentum der Massen. Der Burgherr war ein Ritter alten Schlages, verwegen den Anfechtungen des Zeitgeistes die Stirn bietend, in die eigene Geschmackssicherheit getaucht wie in Drachenblut, umstrahlt von einer Aura der Unbestechlichkeit. Aber zweifellos bankrott.
Maia deponierte ihren Bücherstapel auf einem Stuhl, wischte sich die Hände an der Hose ab, umarmte mich und sagte: „Willkommen zurück unter den Lebenden.“
„Nosferatu“, sagte ich und wurde ein wenig steif in der ungewohnten Umarmung.
„Was?“
„Ach, vergiss es.“
Maia komplimentierte die Kunden aus dem Laden, sie musste nicht viel dafür tun, man kannte sie hier, ihre Gesten waren die einer Königin, eine Handbewegung reichte, und das Geschäft war leer. Das Schild „GESCHLOSSEN“ hing schon vor der Tür, bevor ich in der Küche war und mich setzen konnte.
„Wie geht es dir?“, fragte Maia, als hätte niemals jemand zuvor diese Frage gestellt.
„Ich vermisse sie“, sagte ich.
„Klar“, sagte Maia.