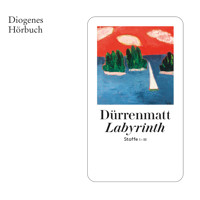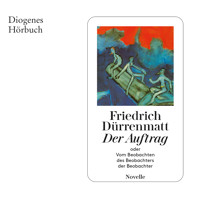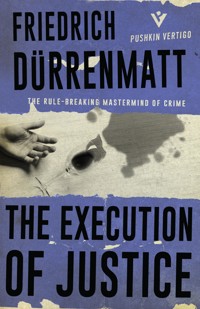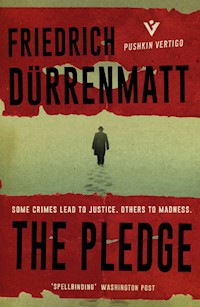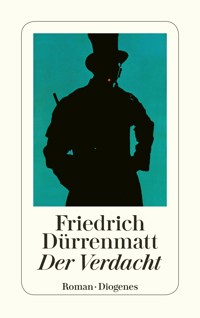
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissär Bärlach
- Sprache: Deutsch
Kommissär Bärlach liegt im Krankenhaus. Todkrank liest er in der Zeitschrift ›Life‹ einen Artikel über den berüchtigten Nazi-Arzt Nehle, der im KZ Stutthof ohne Narkose operierte. Einem Freund von Bärlach kommt der Mann auf dem Foto unheimlich bekannt vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Friedrich Dürrenmatt
Der Verdacht
Kriminalroman
Die Erstausgabe erschien 1985
im Diogenes Verlag
Covermotiv:
Ludwig Hohlwein,
›Die Grathwohl-Zigarette‹,
Werbeplakat, 1921
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchvorlage 978 3 257 21436 9
ISBN E-Book 978 3 257 60131 2
[5] ERSTER TEIL
Der Verdacht
Bärlach war anfangs November 1948 ins Salem eingeliefert worden, in jenes Spital, von dem aus man die Altstadt Berns mit dem Rathaus sieht. Eine Herzattacke schob den dringend gewordenen Eingriff zwei Wochen hinaus. Als die schwierige Operation unternommen wurde, verlief sie glücklich, doch ergab der Befund jene hoffnungslose Krankheit, die man vermutete. Es stand schlimm um den Kommissär. Zweimal schon hatte sein Chef, der Untersuchungsrichter Lutz, sich mit dessen Tod abgefunden, und zweimal durfte er neue Hoffnung schöpfen, als endlich kurz vor Weihnachten die Besserung eintrat. Über die Feiertage schlief zwar der Alte noch, aber am siebenundzwanzigsten, an einem Montag, war er munter und schaute sich alte Nummern der amerikanischen Zeitschrift ›Life‹ aus dem Jahre fünfundvierzig an.
»Es waren Tiere, Samuel«, sagte er, als Dr.Hungertobel in das abendliche Zimmer trat, seine Visite zu machen, »es waren Tiere«, und reichte ihm die Zeitschrift. »Du bist Arzt und kannst es dir vorstellen. Sieh dir dieses Bild aus dem Konzentrationslager Stutthof an! Der Lagerarzt Nehle führt an einem Häftling eine Bauchoperation ohne Narkose durch und ist dabei photographiert worden.«
Das hätten die Nazis manchmal getan, sagte der Arzt und sah sich das Bild an, erbleichte jedoch, wie er die Zeitschrift schon weglegen wollte.
»Was hast du denn?« fragte der Kranke verwundert.
Hungertobel antwortete nicht sofort. Er legte die aufgeschlagene Zeitschrift auf Bärlachs Bett, griff in die rechte [6] obere Tasche seines weißen Kittels und zog eine Hornbrille hervor, die er – wie der Kommissär bemerkte – sich etwas zitternd aufsetzte; dann besah er sich das Bild zum zweiten Mal.
»Warum ist er denn so nervös?« dachte Bärlach.
»Unsinn«, sagte endlich Hungertobel ärgerlich und legte die Zeitschrift auf den Tisch zu den andern. »Komm, gib mir deine Hand. Wir wollen nach dem Puls sehen.«
Es war eine Minute still. Dann ließ der Arzt den Arm seines Freundes fahren und sah auf die Tabelle über dem Bett.
»Es steht gut mit dir, Hans.«
»Noch ein Jahr?« fragte Bärlach.
Hungertobel wurde verlegen. »Davon wollen wir jetzt nicht reden«, sagte er. »Du mußt aufpassen und wieder zur Untersuchung kommen.«
Er passe immer auf, brummte der Alte.
Dann sei es ja gut, sagte Hungertobel, indem er sich verabschiedete.
»Gib mir doch noch das ›Life‹«, verlangte der Kranke scheinbar gleichgültig. Hungertobel gab ihm eine Zeitschrift vom Stoß, der auf dem Nachttisch lag.
»Nicht die«, sagte der Kommissär und blickte etwas spöttisch nach dem Arzt: »Ich will jene, die du mir genommen hast. So leicht komme ich nicht von einem Konzentrationslager los.«
Hungertobel zögerte einen Augenblick, wurde rot, als er Bärlachs prüfenden Blick auf sich gerichtet sah, und gab ihm die Zeitschrift. Dann ging er schnell hinaus, so als sei ihm etwas unangenehm. Die Schwester kam. Der Kommissär ließ die andern Zeitschriften hinaustragen.
»Die nicht?« fragte die Schwester und wies auf die Zeitung, die auf Bärlachs Bettdecke lag.
»Nein, die nicht«, sagte der Alte.
Als die Schwester gegangen war, schaute er sich das Bild von neuem an. Der Arzt, der das bestialische Experiment [7] ausführte, wirkte in seiner Ruhe götzenhaft. Der größte Teil des Gesichts war durch den Nasen- und Mundschutz verdeckt.
Der Kommissär versorgte die Zeitschrift in seiner Nachttischschublade und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er hatte die Augen weit offen und sah der Nacht zu, die immer mehr das Zimmer füllte. Licht machte er nicht.
Später kam die Schwester und brachte das Essen. Es war immer noch wenig und Diät: Haferschleimsuppe. Den Lindenblütentee, den er nicht mochte, ließ er stehen. Nachdem er die Suppe ausgelöffelt hatte, löschte er das Licht und sah von neuem in die Dunkelheit, in die immer undurchdringlicheren Schatten.
Er liebte es, die Lichter der Stadt durchs Fenster fallen zu sehen.
Als die Schwester kam, den Kommissär für die Nacht herzurichten, schlief er schon.
Am Morgen um zehn kam Hungertobel.
Bärlach lag in seinem Bett, die Hände hinter dem Kopf, und auf der Bettdecke lag die Zeitschrift aufgeschlagen. Seine Augen waren aufmerksam auf den Arzt gerichtet. Hungertobel sah, daß es das Bild aus dem Konzentrationslager war, das der Alte vor sich hatte.
»Willst du mir nicht sagen, warum du bleich geworden bist wie ein Toter, als ich dir dieses Bild im ›Life‹ zeigte?« fragte der Kranke.
Hungertobel ging zum Bett, nahm die Tabelle herunter, studierte sie aufmerksamer denn gewöhnlich und hing sie wieder an ihren Platz. »Es war ein lächerlicher Irrtum, Hans«, sagte er. »Nicht der Rede wert.«
»Du kennst diesen Doktor Nehle?« Bärlachs Stimme klang seltsam erregt.
»Nein«, antwortete Hungertobel. »Ich kenne ihn nicht. Er hat mich nur an jemanden erinnert.«
Die Ähnlichkeit müsse groß sein, sagte der Kommissär.
[8] Die Ähnlichkeit sei groß, gab der Arzt zu und schaute sich das Bild noch einmal an, von neuem beunruhigt, wie Bärlach deutlich sehen konnte. Aber die Photographie zeige auch nur die Hälfte des Gesichts. Alle Ärzte glichen sich beim Operieren, sagte er.
»An wen erinnert dich denn diese Bestie?« fragte der Alte unbarmherzig.
»Das hat doch alles keinen Sinn!« antwortete Hungertobel. »Ich habe es dir gesagt, es muß ein Irrtum sein.«
»Und dennoch würdest du schwören, daß er es ist, nicht wahr, Samuel?«
Nun ja, entgegnete der Arzt. Er würde es schwören, wenn er nicht wüßte, daß es der Verdächtigte nicht sein könne. Sie sollten diese ungemütliche Sache jetzt lieber sein lassen. Es tue nicht gut, kurz nach einer Operation, bei der es auf Tod und Leben gegangen sei, in einem alten ›Life‹ zu blättern. Dieser Arzt da, fuhr er nach einer Weile fort und beschaute sich das Bild hypnotisiert von neuem, könne nicht der sein, den er kenne, weil der Betreffende während des Krieges in Chile gewesen sei. Also sei das ganze Unsinn, das sehe doch ein jeder.
»In Chile, in Chile«, sagte Bärlach. »Wann ist er denn zurückgekommen, dein Mann, der nicht in Frage kommt, Nehle zu sein?«
»Fünfundvierzig.«
»In Chile, in Chile«, sagte Bärlach von neuem. »Und du willst mir nicht sagen, an wen dich das Bild erinnert?«
Hungertobel zögerte mit der Antwort. Die Angelegenheit war dem alten Arzt peinlich.
»Wenn ich dir den Namen sage, Hans«, brachte er endlich hervor, »wirst du Verdacht gegen den Mann schöpfen.«
»Ich habe gegen ihn Verdacht geschöpft«, antwortete der Kommissär.
Hungertobel seufzte. »Siehst du, Hans«, sagte er, »das habe ich befürchtet. Ich möchte das nicht, verstehst du? Ich bin ein [9] alter Arzt und möchte niemandem Böses getan haben. Dein Verdacht ist ein Wahnsinn. Man kann doch nicht auf eine bloße Photographie hin einen Menschen einfach verdächtigen, um so weniger, als das Bild nicht viel vom Gesicht zeigt. Und außerdem war er in Chile, das ist eine Tatsache.«
Was er denn dort gemacht habe, warf der Kommissär ein.
Er habe in Santiago eine Klinik geleitet, sagte Hungertobel.
»In Chile, in Chile«, sagte Bärlach wieder. Das sei ein gefährlicher Kehrreim und schwer zu überprüfen. Samuel habe recht, ein Verdacht sei etwas Schreckliches und komme vom Teufel.
»Nichts macht einen so schlecht wie ein Verdacht«, fuhr er fort, »das weiß ich genau, und ich habe oft meinen Beruf verflucht. Man soll sich nicht damit einlassen. Aber jetzt haben wir den Verdacht, und du hast ihn mir gegeben. Ich gebe ihn dir gern zurück, alter Freund, wenn auch du deinen Verdacht fallen läßt; denn du bist es, der nicht von diesem Verdacht loskommt. «
Hungertobel setzte sich an des Alten Bett. Er schaute hilflos nach dem Kommissär. Die Sonne fiel in schrägen Strahlen durch die Vorhänge ins Zimmer. Draußen war ein schöner Tag, wie oft in diesem milden Winter.
»Ich kann nicht«, sagte der Arzt endlich in die Stille des Krankenzimmers hinein: »Ich kann nicht. Gott soll mir helfen, ich bringe den Verdacht nicht los. Ich kenne ihn zu gut. Ich habe mit ihm studiert, und zweimal war er mein Stellvertreter. Er ist es auf diesem Bild. Die Operationsnarbe über der Schläfe ist auch da. Ich kenne sie, ich habe Emmenberger selbst operiert. «
Hungertobel nahm die Brille von der Nase und steckte sie in die rechte obere Tasche. Dann wischte er sich den Schweiß von der Stirne.
»Emmenberger?« fragte der Kommissär nach einer Weile ruhig. »So heißt er?«
»Nun habe ich es gesagt«, antwortete Hungertobel beunruhigt. »Fritz Emmenberger.«
[10] »Ein Arzt?«
»Ein Arzt.«
»Und lebt in der Schweiz?«
»Er besitzt die Klinik Sonnenstein auf dem Zürichberg«, antwortete der Arzt. »Zweiunddreißig wanderte er nach Deutschland aus und dann nach Chile. Fünfundvierzig kehrte er zurück und übernahm die Klinik. Eines der teuersten Spitäler der Schweiz«, fügte er leise hinzu.
»Nur für Reiche?«
»Nur für Schwerreiche.«
»Ist er ein guter Wissenschaftler, Samuel?« fragte der Kommissär.
Hungertobel zögerte. Es sei schwer, auf seine Frage zu antworten, sagte er: »Er war einmal ein guter Wissenschaftler, nur wissen wir nicht recht, ob er es geblieben ist. Er arbeitet mit Methoden, die uns fragwürdig Vorkommen müssen. Wir wissen von den Hormonen, auf die er sich spezialisiert hat, noch herzlich wenig, und wie überall in Gebieten, die sich die Wissenschaft zu erobern anschickt, tummelt sich allerlei herum. Wissenschaftler und Scharlatane, oft beides in einer Person. Was will man, Hans? Emmenberger ist bei seinen Patienten bliebt, und sie glauben an ihn wie an einen Gott. Das ist ja das Wichtigste, scheint mir, für so reiche Patienten, denen auch die Krankheit ein Luxus sein soll; ohne Glauben geht es nicht; am wenigsten bei den Hormonen. So hat er eben seine Erfolge, wird verehrt und findet sein Geld. Wir nennen ihn denn ja auch den Erbonkel –.«
Hungertobel hielt plötzlich mit Reden inne, als reue es ihn, Emmenbergers Übernamen ausgesprochen zu haben.
»Den Erbonkel. Wozu dieser Spitzname?« fragte Bärlach.
Die Klinik habe das Vermögen vieler Patienten geerbt, antwortete Hungertobel mit sichtlich schlechtem Gewissen. Das sei dort so ein wenig Mode.
»Das ist euch Ärzten also aufgefallen!« sagte der Kommissär.
Die beiden schwiegen. In der Stille lag etwas Unausgesprochenes, vor dem sich Hungertobel fürchtete.
[11] »Du darfst jetzt nicht denken, was du denkst«, sagte er plötzlich entsetzt.
»Ich denke nur deine Gedanken«, antwortete der Kommissär ruhig. »Wir wollen genau sein. Mag es auch ein Verbrechen sein, was wir denken, wir sollten uns nicht vor unseren Gedanken fürchten. Nur wenn wir sie vor unserem Gewissen auch zugeben, vermögen wir sie zu überprüfen und, wenn wir unrecht haben, zu überwinden. Was denken wir nun, Samuel? Wir denken: Emmenberger zwingt seine Patienten mit den Methoden, die er im Konzentrationslager Stutthof lernte, ihm das Vermögen zu vermachen, und tötet sie nachher.«
»Nein«, rief Hungertobel mit fiebrigen Augen: »Nein!« Er starrte Bärlach hilflos an. »Wir dürfen das nicht denken! Wir sind keine Tiere!« rief er aufs neue und erhob sich, um aufgeregt im Zimmer auf und ab zu gehen, von der Wand zum Fenster, vom Fenster zum Bett.
»Mein Gott«, stöhnte der Arzt, »es gibt nichts Fürchterlicheres als diese Stunde.«
»Der Verdacht«, sagte der Alte in seinem Bett, und dann noch einmal unerbittlich: »Der Verdacht.«
Hungertobel blieb an Bärlachs Bett stehen: »Vergessen wir dieses Gespräch, Hans«, sagte er. »Wir ließen uns gehen. Freilich, man liebt es manchmal, mit Möglichkeiten zu spielen. Das tut nie gut. Kümmern wir uns nicht mehr um Emmenberger. Je mehr ich das Bild ansehe, desto weniger ist er es, das ist keine Ausrede. Er war in Chile und nicht in Stutthof, und damit ist unser Verdacht sinnlos geworden.«
»In Chile, in Chile«, sagte Bärlach, und seine Augen funkelten gierig nach einem neuen Abenteuer. Sein Leib dehnte sich, und dann lag er wieder unbeweglich und entspannt, die Hände hinter dem Kopf.
»Du mußt jetzt zu deinen Patienten gehen, Samuel«, meinte er nach einer Weile. »Die warten auf dich. Ich wünsche dich nicht länger aufzuhalten. Vergessen wir unser Gespräch, das wird am besten sein, da hast du recht.«
[12] Als Hungertobel sich unter der Türe noch einmal mißtrauisch zum Kranken wandte, war der Kommissär eingeschlafen.
Das Alibi
Am andern Morgen fand Hungertobel den Alten um halb acht nach dem Morgenessen beim Studium des Stadtanzeigers, etwas verwundert; denn der Arzt war früher als sonst gekommen, und Bärlach pflegte um diese Zeit wieder zu schlafen, oder doch wenigstens, die Hände hinter dem Kopf, vor sich hinzudösen. Auch war es dem Arzt, als sei der Kommissär frischer als sonst, und aus seinen Augenschlitzen schien die alte Vitalität zu leuchten.
Wie es denn gehe, begrüßte Hungertobel den Kranken.
Er wittere Morgenluft, antwortete dieser undurchsichtig.
»Ich bin heute früher als sonst bei dir, und ich komme auch nicht eigentlich dienstlich«, sagte Hungertobel und trat zum Bett. »Ich bringe nur schnell einen Stoß ärztlicher Zeitungen: ›die Schweizerische medizinische Wochenschrift‹, eine französische, und vor allem, da du auch Englisch verstehst, verschiedene Nummern der ›Lancet‹, der berühmten englischen Zeitschrift für Medizin.«
»Das ist lieb von dir, anzunehmen, ich interessiere mich für dergleichen«, antwortete Bärlach, ohne vom Anzeiger aufzublicken, »aber ich weiß nicht, ob es gerade die geeignete Lektüre für mich ist. Du weißt, ich bin kein Freund der Medizin.«
Hungertobel lachte: »Das sagt einer, dem wir geholfen haben!«
Eben, sagte Bärlach, das mache das Übel nicht besser.
Was er denn im Anzeiger lese? fragte Hungertobel neugierig.
»Briefmarkenangebote«, antwortete der Alte.
[13] Der Arzt schüttelte den Kopf: »Trotzdem wirst du dir die Zeitschriften ansehen, auch wenn du um uns Ärzte für gewöhnlich einen Bogen machst. Es liegt mir daran, dir zu beweisen, daß unser Gespräch gestern eine Torheit war, Hans. Du bist Kriminalist, und ich traue dir zu, daß du aus heiterem Himmel unseren verdächtigen Modearzt samt seinen Hormonen verhaftest. Ich begreife nicht, wie ich es vergessen konnte. Der Beweis, daß Emmenberger in Santiago war, ist leicht zu erbringen. Er hat von dort in verschiedenen medizinischen Fachzeitschriften Artikel veröffentlicht, auch in englischen und amerikanischen, hauptsächlich über Fragen der inneren Sekretion, und sich damit einen Namen gemacht; schon als Student zeichnete er sich literarisch aus und schrieb eine ebenso witzige wie glänzende Feder. Du siehst, er war ein tüchtiger und gründlicher Wissenschaftler. Um so bedauernswerter ist seine jetzige Wendung ins Modische, wenn ich so sagen darf; denn was er gegenwärtig treibt, ist nun doch zu billig, Schulmedizin hin oder her. Der letzte Artikel erschien in der ›Lancet‹ noch im Januar fünfundvierzig, einige Monate bevor er in die Schweiz zurückkehrte. Das ist gewiß ein Beweis, daß unser Verdacht eine rechte Eselei war. Ich schwöre dir, mich nie mehr als Kriminalist zu versuchen. Der Mann auf dem Bild kann nicht Emmenberger sein, oder die Photographie ist gefälscht.«
»Das wäre ein Alibi«, sagte Bärlach und faltete den Anzeiger zusammen. »Du kannst mir die Zeitschriften dalassen.«
Als Hungertobel um zehn zur ordentlichen Arztvisite zurückkam, lag der Alte, eifrig in den Zeitschriften lesend, in seinem Bett.
Ihn scheine auf einmal die Medizin doch zu interessieren, sagte der Arzt verwundert und prüfte Bärlachs Puls.
Hungertobel habe recht, meinte der Kommissär, die Artikel kämen aus Chile.
Hungertobel freute sich und war erleichtert. »Siehst du! Und wir sahen Emmenberger schon als Massenmörder.«
»Man hat heute in dieser Kunst die frappantesten Fortschritte [14] gemacht«, antwortete Bärlach trocken. »Die Zeit, mein Freund, die Zeit. Die englischen Zeitschriften brauche ich nicht, aber die schweizerischen Nummern kannst du mir lassen.«
»Emmenbergers Artikel in der ›Lancet‹ sind doch viel bedeutender, Hans!« widersprach Hungertobel, der schon überzeugt war, dem Freund gehe es um die Medizin. »Die mußt du lesen.«
In der medizinischen Wochenschrift schreibe Emmenberger aber deutsch, entgegnete Bärlach etwas spöttisch.
»Und?« fragte der Arzt, der nichts begriff.
»Ich meine, mich beschäftigt sein Stil, Samuel, der Stil eines Arztes, der einst eine gewandte Feder führte und nun reichlich unbeholfen schreibt«, sagte der Alte vorsichtig.
Was denn dabei sei, fragte Hungertobel noch immer ahnungslos, mit der Tabelle über dem Bett beschäftigt.
»So leicht ist ein Alibi nun doch nicht zu erbringen«, sagte der Kommissär.
»Was willst du damit sagen?« rief der Arzt bestürzt aus. »Du bist den Verdacht immer noch nicht los?«
Bärlach sah seinem fassungslosen Freund nachdenklich ins Gesicht, in dieses alte, noble, mit Falten überzogene Antlitz eines Arztes, der es in seinem Leben mit seinen Patienten nie leicht genommen hatte, und der doch nichts von den Menschen wußte, und dann sagte er: »Du rauchst doch immer noch deine ›Little-Rose of Sumatra‹, Samuel? Es wäre jetzt schön, wenn du mir eine anbieten würdest. Ich stelle es mir angenehm vor, so eine nach meiner langweiligen Haferschleimsuppe in Brand zu stecken.«
[15] Die Entlassung
Doch bevor es noch zum Mittagessen kam, erhielt der Kranke, der immer wieder den gleichen Artikel Emmenbergers über die Bauchspeicheldrüse las, seinen ersten Besuch seit seiner Operation. Es war der »Chef«, der um elf das Krankenzimmer betrat und etwas verlegen am Bett des Alten Platz nahm, ohne den Wintermantel abzulegen, den Hut in der Hand. Bärlach wußte genau, was dieser Besuch bedeuten sollte, und der Chef wußte genau, wie es um den Kommissär stand.
»Nun, Kommissär«, begann Lutz, »wie geht’s? Wir mußten ja zeitweilig das Schlimmste befürchten.«
»Langsam aufwärts«, antwortete Bärlach und verschränkte wieder die Hände hinter dem Nacken.
»Was lesen Sie denn da?« fragte Lutz, der nicht gern aufs eigentliche Thema seines Besuches kam und nach einer Ablenkung suchte: »Ei, Bärlach, sieh da, medizinische Zeitschriften!«
Der Alte war nicht verlegen: »Das liest sich wie ein Kriminalroman«, sagte er. »Man erweitert ein wenig seinen Horizont, wenn man krank ist, und sieht sich nach neuen Gebieten um.«
Lutz wollte wissen, wie lange denn Bärlach nach Meinung der Ärzte noch das Bett hüten müsse.
»Zwei Monate«, gab der Kommissär zur Antwort, »zwei Monate soll ich noch liegen.«
Nun mußte der Chef, ob er wollte oder nicht, mit der Sprache heraus. »Die Altersgrenze«, brachte er mühsam hervor: »Die Altersgrenze, Kommissär, Sie verstehen, wir kommen wohl nicht mehr darum herum, denke ich, wir haben da unsere Gesetze.«
»Ich verstehe«, antwortete der Kranke und verzog nicht einmal das Gesicht.
»Was sein muß, muß sein«, sagte Lutz. »Sie müssen sich schonen, Kommissär, das ist der Grund.«
[16] »Und die moderne wissenschaftliche Kriminalistik, wo man den Verbrecher findet wie ein etikettiertes Konfitürenglas«, meinte der Alte, Lutz etwas korrigierend. Wer nachrücke, wollte er noch wissen.
»Röthlisberger«, antwortete der Chef. »Er hat ja Ihre Stellvertretung schon übernommen.«
Bärlach nickte. »Der Röthlisberger. Der wird mit seinen fünf Kindern auch froh sein über das bessere Gehalt«, sagte er. »Von Neujahr an?«
»Von Neujahr an«, bestätigte Lutz.
Noch bis Freitag also, sagte Bärlach, und dann sei er Kommissär gewesen. Er sei froh, daß er nun den Staatsdienst hinter sich habe, sowohl den türkischen als auch den bernischen. Nicht gerade, weil er jetzt wohl mehr Zeit habe, Molière zu lesen und Balzac, was sicher auch schön sei, aber der Hauptgrund bleibe doch, daß die bürgerliche Weltordnung auch nicht mehr das Wahre sei. Er kenne sich aus in den Affären. Die Menschen seien immer gleich, ob sie nun am Sonntag in die Hagia Sophia oder ins Berner Münster gingen. Man lasse die großen Schurken laufen und stecke die kleinen ein. Überhaupt gebe es einen ganzen Haufen Verbrechen, die man nicht beachte, nur weil sie etwas ästhetischer seien als so ein ins Auge springender Mord, der überdies noch in die Zeitung komme, die aber beide aufs gleiche hinausliefen, wenn man’s genau nehme und die Phantasie habe. Die Phantasie, das sei es eben, die Phantasie! Aus lauter Phantasiemangel begehe ein braver Geschäftsmann zwischen dem Aperitif und dem Mittagessen oft mit irgendeinem gerissenen Geschäft ein Verbrechen, das kein Mensch ahne und der Geschäftsmann am wenigsten, weil niemand die Phantasie besitze, es zu sehen. Die Welt sei aus Nachlässigkeit schlecht und daran, aus Nachlässigkeit zum Teufel zu gehen. Diese Gefahr sei noch größer als der ganze Stalin und alle übrigen Josephe zusammengenommen. Für einen alten Spürhund wie ihn sei der Staatsdienst nicht mehr gut. Zuviel kleines Zeug, zuviel Schnüffelei; aber das Wild, das rentiere und das man [17] jagen sollte, die wirklich großen Tiere, meine er, würden unter Staatsschutz genommen wie im zoologischen Garten.
Der Doktor Lucius Lutz machte ein langes Gesicht, als er diese Rede hörte; das Gespräch kam ihm peinlich vor, und eigentlich fand er es unschicklich, bei so bösartigen Ansichten nicht zu protestieren, doch der Alte war schließlich krank und Gott sei Dank pensioniert. Er müsse nun leider gehen, sagte er, den Ärger hinunterschluckend, er habe um halb zwölf noch eine Sitzung mit der Armendirektion.