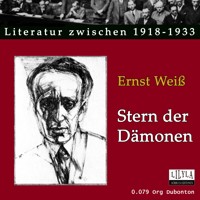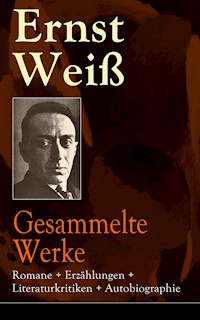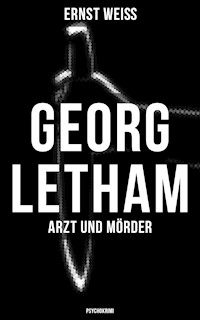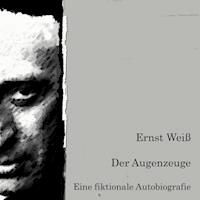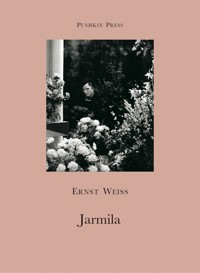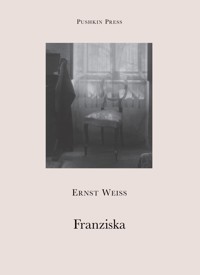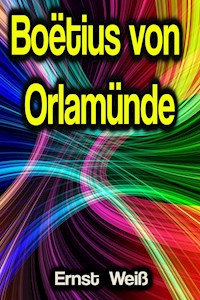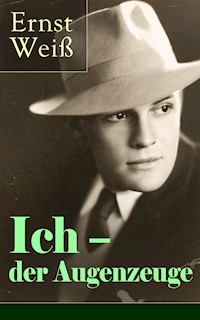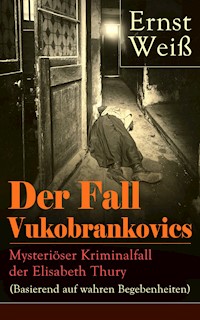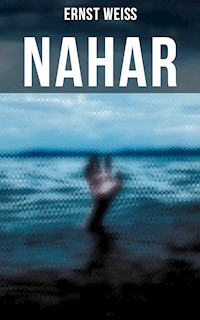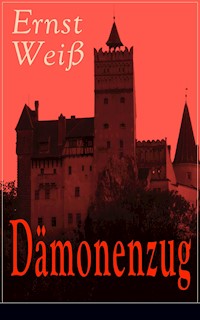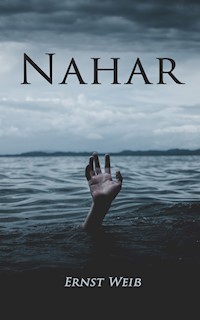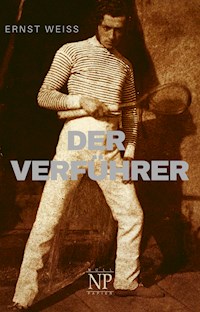
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte eines jungen Mannes, der den ausschweifenden Lebensstil des Vaters nachzueifern sucht und dabei an dem Widerspruch zwischen einer idealisierten Liebe und der Realität zu scheitern droht. Seine Sucht nach Liebe, nach Wärme, nach Zugehörigkeit lässt ihn immer wieder für die Wahrheit seiner Existenz blind werden. Ernst Weiß widmete dieses Werk Thomas Mann. "Das Buch gehört zu dem Allerinteressantesten, das mir in Jahren vorgekommen, und während ich las, blätterte ich öfter zurück zur Widmung und freute mich, daß es mir gehört." (Thomas Mann in einem Dankesbrief an Weiß, 22.12.1937) Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Weiß
Der Verführer
Roman
Ernst Weiß
Der Verführer
Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Zürich, Humanitas-Verlag, 1938 (440 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962815-73-8
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zweiter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dritter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Vierter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Thomas Mann gewidmet
Erster Teil
1.
Mein schöner, viel zu früh verstorbener Vater hatte mich, wie ich glaubte, besonders in sein Herz geschlossen. Ich ihn aber noch mehr in das meine. Das wusste ich. Ich habe später niemals einen Menschen so geliebt wie ihn. Ja, die Summe aller Liebe, die ich später vielen Menschen gegenüber empfunden habe, hat das Maß meiner Liebe zu ihm niemals ganz erreicht. Denn ich, sein einziger Sohn, lebte so sehr in ihm und ging so in ihm auf, wie man sich nur in der vollen Jugend hingibt, wo alles noch grenzenlos ist und man den Tod nicht zu ahnen vermag.
Viel geliebt zu werden und hinter die ›Geheimnisse‹ zu kommen, die überall verborgen sind für ein Kind, war der Wunsch meiner jungen Jahre. Deshalb war ich eifersüchtig auf jeden, den mein Vater freundlich ansah. Selbst meiner Mutter gönnte ich ihn nicht. Aber dies verbarg ich gut, seitdem sie einmal darüber gespottet hatte.
Mein ewiges Warum, mein niemals ganz gestilltes Wissensbedürfnis durfte ich nicht immer an ihm auslassen, denn er arbeitete schwer. Deshalb versuchte ich, mir viele Fragen, die mich bedrängten, selbst zu beantworten. Zu Gehorsam war ich nicht geneigt. Der ›Geist des Widerspruchs‹ hat mich schon früh besessen. Mich konnte niemand beherrschen, ich fügte mich zuerst nur aus Liebe, – und später nur aus Notwendigkeit. Selbst ein Kind begreift diese Notwendigkeit sehr gut. Meine Mutter machte sie mir in ihrer ruhigen, fast eisigen Art immer schnell klar. Konnte sie mich nicht von meinem Widerspruch abbringen, überließ sie mich den üblen Folgen meines Ungehorsams, oder sie brachte mich durch Ironie dazu, den Widerspruch bis zur Lächerlichkeit zu übertreiben. Bald fügte ich mich meiner besseren Erkenntnis, denn das Salz, das ich aus Widerspruch statt des Zuckers genommen hatte, schmeckte schlecht. Wenn ich aber etwas Erreichbares wollte, erlangte ich es fast immer, ich brauchte nicht lange zu bitten, sie konnten schon meinen Blicken schwer widerstehen. Oft sah meine Mutter fort, wenn ich mit einer ›heißen‹ Bitte zu ihr kam, schwieg eine Weile, wandte sich aber dann doch, mit zusammengepressten Lippen lachend, zu mir und gewährte mir den Wunsch durch ein Kopfnicken, das sie mit einem leichten Streich auf meine Wange begleitete, damit ich nicht übermütig würde.
Meine Mutter war vor ihrer Verheiratung und noch ein oder zwei Jahre nachher, um zu den Kosten der Wirtschaft beizutragen, Lehrerin an einer Mädchenschule gewesen, bis ich dann, als erstes Kind, auf die Welt kam. Sie besaß noch einen Stock, ein graues, abgegriffenes Stäbchen, von dem sie, um mir zu drohen, behauptete, sie hätte böse Kinder damit gestraft. Aber ich erfuhr bald, natürlich von meinem gütigen Vater, dass sie mit dem Stock auf der Landkarte den Kindern die Städte, Meere, Landesgrenzen, Flüsse und Eisenbahnlinien gezeigt hatte, und da sie den Stab in der letzten Schulstunde, die sie gab, benutzt hatte, hatte sie ihn als Andenken mitgenommen. Alle diese Dinge konnte ich mir vorstellen bis auf die Meere, die eines der vielen Geheimnisse waren. – »Viele Flüsse nebeneinander?« fragte ich. – »Nein, aber so ähnlich!« sagte sie bloß, um mich loszuwerden, denn sie hatte viel im Hause zu tun.
Mein Vater war Handwerker, Schuhmachermeister. Er liebte das Schöne. Auch sie, meine Mutter, war ungewöhnlich schön, schlank, groß, mit hellen Augen, reichem dunklem Haar.
Am liebsten hätte er nur die schmalen, feinknöcheligen, hochspannigen Füße junger, gesunder, schöner Menschen mit herrlichen Schuhen bekleidet. Aber sein Drang nach Wissen und nach Vorwärtskommen in der Welt hatte ihn noch als Lehrling dazu gebracht, volkstümliche Bücher über allerlei Wissenschaften und besonders über Medizin zu studieren. (Für sich selbst brauchte er solche nicht, denn er war bis zu seiner letzten und einzigen Krankheit das Bild der Gesundheit.) Die Abbildungen kranker, verkrüppelter Füße hatten ihn auf den Gedanken gebracht, Schuhe für diese Füße herzustellen. Er hatte die geschickteste Hand. Alles flog nur so von seinen Fingern. Anfangs hatte er sich bei einem befreundeten Oberwärter der Chirurgischen Klinik, dann bei dem Professor der Orthopädie Rat geholt, später besprachen die Ärzte mit ihm gemeinsam, wie die Schuhe und Bandagen beschaffen sein sollten. Eine Schuh-Einlage für Plattfüße (ich hielt sie immer für Blattfüße), aus einem besonders elastischen und widerstandsfähigen Material von ihm erfunden, hatte ihm etwas Geld eingebracht. Sie sollte in Amerika ebenso patentiert werden, wie in Europa. Leider tat er nichts dazu. Der Beruf befriedigte ihn nicht. – Noch ein schwerer Klumpfuß! hörte ich ihn murmeln, wenn ein Kunde mit ungefügigen Schuhen wie auf Pferdehufen daherstapfend, den Laden verließ. Er, der so vielen Menschen, wenn schon nicht Heilung, so doch Erleichterung gebracht, der mehr als einen Menschen auf die Füße gestellt hatte durch seine Wunderwerke von orthopädischen Schuh-Apparaten, die aus Korkhülsen, Stahlscharnieren und unsichtbaren Einlagen unter dem Leder bestanden, er hielt sein Werk für ›unnütz‹. Anderen machte er es recht, sich selbst nie. Er hatte verzagt, aber nicht für lange, denn am nächsten Tag war er der Übermut selbst, als wäre er in der Zwischenzeit einer Fee begegnet. Aber gab es denn noch Feen? Sein Frohsinn machte uns alle glücklich.
»Flott, flink und federleicht, Kinder!« rief er meiner Mutter und mir bei einem unserer herrlichen Sonntagsausflüge in dichtem Walde zu, über ein breites, ausgetrocknetes Bett eines Baches hin und her springend. Ich kannte keine Furcht, ich sprang ihm nach, zuerst schlecht, dann besser, mein Vater hob mich an den Armen in die Höhe, schwang mich im Kreise und schüttelte lachend über meinem heißen Gesicht seine dichte Mähne, seinen blonden Bart. Meine Mutter, einen halbvollendeten Kranz von Dotterblumen und Vergissmeinnicht in den Händen, sah in ihren Schoß, in die ordentlichen Falten ihres schwarzen Seidenkleides und schwieg. Mein Vater war am Abend vorher etwas spät heimgekehrt.
Meine Mutter hatte meinen Vater sehr lieb, denn sonst hätte sie nicht den ihr so teuer gewordenen, durch viele lange Entbehrungen erreichten Beruf einer Lehrerin seinetwegen aufgegeben. Er liebte sie noch viel leidenschaftlicher, aber nicht in gleicher Weise wieder. Darüber freute ich mich, denn er gehörte umso mehr mir. Aber es tat mir auch wehe, denn ich sah, dass selbst er manchmal trüb gestimmt war, und alle Aufforderungen der Mutter, nun solle er endlich lachen und eine ›sonnige Miene‹ zeigen, nützten nichts. Ich schmiegte mich, – wie schwer fiel mir das Schweigen, – an die Knie meines Vaters und er fuhr mir zerstreut durch das Haar und seufzte.
Wie selig wäre ich gewesen, wenn er mit mir im gleichen Bette oder wenigstens im gleichen Zimmer geschlafen hätte! Ich ahnte wohl, dass zwischen ihm und ihr etwas bestand, das sie mir verschwiegen. Was? Ein Geheimnis. Aber danach fragte ich nicht. Er, der mir sonst mit Engelsgeduld alles möglichst klar verständlich machte, wonach offenbar die meisten Kinder gar nicht fragen, wäre vielleicht böse geworden über meine bohrende Neugierde, – wie über meine Eifersucht. Und doch konnte ich diese nicht beherrschen. Meine Mutter ging ruhig darüber hinweg. Sie sagte nichts dagegen, wenn ich oft spät abends, wenn die beiden sich schon zu Bett gelegt hatten, an ihre Tür pochte und bat, sie möchten mich einlassen, für ein Stündlein, ein Sekündlein, (die Minuten hatte ich vergessen). Meine Mutter räumte nur schnell einige raschelnde Kleidungsstücke zur Seite, dann öffnete sie in ihrem faltenreichen Nachtgewand die Tür und sagte mit ihrer spöttischen Stimme: »Und was noch?« Ich sprang, die Säume meines langen Nachthemdes hochhebend, schnell über die Schwelle. Flott, flink und federleicht!
Ich wusste wohl, dass es ziemlich schmerzhaft war, auf den schmalen Kanten der nebeneinanderstehenden Betten zu schlafen. Denn das war mein mir von beiden angewiesener Platz. Aber was tat ich nicht alles, um ihm nahe zu sein! Am Tage hatte ich so wenig von ihm! Ich machte mich ganz klein und schmal. Und er, in seiner großen Güte, gab mir sogar ein Kopfkissen (und doch schlief er so gerne weich!) und belohnte mich durch einen seiner seltenen, rauen und festen Küsse dafür, dass ich mich in meiner liebenden Grausamkeit und Eifersucht zwischen ihn und sie gedrängt hatte… Und doch war es eine glückliche Zeit! Bald schliefen wir alle drei ruhig nebeneinander, und morgens waren sie längst aufgestanden, als ich aus himmlischen Träumen, trotz der schmerzenden Knochen fast betäubt von Glück, allmählich erwachte, von ihrer Steppdecke eingehüllt.
2.
Ich erinnere mich, ich war nicht älter als zwölf Jahre, als mich mein Vater in seiner Werkstatt beim Gipsen mithelfen ließ. Ich hatte nichts zu tun, als die Binden, die mit Gipsstaub dick bestreut waren, ins Wasser zu legen, leicht auszudrücken und ihm zuzureichen. Ich hatte einen neuen blauen Matrosenanzug an und gab mir Mühe, ihn nicht schmutzig zu machen. Auf einem ziemlich hohen Stuhle saß verängstigt ein schlankes, rothaariges, grünäugiges Mädchen und hielt meinem Vater, der auf seinem alten Schusterschemel vor ihr saß, ihr fein geschnitztes Knie, den Unterschenkel und ihr kleines, aber etwas nach innen gekrümmtes Füßchen dar. Mein Vater, die linke Hand nach den Gipsbinden ausstreckend, sprach die Mutter des Kindes mit ›Frau Gräfin‹ an.
Ich hatte mir Grafen immer prächtig gekleidet und nur in Karossen fahrend vorgestellt, also ganz anders, als hier Mutter und Kind. Die Mutter war altmodisch angezogen, in jeder Hand hielt sie, ziemlich ratlos, einen Schuh ihrer Tochter. Der linke war eines von den Kunstwerken, in denen mein Vater so groß war, eine komplizierte Maschine mit Stahlscharnieren und hohem Lederschaft, kreuzweise zu schnüren. In jedem der Schuhe, die vom Straßenschmutz recht mitgenommen waren, – in einer Kutsche waren also Gräfin und Komtesse nicht zu uns gekommen, – stak zusammengeknäuelt ein dunkelblauer, handgestrickter Strumpf mit den Initialen A. v. W. in weißer Wolle. Mein Vater wies stumm nach dem Fuß des adeligen Fräuleins. Ich sollte ihn richtig halten. Ich fasste mutig den kühlen Fuß an, der weich war wie das Samtband, das meine Mutter mit einem goldenen Kreuzlein um den Hals trug und das ich gerne anfasste. Aber es war etwas anderes, meiner Mutter das Samtband zu lockern und es ihr lachend unter den Händen fortzuziehen, als hier die etwas feuchte, mit bläulichen Adern durchzogene Haut eines zitternden großen Mädchens zu berühren. Das Halten genügte nicht, ich musste, wie mir mein Vater halblaut befahl, ihr das Fußgelenk stark nach außen beugen und die Zehen, (sie glichen mit den kleinen glänzenden Nägeln winzigen Fingern), nach oben drücken. Während das Mädchen schmerzhaft aufseufzte und sich gegen den Druck meiner Hand wehrte, legte mein Vater die ersten Gipsbinden um den gelähmten oder verkrüppelten Fuß. Als mein schöner Anzug ein paar weiße Flecken abbekam, zu meinem Schrecken, lachte sie mich plötzlich an, mit ihren reinen großen grünen Augen mich umfassend und ihre spitzen, aber kurzen Zähnchen zwischen den vollen Lippen zeigend. Mein Vater führte die Binden weiter bis unter das Knie. Dann wartete er eine kleine Weile, die Hände im Schoße auf seiner grünen Schürze, bis die Gipslage erstarrte, eine ziemlich starke Wärme verbreitend. Wir schwiegen alle vier. Bald wurde der Verband trocken und hart, er tönte hell wie dürres Holz, als mein Vater mit dem Griff eines scharfen kleinen Messers daran klopfte. Er begann den Verband vorne aufzuschneiden. Das Fräulein hatte die Augen geschlossen, es begann leise zu zittern. Auch ich empfand eine seltsame Angst, mein Vater könne zu tief schneiden und durch die Gipsschichten hindurch meine Hand, die immer noch die Zehen umklammert hielt, oder gar das Mädchen selbst verletzen.
Ich fühlte eine Welle von Blut in mir aufsteigen. Es war mitten im Hochsommer, deshalb standen die Fenster offen. Der Wind hatte sich in dem blauen Rock des Mädchens verfangen. Etwas Unbeschreibliches in mir wollte etwas und wusste nicht was. Aber schon hatte mein Vater das Werk vollendet. Er hob das schlanke rosige Bein aus der kalkigen Form heraus, die er dann später mit Gips ausfüllte, um auf dem Modell seinen Schuh zu bauen. Solcher Modelle gab es eine Unzahl hier; sie hingen an Schnüren und bewegten sich in ihren Ecken unter dem Wind, andere lagen auf einem Haufen, zum Teil noch kreidig weiß, zum Teil schon schmutzig geworden. Die Gräfin begab sich mit meinem Vater zum Schreibtisch, wo er in sein Bestellbuch alles Nötige eintrug. Ich hörte sie sagen: »Man wird doch nichts sehen?« Sie wollte, dass der Schönheitsfehler ihrer armen schönen Tochter verborgen blieb. (Ich aber kannte ihn.) Die alten Schuhe hatte sie jetzt vor uns beide, das Fräulein und mich, hingestellt. Das Mädchen hatte sich zurückgelehnt und blickte mich seltsam an, nicht Lachen nicht Weinen, keine Scham, viel eher Stolz, aber dann schlug sie die Augenlider nieder, und um ihren Mund begann es zu zucken. Ich machte mich daran, ihr die Strümpfe anzuziehen, aber kaum hatte ich ihre Haut berührt, als sie mir die Strümpfe aus der Hand riss und sich anzuziehen begann. Schämte sie sich vor mir? Dann schämte sie sich nicht ihres Gebrechens, nicht ihrer nackten weißen Haut, sondern der Löcher, die in den adeligen Strümpfen zu sehen waren. »Sie kommen in ein paar Tagen zur Anprobe! Später brauchen Sie nur zu schreiben, wenn Sie neue Schuhe brauchen. Vor einem Jahr wächst sich der Fuß noch nicht aus. Aber bis dahin… oh, bis dahin! –« sagte mein Vater. Die Gräfin strahlte. Dass mein Vater ihr eine, wenn auch nur ganz zarte Hoffnung gemacht hatte, ihr Kind könne von seiner Lähmung in einem Jahr genesen sein, hatte ihr offenbar eine große Freude bereitet. »Sollen wir Ihnen eine Angabe geben?« fragte sie, ein etwas abgeschabtes schwarzes Portemonnaie aus ihrer Tasche ziehend. Mein Vater winkte ab. Sie gingen. Das Mädchen wandte sich an der Schwelle nach uns oder mir um. In dem blassen Gesichtchen leuchteten die dunkelroten Lippen, von denen die Oberlippe voller war als die Unterlippe und wie ein kleines Flügelchen nach vorne stand. Von jetzt an dachte ich viel an A. v. W. Ich wusste nicht wie sie hieß, ich kannte nur die Anfangsbuchstaben. Ich versuchte sie in der Werkstatt gelegentlich der Anprobe wiederzusehen, vergebens. Ich träumte von ihr, wirr und nicht angenehm. Es scheint, dass ich mir im Traume vorstellte, das Messer dringe einem von uns und dann beiden zu gleicher Zeit wirklich in die Haut. Ich muss im Traume vor Schmerzen aufgeschrien haben. Und doch war es nicht ein Schmerz wie sonst, eher ein schmerzhaftes, starkes, banges Entzücken. Vielleicht habe ich sogar nachts geweint, (und ich weinte doch immer so schwer!) denn mein Kopfkissen war nass.
Meine Mutter sah es, ich log diesmal. Ich log selten, denn meine Eltern sorgten dafür, dass mir das Lügen erspart blieb. Sie stellten mich meist nicht auf die Probe. Ich sagte, ich hätte aus dem Wasserglas trinken wollen, das auf dem Nachttischchen stand und dabei etwas Wasser vergossen. Meine Mutter sah sofort, dass das Glas bis oben voll war, so wie sie es gestern Abend hingestellt hatte.
In diesem Augenblick erschien mein Vater auf der Schwelle, meiner Mutter zuckten schon die Lippen, als wolle sie ihm von meiner Lüge erzählen, dann aber hob sie mit ihrem etwas spöttischen Lächeln die Schultern, – und schüttete, – das war eben ihre ironische Art der Erziehung – jetzt soviel Wasser aus dem Glas auf das Kissen, dass es noch abends feucht war. Die junge Gräfin traf ich nicht. Auch im Traume wollte sie mir nicht mehr erscheinen.
Aber ihr zartes Knie und den armen kleinen Fuß habe ich wieder gesehen. Vom Knie war nur der Ansatz da. Ich habe das schneeweiße, schlanke leichte Gebilde, das ihren Namen und das Datum unserer Begegnung trug, mit meinen Wangen und mit meinen Haaren gestreift. Es hing nicht an einer Schnur, es lag auch nicht tot da. Es lehnte für sich allein an der Wand, als sei es aus der Mauer herausgetreten, um zu mir zu kommen. Jetzt durchrieselte mich das schwere, beklemmende, schmerzhafte Entzücken noch stärker als im Traum. Die Werkstatt war leer. Geküsst habe ich es nicht. Ich fürchtete dies zu sehr. Ich ahnte unser Geheimnis.
3.
Gott, Christus, Himmelreich und Hölle waren große ›Geheimnisse‹ für mich als Kind. Ich empfand eine Art freudiger Neugierde für Gott, keine Angst vor ihm, keine Furcht. Den Tod verstand ich noch nicht. Ich lebte unendlich gern. Gott bedeutete für mich Geliebtwerden, Lieben und ewiges Geheimnis zugleich.
Oft ging ich am Sonntagvormittag mit meinem Vater zum Hochamt, während meine Mutter daheim blieb. Ab und zu stand mein Vater während der Messe auf und blickte sich um. Es kam vor, dass er schon lange vor dem Ite Missa est! dem letzten dröhnenden Orgelschall (Gott bläst uns alle aus der Kirche heraus, dachte ich, es war wie ein Sturm) die Kirche verließ, ohne dass ich ihn begleiten musste. Meine Mutter empfing mich dann nicht immer freundlich. Aber bald kam er nach. Wir trösteten uns, mein Vater nahm seinen alten Handatlas und verließ mit mir noch einmal die Wohnung. Wir gingen spazieren oder wir setzten uns im stillen, kühlen Treppenhaus nieder, auf die Stufen, jeder sein Taschentuch unter sich, er holte Bonbons aus seiner Tasche und teilte sie mehr als redlich mit mir. Wir breiteten den Atlas über unsere vier Knie und mein Vater erklärte mir die Welt. Die ersten Seiten des Atlasses, welche die Sternenwelt darstellten, überschlug er mit seiner am Handrücken samtartig weichen und weißen, aber an den Fingerspitzen und in dem Handinnern etwas schwieligen und gelblichen Hand. Er hatte auf den freien Rückseiten dieser Karten als junger Mensch Abbildungen der Fuß- und Beinknochen kopiert und ihre lateinischen Namen mit seiner kleinen, kritzligen Schrift aufgezeichnet. Bald aber erschien meine Mutter, halb und halb wieder versöhnt, hörte mit ihrem alten Lächeln seine Erklärungen an, als wisse sie es besser. In ihrer Nähe wurde mein Vater still, errötend klappte er das Buch zu, plötzlich fiel er meiner Mutter um den Hals und sie küssten einander wie Kinder. Ich ging voraus in die Wohnung. Sie sprachen leise und lange auf dem Treppenabsatz.
Meine Mutter lächelte ihm am Nachmittag wieder viel gütiger und frohsinniger zu, und als sie abends schlafen gingen, hörte ich traurig, wie eines von ihnen den Riegel vorschob.
Einige Monate später kündigte mir meine Mutter an, ich solle sie auf vier Wochen verlassen. Ich reiste, als ein Junge von dreizehn Jahren ohne Furcht, aber auch ohne die geringste Freude zu meinem Großvater auf das Graf Minskysche Gut, wo er Obergärtner war. Mein Großvater führte mich in den Glashäusern umher. Mein Vater schrieb mir eine schöne Ansichtskarte. Der Großvater wollte sie natürlich sehen, aber ich hatte sie in meiner Eifersucht längst in kleine Stückchen zerrissen.
Mein Großvater war ein Meister der Gartenkunst und es kamen stets Gärtner der großen benachbarten Güter, um Rat von ihm zu erholen. Er sprach sehr lange und ernsthaft mit ihnen, nachher vertraute er mir, unter seinem dicken grauen Barte listig schmunzelnd an, er habe keinem Menschen jemals seine Geheimnisse verraten, und deshalb liebe ihn die Gutsherrschaft und komme ihm in allem entgegen. Das bezog sich auf die einzige Leidenschaft, die ihn beherrschte, nämlich die Jagd. Er war ein herrlicher Schütze, verfehlte nur sehr selten sein Ziel, aber die Herrschaft sah es nicht immer gerne, behauptete er, wenn er ›Blattschüsse‹ setze, (ich verstand das Wort falsch und dachte, es habe etwas mit Blättern und Wald zu tun), während der Graf die Rehe und Fasanen so schlecht traf, dass es ihn, den Gärtner jammere. Auch sei es schrecklich, das Gezerre der angeschossenen Fasanen, das traurige Flüchten und scheußliche Schweißen der bloß angeschossenen armen Jagdtiere zu sehen. Nur deshalb gehe er, der Großvater, am liebsten allein mit seinem guten Hund, auf den Anstand. Manchmal ließ er mich seine Flinte auf dem Hinweg oder die Jagdtasche auf dem Heimweg tragen. Ich saß auf dem Anstand neben ihm, mitten im Duft des Waldes und im Dunst seines feuchten Lodenrockes; wir hockten stundenlang auf dem Holzgerüste am Waldrande, das er die Jagdkanzel nannte, und lauerten in der Dämmerung auf das Erscheinen der Rehe, die mit den Kälbern und Kitzen lautlos angetrabt kamen. Manchmal begnügte er sich, sie nur zu visieren. Manchmal aber schoss er. Ich erinnere mich aber nur einer Jagd auf Fasanen. Das warme Leder der prall gefüllten Jagdtasche schlug beim Heimweg durch die kahlen Felder an meine Knie und wir beide, Großvater und ich, summten vor uns hin. Der alte Graf begegnete uns, lachte uns zu und schlug sich auf die Schenkel, auf die Jagdtasche anspielend. Der Großvater fluchte und nahm mich nicht mehr zur Jagd mit.
Kurz darauf kam mein Vater an. Er begrüßte den Großvater etwas kühl. Sehr zu meiner Freude, denn ich wollte, mein Vater solle endlich mir allein gehören. Indessen musste ich hören, dass mich daheim ein ›Geschwisterchen‹ erwarte. Es war meine Schwester Anna, die man Anninka nannte. Ich staunte sie sehr an, konnte mich aber lange nicht an sie gewöhnen.
Mit meinen Eltern war ich jetzt viel weniger als früher allein. Ich begann sehr viel zu lesen. Ich lag dann am liebsten flach auf der Erde, die Arme aufgestützt, die Hände an den Wangen und die Zeigefinger in den Ohren, von wo ich sie nur fortnahm, um die Seiten umzublättern. So konnte mich niemand stören. Ich las mit unersättlichem Hunger, selbst auf dem Heimweg aus der Schule, im gehen. Aber am liebsten in einer bestimmten Ecke meines Zimmers, bei offenem Fenster, wenn der Wind die Vorhänge hineinbauschte. Alte Zeitschriften, Kochbücher, Traumbücher (diese von unserer guten Magd Marthy geliehen), Eisenbahnfahrpläne, Gedichte und Romane, Postalmanachs mit blöden Scherzen und alten Witzen, Schlossers Weltgeschichte, die Bibel, Sagen und Märchen, die Schulbücher meiner Mutter, moralische Erzählungen aus der Schulbibliothek, Goethe und Schiller, oft vieles nebeneinander, ohne immer den Inhalt zu verstehen. Aber ich merkte mir manche Sätze, oft ganze Seiten, dachte später in Ruhe, vor dem Schlafengehen darüber nach, brachte sie mit meinem alten Warum in Zusammenhang. Ich schlug ein kleines Lexikon nach, da ich viele Fremdwörter nicht verstand, den Atlas blätterte ich fast täglich abends durch. Es war immer Neues in ihm zu finden.
Die Sternkarte fesselte mich, die Sterne regten mich auf. Ich fand sie getreu auf dem Himmel wieder. Aber auf dem Himmel waren sie gleichsam weiß auf schwarz, auf der Karte schwarz auf weiß. Einmal lieh ich mir von meiner Mutter ihren neuen Brillantring, den sie anlässlich Anninkas Taufe erhalten hatte, und sah nachts vor dem Schlafen durch das Rund des Ringes den klaren wolkenlosen Himmel an. Aber je länger ich durch den Ring hindurchsah, desto zahlreicher wurden die Sterne, es war, als kämen sie aus einer Wand lautlos und leuchtend hervor. Einen großen grüngoldenen, den ich immer fand, belegte ich mit Beschlag und nannte ihn nach meinem Vater, einen zweiten nach einer anderen Person. Ich selbst war ein ziemlich kleiner, der zwischen beiden war. Ihre Stellung gegeneinander blieb stets die gleiche, worüber ich sehr staunte, und was ich als die Ordnung Gottes bewunderte. Von Amerika gesehen sollte dies anders sein, behauptete meine Mutter. Aber sie hatte unrecht, obgleich sie früher Lehrerin gewesen war. Ich sagte es ihr nicht. Manchmal hatte sie gerötete Augen, so sehr sie sich mit meinem Schwesterchen freute. (Nun hatte meine Mutter von jeher schwache Augen. Aber es war mir noch nie so aufgefallen.) Ich überraschte sie einmal, als sie sehr betrübt in ihren Schoß sah, wo mein Schwesterchen, fast nackt und ebenfalls sehr still, dasaß. (Ich habe es kaum dreimal weinen gehört; wenn es lachte, tat es dies schüchtern, in Absätzen, immer wieder innehaltend, als stottere es beim Lachen.) Nun hatte ich eine naseweise Frage an meine Mutter, ein Warum, für das es kein Darum gab. Aber ich hätte niemals gedacht, dass sie mir deshalb böse sein könne. Ich fragte sie nämlich warum man Finger hut sage und nicht Finger schuh, da man doch von Hand schuh und nicht von Hand hut rede. Sie blickte überrascht auf, aus allen ihren Gedanken gerissen und da sie glaubte, ich mache mich über sie und ihre ›Lehrerinnenweisheit‹, wie sie es nannte, lustig, schlug sie mir fest mit der geballten Hand ins Gesicht. Mein Schwesterchen schrie auf. Ich nicht. Ich fragte von jetzt an viel weniger, und meine Mutter selbst war es, die mir ihre Ungeduld abbat. Ich küsste sie nur, ohne zu antworten.
Meine Jugend war übervoll von Glück. In der Schule kam ich gut vorwärts trotz meiner Lesewut, denn ich brauchte eine Seite nur einmal gut zu lesen, um sie mir zu merken. Ich war sehr erstaunt, dass nicht jeder Mensch dies konnte, selbst meine Eltern konnten es kaum. Ich hatte viele gute Kameraden in der Schule, obgleich ich mich mit unsinnigem Stolz niemals ganz auf gleiche Stufe mit ihnen stellen wollte. Ich sollte ihnen immer der Richter sein, wenn sie Streitigkeiten miteinander hatten. Aber das Richteramt endete meist in einer allgemeinen Prügelei. Dann wollten sie meine ›Trabanten‹ werden. Das heißt, sie wollten mir ihre Dienste widmen, mir zum Beispiel im Turnsaal die Schuhe ausziehen, die Turnschuhe knüpfen, mir den Bleistift spitzen, die Schultasche tragen usw. Ich tat dies aber natürlich viel lieber selbst. Ich brauchte sie nicht. Deshalb hingen sie mir vielleicht so sehr an. – Mit immer stärkerer, aber nur noch stillerer Liebe wollte ich bei meinem Vater sein. Sein Trabant zu sein, war mein Traum. Er aber ahnte nichts davon, und meine Mutter sagte mir damals mit einer Art Triumph, ich müsse als großer Junge endlich lernen, mit mir selbst fertig zu werden. Ich verstand dies schwer, aber endlich verstand ich es, ich beherrschte mich so sehr, dass er einmal, verlegen, die schöne Hand in seinem dichten Bart, zu mir kam, und mich, bei jedem Wort auf meine Schulter klopfend, fragte: »Bist du mir böse?« Wäre er doch immer so neben mir, über mir gestanden.
4.
Um diese Zeit verkaufte mein Vater gegen den Rat meiner Mutter seine Werkstatt an seinen ältesten Gehilfen, und meine Eltern überlegten lange, was man beginnen sollte. Die Stadt entwickelte sich sehr schnell, kleine Dörfer, die in der Umgebung lagen, wurden eingemeindet, selbst Wälder, Wiesen und unbebaute Grundstücke. Viele Menschen wurden schnell reich. Mein Vater dachte daran, ein Grundstückbüro zu eröffnen.
Mein Vater muss jetzt noch mehr beschäftigt gewesen sein als früher. Er kam oft spät heim, einmal hatte er eine bereits etwas welke, seltene Blume im Knopfloch, manchmal war er noch nicht daheim, wenn es neun Uhr geworden war und die Schlafmüdigkeit mir die Augen schwer machte. Meine Mutter riet mir, ich solle ruhig aufbleiben und die Ankunft meines Vaters abwarten und noch mit ihm einen Bissen essen, sie zeigte mir sogar, wo die Speisen standen. Rechnete sie mit meinem Widerspruchsgeist, das heißt damit, dass mir das erlaubte Aufbleiben keinen Spaß machen würde? Ich ließ mich nicht stören und blieb. Endlich knarrte die Entreetür leise, mein Vater kam heim, seine Augen leuchteten in merkwürdigem Glanz, in seiner Tasche klingelte etwas Metallgeld. Er hatte einen starken, süßen und dumpfen Geruch an sich.
Er sagte, er sei beim Frisör gewesen und dieser hätte zu viel Parfüm genommen. Aber sein Haar, das hatte ich beim Kuss gemerkt, roch eher nach Rauch, Zigarrengeruch, das Parfüm kam von unten, aus seiner Rocktasche. Wir saßen einander gegenüber, er hatte ein müdes, aber eigentlich glückliches Gesicht. Er fasste jetzt etwas verlegen in seine Rocktasche, dann gab er mir die Zeitung zu lesen, die ich sonst nur heimlich mit größtem Genusse verschlang.
Ich tat, als ob ich lese, als er sich aus dem Fenster herausbeugte, ein kleines weißes Taschentuch herauszog, es an seine Schläfe, an seinen Mund hielt, und es dann, zu einem kleinen Knäuel zusammengeballt, aus dem Fenster warf. Er sah ihm nach. Der Wind hob seinen blonden Bart fort von seinem weißen glänzenden Halskragen. In diesem Augenblick trat meine Mutter in ihrem Nachtkleid ein, unerwartet von uns beiden. Er wandte sich errötend um, nahm mir die Zeitung aus der Hand und hieß mich schlafen gehen. Jetzt gehorchte ich ihm, ohne Zögern, ohne Besinnung. Bei ihm empfand ich den Widerspruchsgeist nicht, denn ich wollte ihm gehören. Es war mir traurig, dass er ein neues Geheimnis vor mir hatte. An der Schwelle zu meinem Schlafraum blieb ich stehen und sah empor. Vielleicht wollte ich den lieben Gott um etwas besonders Gutes und Frohes für ihn bitten, denn damals stellte ich mir Gott immer über meinem Kopfe, in die sogenannte Ewigkeit und Unendlichkeit hineinragend vor. Er missverstand aber diesen Blick. Er lachte meiner Mutter zu und zeigte ihr, die ganz und gar nicht hinhörte, sondern mir stumm winkte, ich möge doch endlich gehen, zwei Ringe in der Decke eingelassen, welche die früheren Mieter der Wohnung zum Aufhängen von Zimmerturngeräten benützt hatten. Ich verbeugte mich vor meinen Eltern und ging schlafen, ich hörte sie sofort sehr schnell und leise reden, aber nicht so leise, dass ich nicht etwas davon hätte auffangen können. Das aber wollte ich um keinen Preis. Ich stopfte mir die Finger in die Ohren und schlief ein. Natürlich ließen die Finger bald nach und mein ganzer Körper löste sich in dem (auch an diesem Abend seligen) Gefühl der Müdigkeit, des sich Verlierens, des sich Anvertrauens, des an Gott, den unendlichen und ewigen Vater Glaubens, des sich an ihn und das ewige freudige Leben Dahingebens.
Am nächsten Abend kehrte mein Vater schon um sechs Uhr heim, er setzte sich zu mir, sah mir über die Schultern in meine Schulaufgaben, zog dann ein Notizheft heraus und schrieb meine Aufgabe, – (es war darstellende Geometrie mit verwickelten Zeichnungen), in seinem Hefte nach. Es war, als wolle er noch einmal in die Schule gehen. Das Gymnasium, das ich, als wäre es etwas Selbstverständliches, besuchte, war der große Traum seiner Kindheit gewesen. Meine Mutter war sehr froh über sein frühes Heimkommen. Das Parfüm schwebte noch um ihn, wie die letzte Erinnerung an einen Traum. Meine Eltern tranken Wein, von denen sie mir einige Tropfen in mein großes Wasserglas schütteten.
Nach der Mahlzeit, als meine Mutter die kleine Schwester zur Ruhe gebracht hatte, schleppte mein Vater ein großes, in blaues dickes Packpapier gehülltes Paket herein. Es enthielt Turngeräte, eine Schaukel aus gelbem glatten Holz, ein Reck, zwei Ringe aus Eisen, mit hellem Leder bespannt, und die dazu gehörigen Seile und eisernen Schnallen. Meine Mutter schüttelte den Kopf, plötzlich etwas ernst geworden. Vielleicht fürchtete sie, mein Vater wolle durch dieses Geschenk etwas gutmachen. Aber jetzt schoss geradezu eine fröhliche Flamme in den goldbraunen schönen Augen meines Vaters auf, als er meiner Mutter den Rücken streichelte, und auf ihren bloßen weißen Nacken hinflüsterte: – »Liebes! Nicht er, sondern du musst es zuerst versuchen! Du musst schaukeln!« Wie hätte sie ihm widerstehen können? Ich und er hatten das Turngerät oben mit Hilfe der Küchenleiter befestigt. Um es zu erproben, hatte sich mein Vater an die frischen, knarrenden Seile gehängt. Jetzt hob er meine errötende Mutter sanft auf die Schaukel, strich ihr zärtlich die Hausschürze über den Knien zurecht, und schaukelte sie lind hin und her, bis sie ihm, als wäre sie schwindlig geworden, mit beiden Armen um den Hals fiel. Jetzt durfte ich turnen. Welches Entzücken war es für mich, als ich, vom parkettierten Fußboden mich mit Kraft abstoßend, zuerst von der Erde aufstieg, und dann, durch Aneinanderziehen der Halteseile die Schaukel in immer sausendere Schwünge versetzte! – Unten saßen die Meinen und tranken sich zu, mein Vater spielte mit seiner von Ringen blitzenden Hand in den dicht und streng geflochtenen Haaren meiner Mutter, die still vor sich hin sah, ich aber flog fast zur Decke, die Augen schließend, tief atmend und wie berauscht, ihnen entgegen, dann nieder zur Erde, und zurück schwang ich in den dunklen kühlen Schlafraum.
Mein Vater hatte jetzt ein schönes Büro in der Stadt, aber dort sah er uns, meine Mutter, mich und meine Schwester (die jetzt schon fleißig lief und die ebenso um meine Freundschaft warb, wie die Trabanten in der Schule), – nicht gerne, wenn wir ihn unangesagt besuchten. Aber gerade das wollte meine Mutter. Einmal kam sie mit uns, ließ uns aber vor der Tür warten. Nachher aber eilte sie mit bitterem blassem Gesicht, mich mit der rechten, meine Schwester mit der linken Hand haltend, die Treppe hinab und atmete schwer, ihren gestickten Schleier lüftend, als bedrücke er sie. Zwei ältere, sehr kostbar und doch nicht schön gekleidete Herren, die Zigarren im Mund, mit dicken goldenen Uhrketten und Brillantennadeln in den auffallenden Krawatten, schnauften eben an uns vorbei die Treppe hinauf. Sie grüßten meine Mutter, die kaum dankte und uns so stürmisch herunterführte, dass meine Schwester, die noch nicht genug Bescheid wusste mit ihren dünnen Beinchen, beinahe gestürzt wäre. Meine Mutter fing sie gerade noch auf. Sie ließ meine Hand los, und hob die eben zum Weinen ansetzende Anninka an ihre Brust.
Wir gingen dann auf der Straße schnell weiter. Ich hatte den Eindruck, dass ein Fenster im Büro meines Vaters jetzt geöffnet wurde, und dass er uns etwas nachrief. Sie hörte nicht hin und eilte mit uns heim. »Versprich mir, dass du niemals spielst!« rief sie mir atemlos zu, als wir daheim vor unserem Hause angelangt waren. Als wir aber im Kinderzimmer waren, sagte sie, den Schleier von ihrem Hut abreißend: »Endlich! … So, Kinder, spielt!« Ich hätte jetzt nach dem Warum fragen sollen. Vielleicht hätte mir meine Mutter etwas von ihrem Kummer mitgeteilt. Aber ich wollte nichts wissen. Übrigens übersiedelten wir bald danach in eine etwas größere Wohnung, für die neue Möbel beschafft werden mussten. Vieles von der alten Einrichtung wurde verschenkt, aber die Turngeräte nahmen wir natürlich mit …
5.
Am schwersten fiel mir in der Schule die Mathematik, Geometrie, Algebra. Aus Widerspruchsgeist gab ich mir bald die größte Mühe gerade mit diesen Gegenständen. Die verwickelten Aufgaben in immer kürzerer Zeit, auf immer weniger Umwegen, immer klarer zu lösen, ›eleganter‹, wie es im Schuljargon heißt, das war nur der Anfang. Die schwerste, wichtigste Schule bestand aber für mich darin, die Beweise der Lehrsätze, die Ableitungen der Formeln selbst zu finden. Weder auf den Professor zu warten, der sie vortrug, noch in dem Lehrbuch nachzusehen, wo alle Beweise sich bereits gedruckt vorfanden. Die Kameraden glaubten der Autorität, sie lernten auswendig. Ich wollte (auch dies ein Größenwahn der Jugend) selbst meine Autorität sein, ich lernte inwendig. Unnütze Zeitverschwendung?
Und doch brachte ich mit Stolz eine halbe Nacht damit zu, die Ableitung für den binomischen Lehrsatz in meinem Geist, in meiner Logik, in meiner Kombination zu finden. Nicht nur unnütz, sondern dieses – wie viele andere Male – vergeblich! Die Wonne verwandelte sich in Müdigkeit und Gram. Endlich erkannte ich, dass mein Grübeln mich nur verwirrter mache. Ich wollte aber nicht verzweifeln. Ich konnte mich nicht geschlagen geben. Ich kam lieber ›unvorbereitet‹ in die Schule, wurde gerade an diesem Tage geprüft, und wenn ich mich auch der unsinnigen Hoffnung hingegeben hatte, vor der schwarzen Schultafel den Beweis zu finden, so musste ich doch voller Beschämung, die Kreide zerbröckelnd, schweigen. Meine Kameraden, die bis jetzt meinen geistigen Hochmut bewundert hatten, statt ihn, wie ich es später selbst tat, zu belächeln, flüsterten mir die Lösung zu. Ich war nicht imstande, ihnen die lange gesuchte Wahrheit abzulauschen. Ich kam mit einer schlechten Note heim, aber an meiner Energie zweifelte ich weniger denn je. Ich erzählte diese komischen Abenteuer meiner Mutter. Sie als frühere Lehrerin begriff sofort das Unsinnige daran, sie warnte mich. Mein Vater kam hinzu, lächelte zerstreut. Er sagte nichts. Ich glaubte mich damals weit von ihm entfernt (seit dem Besuch in seinem Büro), aber in Wahrheit waren wir uns näher denn je. Denn auch er hing unnützen Spekulationen nach, die über seine Kraft gingen, wenn auch in ganz anderer Weise. Ich grübelte über den binomischen Lehrsatz, der längst von großen Genies gefunden war, er grübelte über seine Kombinationen, die ihm Millionen verschaffen sollten, ein Palais, den Adel, einen Sitz im Gemeinderat … Er setzte alles, was er hatte, und vielleicht noch etwas mehr auf eine Karte. Für wen? Nicht für uns! Das hatte ich erkannt, als ich vor seiner Tür vergebens auf ihn gewartet hatte.
Er studierte den Stadtplan, um zu sehen, nach welcher Richtung sich die Stadt ausbreiten würde. Hier und da in der Provinz kaufte er unbebaute Grundstücke, sich schlecht rentierende Zinshäuser, verlassene Villen, Gärten und Felder auf. Er hielt sich nicht lange mit Überlegungen auf: »Flott, flink und federleicht!« wiederholte er oft. Aber glaubte er an sein Glück, an seinen Stern? Er verkaufte die ›Gründe‹ weiter, oder er ließ sich die Realitäten hoch belehnen, er tauschte sie gegen andere um, oft musste er sie aus einer ›schwachen Hand‹ wieder zurücknehmen.
Aber er erzählte nur von den Gewinnen. Telegrafenboten kamen, fürstlicher Trinkgelder gewiss, auch nachts, die mürrischen, abgeschabten und strengen Steuerbeamten suchten ihn morgens auf, er hatte seinen Anwalt. Alte, aber noch gute Häuser ließ er niederreißen und machte mit Architekten oder Gruppen kühne Verträge. Zum Bauen gehörte viel Mut, aber noch mehr Geld. Die Architekten stürmten unsere Wohnung, mein Vater konnte sich weder in seinem Büro noch bei uns vor ihnen retten. Hatte er aber das Geld besorgt, dann musste er hinter ihnen bei Tag und bei Nacht her sein. Er stand in seinem hellen Mantel den ganzen Tag auf dem Bau, trieb die Polierer und Maurer bis zum letzten Tagelöhner und ›Ziegelschupfer‹ an, und alle waren froh, dass sie für ihn arbeiten konnten. Er sparte nicht, denn sparen bringe kein Glück sagte er, Glück aber war die Hauptsache. Kaum waren die Mauern etwas ausgetrocknet, als die ersten Mieter einziehen mussten. Dann kamen die Termine, vier im Jahr, und wir zitterten alle um die Mieten, denn auch unter den vielen neuen Mietern gab es manche schwache Hände.
»Wenn die erste Jahresmiete bis morgen Glockenschlag zwölf nicht da ist, richtet mich die Bank zugrunde.« Das Wort verlor sich dumpf, unheimlich in seinem Bart. Wie sehr zitterte ich bei diesem Unglückslaut, wie blass wurde meine Mutter, selbst mein ahnungsloses zartes Schwesterchen verkroch sich in eine Ecke mit den Spielsachen, die sie von mir geerbt hatte. Und doch schien er eine gewisse Wollust bei diesem Worte zugrunde zu empfinden.
Eines Tages sandte er die ganze Familie in die Kirche. – »Betet! Betet um Sonnenschein!« Wie meist, wie bis jetzt noch immer hatten wir Glück, die Regenzeit hörte auf und der Bau kam noch vor dem Herbst unter Dach und Fach. Ein anderesmal hatte er mit dem Grundwasser nicht gerechnet. Die Fundamente sackten nach einem Gewitter zusammen. Wo war jetzt: Flott, flink und federleicht? Nur durch ein Wunder konnten wir vor dem ›Zugrunde‹ gerettet werden. Und wurden gerettet. Auch hier fragte ich mich nicht nach dem Warum. Ich war sehr froh und alle mit mir. Waren das Gebet, der Himmel, der Heiland (den ich mir als jungen Menschen, wenig älter als ich vorstellte), die Rettung? Verdankten wir der Hilfe Gottes, des Allmächtigen, das Wunder? Nein, meine Mutter klärte mich heimlich auf, die Rettung kam vom grünen Tisch, vom grünen Rasen. Mein Vater spielte, er setzte auf junge, dreijährige Pferde, er setzte auf Sieg und auf Platz. Einmal nahm er mich sonntags heimlich gleich nach dem Essen zum Rennen mit, er erklärte mir alles wie seinem Freund. Er hatte aber nicht den Mut, den Ausgang der Rennen abzuwarten, und vielleicht zuzusehen, da der Name eines ›fremden‹ Pferdes am Totalisator hochgezogen würde. – »Nie wieder!« sagte er beim Fortgehen, halb lustig, halb verzweifelt lächelnd, als wir vor dem verlassenen Ausgang standen.
In einer vor Hitze knisternden Holzbude zählte ein eisgrauer alter Beamter den Erlös der Eintrittskarten. Der Tee auf dem Dache glänzte in der prallen Sonne, über den gemähten Wiesen flirrte die Luft. Dann ging mein Vater. Man hörte die Glocke klingeln. Das Heranrauschen der Hufschläge auf der Erde, das Rufen und Klatschen der Zuschauer und ihr Verstummen. Plötzlich dachte ich an A. v. W. Da begann es von neuem auf der Erde zu trommeln. Die Pferde kamen zum zweiten Male vorbei. Es war noch nicht entschieden.
Er war schon fern. Seine hohe Gestalt hob sich kaum von der strahlenden weißen staubigen Landstraße ab, die sich zwischen den kurzgeschnittenen, weiß bepuderten Hecken in gerader Linie hinzog. Ich kehrte zu dem Sattelplatz zurück, für den wir die zwei teuren Karten gelöst hatten. Mich reizte das Gewinnen nicht. Ich verstand vom Geld noch zu wenig. Herrlich fand ich die prachtvollen Pferde mit den bunten Jockeys. Es war ein wolkenloser, aber schon etwas müder Tag, am Ende des Sommers. Unsere Pferde gewannen. Warum hatte sich mein Vater diese Freude versagt? Er hatte richtig gesetzt. Er hatte ungewöhnliches Glück. Er? Wir alle! Wir hatten die Sieg-Quoten 26 : 1,5 : 1 und zweimal wenigstens Platz.
Ich sollte ihm die Nachricht in sein Kaffeehaus bringen. Ich hatte noch niemals eine so riesige Summe in der Hand gehabt. Atemlos vor Stolz, Freude und Aufregung kam ich an, aber er winkte mir ab, müde und bleich in seinem weißen Leinenrock, der nicht in die schmierige Umgebung hereinpasste … Ich habe niemals gewagt, über ihn zu urteilen wie über andere Menschen.
Ich musste die großen Banknoten eine nach der anderen aus der Hand geben. Er war dauernd im Verlust. Meinen Blicken wich er aus. Ich hockte hinter ihm, hielt den Atem an und wünschte nur eines: Wäre er wenigstens glücklich gewesen! Ich schweige über unseren Heimweg. Er musste doch jemandem Vorwürfe machen. Mich machte auch dies glücklich.
Unser altes Dienstmädchen, der treue Geist, sie, die seit zehn Jahren an einen Kaminfeger ›versagt‹ war und dennoch meine Mutter und uns ›arme Kinder‹, wie sie uns nannte, nicht verlassen wollte, fand am nächsten Morgen die blutroten Eintrittskarten zum Rennplatz in meinen Taschen. Auf eine hatte ich mit Kopierstift ein A geschrieben. Marthy zeigte sie meiner Mutter, die sie im Küchenherd verbrannte.
Mich nahm er seitdem nie mehr zum Rennen mit. Er war nicht mehr der alte. Oft kehrte er am Vormittag noch einmal zurück in unsere Wohnung, mit ganz verlorenem leeren Blick, totenstill, klein geworden. Um den Tag zum zweiten Mal zu beginnen, legte er sich zu Bett, aber er stand bald nachher flott und federleicht ein zweitesmal auf, den Blick wieder lebhaft, die Stimme klangvoll, ein Bild der Jugend und Gesundheit wie immer.
6.
In einem dieser schönen Sommer machten wir fast jeden Sonntag Ausflüge. Es war meiner Mutter gelungen, meinen Vater davon abzuhalten, uns Kinder mit ihr aufs Land zu schicken, wie er es in den früheren Jahren getan hatte, um allein in der heißen Stadt zurückzubleiben.
Wir fuhren gewöhnlich gegen 2 Uhr von unserem Bahnhof ab, dessen Glasveranda mit wildem Wein bewachsen war, und wo eiserne Netze zwischen den Geleisen gespannt waren, um zu verhindern, dass die Reisenden diese überquerten. Wenn wir in der kleinen Station angekommen waren, gingen wir den zuerst geraden, breiten und staubigen, aber bald schmaler und schattiger werdenden, in Windungen verlaufenden Weg zur Ortschaft. Die Hühner liefen über die holperigen, mit Gras durchwachsenen Pflastersteine der einzigen Dorfstraße, flatterten uns über die Füße, magere Hunde gähnten, den Kopf zurückbeugend und mit der langen Zunge plötzlich Fliegen schnappend. Aus einer offenen Wirtschaftstür drang der Geruch von abgestandenem Bier, auf hohen Düngerhaufen paradierte ein bunter Hahn, ein halbnacktes Kind sprang mit wehenden schmutzigen Hemdzipfeln aus einem schwarzen Hausflur, und rannte, bis zu den Knöcheln im Staube, einer feuerfarbenen Katze nach, die in weiten Sprüngen galoppierte. Bald waren wir an dem mit grünem Unkraut bedeckten Dorfteich vorbei, wo die bunten Enten träge dahinschwammen, bisweilen tauchend und ihre unschönen Füße nach oben kehrend, während die schneeweißen glatten Gänse auf den gemähten Wiesen, von einem schläfrigen Jungen gehütet, das von der Hitze schon bräunlich gewordene Gras abknabberten, bis sie, von einer unter ihnen gewarnt, mit lautem Zischen und gereckten offenen Schnäbeln sich uns in den Weg stellten. Nach einer kleinen Steigung kamen wir zu einer verlassenen Gnadenkapelle. Aus der Kapelle hauchte der Geruch der frisch getünchten Wände, des noch am Morgen verbrannten Weihrauchs und des alten wurmzerfressenen goldbraunen Gestühls. Wir standen im Schatten etwas still. Von den nahen Linden duftete es heiß und zart zugleich. Im Wind raschelten die Papierblumen auf dem verlassenen Altare und die himmelblaue, mit Silber gestickte Prozessionsfahne bauschte sich in einem Winkel der Kapelle.
Jetzt nahm uns alle der Wald auf. Meine Eltern lagerten sich mit meiner Schwester auf dem alten weichen schattigen Platz. Ich erkundete stundenlang für mich allein den tiefen kühlen Wald, kehrte aber immer, von einem Instinkt geführt, zu den Meinen zurück, die schon unnötigerweise in Sorge waren. Dann machte sich meine Mutter von neuem an ihre Handarbeit, meine Schwester hielt den Garnknäuel und wehrte mit einem Zeitungsblatt die Fliegen und anderen Insekten ab, welche die Obstreste herangelockt hatten. Ich und mein Vater gingen dann schwimmen.
Einmal verfing ich mich beim Schwimmen mit dem linken Fuß in die tief am Grund wurzelnden schleimigen Algen.
Wir schwammen sonst immer nebeneinander, mein Vater und ich, und zwar zuerst gegen den Strom, dem Mühlwehr zu. Ich hätte vielleicht zu Anfang etwas schneller schwimmen können als er, ich ließ ihn aber immer vor. Er wandte sich lachend nach mir um, spritzte, laut atmend, geröteten Gesichts, den Bart im Wasser, mit seiner reich beringten Hand Wasser nach mir, als wäre ich nicht nass genug geworden. Nun konnte ich ihm plötzlich nicht nach. Ich ruderte mit den Armen, schlug mit den Beinen um mich. Alles wurde einen kurzen Augenblick lang dunkel um mich, so heiß stürzte mir das Blut von der Anstrengung in die Augen. Ich hatte keine Angst. Ich, in meinem Größenwahn des Glücks, hielt mich ja für besonders von Gott begünstigt. Ich hätte ihn jetzt schon noch um Hilfe anrufen können, meinen Vater – auf Erden. Aber ich dachte daran, dass auch er sich in den Algen und Seerosenstengeln verfangen könne, und ihn würden sie sicherlich zu Boden ziehen. Ich sah ihn also vorne im funkelnden Wasser immer kleiner werden, und endlich verschwand sein Kopf bei der Biegung, die der Fluss ein paar hundert Meter weiter aufwärts machte.
War ich immer noch so ruhig? Hatte ich immer noch keine Angst vor dem Untergang? Blitzartig schossen zwei Gedanken durch meinen Kopf, der eine war der Gedanke an das Zugrundegehen, das geschäftliche, das mein Vater immer in seinem Pessimismus gefürchtet hatte und das ich vielleicht unmöglich machte, wenn ich selbst unterging. Denn wie sollte der allgerechte Gott meinen Eltern zwei Unglücke auf einmal bescheren, ohne dass sie schuld waren?
Der zweite Gedanke war aber ganz anderer Art. Der Beweis des binomischen Lehrsatzes trat vor meinen Geist mit absoluter Klarheit. Ich hatte das stolze Gefühl, als hätte ich die sich logisch entwickelnde Formel selbstständig gefunden. Dies war natürlich ein Irrtum. Aber es erfüllte mich mit einem kalten und doch glühenden Stolz, dass ich in Lebensgefahr, – ich merkte endlich, wie es mich mit aller Gewalt, langsam, aber zähe und unentrinnbar, niederzog zum Grunde –, dass ich selbst jetzt noch an die Wissenschaft, an das ewige Warum denken konnte.
Jetzt war alles still, denn, von meiner Kraft verlassen, erlahmend, fast atemlos, von unten gepackt, schlug ich nicht mehr um mich. Die Wasseroberfläche breitete sich in der bronzefarbenen Spätnachmittagssonne glimmernd vor meinen Augen aus. In der Stille hörte ich deutlich das Dröhnen der Mühlenräder und vom Dorf her das dünne Krähen eines alten Hahnes und das Läuten der Glocke in der Kapelle.
Ich dachte jetzt – an eine Totenglocke. Aber nur einen flüchtigen Augenblick lang. Dann wallte in mir meine ganze Jugendkraft auf. Ich wollte nicht sterben. Ich wusste jetzt, dass ich nicht sterben konnte, bevor ich mich nicht ergab. Mein ›Widerspruchsgeist‹ wehrte sich, es war mein Lebenswille, der mir neue Kräfte gab. Und vor allem gab er mir die notwendige Klarheit. Rufen hatte keinen Sinn. Der kleine Flussweg am Ufer war sonntags verlassen. Niemand konnte mich hören. Vielleicht kehrte mein Vater von einer Ahnung getrieben aus eigenem zurück? Noch länger warten? Vielleicht fehlte ich ihm, und er vermisste mich? Nein, sich selbst helfen, in der Not den besten, den einzigen Halt an sich finden. Kein unnützes kräftevergeudendes sich Aufbäumen mehr. Aber das allein war zu wenig. Was also noch? Endlich durchzuckte mich der rettende Gedanke. Weshalb war ich immer noch gegen die Strömung gewandt, statt umgekehrt? Ich ließ mich also vor allem im Halbkreis in die Flussrichtung zurücktreiben. An meinem Knöchel zerrte es und es schmerzte ziemlich stark. Plötzlich sah ich die kleine Gräfin vor mir mit ihrem linken Fuß, dem zarten Knöchel, ihre schwellende Hüfte, ihren langen weißen Hals. Es kann sogar sein, dass ich jetzt schon über meine Angst erhaben war. Ich tat nämlich das Notwendige. Ohne klare Überlegung, ich gestehe es. Vielleicht aus animalischem Instinkt, um das nackte Leben zu retten. Über Wasser war mir nicht zu helfen. Ich musste unter Wasser an die Wurzeln gehen. Ich tauchte, nachdem ich die Lunge so weit wie nur möglich mit Luft gefüllt hatte. Ich versuchte die Algen mit der Hand zu erreichen, aber ich sah sie ja nicht und sie entglitten mir. Halb tot tauchte ich auf.
Die Welt erschien mir viel dunkler. Der Himmel viel niedriger, wie zusammengedrückt. Alles muss sterben. Das wusste ich und es dröhnte mir in den Ohren. Jetzt fasste ich mir nochmals ein Herz. Nochmals getaucht, aber diesmal mit offenen Augen. Das Wasser war schön klar, smaragdfarben, die Luftblasen aus meinem Haar rieselten silbern nach oben, nur aus meinen Nüstern kamen keine, ich sparte mit der Luft. Jetzt sah ich die Seerosenstengel so klar vor mir, als hätte ich sie schon. Sie hatten mein Knie umklammert. Sie waren aber weiter entfernt und viel zäher, als ich dachte. Ich musste mich wie einen Bogen zusammenpressen, und das Herz stieß mir schmerzhaft in der Herzgrube und in der Kehle. In den Ohren dröhnte es, und vor den Augen wallte es purpurn. Aber ich blieb unten, ich hatte endlich die Stengel gefasst mit der rechten Hand, mit der linken ruderte ich, um nicht abgetrieben zu werden, so gut als es eben noch ging. Ich riss an den Stengeln und sie rissen an mir. Sie schnitten mir ins Fleisch, und es kamen Wolken von Rot von meiner Hand her. Die Luft fehlte mir, fürchterlich gierte ich nach oben, es drängte mich, meine Lungen zu füllen, einzuatmen … Aber ich wusste, das war der Tod durch Ertrinken. Wenn ich mich wenigstens hätte gerade strecken können! Aber erst mussten die Stränge gerissen sein, und eben begannen sie zähe zu weichen, ich brauchte nicht mehr so gebückt im Wasser zu bleiben, ich durfte und musste mich strecken. Jetzt kam ich los. Die Hand noch um ein paar unscheinbare schleimige Stränge geklammert, tauchte ich endlich wieder auf. Jetzt atmete ich mich wieder hinein in die herrliche, wunderbare und himmlische Luft! Und jetzt stieß ich ab von dem gefährlichen Ort mit einem gewaltigen Schwimmstoß, auf der Flanke liegend, den rechten Arm mit der immer noch blutenden Hand kraftvoll nach vorne werfend. Jetzt trug mich das Wasser, wohin ich nur wollte. Den Flusslauf hinab, die rechte Wange und das Ohr im Wasser, zu den Weiden am rechten Ufer. Hier kam ich an Land, hundert Meter unter der Abfahrtstelle. Atemlos legte ich mich auf die grasige Böschung. Meinen Namen hörte ich von weitem rufen und ein kleines Echo dazu. War aber zu müde, zu antworten. Ich sah die Sommerluft mit den silbergrünen Weidenblättern spielen. Von meinem Haupthaar tropfte es kühl mein Rückgrat entlang. Meine Hand blutete noch etwas in das dichte kurze Gras hinein, meine Knie nicht mehr. Die Sonne stand noch hoch. Ich war sehr froh zu leben.
7.
Ich hockte lange noch an der Uferböschung und lugte nach meinem Vater aus. Er glitt endlich, ohne Schwimmstöße, ohne Anstrengung, den Flusslauf hinab, auf dem Rücken liegend, sein schönes gerötetes Gesicht von dem schwimmenden fächerförmigen Bart umgeben, die Augen geschlossen, dem Himmel zugewendet. Ich rief ihn an, denn er näherte sich der Stelle, wo sich die flottierenden Algen (ich nenne sie Algen, aber es waren auch Stengel von Seerosen darunter) befanden. Er schreckte auf, warf sich herum auf die Brust und kam mit einigen Schwimmbewegungen zu mir. Er fragte mich, während er nach unseren Sachen Umschau hielt (sie befanden sich weiter flussaufwärts), warum ich ihn so erschreckt hätte. Ich wollte damit beginnen, ihm meine blutigen Hände zu zeigen und ihm meinen Kampf um mein Leben zu erzählen und hatte den ersten, ironischen, mich selbst tapfer verspottenden Satz schon auf den Lippen, da besann ich mich. Er hörte höchst ungern vom Tode reden. Er nannte ihn nicht oft beim Namen, sondern bezeichnete ihn, wenn er schon davon sprechen musste, als das natürliche Lebensende oder die traurige Bestimmung von uns armseligen Menschen, nie nannte er unsereinen sterblich, immer nur vergänglich, nie war einer tot, stets nur ›von uns gegangene‹ dorthin, woher man nicht wiederkehrt, er war abgeschieden. Am liebsten schwieg er davon.
Ich erklärte ihm meinen Warnungsruf lieber nicht. Ich liebte ihn so und war so ungeheuer gewiss auch seiner Liebe, dass mir sein Mitleid wehe getan hätte. – »Ungeschickt wie immer!« meinte er, als er die blutigen Schrammen an meiner Hand und unter meinem Knie sah, er wollte aber eigentlich nicht wissen, wie ich dazu gekommen war.
Jetzt waren wir an der Stelle angekommen, wo unsere Kleider lagen. Sie waren trocken und warm und dienten uns wunderbar als Kopfkissen. Hier, schon am Rande des schwellend frischen grünen Laubwaldes, dem noch nichts von der Dürre des Hochsommers anzusehen war, und wo noch weniger ein fallendes, raschelndes Buchenblatt das Kommen des Herbstes verkündete, legten wir uns hin. Hier waren wir noch im Bereich der Sonne, und unsere Körper trockneten schnell.
Ein leichter Wind hatte sich bald von neuem erhoben. Ich merkte es am Rascheln der Büsche, am Wiegen der Zweige, sogar an dem deutlicher werdenden Rauschen des Flusses, dass der Wind auf uns zukam. Er strich dann über seine und dann über meine Brust hinweg, die sich fast im gleichen Takte hoben und senkten. An seinem Bart und auf seiner Brust glitzerten die letzten Tropfen. Unter seiner Achsel sah ich das Blut pulsieren, denn die bläulichen Adern schimmerten durch seine weiche, mädchenhafte Haut, die der der jungen Gräfin ähnelte. Er hatte jetzt seine Arme unter den Kopf gelegt, lächelte in seinen Bart, wie in Erwartung einer schönen Stunde, summte verloren vor sich hin, bald begann er einzuschlafen, sein Gesicht drückte aber eine Erwartung, eine freudige Spannung aus, die sich allmählich löste in den tiefen Atemzügen des Schlummers, in seinem wie verklärten, frohen, aber etwas fremd werdenden Gesicht. Der Wind kam dann von Osten in frischen Stößen, als wolle er ihn wecken. Ich kniete jetzt neben ihm und deckte ihn mit meinen Sachen zu. Er schlug die Augen auf, sagte aber nichts mehr. Im Schatten war es kühl. Sein Arm war wie aus Alabaster, kein Haar, keine Falte. Mich durchlief es kalt. Ich stand auf, und lief auf dem Uferweg dahin, die Arme an die Brust gepresst wie im Turnsaal und erwärmte mich schnell. Meine Wunden hatten sich längst geschlossen, alles heilte bei mir sehr schnell.
Während ich lief, ohne mich um das schmerzhafte und doch süße, aufregende, sinnliche Gefühl zu kümmern, das die Steine auf dem Treidelweg auf meinen nackten Sohlen verursachten, fiel mir ein, dass ich keine Impfnarben an seinem linken Arm gesehen hatte. Ich nahm mir vor, ihn danach zu fragen. Denn es gab in unserer Stadt immer wieder vereinzelte Fälle von Pocken, die man bei uns ›schwarze Blattern‹ nannte. Man sah auch ab und zu auf der Straße Menschen, sonderbarerweise meist Männer, deren Gesicht die tiefen Narben trugen, als ob der Teufel Erbsen gedroschen hätte, nach Marthys Worten, die ihr meine Mutter stets verwies. Ich erinnerte mich an einen blatternarbigen, kahlköpfigen, scheußlich hässlichen Bettler, der an unserer Ecke stand und blind war. An ihm hatte ich erfahren, was Mitleid heißt. Erst vor einem Jahr ist er verschwunden, und er hat mir sogar gefehlt.
Ich kam jetzt schnell zu meinem Vater zurück. Er war erwacht, auf seiner jetzt bläulichen, leicht marmorierten Haut sah ich die Wirkung der Kälte, und er war wohl ihretwegen erwacht. Ich fragte ihn, warum er nicht geimpft sei. Er sagte irgendwas, aber er wich mir aus, – wie so oft auf ihm unangenehme Fragen, denn Impfen hing mit Krankheit und Krankheit mit Tod zusammen. Und Tod an einem so herrlichen Tag? Ich, der eben einer Lebensgefahr entronnen war und jetzt ahnte, was sterben bedeuten könnte, nahm seine beiden Hände in die meinen. Er machte sich aber erstaunt los. Ich bat ihn, stotternd in meiner Ungeduld, er möge sich impfen lassen, uns zuliebe! Mir zuliebe! Er schüttelte den Kopf, sein Gesicht war eher finster. Ich sagte also nichts mehr. Er stand auf, reckte sich mit seiner hohen, breitschultrigen Gestalt, sein Hemd hin- und herschwingend im Winde, um die Feuchtigkeit daraus zu entfernen, die sein nasses Haar zurückgelassen hatte. Seine goldenen Manschettenknöpfe leuchteten hell. Er schien mir jetzt viel größer als ich, denn er sah über mich hinweg nach etwas Weitem. Aber die Vorfreude, die er vor einer halben Stunde gehabt hatte, war nicht mehr an ihm zu sehen, nur das Zerstreute, das Verlorene …
Meine Mutter rief uns mit ihrer etwas scharfen, heiseren Stimme, meine Schwester tat mit ihrem hellen, piepsenden Stimmchen das gleiche. In den Gebüschen regten sich überall Vögel, sie kamen von den Buchen, Birken und Weiden, flatterten, sich jagend und fliehend und erreichend, im Zickzackflug über den kleinen Fluss, um am jenseitigen Ufer in den Rüben- und Kartoffelfeldern zu verschwinden. Ich nahm meine Sachen und zog mich in einem von jungen Laubgewächsen dicht umgebenen, dunklen, moosigen Fleckchen mitten im Walde wieder an. Auf dem Boden wuchsen Erdbeeren. Ich pflückte welche und brachte sie den Meinen. Es war schon etwas spät im Jahr für Erdbeeren, sie waren dunkelrot und zusammengeschnurrt. Niemand wollte sie nehmen. Sie dufteten aber noch sehr süß. Sie hatten ja den ganzen langen Sommer in sich. Alle rieten mir, sie fortzuwerfen. Aus Widerspruchsgeist aß ich sie, sie schmeckten wie rotes Löschpapier.
Meine Schwester bat meinen Vater, er solle ihr Holzlöffelchen für die Puppenstube schnitzen. Meine Mutter sah auf ihre goldene, mit kleinen Brillanten eingefasste Uhr. Aber nicht sie, er drängte zum Aufbruch.
Wir hatten viel Zeit, die Tage waren noch sehr lang. Im Westen stand eine halbmondförmige oder kahnförmige Wolke bläulich und unbeweglich über den vom Wind bewegten Bäumen. Eine Wolke, und doch war ihr Blau so zart, so himmlisch, so voller freudiger Zuversicht. Aber es war kein Stück Himmel. Die Sonne sank allmählich hinter das Gewölk, die Bäume nahmen eine kalte steingrüne Färbung an, der zwiebelförmige schwarze Kirchturm des großen Dorfes, dem wir nun alle vier zustrebten, lag wie zum Greifen nahe vor uns, wie stets vor einem Regen. Hier waren die Felder schon abgeerntet, die Stoppeln standen rostrot und matt glimmernd in dem von kleinen Furchen zerrissenen Boden, in welchen sich Heuschrecken und Eidechsen versteckten und aus denen bald, mit sinkendem Abend, die Grillen zu schrillen begannen. Wir aßen im Gasthof des Ortes unter den Nussbäumen vor einem großen Bauernhofe allerhand Gekochtes, Gebackenes und Gebratenes auf dicken Steinguttellern. Ich hatte nicht acht, was es war. Ich hatte gewaltigen Hunger, es wühlte geradezu in mir. Ich kannte das Gefühl noch nicht …