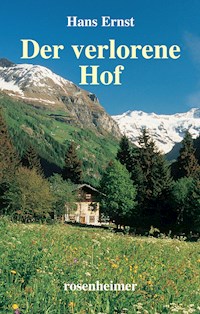
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johanna Kainz möchte den Hof ihrer Familie, den der Vater leichtsinnig verlor, zurückkaufen. Um Geld zu verdienen, arbeitet sie daher auf einem großen Anwesen. Als sie Severin begegnet und sich in ihn verliebt, scheint zunächst alles himmelblau. Doch als der sie schwer enttäuscht, gerät ihr Leben ganz und gar aus den Fugen. Nach vielen einsamen Jahren in der Fremde findet sie schließlich in die Heimat zurück. Wird sich auch ihr Traum vom elterlichen Hof erfüllen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2005
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titel der Originalausgabe: »Martha Kainz«
Titelfoto: Ernst Wrba, Sulzbach
Bearbeitung, Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen, Villingen-Schwenningen
eISBN 978-3-475-54734-8 (epub)
Worum geht es im Buch?
Hans Ernst
Der verlorene Hof
Johanna Kainz möchte den Hof ihrer Familie, den der Vater leichtsinnig verlor, zurückkaufen. Um Geld zu verdienen, arbeitet sie daher auf einem großen Anwesen. Als sie Severin begegnet und sich in ihn verliebt, scheint zunächst alles himmelblau. Doch als der sie schwer enttäuscht, gerät ihr Leben ganz und gar aus den Fugen. Nach vielen einsamen Jahren in der Fremde findet sie schließlich in die Heimat zurück. Wird sich auch ihr Traum vom elterlichen Hof erfüllen?
1
Als Severin Lienhart den Weg vom Bahnhof zum Dorf Bernbichl beschritt, läutete auf dem Sattelturm der Kirche die Elfuhrglocke. Es war ein warmer Tag, Mitte des Monats Juni. Die Sonne strahlte aus einem wolkenlosen Himmel und das schöne Wetter ließ vermuten, dass eine gute Heuernte eingebracht werden konnte.
Severin hatte seine Joppe abgenommen und über den Arm gehängt. Dennoch lief ihm der Schweiß übers Gesicht, obwohl der Weg vom Bahnhof bis zum Dorf kaum eine Viertelstunde ausmachte. Er war ein noch junger Mann, bestimmt noch keine dreißig Jahre alt, groß und schlank, aber erschreckend mager.
Auch in anderer Hinsicht wirkte er nicht gesund und glücklich: Die Augen lagen tief in den Höhlen, und um den schmalen Mund lag ein Zug von Bitterkeit.
Nun blieb der Wanderer stehen, nahm den Hut ab und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. Das blonde, wellige Haar war naß von Schweiß. ›Ich bin zu rasch gegangen‹, dachte er, und schämte sich seiner Kraftlosigkeit, denn schließlich war er ja früher nie schwächlich gewesen. Doch im Moment kam er sich vor wie ein armseliges Wrack. Wahrhaftig, er musste sich jetzt ein wenig hinsetzen, um am Rande des Weges auszuruhen.
Mädchen mit weißen Kopftüchern und braun gebrannten Gesichtern gingen an ihm vorüber und hielten ihn wohl für einen Landstreicher, denn er hatte keinerlei Gepäck bei sich. Und was für ein hochmütiger Landstreicher, denn er reagierte auf keinen der lachenden Blicke, sondern schaute nur mit müden, glanzlosen Augen hinter ihnen her und dachte: ›Das ist das Leben, das sprühende, brausende Leben, auf das noch kein Schatten gefallen ist.‹
Da kam ein halbwüchsiger Bub vorbei. Ihn fragte Severin nach dem Eggstätterhof. Die Antwort, die er erhielt, war ausführlich und genau: »Ja, da musst du jetzt geradeaus bis zur Kirche, dann beim Brandner rechts um die Ecke, links über die Bachbrücke, dann den Hügel hinauf und wieder ein kleines Stück nach rechts, und dann siehst du ihn schon rechter Hand liegen, den Eggstätterhof.«
»Danke«, sagte Severin und konnte sich eines Lächelns über den Eifer des Jungen nicht enthalten. So ausführlich hatte er die Wegbeschreibung nun auch wieder nicht gebraucht. Er stand auf, streifte ein paar Grashalme von seinem Ärmel und machte sich auf den Weg.
Er bog also gemäß der Beschreibung rechts bei der Kirche ab, überquerte die Brücke über den Bach, in deren Mitte ein steinerner Heiliger thronte, und dann sah er schon, kaum zweihundert Schritte vor sich auf einer Anhöhe den Eggstätterhof mit seinen weißen Mauern und dem dunklen Gebälk.
Im Hof machte sich gerade ein junger Bursche mit einem Werkzeugkasten neben sich an der Mähmaschine zu schaffen. Den fragte Severin, ob er hier richtig sei beim Eggstätter.
»Ja, ist schon richtig. Der Vater ist drinnen. Aber wir brauchen keinen Arbeiter«, sagte der Bursche.
»Ich habe auch gar nicht die Absicht, hier zu arbeiten«, antwortete Severin. »Sind Sie der Sohn?«
»Ja, der bin ich«, gab der Gefragte zu und schaute jetzt den Fremden ein wenig genauer an. Er konnte sich wohl keinen Reim darauf machen, wer dieser sein könnte, doch er schien nicht über die Maßen neugierig darauf zu sein, es zu erfahren, denn schließlich wandte er sich von dem Fremden ab und wieder der geöffneten Motorhaube des Mähdreschers zu.
Severin sah sich im Hof um. Wahrhaftig, ein schöner Besitz. Aus jedem Winkel schien die ruhige Behaglichkeit eines gesicherten Wohlstandes zu strömen. Über der Haustür war ein Wappen in die Mauer eingelassen, das sehr alt aussah und die Jahreszahl 1765 trug; darunter stand an die weiße Wand gemalt: »Renoviert im Jahre 1980 von Andreas und Magdalena Birkner.«
Ganz richtig, Birkner hieß der Bauer, zu dem Ralph Kirchhoff ihn geschickt hatte, Eggstätter war nur der Hofname.
Severin klopfte an die Tür, hinter der er Stimmen vernahm. Da niemand »Herein« sagte – vielleicht hatte man sein Klopfen auch gar nicht gehört – trat er ein. Die Leute des Hofes saßen um den großen viereckigen Tisch und warteten auf das Mittagessen.
»Verzeihung, wenn ich störe. Ich möchte den Eggstätter sprechen.« Ein Mann in der Mitte des Tisches, offenbar der Bauer, stand auf und richtete seine Augen auf den Fremden.
»Ich bin der Eggstätter. Was wünschen Sie?«
»Arbeiter brauchen wir im Moment nicht«, ließ sich schnippisch eine weibliche Stimme am Tisch vernehmen.
›Schon zweimal der gleiche Satz‹, dachte Severin. Der Bauer aber wandte langsam den Kopf.
»Halt den Mund, Barbara. Das sieht man doch, dass der Herr keine Arbeit sucht.«
Das Mädchen bekam einen roten Kopf, zumal sie den Blick des Fremden auf sich ruhen fühlte. ›Hübsch ist sie‹, dachte Severin.
»Was will der Herr?«, fragte der Bauer, und Severin wurde aus seinen Betrachtungen gerissen.
»Herr Kirchhoff verwies mich an Sie. Hier würde ich den Schlüssel zu seinem Jagdhaus ausgehändigt bekommen.«
Wieder hefteten sich die grauen Augen des Bauern auf ihn. Dann nickte er. »Das ist richtig. Aber nehmen Sie zuerst einmal Platz. Sie werden hungrig und müde sein.«
Im selben Augenblick trug die Bäuerin die dampfende Schüssel auf, und der Bursche, den er vorhin angesprochen hatte, folgte ihr auf dem Fuße.
»Richte für den Herrn dort auch was zum Essen her«, sagte der Bauer und deutete mit dem Daumen auf Severin, der an dem kleinen Tisch neben dem Kachelofen Platz genommen hatte. »Der Kirchhoff hat ihn geschickt.«
Die Eggstätterin mochte gut ihre zwei Zentner wiegen, während der Bauer schlank und hager war. Als sie hörte, dass der Fremde von Kirchhoff kam, fing sie sofort an, eine Menge Fragen zu stellen: Ob der Herr Kirchhoff auch noch kommen werde, wie es der Frau Kirchhoff gehe und ob der Sohn schon geheiratet habe, den sie schon gekannt habe, als er noch ein ganz kleiner Bub war.
Severin gab Antwort, soweit es in seinen Kräften stand, und er war bereit, ihr so lange Rede und Antwort zu stehen, bis sie zufrieden war, aber da sagte der Bauer: »Bring ihm was zu essen! Von deiner Fragerei wird er nicht satt.«
Nach dem Essen setzte sich der Bauer zu Severin an das kleine Tischchen. »Es wird am besten sein, wenn ich gleich selbst mit hinaufgehe. Ich habe sowieso etwas nachzuschauen droben in meinem Wald, und es ist kein großer Umweg zum Jagdhaus Ludwigsruh.«
Severin langte in seine Rocktasche und zog einen Brief hervor. »Diesen Brief hat mir der Herr Kirchhoff für seinen Jäger mitgegeben. Wie kann ich den Mann am besten erreichen?«
»Unter der Woche sehr schwer, weil er sich dann die meiste Zeit am Berg aufhält. Aber am Samstagabend kommt er normalerweise immer ins Dorf zu seiner Mutter. Lassen Sie den Brief einfach bei mir, ich sorge dafür, dass der Anderl ihn am Samstag bekommt.«
»Vielen Dank, Herr Eggstätter.« Severin lehnte sich zurück, zündete sich eine Zigarette an und schaute zum Fenster hin, wo soeben die Leute des Hofes vorübergingen. Große und starke Gestalten waren es.
Der Bauer sprach wieder. »Was ich noch fragen wollte, Gepäck haben Sie keins dabei?«
»Doch, doch, natürlich habe ich Gepäck. Es lagert noch drunten am Bahnhof. Könnten Sie es vielleicht abholen lassen?«
»Morgen früh muss der Lukas ohnehin ins Dorf«, meinte der Eggstätter. »Es hat doch Zeit bis morgen?«
»Ohne weiteres. Es eilt gar nicht«, antwortete Severin.
Kurze Zeit darauf wanderten beide bergwärts. Ein leichter Wind bewegte das grüne Wipfelmeer des Bergwaldes, zwischen dem sich zuweilen die helle Fläche eines Almfeldes abhob.
Der Bauer deutete mit ausgestreckten Hand in südwestlicher Richtung. »Sehen Sie den hellen Fleck dort oben? Das ist meine Alm. An die vierzig Stück Vieh habe ich da droben.«
»Und wer bewirtschaftet sie?«
»Die Johanna.«
Er erklärte nicht weiter, wer Johanna war, doch sie würde wohl eine seiner Mitarbeiterinnen sein. Severin sah keinen Grund, um eine nähere Erklärung zu bitten, und wollte statt dessen lieber die Namen der Berggipfel wissen. Der Bauer erklärte sie ihm, soweit sie sichtbar waren, kam aber dann bei der nächsten Gelegenheit sofort wieder auf seine Alm zu sprechen.
Dabei schritt er rasch aus, so dass Severin, der das Bergsteigen nicht gewohnt war, ihm kaum folgen konnte. Unwillkürlich blieb er stehen und presste die Hand gegen das Herz.
»Gehe ich Ihnen zu schnell?«, fragte der Eggstätter.
»Ja, entschuldigen Sie bitte, aber ich bin noch nicht ganz auf der Höhe und sollte ein bisschen langsamer gehen. Ich bin vorgestern erst aus dem Krankenhaus gekommen.«
»Ach so. Na, ich hatte mir schon gedacht, dass Sie krank gewesen sein müssen. Sie sehen überhaupt nicht gut aus. Na – die Luft und die Ruhe da droben im Jagdhaus, die werden Ihnen sicher gut tun.«
»Ja, Ruhe ist genau das, was ich im Moment am nötigsten brauche. Ich freue mich darauf, hier eine Weile bleiben zu können. Wie nennt sich die Graskuppe da drüben mit der Kapelle?«
»Das ist der Osterberg«, erklärte der Eggstätter. »Am Sankt-Georgs-Tag kommen die Leute von weither zur Wallfahrt auf den Osterberg.«
»Und der Hof links davon?«
»Das ist der Margaretenhof gewesen.«
»Wieso gewesen?«
»Ja, es haust schon seit ein paar Jahren niemand mehr dort, und allmählich fällt er ganz zusammen. Im letzten Winter hat es auf der einen Seite das Dach eingedrückt. Sein ursprünglicher Besitzer, der Kainz, hat den Hof verkauft und ist dann in die Stadt gezogen. Das hat ihm wohl kein Glück gebracht, er ist vor ein paar Jahren völlig mittellos gestorben. Seine einzige Tochter ist dann zurückgekommen und arbeitet jetzt bei mir, es ist die Johanna, von der ich vorhin erzählt habe, dass sie auf meiner Alm ist. Der Hof hat seit damals einige Male den Besitzer gewechselt, aber es war, als ob er das Unglück anziehe, keiner der Besitzer konnte sich länger als zwei oder drei Jahre dort halten. Jetzt ist er schon ein paar Jahre lang ganz unbewohnt, nur die Felder sind verpachtet.«
Severin schaute sich noch ein wenig um, dann gingen sie weiter und erreichten schon nach knapp zehn Minuten das Jagdhaus.
Wie ein kleines Märchenschloss lag dieses einstöckige Haus eingebettet in einen Ring großer Buchen mit weit ausladenden Ästen. Direkt an den Hang gebaut, hatte es nach vorne heraus eine große, sauber angelegte Terrasse, die mit Tuffsteinen belegt war. Ganz still war es ringsum. Die braunen Fensterläden waren geschlossen. Hinter dem Haus zog sich der Hochwald empor. Aus dem Wald wehte ein starker Harzgeruch herunter, und manchmal hörte man den Schrei eines Habichts.
Mittlerweile hatte der Eggstätter das Haus aufgeschlossen und die verschiedenen Türen des Untergeschosses geöffnet. Oben, sagte er, seien die Gästezimmer, aber es sei wohl nicht nötig, sie ebenfalls aufzuschließen, solange er nur allein hier wohnen wolle.
Die Küche und die anstoßende Wohnstube waren im Bauernstil gehalten. In der Küche führte eine steinerne Treppe in den Keller hinunter, in dem Konserven gelagert waren. Auf der anderen Seite des Ganges war ein Jagdzimmer, an dessen hellen Wänden Hirsch- und Rehgeweihe hingen. Daran anstoßend befand sich ein kleineres Schlafzimmer mit zwei Betten.
»Hier könnten Sie schlafen«, meinte der Eggstätter. »Ich kann Ihnen aber auch droben noch die Zimmer zeigen , falls es Ihnen dort vielleicht besser gefallen sollte.«
»Nein, bemühen Sie sich nicht, lieber Herr Eggstätter«, antwortete Severin abwesend. Er war wie benommen von dem Gedanken, dass er nun hier wohnen würde, fern von allem Lärm und Hader der Welt.
»Und wie wollen Sie es denn sonst halten?«
»Was meinen Sie?«
»Ich meine, mit dem Essen und so. Von dem, was da drunten im Keller lagert, können Sie ja allein auch nicht leben. Einmal am Tag wenigstens müssten Sie etwas Warmes haben.«
»Ach so, richtig, ja. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich werde wohl mein eigener Küchenmeister sein müssen. Oder wie wird es denn sonst immer gehalten, wenn Herr Kirchhoff da ist?«
»Meistens ist die ganze Familie gekommen und hat sich dann selbst versorgt. Wenn der alte Herr allein da war, haben wir ihm das Mittagessen heraufgeschickt.«
»Wenn es möglich ist, möchte ich es natürlich auch gerne so halten. Aber ich möchte Ihnen keine Umstände bereiten. Ich kann notfalls ja auch ins Gasthaus hinuntergehen.«
Der Eggstätter überlegte kurz.
»Im Augenblick ist es zwar ein bisschen umständlich, weil wir mitten in der Heuernte sind. Aber es wird sich schon machen lassen.« Er griff nach seinem Hut und wandte sich zum Gehen. »Verstehen kann ich das aber nicht, was ein junger Mensch wie Sie hier so ganz alleine anfangen will.«
»Gerade das ist es, was ich im Moment brauche, Ruhe und Einsamkeit.«
»Na ja, mir kann es gleich sein. Mein Geschmack wäre es jedenfalls nicht.«
Severin begleitete den Bauern bis zum Weg hinaus, schloss das Gartentürchen und ging dann zwischen den hohen Bäumen durch das ganze Grundstück, das bis weit hinauf eingezäunt war, und sahsich um. Schließlich setzte er sich zwischen die Wurzeln einer mächtigen Buche, lehnte den Kopf an den silbergrauen Stamm und verschränkte die Hände über der Brust. Er schloss die Augen und ließ die Bilder der letzten Wochen und Monate an sich vorüberziehen.
Venedig mit seinen herrlichen Bauten sah er im Geiste vor sich, und Rom mit den unsterblichen Denkmälern eines Michelangelo und vor allem den Zeugnissen der Antike, vor denen ihm sein eigenes Schaffen als Bildhauer nicht mehr als Dilettantismus zu sein schien. Und doch hatte auch er schon einen beachtlichen Namen, trotz seiner Jugend. Ein Brunnen, den er im Auftrag einer Stadt im Rheinland gestaltet hatte, war sehr gelobt worden und hatte ihm nicht nur eine Menge Selbstvertrauen, sondern auch die materielle Grundlage gegeben für die Reise nach dem Süden.
Zwar hatte er die berühmten Bildwerke alle schon aus Abbildungen gekannt, doch was für ein Unterschied, sie aus nächster Nähe zu sehen! Viele Stunden hatte er jeden Tag in den Museen vor diesen verbracht und die Schönheit und Genauigkeit der Ausführung bewundert. Das waren Vorbilder, denen nachzueifern sich lohnen würde!
Die Zeit verging wie im Flug, und schließlich musste er an die Heimreise denken. Eine einzige kleine Zeitungsnotiz hatte ihn dann jäh aus der Bahn geworfen. Es war ein reiner Zufall gewesen, dass er in Rom, bevor er seine Heimfahrt antrat, noch eine deutsche Zeitung gekauft hatte, um während der langen Fahrt eine Lektüre zu haben. Und wie es einem manchmal ergehen kann, sein Blick fiel sogleichauf die kleine Rubrik, die Familiennachrichten enthielt. Und da stand schwarz auf weiß, dass sich der bekannte Bankier Lienhart mit der Tochter des Industriellen Nabenburg, Silvia Nabenburg, verheiratet habe.
Silvia, die Frau, die er liebte, hatte seinen Bruder geheiratet! Severin konnte es nicht fassen. Er las die Notiz wieder und wieder, als müsse sich beim Wiederlesen irgendwann ergeben, dass etwas ganz anderes darin stand und das, was er zunächst gelesen hatte, nur ein Irrtum gewesen war. Schließlich musste er aber akzeptieren, dass es wohl wirklich so geschehen war.
Er verließ den Zug in Innsbruck. Was wollte er unter diesen Umständen zu Hause?
Mehrere Wochen war er anschließend in Innsbruck geblieben, ohne sich zu irgendeinem Entschluss oder einer Tätigkeit aufraffen zu können. Er trank zuviel und aß kaum etwas und kam durch seine Gleichgültigkeit gegen sich selbst rasch ziemlich herunter.
Mit einer doppelseitigen Lungenentzündung wurde er in Innsbruck schließlich ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte schüttelten die Köpfe. Die Lungenentzündung konnte man zwar behandeln, doch dieser junge Mann schien überhaupt keinen Lebenswillen mehr zu haben. Was mochte der Grund dafür sein? Eine Benachrichtigung seiner Familie über seinen Zustand hatte er sich aufs schärfste verbeten, also musste man annehmen, dass die Ursache in diesem Bereich zu suchen war.
Doch die sorgfältige Pflege siegte trotz allem über die Krankheit, und schließlich nahte der Tag,an dem er aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte.
Severin stellte sich die Frage, wie es nun mit ihm weitergehen sollte. Sterben würde er offensichtlich nicht. Aber seine früheren Zukunftspläne hatten sich in einen Scherbenhaufen verwandelt, denn Silvia hatte in diesen eine zentrale Rolle gespielt.
Wie sehr er auch sein Gedächtnis wieder und wieder nach Hinweisen durchforschte, die ihm Silvias Verrat hätten ankündigen müssen, er konnte keine erkennen. Bevor er seine Reise angetreten hatte, war nicht das kleinste Anzeichen dafür da gewesen, dass sie einen solchen Treuebruch plante. Allerdings, sie hatte ihn leichten Herzens nach Italien reisen lassen. Er hatte es als Zeichen ihres Vertrauens betrachtet. Vielleicht aber war es deshalb geschehen, weil ihr Verrat bereits eine abgemachte Sache gewesen war? War seine Abreise ihr sogar ganz gelegen gekommen?
Die Fahrt in seine Heimatstadt hatte ihn Überwindung gekostet. Mit zusammengebissenen Zähnen war er dann an dem väterlichen Bankhaus vorübergegangen, das nach dem Tode des Vaters sein Bruder übernommen hatte. Er dachte, dass vielleicht Silvia oben an einem Fenster des zweiten Stockwerkes stehen und ihn sehen würde. Oder war sie gar nicht in den Stadt, sondern draußen auf dem Landsitz, auf dem auch seine Mutter lebte?
Ja, ja, da konnten sie dann allabendlich im Familienkreis zusammensitzen und über ihn, den verlorenen Sohn, spötteln, der sich nicht in die starren Formen eines Berufslebens, in dem es nichts als Zahlen und wieder Zahlen gab, hineinzwängen lassen wollte, auch wenn das zum Bruch mit seiner Familie führen sollte.
Severin dachte an die letzte Unterredung, die sein Vater mit ihm geführt hatte. »Es ist dein Leben«, hatte er gesagt. »Du kannst es führen, wie du möchtest. Aber von nun an ohne mich. Deine Spielerei mit Gips und Ton hat mich bereits genug gekostet, nun sieh zu, wie du alleine durchkommst.«
Sein Kunststudium war damals schon einige Zeit lang abgeschlossen gewesen. Es traf natürlich zu, dass er der Familie lange auf der Tasche gelegen war und kaum Einnahmen vorzuweisen hatte. Doch konnte man erwarten, dass ein Künstler direkt nach dem Studium schon Geld verdiente?
Damals, vor drei Jahren, hatte er Silvia schon gekannt; ihre Familie gehörte zum Bekanntenkreis seiner Eltern. Dass sie einander liebten, das hatten nur wenige mitbekommen. Nach dem Bruch mit seinem Elternhaus verkehrte er in diesen Kreisen nicht mehr. Er zog in eine kleine Altbauwohnung und beteiligte sich an einer Ateliergemeinschaft einiger junger Künstler, die, so wie er selbst, nur wenig Geld zur Verfügung hatten, und ihre Ausgaben mehr durch Aushilfsarbeiten als durch den Verkauf ihrer Kunstwerke bestritten. Er selbst konnte immerhin gelegentlich mit heimlichen Zuwendungen seiner Mutter rechnen, so dass es ihm, insgesamt gesehen, nicht schlecht ging.
Silvia war er bei einer Ausstellungseröffnung wiederbegegnet, bei der auch zwei kleinere Werke von seiner Hand ausgestellt worden waren. Ja, allmählich konnte Severin erste Erfolge als Künstler vorweisen! In der Zeitung war sein Name erwähntworden; der Rezensent hatte ihm beachtliches Talent bescheinigt und eine große Zukunft vorhergesagt. Der Auftrag, einen Brunnen zu gestalten, war sein bisher größter Erfolg gewesen.
Nur wenige hatten von ihm und Silvia gewusst; einer davon war Ralph Kirchhoff, der einzige Freund aus alten Tagen, der nach dem Bruch mit dem Elternhaus noch zu ihm gehalten hatte. Ob Silvia von Anfang an ein doppeltes Spiel mit ihm getrieben und deshalb so viel Wert auf Diskretion gelegt hatte?
Damals hatte er sich nichts dabei gedacht, denn ihre Eltern wären entsetzt darüber gewesen, dass sie sich mit einem mittellosen Künstler eingelassen hatte – auch wenn dieser ursprünglich aus denselben Kreisen stammte –, so wie seine eigenen Eltern entsetzt darüber gewesen waren, dass er sich mit so brotlosen Dingen befasste.
Verständlich, dass sie sich ihren Vorwürfen nicht aussetzen wollte! »Warten wir noch ein bisschen«, hatte sie kurz vor seiner Italienreise gemeint. »Nicht mehr lange, und niemand kann dich mehr als Hungerleider bezeichnen, ohne sich lächerlich zu machen.«
Rückblickend fragte er sich, ob er nicht zu naiv gewesen war.
Severin seufzte. Was für einen Sinn hatte es, jetzt noch an diese Dinge zu rühren? Er hatte sich wieder einigermaßen gefangen und war bereit, sein Leben neu zu ordnen. Wie und auf welche Art, das musste sich erst herausstellen. Vorerst war er einmal hier. Am Abend dieses Tages schrieb Severin noch einen Brief an seinen Freund.
»Mein lieber Ralph!
Wie soll ich deinem Vater danken für sein Einverständnis dafür, mich hier wohnen zu lassen? Hier müsste wahrlich ein Toter noch mal zum Leben erwachen können, bei dieser Luft, und in dieser schönen, friedlichen Landschaft. Mir ist, als spürte ich jetzt schon etwas von der urtümlichen Kraft dieses Waldes in mir selbst. Ja, ich fühle es, lieber Ralph; ich werde wieder gesund und stark werden.
Heute bin ich lange draußen auf der Terrasse gelegen und habe das Bild dieser Landschaft in mich aufgenommen. Himmel und Berge stoßen hier aneinander, als wären sie eins. Hier ist das Gegenwärtige so eindrucksvoll, dass alle Erinnerungen klein werden. Schon jetzt fühle ich, dass ich mich von dem zu lösen beginne, das mich so lange gequält hat, und ich denke nur mehr wie im Traum an meine Gefühle für Silvia.
Aber nun Schluss mit diesem Thema. Ich will nun wieder beginnen an das Leben zu glauben und – an mich selbst. Ja, ich fühle, dass ich hier wieder Kunstwerke schaffen könnte! Aber vorher will ich erst mal ein paar Wochen faulenzen. Im Übrigen hast du mir ja bei unserem letzten Gespräch versprochen, demnächst hierher nachzukommen. Komm recht bald, und lass uns die Schönheit teilen, die hier um mich ist. Bis dahin also recht herzliche Grüße, auch an deinen Vater, dein Severin.«
2
Als Severin am nächsten Tag um die Mittagsstunde von einem Spaziergang aus dem Wald zurückkam, befand sich die Tochter des Eggstätters, Barbara, im Jagdhaus Ludwigsruh.
Sie hantierte mit Besen und Scheuerlappen und bemerkte den Zurückkommenden erst, als er schon unter der Tür stand, wo er sie schon eine ganze Weile beobachtet haben mochte.
»Das Haus sollten Sie nicht abschließen, wenn Sie fortgehen«, sagte sie, fröhlich lachend. »Ich musste wie ein Einbrecher durch das Fenster einsteigen.«
Severin schmunzelte. Das Mädchen wusste sich offensichtlich zu helfen! »Ach ja, richtig. Man müsste den Schlüssel irgendwo hinterlegen, nicht wahr?«
»Alles ist voller Staub«, meinte sie, als wollte sie ihr Hiersein damit entschuldigen. »Ich habe Ihnen Milch mitgebracht; sie steht im Keller. Milch müssen Sie viel trinken, weil Sie so blass sind, meint meine Mutter.«
»Lassen Sie nur, Barbara«, sagte er belustigt. »Die Sonne wird mich schon braun machen, verlassen Sie sich darauf! Aber – Sie haben ja gleich einen ganzen Korb voller Essen mitgebracht, als ob ich hier gemästet werden sollte!«
»Ja, das muss aber auch drei Tage reichen. Wir haben Heuernte, da kann ich nicht jeden Tag etwasvorbeibringen. Im Herbst wird das wieder anders. Aber wer weiß, da sind Sie vielleicht schon längst wieder fort.«
»Wo sollte ich denn dann wohl sein?«
Barbara zuckte die Schultern und sah ihn bedeutdungsvoll an. »Woher soll ich das wissen? Vielleicht daheim, bei Ihrer Braut.«
Damit wollte sie offensichtlich auf den Busch klopfen.
»Ich habe keine Braut«, gab Severin bereitwillig und amüsiert die gewünschte Auskunft.
Barbara lachte spöttisch. »Das kann ja jeder sagen!« Sie wischte üben die Bank und sah ihn dann aus zusammengekniffenen Augen an und blinzelte schalkhaft. »Euch Männern darf man ja nichts glauben. Da lügt einer besser als der andere.« Doch ihr Ton war eher kokett als abwehrend, dazu lachte sie wieder hell und ausgelassen.
Severin betrachtete sie belustigt. Er sagte: »Gestern haben Sie mich für einen Knecht gehalten, und heute stehen Sie an meinem Herd und kochen für mich.«
Später aßen sie dann zusammen. Sie wollte ihn zunächst nach dem Kochen alleine lassen, aber er versicherte ihr, dass das Essen ihm in ihrer Gesellschaft viel besser schmecken würde, und so ließ sie sich dann gerne dazu überreden, sich ebenfalls mit an den Tisch zu setzen. Es gab Geräuchertes mit Kraut und Knödeln. Sie sagte, dass er das, was übrigbliebe, am nächsten Tag nur aufzuwärmen brauche. Was das Sauerkraut betreffe, so schmecke es ohnehin am besten, wenn es ein paar Mal aufgewärmt worden sei.
Barbara war ein ausgesprochen hübsches Mädchen, stellte Severin fest. Unwillkürlich fragte er: »Wer ist denn eigentlich Ihr Schatz, Barbara?«
Sie machte das treuherzigste Gesicht der Welt. »Ich habe keinen!«
»Ja, wie ist denn das möglich?«
»Warum soll das nicht möglich sein?«
»Weil ich nicht glauben kann, Barbara, dass die Burschen hier blind an Ihnen vorüberlaufen.«
»Na, Sie sind aber einer«, sagte sie schelmisch und stand auf, um das Geschirr abzuräumen und zu spülen.
Später half sie ihm dabei, die beiden Koffer auszupacken, die am Morgen gebracht und vor die Tür gestellt worden waren. Severin hatte nichts davon mitbekommen. Er habe geschlafen wie ein Stein, erzählte er Barbara. Das sei er schon gar nicht mehr gewohnt, dass man eine ganze Nacht durchschlafen könne.
»Wozu brauchen Sie denn dies ganze Eisenzeug, all die vielen Messer und Hämmer?«, unterbrach ihn Barbara, die gerade den einen Koffer geöffnet hatte und etwas ratlos auf den Inhalt schaute, auf den sie nicht gefasst gewesen war.
»Für meine Arbeit. Ich bin Bildhauer, und wer weiß, Sie haben einen so reizvollen Kopf, dass ich vielleicht Lust bekomme, ihn zu modellieren!«
»Sie sind aber ein Schmeichler!«
»Nein, im Ernst, Barbara, vielleicht bitte ich Sie eines Tages, mir Modell zu stehen.«
»Da werden Sie nicht viel Freude haben, denn stillhalten, das liegt mir nicht, wenn ich ehrlich sein soll!«
›Ja, das glaube ich dir gerne‹, dachte er. An ihr sprudelte und sprühte alles vor lauter Lebenskraft. Aber vorerst hatte er ohnehin nicht die Absicht, sich an seiner Arbeit zu versuchen, denn er spürte den inneren Drang dazu noch nicht. Das musste erst wieder zu ihm zurückkommen, genauso wie das Vertrauen zu den Menschen.
Nun schickte Barbara sich zum Gehen an. Sie sagte, dass sie erst in ein paar Tagen wiederkommen werde. Bis dahin müsse er sich allein helfen. Ihr Blick ging durch den Raum, als suche sie noch nach einer Unordnung, die beseitigt werden müsse. Dann schaute sie ihn an, so ein wenig von unten herauf, als warte sie auf etwas Bestimmtes. Er gab ihr die Hand.
Das war nicht das, was sie heimlich gehofft hatte, aber es war immerhin ein Anfang, beschloss sie, als sie sich auf den Weg machte.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























