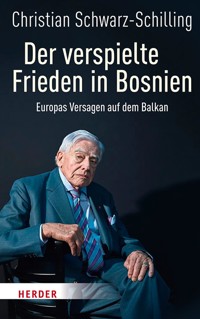
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Christian Schwarz-Schilling war zehn Jahre lang Minister in der Regierung Helmut Kohl. 1992 trat er aus Protest zurück, da die Bundesregierung nicht aktiv gegen die Gräueltaten in den Jugoslawienkriegen vorging. Seitdem widmet er sich leidenschaftlich der Befriedung und dem Wiederaufbau auf dem Balkan, insbesondere in Bosnien-Herzegowina. In diesem Buch legt er seine Erlebnisse über die letzten 30 Jahre, zugleich eine scharfsinnige Analyse der deutschen Außen- und Menschenrechtspolitik, vor, insbesondere über die 1990er Jahre. 25 Jahre nach dem Friedensabkommen von Dayton zieht Schwarz-Schilling auch Lehren für die Jetztzeit. Denn wieder agieren wir nur zögerlich bei der Befriedung brutaler Kriege und noch immer behandeln wir den Balkan nicht mit der angemessenen Aufmerksamkeit und laufen Gefahr, ihn für Europa zu verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Schwarz-Schilling
Der verspielte Frieden in Bosnien
Europas Versagen auf dem Balkan
Den Menschen von Bosnien und Herzegowina für eine glücklichere Zukunft in Europa gewidmet
Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Oliver Rüther, Wiesbaden
E-Book Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN E-Book: 978-3-451-82248-3
ISBN Print: 978-3-451-38908-5
Inhalt
Geleitwort
Vorwort und Danksagung
Einführung
Ausgangslage
1945 – und die prägenden Ereignisse der Nachkriegszeit
Der Funke der Freiheit
Der selbstzerstörerische Sonderweg Jugoslawiens
Eine denkwürdige Kabinettssitzung
Kriegsansage und offene Menschrechtsverletzungen auf dem Balkan – ohne Antwort Europas
Die Tragödie von Vukovar
Memorandum der Serbischen Akademie der Künste und Wissenschaften (1986)
Der Paukenschlag der Sat 1-Fernsehsendung »Einspruch« vom 5. Januar 1993
Politische und militärische Fehleinschätzungen der Regierungen des Westens
Erkundungsreise nach Genf
Ermutigende Haltung der Unionsfraktion
Rücksichtslose Egozentrik der FDP
Heftiger Streit über die Mission der AWACS-Luftüberwachung in Deutschland – Kraftprobe zwischen CDU/CSU und FDP-Fraktion
Außenpolitische Lage – Verfall im Denken und Handeln des Westens
Deutschland landet international auf einem toten Gleis
Großbritannien und Frankreich verfangen sich in ihren historischen Traditionen
Umdenken in Amerika – Fatale Besserwisserei in Europa
Elie Wiesel, Auschwitz-Überlebender, hält eine aufrüttelnde Rede – Wetterleuchten in Washington
Europa verdammt den amerikanischen Interventionsplan in Bausch und Bogen
Konsultationen des amerikanischen Außenministers in Moskau
Außenminister Christopher in Bonn
Die USA haben die Nase voll von Europa und versuchen mit einer »Rolle rückwärts« Ruhe zu finden
Die gründliche Stellungnahme des amerikanischen Senatsausschusses unter Vorsitz von Senator Joe Biden (April 1993)
Die Zivilgesellschaft in Europa und den USA wird hörbar – Karl Popper: »Aufschrei der Seele gegen das Versagen der Politik«
Albert Wohlstetter: »Open Letter« an Präsident Clinton
Das Drama im Balkan geht ungebremst weiter
Das serbische Militär hat bereits drei Fünftel von Bosnien erobert – NATO-Gipfel in Brüssel – Marsch in die Scheinwelt der Illusionen
Massaker in Sarajewo – die unmittelbare Folge der Appeasementpolitik der NATO
UN-Schutzzonen mitten im Krieg
Die Lage in Bihac spitzt sich dramatisch zu
Das Bundesverfassungsgericht spricht (12. Juli 1994)
1995 – Von der humanitären Katastrophe zum gezielten Völkermord
Massaker in Tuzla – Blauhelme werden zu Geiseln
Srebrenica – Der schlimmste Völkermord seit dem Zweiten Weltkrieg
Der Angriff auf Bihac – ganz Bosnien steht vor dem Fall
Die wundersame Konferenz von Split – Militärbündnis zwischen Kroatien und Bosnien
Die gemeinsame Offensive »Oluja« bringt in letzter Minute die militärische Wende
Nach dem Waffenstillstand übernehmen die USA die Friedensverhandlungen in Dayton
Die Friedensarbeit beginnt – meine Rolle als internationaler Streitschlichter
Unvergessliche Erlebnisse auf den Streitschlichtungsreisen: Drvar, Stolac und Vares
Lieblingsthema der deutschen Politiker: »Rückführung der Flüchtlinge«
Kleiner Ausflug nach Belgrad – ein kurzes Intermezzo in der »großen« Politik
Mein Aufstieg zum »OHR-Gipfel«
HR-Amtsantritt in Sarajewo
Das Prinzip »Ownership« soll es richten
Erste Konfrontationen mit der amerikanischen Administration
Die Verfassungsreform
»Mission impossible«?
OHR und Bonn-Powers werden verlängert
Meine Amtszeit endet mit einem Abschiedsknall: Das Gesetz über das Srebrenica-Potocari Memorial Center
Bosnien heute und morgen
Die unerwartete Begegnung mit Bärbel Bohley in Sarajewo
Gedanken über die Macht des Bösen
30 Jahre Überlebenskampf des bosnischen Staates und der Zivilgesellschaft: Ein Ausblick
»Lessons Learned«?
Wachwerden in Bosnien-Herzegowina und in Europa
Anhang
Benutzerhinweise
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anlagen
Bildnachweis
Über den Autor
Geleitwort
»Ich habe überlebt. Ich hätte einen beliebigen Namen haben können, Muhamed, Ibrahim, Isak, das ist nicht wichtig. Ich habe überlebt, viele haben es nicht. Ich habe überlebt, wie sie gestorben sind. Zwischen ihrem Tod und meinem Dasein gibt es keinen Unterschied, weil ich in einer Welt weiterlebe, die dauerhaft, unwiederbringlich von ihrem Tod gezeichnet ist. Ich komme aus Srebrenica.«
Emir Suljagic: Srebrenica – Notizen aus der Hölle
Europa und der Westen hatten sich getäuscht: Es gab doch noch einmal einen Krieg und einen Völkermord in Europa – den Bosnienkrieg (1992– 1995). Wer hätte sich vorstellen können, dass 50 Jahre nach dem Ende der Nazi-Kriegsgräuel und dem Holocaust noch einmal eine derartige Barbarei auf europäischem Boden stattfinden würde? Doch selbst der Bosnienkrieg sollte nicht »der letzte Krieg in Europa« sein: der Kosovo, Georgien sowie die Kämpfe in der Ostukraine und um die Krim würden noch folgen. Auch wurde Francis Fukuyamas Behauptung vom »Ende der Geschichte« (1992) und dem globalen Siegeszug (gewaltfreier) Demokratie durch die Gräuel auf dem Westbalkan widerlegt: Das Narrativ universeller Durchsetzung von Freiheit und Menschenrechten wurde von den großserbischen Ideologen und Kriegstreibern um Slobodan Milosevic kaltlächelnd und brutal umgeschrieben. Seine Schergen Radovan Karadzic und Ratko Mladic haben das blutig umgesetzt. Dennoch ragt der Bosnienkrieg im Post-Weltkrieg-II-Europa, der nicht, wie fälschlich oft behauptet, ein Bürgerkrieg war, sondern Opfer serbischer Großmannssucht und Aggression von außen, weit heraus, nicht nur wegen des Genozids an den Bosniaken. Vielmehr sagen der Krieg und die bis in die Gegenwart andauernde Wiederaufbauphase etwas über das zweifelhafte Verständnis der sogenannten internationalen Gemeinschaft von der Notwendigkeit und Ausgestaltung humanitärerer Interventionen aus. Zwar gab es damals noch nicht den Grundsatz von der »Responsibility to Protect, R2P«, ein Konzept, das die UN-Vollversammlung erst 2005 verabschieden sollte. Aber neben dem Konzept der »Human Security«, das bereits im Rahmen der UNDP entwickelt wurde, gab es Leitlinien für den Schutz insbesondere der Zivilbevölkerungen vor Menschenrechtsverletzungen und Gräuel. Auch die UN, die NATO und die EU, die OSZE und der Europarat hatten solche Regeln – »nie wieder Barbarei« war allerorts die Devise. Selbst in Deutschland wurden die Erfahrungen mit dem Morden der Nazis und dem Holocaust nicht als Katalysator für einen entschiedenen deutschen Beitrag zur Kriegsbeendigung in Bosnien gesehen – im Gegenteil, wie Schwarz-Schilling schonungslos offenlegt, suchte man sich im Bundeskabinett mit dem Argument der »Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit« aus den Bemühungen zur Kriegsbeendigung herauszuhalten. »Nie wieder Auschwitz« sollte Joschka Fischer erst 1999, im Kosovo- Kontext, seinem Parteitag zurufen. Diese Serie unverzeihlicher Fehl- oder Nichtentscheidungen sowie politischer Fehler gesteht man sich erst jetzt, anlässlich des 25. Jahrestages des Srebrenica-Genozids am 11. Juli 2020, ein – ein »mea culpa« durchzieht nahezu alle Reden und Presseerklärungen aus Anlass des Gedenktags. UN-Generalsekretär Antonio Guterres räumt erstmals ein, »the UN and the international community failed the people of Srebrenica, and, as former Secretary-General Kofi Annan said, this failure will ›haunt our history for ever‹.«
Es geschah in Frankreich, am Strand von Juan-les-Pins, Anfang August 1992. Nein, keine Erscheinung, vielmehr ein Albtraum für einen Menschenrechtler wie Christian Schwarz-Schilling – für jedermann. In der »Welt« stieß er auf abgedruckte Horrorberichte des amerikanischen Journalisten Roy Gutman aus dem gar nicht so weit entfernten Bosnien: Krieg, Massaker, Vergewaltigungen. Schwarz-Schilling mochte kaum glauben, was er dort las. Die Reportagen erschienen dem erfolgreichen Bundesminister für Post- und Telekommunikation, einem zivilen wie zivilisierten Zukunftsressort, wie »Berichte aus der dunklen Welt« (Dzevad Karahasan), einer Welt, die man sich in Bonn und später in Berlin kaum vorstellen konnte. Mit der ihm eigenen Energie und Beharrlichkeit ging er den Dingen sofort auf den Grund. Der Bosnienkrieg, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor allem in den Enklaven und sogenannten UN-Schutzzonen sowie das Ringen um das Daytoner-Friedensabkommen und der darauf folgende Versuch, ein neues, besseres, versöhntes Bosnien aufzubauen, sollten von da an – bis heute – sein Leben bestimmen. Aus dem »Christian von der Post« wurde in BiH wie international anerkennend »Mr. Bosnia« – ein »Bosnier mit befristetem Aufenthalt in Deutschland« (Tageszeitung »Oslobodjenje«).
Dass er von den sogenannten einfachen Menschen im Westbalkan dafür geliebt wurde, ist keine spöttische Kolportage, sondern entsprach und entspricht der Wahrheit.
Sein persönlicher Feldzug im besten Sinne für ein Ende des Krieges und der Gräuel begann mit einem Paukenschlag: die Niederlegung seines Ministeramtes im Protest gegen die Bosnienpolitik der Bundesregierung und das Ausscheiden aus dem Kabinett Kohl. Christian Schwarz-Schilling ist entschlossen, den »bosnischen Knoten« durchzuschlagen: »He does not take no for an answer!« Fortan nimmt er sich kritisch die Bosnienkriegspolitik der Bundesregierung wie der internationalen Gemeinschaft vor, seziert die Interessenlagen der Innenpolitik wie der europäisch-atlantischen Diplomatie, ohne Rücksicht auf große Namen, Staaten, politische Usancen und Empfindlichkeiten. Ob Kanzler, Außenminister oder internationale Staats-und Regierungschefs – wenn nötig, fährt er ihnen gehörig an den Karren, entlarvt, wenn es um den Krieg geht, ihre Spielchen, Kartelle, Intrigen, ihre Falschheiten, ihre Tricksereien, ihr Wegsehen, Nichtstun, ihr Abtauchen, ihren Mangel an Verantwortung, Empathie und Humanität. Jetzt war er auf ganz eigenem »Kriegspfad«, der zum Frieden führen sollte. Ausgestattet mit seinem Bundestagsmandat (1976– 2002), dem Vorsitz im Unterausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe und dem stellvertretenden Vorsitz im späteren Ausschuss gleichen Namens, vor allem aber seine langjährigen Erfahrungen als Politiker, bestens vernetzt, helfen ihm, die zahllosen Reisen nach Bosnien, in die Region und in die »Große Welt« der Geopolitik Europas und des Westens durchzustehen. Er ist rastlos, Tag und Nacht im Einsatz, fällt den Mächtigen lästig und kämpft um jedes Dorf, jedes Leben. Zeit und Kosten spielen für ihn keine Rolle. Geben es die amtlichen Mandate nicht her, später auch seine Rolle als internationaler Streitschlichter, greift er selbstverständlich in die eigene Schatulle und finanziert spontan Reisen für sich und seine freiwilligen Mitarbeiter, für Hilfslieferungen und andere Notmaßnahmen. Er telefoniert und faxt 24 Stunden um die ganze Welt und erfindet gar unkonventionelle Finanzierungsinstrumente wie die Verteilung von Geldumschlägen mithilfe von Privatfliegern an Hilfsbedürftige – das Befinden seines Portefeuilles ist ihm dabei nachrangig. Anders als so manchem Politiker, so beobachtet Rupert Neudeck von Cap Anamur, gelingt es ihm mühelos, vom hohen Ross zu steigen und ganz ohne die üblichen Entourages etwa der Außenminister zurechtzukommen.
Christian Schwarz-Schilling vermag so manchen erstaunlichen Erfolg zu verbuchen, erfährt, mit Genugtuung, auch verspätete Anerkennung, selbst des lang zaudernden Kanzlers. Die Zeit als internationaler Streitschlichter (Mediator) (1995–2004) bringt ihm viel Befriedigung, trotz der Reise- und Verhandlungsstrapazen. Dann aber treibt es ihn doch noch einmal in die »amtliche« Politik zurück – er übernimmt, mit Unterstützung Bundeskanzlerin Merkels, 2006 das Amt des Hohen Repräsentanten und später auch das des Europäischen Sonderbeauftragten für Bosnien und Herzegowina, mit Sitz in Sarajewo – einen »Doppelhut« der Verantwortlichkeit, sozusagen, unter dem Dach des Daytoner Friedensabkommens (1995). Wer, so meinten viele Bosnier und Internationale, könne den nun anstehenden Wieder-und Neuaufbau des kriegszerstörten Landes besser in Angriff nehmen, als Christian Schwarz-Schilling. Für viele Beobachter schien das eine eher leichte Aufgabe zu sein – keiner wie Schwarz-Schilling wusste aber besser, wie schwer es werden würde, die immer noch postkommunistischen Strukturen des Landes in Richtung auf eine spätere EU-Mitgliedschaft zu transformieren. Dayton gab mit den sogenannten Bonn-Powers dem Office of the High Representative, der Behörde der internationalen Regentschaft in dem De-facto-Protektorat BiH, eine enorme Machtfülle mit auf den Weg. Doch hatte die Weltgemeinschaft aus anderen humanitären Interventionen lernen müssen, dass internationale »State-Builder« aufpassen müssen, ihre Rolle als externe Wiederaufbaugehilfen nicht zu überdehnen und eine bestimmte »rote Linie« nicht zu überschreiten: Nur da, wo die Post-Konflikt-Gesellschaft nicht mehr weiterkommt, etwa in festgefahrenen ethnischen Spaltungen, sollten die »Externen« eingreifen. Dieser »political self-restraint«, ein Interventionsminimum zu wahren, ist aber nicht immer eingehalten worden – man ging da schon mal »overboard«.
Irgendwie war das Post-Dayton BiH eine Art fragiler, manche meinen sogar gescheiterter, Staat. Wie viel Reform sollte nun der OHR anstoßen und durchführen, was sollte man den Bosniern überlassen? Derartige Fragen sollten sich später etwa im Kosovo und in Afghanistan erneut stellen. Schwarz-Schilling hatte hohes Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der von ihm geschätzten Bosnier und in ihre Entschlossenheit, die Gräben des Krieges und die toxische ethnische Teilung zu überwinden: Er setzte auf Eigenverantwortlichkeit, auf »local ownership«. Selbstkritisch, er schildert das im Buch ohne Schonung seiner selbst, und bitter enttäuscht musste er später eingestehen, dass er mit diesem Vertrauen in die Einigungs- und Wiederaufbaufähigkeit der bosnischen Politiker gescheitert war (2007) – ein Prozess, der dann auch zu seiner Niederlage als Hoher Repräsentant führen sollte. Hierzu hatte am Ende auch die Rivalität in der internationalen Gemeinschaft, ihre Uneinigkeit hinsichtlich der Ziele und der Vorgehensweisen sowie das OHR beigetragen, in dem man seine Arbeit immer wieder auf infame Weise konterkariert und untergraben hat – wie ich vor Ort beobachten musste. Rückendeckung »aus den Hauptstädten« bekam er kaum. Im Alter von 76 Jahren einen solchen Rückschlag einstecken zu müssen, gleichsam auf dem Höhepunkt seines Einsatzes für Bosnien und seine Menschen, war nicht leicht – und doch hat er es weggesteckt und als Streitschlichter weitergearbeitet. Noch heute ist er für viele »Mr. Bosnien« – und er mischt sich weiter ein, vor allem dort, wo die EU und die internationale Gemeinschaft seiner Einschätzung nach gar nichts oder zu wenig tun. Gemeinsam mit dem EU-Aspiranten-Schlusslicht Kosovo, beides Gesellschaften mit hohem muslimischen Anteil, sieht er Bosnien in einem lecken, zu langsamen Boot auf der Fahrt nach Brüssel. Das aber will er keinesfalls zulassen – auch mit 90 Jahren sieht er sich kraftvoll und kreativ genug, mit »Brüssel und den Hauptstädten« dazu im Clinch zu bleiben.
In der Wohnung Christian Schwarz-Schillings in Sarajewo hängt ein ebenso humoriges wie bedrückendes Bild des bosnischen Malers Mehmed Zaimovic: »Pejzaz Sarajeva – Sarajewoer Landschaft«. Es war das Abschiedsgeschenk der europäischen Botschafter, für die ich als EU-Ratspräsidentschaft in BiH am 20. Juni 2007 ein großes Abschiedsessens für den Hohen Repräsentanten und EU-Sonderbeauftragten ausrichten durfte. Zunächst sieht der Betrachter ein beschwingtes Sarajewo, dessen vertraute Türme und Brücken zu tanzen und alle Religionen zu vereinen scheinen. Sie strahlen Lebensfreude und Optimismus aus. Doch auf den zweiten Blick fallen einem die Farben von Zerstörung und Barbarei (Meliha Husedzinovic), orange-braun-rote Flammen auf – man erkennt die düstere Metaphorik des Tötens und der Friedhofsstelen. Dieses Wechselbad der Gefühle, das jeder erfährt, der sich mit Bosnien-Herzegowinas jüngster Geschichte sowie mit seiner Zukunftsperspektive beschäftigt, hat Christian Schwarz-Schilling in diesem Buch versucht nachzuzeichnen. Es ist letztlich ein Ausriss aus seiner (ungeschriebenen) Autobiografie, seine »Bosnienjahre«: sehr persönlich, tiefschürfend, faktenorientiert, über Strecken atemberaubend, kritisch und schonungslos, aber immer voller Zuneigung und Hoffnung für die Menschen, die sich um ihre Familien und ihre Zukunft beraubt sehen. »Bequem war er nie« (Karl Hugo Pruys), alles andere, möchte ich hinzufügen, entspricht nicht seinem Charakter – emphatisch dafür war er immer. Ein Leben für die Menschlichkeit.
Hamburg, im Spätsommer 2020
Michael Schmunk, Botschafter a. D.
Vorwort und Danksagung
Es war ein schweres Stück Arbeit, was ich mir vor vier Jahren, als die Idee zu dem Buch geboren wurde und das Recherchieren und Schreiben begonnen hat, so nicht hätte vorstellen können – nicht einmal im Traum! Als Historiker bin ich ja im Umgang mit dicken Werken bestens vertraut – aber solche zu lesen ist wirklich leichter als sie zu schreiben! Dennoch hat es großen Spaß gemacht und mich zufrieden zurückgelassen, noch einmal all die Jahre des intensiven Einsatzes für Frieden in Bosnien und für das Überleben der Bosnier Revue passieren zu lassen.
Gerade die Fülle von Gesprächen und hautnahen Erlebnissen in Kombination mit Schlüsseltreffen mit politischen Führern jener Zeit hatte mich angetrieben, die Ereignisse noch einmal aus der Sicht eines derjenigen, die, wie man so schön sagt, »dabei waren«, neu zu erzählen und vor allem auch aus diesem Blickwinkel neu zu bewerten. Den letzten Anstoß hierzu hatte mir Hanns Jürgen Küsters von der Konrad-Adenauer-Stiftung gegeben, der mich eingeladen hatte, am 7./8. Juli 2016 auf dem Petersberg bei Bonn einen Vortrag zum Thema »Die Haltung der Bundesregierung zum beginnenden Balkankonflikt« zu halten. Danach war klar: Das Buch musste her! Ich möchte Hanns Jürgen Küsters für diese Initialzündung noch einmal aufrichtig danken.
Die bisherige Geschichtsschreibung zum Bosnienkrieg und zum Wiederaufbau des Landes unter internationaler Anleitung ist in meinen Augen nicht immer gelungen – vieles, insbesondere was die Rolle der internationalen Gemeinschaft und hier vor allem des Westens betrifft, wurde geschönt oder gar nicht ausgesprochen. Das hatte mich schon immer umgetrieben – nicht zuletzt schulden wir den Menschen Bosnien und Herzegowinas nach all unseren Versäumnissen und Fehlern wenigstens ein ehrliches, ungeschminktes Bild, wie es wirklich war. Wir haben die Akten, sie nicht! Wir müssen endlich dazu stehen, dass wir lange den Frieden unverantwortlich verspielt und dann trotz oder wegen Dayton auch bis heute verloren haben: das Land ist immer noch ethnisch tief gespalten, und Wohlstand hat sich ebenso wenig eingestellt wie die versprochene Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
Der furchtbare Völkermord im westlichen Balkan hat tiefe Spuren in dieser Region hinterlassen. In der Welt drum herum kam es anlässlich des Bosnienkrieges (1992–1995), der kein Bürgerkrieg, sondern Folge großserbischer Aggression war, zwar medial zu einem gewaltigen Aufschrei, mit grauenhaften Fernsehbildern, die nie aus unseren Köpfen verschwinden werden. Aber, Hand aufs Herz, bleibende Eindrücke haben der Krieg und die Massenmorde in Europa nicht hinterlassen. Was weiß die heutige Generation (noch) davon? Europa war zu dieser Zeit zu stark mit sich selbst beschäftigt und heilfroh, dass der Albtraum vom Zerfall Jugoslawiens und der Horror in Bosnien-Herzegowina Ende 1995 durch die Friedensvereinbarung von Dayton, wie man glaubte, endlich vom Tisch war. Damals spukte längst Fukuyamas beschwichtigende These vom »Ende der Geschichte« herum, die sich als Trugschluss herausstellen sollte – wieder einmal in der jüngsten europäischen Geschichte. Selbst 25 Jahre haben nicht gereicht, um der gesamten Region – Kernland Europas – einen wirklichen Frieden und Integration zu bescheren. Heute liefern sich im Balkan die alten bzw. neuen »Großmächte« China, Russland und vielleicht sogar wieder die USA (mit noch unklaren Motiven der Trump-Administration) altbekannte geopolitische Spielchen, von denen selbst kleinere »Regionalmächte« wie die Türkei und die Araber gern etwas abhätten.
Bleibt das Thema Deutschland und Bosnien. Das wenig informierte, wenig verantwortungsvolle, wenig emphatische, ja manchmal, so schien es mir, zynische Verhalten der Bundesregierung hatte mich fassungslos gemacht. In der Folge hat mich diese bittere Erfahrung geradezu zur Außen- und Sicherheitspolitik getrieben, erstmals in meinem Politikerleben – Menschenrechtler allerdings war ich schon immer gewesen. Meine erste grundsätzliche Auseinandersetzung mit Menschenrechtsfragen begann mit der Verjährungsdebatte zu den NS-Verbrechen in den 1970er Jahren. Damals hatte ich bereits eine eigene, ablehnende Position zur Verjährung bezogen, mit der ich allerdings in meiner hessischen CDU-Landesgruppe allein stand.
In Bosnien wurden Menschen gefoltert, Frauen vergewaltigt und natürlich ›Europäer‹ ermordet, aus niederen ideologischen Beweggründen – und im Bundestag trickste man an der Verfassung herum, um sich heraushalten zu können. Das für Bosnien und den gesamten Westbalkan europapolitisch so zentrale Deutschland, trotz der schlimmen Auftritte deutscher Soldaten in Südosteuropa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, versuchte sich abzumelden, davonzustehlen. Lieber ließ man etwa die Briten vorangehen, mit ihren durchsichtigen europäischen Führungsambitionen und Balkaninteressen, die an längst vergangene Zeiten erinnerten. Dass die Niederlegung meines Ministerpostens 1992 für Bonn nur ein schwaches Signal sein würde und erst den Anfang einer langen, zähen Kampagne für »mehr Deutschland« im Ringen um Bosniens Überleben bedeutete, war mir bewusst. Aber es war ein Anfang. Mehr Konflikte konnte ich mir jedoch kaum aufhalsen – vom innenpolitischen Missbrauchsversuch am Grundgesetz und dem Geschacher unter den Alliierten über die Gräueltaten in Gorazde, Bihac, Srebrenica und Sarajewo bis hin zu Dayton und dann bis zum Scheitern nahezu aller substanziellen Reformen beim Staatsaufbau von Bosnien-Herzegowina, zwischen den Flüssen Miljacka und Neretva. Dass der Krieg nicht in einer totalen militärischen Katastrophe für Bosnien-Herzegowina geendet hatte, war nicht so sehr der NATO zu verdanken, wie es allgemein kolportiert wird, sondern der Tatsache, dass Bosnien-Herzegowina und Kroatien plötzlich, in letzter Not, zu einem Bündnis zusammenfanden. Mit von den USA insgeheim unterstützten Waffenlieferungen wurde, vor allem mit der »Oluja«-Offensive, die Wende des Krieges möglich. Dieses geschah allerdings leider erst nach mehr als drei Jahren Krieg und Völkermord. Die vielen Toten – mindestens 100 000 – und die über zwei Millionen Vertriebenen und Geflüchteten sprechen eine klare Sprache, Horrorzahlen, die dem Westen und insbesondere Europa den Spiegel des weitgehenden Scheiterns vor Augen halten – auch wenn ihnen mit den Amerikanern in Dayton immerhin ein Stoppen des Blutvergießens gelang. Deutschland hat bei alledem, auch in Dayton, so gut wie keine Rolle gespielt – selbstverschuldet, was die verdienstvolle Rolle einzelner Politiker, Diplomaten und Hilfsorganisationen nicht schmälern soll. Seltsam war für mich, dass trotz Deutschlands schwacher Rolle über 350 000 als Flüchtlinge gerade nach Deutschland wollten, die von der deutschen Bevölkerung (!) bestens aufgenommen und, soweit sie bleiben durften, auch integriert wurden.
Als ich das Buchprojekt 2016 in Angriff nahm, glaubte ich zunächst, es mehr oder weniger allein stemmen zu können, quasi so nebenbei – welch eine vermessene, ja schon fast überhebliche Fehleinschätzung! So etwas geht nur im Team, mit Druck und Zuspruch von außen sowie eiserner Disziplin und Fleiß – zumal ich ja schon damals in »vorgerücktem Alter« war. Anfangs hatte ich noch ein wenig gebummelt, ich sage es offen, und immer wieder die in Büdingen gelagerten Archivschätze, Tagebuchaufzeichnungen und »Balkan-Bücherwände« voll Genugtuung betrachtet: Das würde schon werden!
Sehr schnell musste ich dann aber Lehrgeld zahlen. Eine derartige Herkulesaufgabe verlangt die Verteilung der Gewichte und Aufgaben auf ein kräftiges und kenntnisreiches Team. Neben der üblichen Literatur musste in die Archive und Akten eingestiegen werden, in Briefwechsel und Tagebücher, zahllose Leitz-Ordner voll, eine nicht nur Geduld erfordernde Übung, sondern auch eine sehr staubige – man brauchte folglich sehr gute Kaffee- und Espressomaschinen sowie viel Mineralwasser! Das landestypische Aufbaumittel, den Sljivovica, gab es natürlich nur anlässlich der Erreichung von Etappenzielen!
Wer sich so eingehend mit einem Westbalkanland beschäftigt, kommt ohne landes- und sprachkundliche Expertise nicht weit. Ich konnte mich daher glücklich schätzen, in meiner emsigen damaligen OHR-Mitarbeiterin (2006–2007) Nerma Bucan, heute Leiterin meines Sarajewo-Büros, eine sehr verlässliche, hart arbeitende und engagierte Mitarbeiterin gefunden zu haben, die mit mir die bosnienbezogenen Rechercheaufgaben mit ihrer spezifischen Kenntnis der bosnischen Sprache, Geschichte und Politik durchgeführt hat. Hinzu kamen zahlreiche texttechnische Aufgaben, darunter nicht immer angenehme, die sie solidarisch mit übernommen hat – mit guter Laune und, das braucht man bei mir, auch mal energisch insistierend. Wenn der Stress überhandzunehmen drohte, hatte sie immer eine gute Anekdote aus den Bosnientagen parat, die mich durchatmen ließ. Der enge Kontakt mit bosnischen Persönlichkeiten, den ich bis heute aufrechterhalten und nutzen konnte, ist vor allem ihrem Einsatz und ihrem guten Netzwerk geschuldet. Für all dieses bin ich ihr zu großem Dank verpflichtet!
In diesem Kontext möchte ich auch Jasmina Rose nicht unerwähnt lassen, die in der bosnischen Nachkriegszeit als Journalistin der Deutschen Welle meinen Spuren in Bosnien-Herzegowina gefolgt ist und über ein Jahrzehnt lang meine Mediationstätigkeit treu begleitet hat.
Danken möchte ich auch Manuela Mangold aus meinem Berliner Büro, die das Projekt mit ihren guten Hauptstadt-Kontakten, zumal zu den dort für das Buch wichtigen Institutionen, flankiert, mir aber auch beim Verfassen des Schlusskapitels, als das Team wegen Corona kaum zusammenkommen konnte, beigestanden hat.
Ein solch umfangreiches Veröffentlichungsunterfangen braucht sachverständige Koordinierung. Das war die persönliche Aufgabe der Leiterin des Büros in meinem oberhessischen Heimatort: Iris Noftz. Ihr gelang es nicht nur, mit ruhiger Hand mein Büdinger Hauptbüro zu führen, sondern gleichzeitig, nach dem ersten Schock, dass »der Chef« mit nunmehr 86 Jahren doch noch einmal ein Megaprojekt in Angriff nehmen wollte, auch alle Fäden für die Buchproduktion bei sich zu bündeln. Mit meiner Bosnienleidenschaft war sie bereits durch meine politische Arbeit bestens vertraut. Es wird den Leser nicht überraschen, dass meine Schreibgewohnheiten einer eher vorsintflutlichen Zeit entstammen. Mit nie endender Geduld, Einfühlungsvermögen und Umsicht hat sie die mit meiner nicht mehr ganz fabrikfrischen »Grundig-Stenorette« produzierten Diktat-Kassetten und viel Handschriftliches in lesbaren Text übertragen, aber eben auch vieles, vieles andere mehr sicher gesteuert. Wenn man eine Antwort auf die Frage suchte: »Wer ist Ihre Assistentin, und wenn ja, wie viele?«, kam immer ihr Name heraus. Das Buch wird mich immer daran erinnern, dass ich ihr für sein Entstehen und Fertigwerden in tiefem Dank verbunden bin.
Anlässlich des Weihnachtsfestes schrieb ich im Dezember 2018 auch Botschafter a. D. Michael Schmunk, ein hessischer Landsmann (Wiesbaden) von mir, der heute in Hamburg in seinem Un-Ruhestand fleißig weiter forscht und publiziert, mit Schwerpunkt Westbalkan. Mit ihm hatte ich mich seit meiner Zeit als Hoher Repräsentant in BiH befreundet – er war damals der deutsche Botschafter in Sarajewo und hatte 2007 in Bosnien die deutsche EU-Ratspräsidentschaft inne. Kennengelernt hatten wir uns bereits im Kosovo, wo er die deutsche Vertretung leitete. Da er mich immer ermutigt hatte, balkanpolitisch weiter aktiv zu bleiben und doch »mal alles aufzuschreiben«, war ich hocherfreut, dass er meiner Bitte, zum Gelingen des Buches beizutragen, ohne Umschweife entsprach. Dafür möchte ich mich bei ihm ganz besonders bedanken! Es sollte zu einer ungewöhnlich fruchtbaren intellektuellen Zusammenarbeit kommen, auch durch seine unerbittlich kritischen Fragen, Zurufe und Warnschilder, aber immer herzlich, humorig und ganz auf das Reifen des Textes fokussiert. Wir alle im Team konnten seinem Urteil und seinen diplomatisch-politischen Erfahrungen vertrauen – nicht zuletzt brachte er das Know-how ein, wie man so ein Buch »baut« und zum Verleger bringt. Für diese Freundschaft und Unterstützung rufe jetzt ich ihm zu: »Danke!«
Alle von mir hier besonders Herausgehobenen waren über die Jahre zu enormen Anstrengungen bereit – das werde ich ihnen nicht vergessen! Natürlich gab es auch noch viele andere helfende Hände – sie mögen mir vergeben, dass ich nicht alle aufzählen kann – doch auch ihnen gebührt Dank.
Der Herder-Verlag hat nicht mit der Wimper gezuckt, als ich ihm mein »Projekt« unterbreitete und er die ersten Seiten gelesen hatte. Er hat ein wirklich schönes Buch daraus gemacht, ohne Kosten und Mühen zu scheuen. Mein ganz besonderer Dank geht im Verlagshaus an Dr. Patrick Oelze, der das Buch verlegerisch betreut hat.
Ich möchte es schließlich nicht versäumen zu erwähnen, dass trotz all der grandiosen Unterstützung, die ich erfahren habe, im Buch hier und da Fehler verblieben sein mögen, für die ich ebenso die alleinige Verantwortung übernehme wie selbstverständlich für alle Wertungen von Sachverhalten und Personen.
Büdingen und Berlin, im Sommer 2020
Christian Schwarz-Schilling
Einführung
Als Politiker weiß ich sehr wohl, dass man bei seiner politischen Tätigkeit zwischen Fakten und Bewertung von Fakten möglichst klar unterscheiden sollte. Bei komplexen historischen Situationen ist das schwierig genug. Als gelernter Historiker weiß ich, dass die Bewertung von Fakten sehr verschieden ausfallen kann. Das ist aus der Sicht eines Historikers besonders interessant und erhält die Spannung. Als Politiker, besonders wenn man Mitglied einer Regierung ist, kann eine von der Regierungslinie abweichende Meinungsbildung zu prekären Situationen führen. Als verantwortlicher Politiker muss man immer Entscheidungen treffen, ob man will oder nicht. Wenn man dann zu einer von der Regierung abweichenden Meinung gekommen ist, und es sich um eine gewichtige politische Frage handelt, dann kann man an einen Punkt gelangen, wo die Sache zu einer Gewissensfrage wird. Wenn es dabei um Krieg oder Frieden geht, ist das nicht verwunderlich.
Die zunehmend aggressive Haltung der serbischen Politik unter Führung von Generalsekretär Slobodan Milosevic und die passive Zuschauerrolle, welche der Westen eingenommen hatte, beunruhigten mich zutiefst und führten zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mir und der Bundesregierung. Mit dem Hinweis auf eine angeblich verfassungsrechtlich gebotene deutsche Handlungseinschränkung, spielte die Bundesregierung in meinen Augen eine von der Sache her falsche und politisch verhängnisvolle Rolle.
Der militärische Auftritt der serbischen Politik, zunächst in Slowenien, aber dann in seiner ganzen Brutalität bereits in Kroatien, machte deutlich, dass es sich hier um einen ideologisch begründeten Krieg gegen die nichtserbische Bevölkerung Jugoslawiens handelte, der zum Schlimmsten führen würde, wenn die größenwahnsinnigen serbischen Führer nicht schnellstens den geballten Widerstand Europas und der USA erfahren würden. Spätestens im Laufe des Jahres 1992, als sich Bosnien analog Sloweniens und Kroatiens durch ein Referendum von Jugoslawien losgelöst hatte, war es für alle ersichtlich, welches Feuer sich – praktisch unbekämpft – in großer Geschwindigkeit in dieser Region ausbreitete. Da die Führung der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) fast ausschließlich aus Serben bestand, war es durchaus plausibel, dass sich diese Armee zur Unterstützung der serbischen Aggression insgesamt gegen die übrige Bevölkerung in Jugoslawien stellte.1 Sowohl Slowenien als auch Kroatien und Bosnien hatten keine Armee, um ihre Bevölkerung zu schützen. Obwohl das bereits im Jahre 1991 sichtbar wurde und im August 1992 die erschütternden Berichte des amerikanischen Journalisten Roy Gutman, »Newsday«/«Reuters«, in der deutschen Tageszeitung »Die Welt« veröffentlicht wurden, löste das keine ernsthaften politischen Überlegungen aus, weder in den USA noch in Europa. Es lief mir beim Lesen dieser Berichte kalt den Rücken herunter und ließ mir keine Ruhe mehr. Deutschland und mit ihm ganz Europa, sowie anfänglich auch die USA blieben bei ihrer zögerlichen Haltung und taten nichts Konkretes, um diesen Krieg auf europäischem Boden zu stoppen.
Wie konnte es geschehen, dass ausgerechnet wieder hier in Europa so etwas passierte – dies zu einem Zeitpunkt, wo der Westen mit der NATO das stärkste euro-atlantische Bündnis geschaffen hatte, das es bisher in der Welt gab? Wie konnte man 45 Jahre nach dem Horror des Naziregimes und des Holocausts ruhig auf der Zuschauerbank sitzen und weiter von der »unumkehrbaren« Friedensepoche Europas reden? Hatten der britische Premierminister Neville Chamberlain und der französische Ministerpräsident Édouard Daladier in München nicht die Erfahrung gemacht, dass ein Diktator wenig beeindruckt wird, wenn man freundliche diplomatische Gespräche führt, wie es in München 1938 geschehen war? Hier kann man noch entschuldigend einwerfen, dass sowohl Europa als auch die USA um diese Zeit nicht ausreichend aufgerüstet waren, um einen Krieg mit Adolf Hitler zu riskieren. Aber entfällt dieses Argument nicht am Ende des 20. Jahrhunderts vollständig, weil der Westen diesmal alle militärischen Mittel in der Hand gehabt hatte, um die Katastrophe eines Angriffskrieges im Frühstadium zu verhindern? Alle meine Versuche, die Bundesregierung von einem anderen Kurs zu überzeugen, waren vergeblich. Dass die Lage in Südosteuropa mit jedem Tag bedrohlicher wurde, wollte man einfach nicht zur Kenntnis nehmen.
Dieser Dissens brachte mich sehr bald zu dem Punkt, der nach den Gesprächen mit Bundeskanzler Helmut Kohl zu weiteren politischen Auseinandersetzungen geführt hat.
Am 8. Dezember 1992 kam es folglich zu einem heftigen Streit am Kabinettstisch, der anschließend zu meinem Rücktritt als Bundesminister für Post und Telekommunikation geführt hat.
Ich wirkte im Anschluss als Mitglied der CDU/CSU-Fraktion im Auswärtigen Ausschuss, ab 1994 als Vorsitzender und ab 1998 als Stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. So war der Jugoslawienkonflikt letztlich die Ursache dafür, dass ich meine politischen Schwerpunkte für den Rest meines Lebens von der Post und Telekommunikation auf ein für mich gänzlich neues, das außenpolitische und europapolitische Politikfeld verlagerte.
Dieser Wechsel fiel mir nicht leicht, wie man meinem Rücktrittsschreiben vom 10. Dezember 1992 entnehmen kann.2 Doch ich habe diesen Schritt auch später nie bereut. In den folgenden Monaten und Jahren bemühte ich mich nach Kräften, meinen Beitrag als Mensch und Politiker zu leisten, um eine Völkermordkatastrophe, die zur Zeit meines Rücktritts schon deutlich sichtbar war, zu verhindern. Trotz der heftigen Bemühungen, an denen sich viele Menschen in Deutschland, in Europa und in den USA beteiligt haben, reichten diese Kräfte jedoch bei weitem nicht aus, das Unheil im früheren Jugoslawien abzuwenden.
1 Grützmacher, Felix: Die Jugoslawische Volksarmee und der Zerfall der SFRJ (2004). https://www.grin.com/document/109150, abgerufen am 1.7.2020. Die Jugoslawische Volksarmee (JNA) war die bis 1992 bestehende Streitkraft der SFR Jugoslawien. Zu Beginn der 1990er Jahre war die JNA nominell die viertstärkste Armee Europas. Es war der politische Wille, wie in der SFRJ-Verfassung 1974, dass die Struktur der Ethnien innerhalb des Militärs auch die gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln sollte. Trotz dieses Repräsentationsprinzips existierte in der JNA eine zahlenmäßige Dominanz der serbischen Armeeangehörigen.
2 Siehe Anlage 1: Rücktrittsschreiben, 10.12.1992, sowie das Schreiben an die CDU-Mitglieder des Wahlkreises, 12.1.1993.
Ausgangslage
1945 – und die prägenden Ereignisse der Nachkriegszeit
1945 erlebten wir den Tiefpunkt der deutschen Geschichte. Das »Dritte Reich«, welches »1000 Jahre« glorreicher Geschichte proklamiert hatte, erlebte nach nur zwölf Jahren ein bitteres Ende. Es war nicht nur das militärische Ende durch die Kapitulation vor der militärischen Übermacht der Alliierten. Es war auch der geistige Zusammenbruch der menschenverachtenden Doktrin des Nationalsozialismus, welcher mit beispielloser Hybris die eigene »arische Rasse« überhöhte und einen Vernichtungsfeldzug gegen die übrigen Ethnien und Völker Europas und später der ganzen Welt führte. Millionen von Toten, nicht nur auf dem militärischen Schlachtfeld, sondern auch in den industriell betriebenen Vernichtungslagern der Nazis, waren die furchtbare Folge. Da sich die Siegermächte, die Deutschland 1945 besiegt und in vier Besatzungszonen aufgeteilt hatten, nicht einig waren, wie man dieses Land künftig behandeln solle, war das weitere Schicksal Deutschlands ungewiss. Manche, so wie Henry Morgenthau, damaliger US-Finanzminister, meinten, man solle es in den Zustand des vorindustriellen Zeitalters zurückbefördern. Er hatte in seinem Buch »Germany is our problem« einen Plan, wie man Deutschland in einen Agrarstaat umwandeln soll, erläutert. Doch dieser Plan wurde nicht befolgt. Es dauerte nur vier Jahre, bis aus den drei westlichen Besatzungszonen die Bundesrepublik Deutschland wurde. Die zunehmenden Spannungen zwischen den drei Westmächten und der Sowjetunion sorgten dafür, dass man den Wiederaufbau Westdeutschlands zuließ und dann immer mehr daran interessiert war, dass Deutschland künftig eine konstruktive Rolle in der freien Welt spielt und zur Stabilisierung und Verteidigung Westeuropas einen entsprechenden Beitrag leistet. Die Amerikaner, welche als Supermacht die Hauptlast der Verteidigung des Westens gegen die immer aggressiver auftretende Sowjetmacht trugen, waren besonders daran interessiert, Deutschland wirtschaftlich wieder auf die Beine zu helfen (siehe Marshall-Plan). Als freies Land und mit einem demokratischen System sollte es in die Völkerfamilie zurückkehren und als wichtiges europäisches Land seinen Beitrag zur Verteidigung und Stabilität Europas leisten. So kam es zum baldigen Eintritt in die NATO. Es war ein besonderer Glücksumstand der Geschichte, dass die Bundesrepublik Deutschland auf diese Weise wenige Jahre nach der deutschen Katastrophe eine sichere Nische des Überlebens in der rauen Zeit des Kalten Krieges zwischen dem Westen und der Sowjetunion gefunden hatte. Zwar hatten wir die Teilung Europas besonders schmerzlich als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges auch als Teilung Deutschlands erfahren – aber wir selber in der Bundesrepublik Deutschland konnten die Freiheit, die Menschenrechte, Rechtsstaat und steigenden Wohlstand genießen und fühlten uns im westlichen Bündnis, trotz des nuklearen Patts und des drohenden Schlagabtauschs der beiden Supermächte, relativ sicher. So lebte die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland von deren Beginn im Jahre 1949 an, trotz des Kalten Krieges, in einem relativ friedlichen Zustand. Doch Vorgänge in der DDR, wie auch in den Staaten des Warschauer Pakts, waren bei uns durch die geografisch exponierte Lage und den zeithistorischen Zusammenhang mit der Teilung Deutschlands besonders spürbar und führten auch hier zu lebhaften Diskussionen über den richtigen Weg in die Zukunft. Die Bevölkerung der DDR und die Nachbarvölker im Osten versuchten mehrere Male verzweifelt, der sowjetischen Herrschaft und der kommunistischen Tyrannei im eigenen Land zu entkommen. In der sowjetischen Besatzungszone begann das Unheil nach dem Zwangszusammenschluss von SPD und Kommunisten. Die Gründung der staatlichen kommunistischen Partei, der SED, führte die Restbestände aus der Weimarer Zeit zur kommunistischen Diktatur. Es war damals ein Glücksfall der Geschichte, dass wir durch den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer – der im deutschen Bundestag mit einer Stimme Mehrheit zum Bundeskanzler gewählt wurde – gegenüber der Sowjetunion und auch den Versuchen kommunistischer Umtriebe und Komplotte immun geblieben sind und allen Versuchungen und Versprechungen der Sowjetunion widerstanden haben. Schließlich hatte Konrad Adenauer selber die Nazizeit erlebt und war zu der Auffassung gelangt, dass das Schicksal Deutschlands nicht in Gesprächen mit der Sowjetunion über einen neutralen Status zum Guten geführt werden könnte, sondern nur durch die klare Hinwendung zum Westen und durch entsprechende Schritte zur Vereinigung Europas. Von gleicher Wichtigkeit war die Schaffung des europäisch-atlantischen Bündnisses der NATO, welches durch Einbeziehung der USA und Kanadas die Sicherheit Europas garantierte. Ludwig Erhard, der zweite Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, gewählt im Jahre 1964, hielt an dieser westlichen Politik an der Seite der USA fest. Er war im Übrigen derjenige, der uns als Wirtschaftsminister im Inneren die soziale Marktwirtschaft bescherte und dadurch die Bevölkerung der Bundesrepublik zu einem bisher noch nie gekannten Wohlstand geführt hat.
Im Osten mussten sich die Menschen allerdings dem tragischen Schicksal ergeben, sich der sowjetischen Herrschaft zu unterwerfen und von allen Segnungen der Freiheit und der Sozialen Marktwirtschaft ausgeschlossen zu sein. Gerade in Deutschland wurden durch die rasanten Fortschritte der Kommunikationstechnologie die Zustände im Westen wie im Osten sehr viel unmittelbarer erlebt. Aus diesem Grunde blieben politische Reaktionen nicht aus.
Es begann mit dem Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in der DDR und setzte sich fort mit der vehementen ungarischen Revolution im Herbst 1956. Beide Aufstände wurden durch sowjetische Panzer niedergewalzt. Aber bei der ungarischen Revolution kam noch etwas Erschreckendes zum Vorschein: Der sowjetische Führer, Generalsekretär der KPdSU Nikita Chruschtschow, war zunächst unentschlossen und zögerte ein paar Tage, weil er sich über die Reaktion des Westens auf eine Intervention der sowjetischen Armee nicht klar war. Doch England und Frankreich nutzten die Lage auf ihre Weise und begannen genau zu diesem Zeitpunkt einen Bombenkrieg gegen Ägypten, um die in der Kolonialzeit vereinbarten Zahlungen für die Passagen auf dem Sueskanal, die Ägypten für die Zukunft verweigerte, wieder durchzusetzen. In der nächsten Nacht, nach dem Einsetzen der englischen und französischen Bombardements gegen Ägypten, rollten die sowjetischen Panzer gen Ungarn. Die Ungarn wehrten sich verzweifelt und erbaten Hilfe von Europa, vom Westen und den UN – wenn schon nicht durch Truppen, dann wenigstens durch die Lieferung von Waffen.
Ich stand zu dieser Zeit gerade am Beginn einer Banklehre in Hamburg, nachdem ich Mitte 1956 meine historischen und sinologischen Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München abgeschlossen hatte.
Dieser Aufstand des ungarischen Volkes war für mich ein erster richtiger Schock in der Nachkriegszeit. Mir war zwar klar, dass man bei der ungarischen Revolution nicht einfach mit einer militärischen Intervention antworten konnte. Aber hätte man – so ging es in meinem Kopfe herum – nicht wenigstens den Versuch unternehmen können, mit Chruschtschow Gespräche aufzunehmen, um die Möglichkeiten der Ungarn, sich selbst zu behaupten, zu vergrößern? Hätten wir Europäer uns nicht sofort zusammensetzen müssen, um entsprechende Maßnahmen zu treffen?
Abb. 1: Christian Schwarz-Schilling, Tagebuch, 4. November 1956
Die USA waren praktisch handlungsunfähig, da sie kurz vor der amerikanischen Präsidentenwahl standen und genau zu diesem Zeitpunkt der amerikanische Außenminister John Foster Dulles, der die Außenpolitik der USA entscheidend geprägt hat, wegen einer Operation krank im Hospital lag. Umso mehr empfand ich die Haltung Englands und Frankreichs als schäbig und als Verrat an Europa. In welche verzweifelte Stimmung ich durch diese Ereignisse gekommen bin, zeigen meine Tagebuchaufzeichnungen vom 4. November bis 6. Dezember 19561.
Diese Ereignisse hatten für mich eine doppelte Konsequenz: Ich begann daran zu zweifeln, ob der europäische Gedanke wirklich ernst gemeint war und – wie man meinem Tagebuch entnehmen kann – legte ich für mich einen heiligen Schwur ab: dass ich, wenn ich später je in eine solche Entscheidungsklemme kommen sollte, nicht wanken und nicht schwanken, sondern mich entschieden an meine Grundsätze und an mein Gewissen halten würde. »Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich diese Worte aus Ungarn für immer in mein Herz einbrenne. Man darf sie nicht vergessen – nie, nie, nie! Es lebe das christliche Europa, das hier neu geboren wird! Es lebe die menschliche Freiheit und Würde!2
Als ich nach einigen Wochen das Scheitern der Revolution feststellen musste, konnte ich mich nur noch mit Edzard Schaper und seinem Ruf: »Es lebe die ungarische Freiheit« trösten.3
Im Jahre 1968 erlebten wir, beim sogenannten Prager Frühling das Gleiche noch einmal. Diesmal waren sogar Truppen der DDR eingeplant, um bei der Niederschlagung des Aufstands mitzuwirken. Aber die Russen verhinderten – sehr zum Ärger der DDR-Führung – ihren Einsatz. Für viele Deutsche schwand so die Hoffnung einer friedlichen Wiedervereinigung. Auch viele Politiker, insbesondere in der SPD, hielten die Wiedervereinigung für eine Illusion unseres Denkens, die wir rasch beenden sollten. Wir mussten uns mit der Realität zweier deutscher Staaten auf Dauer abfinden.
Diese Überlegungen fruchteten jedoch bei der Mehrheit der CDU und CSU nicht. Und Helmut Kohl, als er Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wurde, hielt bei allen Kompromissen, die in der Realpolitik notwendig waren, eisern am politischen Ziel der Wiedervereinigung fest. Am Ende der 1980er Jahre geriet die DDR wieder in starke Turbulenzen und es brachen erneut Unruhen in der Bevölkerung aus. Die sogenannten Montagsdemonstrationen gegen das DDR-Regime wurden immer heftiger und der demokratische Aufstand der Bevölkerung der DDR zusehends gefährlich. Bei uns entstand die Diskussion, ob wir durch die Propagierung unserer eigenen Vorstellungenen Öl ins Feuer dieser Bewegung gießen oder der DDR besser wirtschaftlich helfen sollten, damit es zu keiner Katastrophe kam. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß war offensichtlich dieser Meinung und verhalf der DDR-Führung zu relativ großen Krediten mit guten Konditionen, die auch tatsächlich dazu beitrugen, zumindest eine schnelle, vorzeitige wirtschaftliche Krise zu verhindern. Die SPD verhandelte währenddessen mit der SED-Führung über ein handfestes Bündnis, ausgehend von der gegenseitigen Anerkennung der beiden Staaten und der weitgehenden Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen. Es ist erstaunlich, dass Helmut Kohl, der sogar einen Staatsbesuch von Erich Honecker, dem Chef der DDR, in Bonn zugelassen hatte, in diesem zunehmenden politischen Wirrwarr das Steuer fest in der Hand behielt und seine politischen Ziele nicht aus den Augen verlor. Ein Reaktionär? Nein – keineswegs, wie wir sehr schnell sehen werden!
Der Funke der Freiheit
Plötzlich geschah ein Wunder der internationalen Politik. Alle staunten und zunächst konnte man es gar nicht glauben: Michail Gorbatschow, der Generalsekretär der KPdSU, sprach plötzlich von »Glasnost« und »Perestroika« und beschwor das eigene Volk, die Lügen, die bisher ideologisch eingeübt waren, abzustreifen und wieder Schritt für Schritt der Wahrheit entgegenzukommen. Der Westen wollte an die Ernsthaftigkeit seiner Worte nicht glauben und hielt diese für ein besonders geschicktes Propagandamanöver. Doch nach einiger Zeit merkte man, dass sein Denken und seine Taten mit seinen Worten tatsächlich übereinstimmten. Seine Erklärung, dass die Sowjetunion künftig keine militärische Einmischung vornehmen werde, wenn sich in einem Land die Regierung in einer Auseinandersetzung mit dem eigenen Volk befinde, war eine unglaubliche Kehrtwende ihrer Aussenpolitik. Die bisher gültige Breschnew-Doktrin, die genau das Gegenteil verkündete, war plötzlich zur Seite gelegt. Der aufblitzende Funke der Freiheit, der sich in den Hauptstädten des Warschauer Paktes mit großer Schnelligkeit ausbreitete, entfaltete elementare Kräfte. Auch Erich Honecker wurde plötzlich damit konfrontiert, dass er bei einer gewaltsamen Bekämpfung der Massendemonstrationen mit Polizei und Militär nicht mit dem Beistand der Sowjetunion rechnen konnte. Die im Herbst 1989 stattfindende Jubiläumsfeier – »Vierzig Jahre DDR« – zu der auch Michail Gorbatschow eingeladen war und an der er auch teilgenommen hat, wurde zum Menetekel. Die kolportierten Worte von Gorbatschow an Erich Honecker, »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben«, haben eine weltweite Wirkung ausgelöst. Obwohl die DDR-Regierung die gewaltsame Niederschlagung der Opposition in der DDR minutiös vorbereitet hatte, wagte sie unter den neuen Umständen nicht, die »Montagsdemonstrationen« mit Gewalt zu zerschlagen. Und so bewirkten die neuen Konstellationen das Wunder, dass eine vom Volk ausgehende Revolutionsbewegung tatsächlich den Sturz der DDR-Regierung herbeiführen konnte. Dieser Sturz blieb auf allen Seiten friedlich – ein Wunder, das man als ein Unikat der deutschen Geschichte bezeichnen kann.
Der Funke der Freiheit, der die Hauptstädte Osteuropas bis nach Zentralasien erfasste, breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus. »Freiheit« und »Demokratie« waren nun die neuen Stichworte. Der Warschauer Pakt löste sich in kurzer Zeit auf, und in Deutschland ging es mit riesigen Schritten der Wiedervereinigung entgegen. Wenn man sich fragt, wie eine solche völlig neue Konstellation im weltpolitischen Ausmaß möglich war, so kann man eigentlich nur noch spekulieren und die Ursachen des Wunders erforschen. Mir scheint ein Gesichtspunkt wesentlich zu sein: dass in den wichtigen Machtzentren der Welt – auf die es ankam – gleichzeitig kluge und vernünftige Köpfe waren, die darin übereinstimmten, Frieden zu bewahren und die einmalige Chance der Geschichte positiv zu nutzen. Weitsichtige Politiker haben erkannt, dass die Wiedervereinigung Deutschlands auf lange Sicht nach dieser Entwicklung in der DDR kaum zu verhindern war. Da kam auch die Erinnerung daran wieder hoch, dass die deutsche Wiedervereinigung ein damals von Konrad Adenauer hartnäckig vertretenes langfristiges Ziel war, dem schlussendlich die Westmächte im Deutschland-Vertrag zugestimmt haben. So zogen die wesentlichen Politiker des Westens formell zunächst an einem Strang: In Moskau führte Michail Gorbatschow zusammen mit seinem Außenminister Eduard Schewardnadse die Verhandlungen über die Deutschlandfrage in fairer und ernsthafter Weise.
In Washington waren Präsident George H. W. Bush (Bush senior) und sein Außenminister James Baker Teil der Verhandlungen und standen Deutschland vertrauensvoll und freundschaftlich zur Seite.
Und in Bonn trieb Helmut Kohl mit seinem Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Gespräche mit allen vier Mächten entschlossen voran. Wir hatten das einzigartige Glück, dass wir mit Helmut Kohl einen Mann an der Spitze unseres Staates hatten, der die Einheit Deutschlands mit Herz und Verstand verkörperte. Er sorgte zusammen mit Hans-Dietrich Genscher, der aufgrund seiner Lebensgeschichte und seiner Erfahrungen vom gleichen Geist beseelt war, dafür, dass das Momentum der neuen internationalen Lage beherzt umgesetzt wurde, mit Schritten zur Wiedervereinigung unseres Vaterlandes/Deutschlands in immer schnellerer Abfolge.
So konnten die Zwei-plus-vier-Gespräche innerhalb weniger Monate im Jahre 1990 die Wiedervereinigung Wirklichkeit werden lassen. Doch Großbritannien und Frankreich hatten entgegen dem Deutschlandvertrag in Wahrheit erhebliche Bedenken gegenüber der Einheit Deutschlands und wollten ein starkes und großes Deutschland innerhalb Europas möglichst verhindern. Hier wurden die historischen Bezüge der britischen und französischen Politik aus früherer Zeit wieder deutlich, wobei man der Dynamik der Entwicklung und der starken und kraftvollen Politik der USA sowie der zielführenden Politik Deutschlands nichts Entscheidendes entgegensetzen konnte. Die Erfolgswelle von Freiheit und Demokratie rollte über alle Widerstände hinweg und verbreitete sich in Windeseile von Osteuropa bis nach Asien. Das Siegergefühl, dass die Freiheit gegen die Diktatur, dass die Demokratie gegen den Kommunismus, dass der Kapitalismus gegen den Bolschewismus gewonnen hatte, war allenthalben gängige Münze, selbst in intellektuellen Kreisen. Auch absurde Schlussfolgerungen waren in Deutschland kaum zu stoppen. Viele Leute der bisherigen »Friedensbewegung« führten plötzlich wieder das Wort und stellten die Notwendigkeit von Landesverteidigung sowie das Einhaltgebieten von Menschenrechtsverletzungen, notfalls auch mit militärischen Mitteln, gänzlich infrage. Manche besonders phantasievolle Leute plädierten sogar für die Abschaffung der Bundeswehr, die man nicht mehr für notwendig hielt. Und in den USA, überglücklich von der Rolle des Weltpolizisten erlöst zu sein, übersteigerte man die Entwicklung zu einem weltgeschichtlichen Sieg der Demokratie über jegliche Form von Diktatur, bis hin zu einem angeblichen Ende der Geschichte4. Wie illusionär solche Vorstellungen waren, wurde allerdings kurze Zeit später unübersehbar klar.
Der selbstzerstörerische Sonderweg Jugoslawiens
Während in den Hauptstädten des Ostblocks die schnelle Ausbreitung von Freiheit und Demokratie, ausgehend von Ungarn und Polen, zu sich überstürzenden Ereignissen führte – im Juni 1991 erfolgte bereits die Auflösung des Warschauer Paktes –, versank der Westen in Jubelfeiern und kräftigem Schulterklopfen hinsichtlich der eigenen Tüchtigkeit. Dass sich jetzt überall der Frieden und die Demokratie sozusagen automatisch ausbreiteten, war eine verrückte Illusion, die mit dem Namen Fukuyama verbunden wurde und in gleicher Weise Analysten wie Politiker ergriffen hatte. Dass sich aber in Jugoslawien etwas völlig anderes entwickelte, blieb weitgehend unbeachtet. Dort entfaltete sich eine krasse, serbisch befehligte Militäraggression gegen die nichtserbische Bevölkerung in den autonomen Provinzen Jugoslawiens. Die Politik des Westens wollte dies nicht zur Kenntnis nehmen und schaute weg – schließlich wollte man sich das schöne Bild vom Sieg der Demokratie über die kommunistisch-sozialistische Diktatur nicht zerstören lassen.
Auch ich muss bekennen, dass ich mich vom Jubel, dass die 40-jährige Friedensperiode Europas durch die Wiedervereinigung Deutschlands und die Freiheitsentwicklung in Mittel- und Osteuropa eine kraftvolle Fortsetzung finde, zunächst anstecken ließ. Allerdings stand ich der häufig zu hörenden Definition, dass diese Entwicklung in Europa »unumkehrbar« sei, durch meine einschlägigen Geschichtsstudien und Erfahrungen in der Politik skeptischer gegenüber. Doch dann traf mich ein Ereignis wie der Blitz, der mein Weltbild tiefgreifend verändern sollte.
Ich war gerade auf Familienurlaub in Südfrankreich, als ich am 6. August 1992 in der »Welt« unter der Überschrift »Die Bewohner schnitten ihnen die Gurgel durch. Zwei Augenzeugen berichten über serbische Vernichtungslager« einen Artikel gelesen hatte, der mir die Sprache verschlug. Der Autor war der amerikanische Europakorrespondent Roy Gutman, der entsprechende Artikel über die Nachrichtenagentur »Reuters«, im britischen »Guardian« und in der amerikanischen Zeitung »Los Angeles Times« veröffentlicht hatte.5 Er berichtete von zwei Lagern, die in Nordwestbosnien (Omarska) und Nordostbosnien (Brcko am Fluss Sava) errichtet wurden und wo Tausende von bosniakischen und kroatischen Zivilisten umgebracht wurden. In Brcko waren es zwischen dem 15. Mai und Mitte Juni 1992 allein 1350 Menschen. Da ich mich mit Jugoslawien noch nie befasst hatte, stellte ich sofort weitere Nachforschungen an. Mir eröffnete sich ein grauenhaftes Bild – ich konnte es nicht fassen: 47 Jahre nach dem Naziregime fand eine solche Katastrophe wieder mitten in Europa statt! Hatten wir nicht 40 Jahre lang ständig von Frieden und der demokratischen Staatsform der europäischen Völker gesprochen, aufgrund derer sich unsere Meinung gründet, dass sich so etwas während unserer Lebenszeit und danach nie wieder in Europa ereignen sollte? Und dann schauen wir auch noch weg und tun nichts!
Ich suchte sofort weiter nach eventuellen Stellungnahmen der Bundesregierung und fand als Erstes eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl vom 4. September 1991 vor dem Deutschen Bundestag zur »Lage und Entwicklung in der Sowjetunion und Jugoslawien«.6 In dieser Regierungserklärung wurde, angesichts der Bilder des Schreckens und des Terrors die sofortige und uneingeschränkte Beendigung der massiven Einsätze der Jugoslawischen Volksarmee sowie aller anderen bewaffneten Verbände gefordert und die Drohung der völkerrechtlichen Anerkennung derjenigen Republiken ausgesprochen, die nicht mehr zu Jugoslawien gehören wollten. Das war für diese Zeit eine deutliche Stellungnahme und ich war erleichtert, sie zu lesen. Obwohl ich dann feststellen musste, dass sich die Lage im nächsten Jahr (1992) nach den aktuellen Berichten dramatisch verschlechtert hatte, gab es am 22. Juli 1992 noch einmal eine »Regierungserklärung zur Lage und Entwicklung im ehemaligen Jugoslawien und zur Entscheidung der Bundesregierung über die Beteiligung der Bundeswehr an Überwachungsmaßnahmen von WEU und NATO.«7 Diese Regierungserklärung wurde von Außenminister Klaus Kinkel außerordentlich eindrucksvoll eröffnet. Er erklärte: »Die grauenverbreitende Entwicklung im früheren Jugoslawien hat uns leider vor Augen geführt – und es hat keinen Zweck, darüber hinwegzusehen –, dass die traditionellen Instrumente unserer Friedens- und Sicherheitspolitik nicht ausreichen. Die Konflikte sind schneller gewachsen, als die Bekämpfungs-Instrumente entwickelt werden konnten. Wir müssen demnach allem mehr politischen Nachdruck verleihen; denn es bewahrheitet sich eben leider, dass die Verantwortlichen für Gewalt und Aggression nur dann reagieren, wenn ihnen demonstriert wird, dass ihr verbrecherisches Handeln zu einer Reaktion der internationalen Gemeinschaft führt. Daher hat sich der UN-Sicherheitsrat entschlossen, mit den Resolutionen 713 und 757 ein Waffen- bzw. generelles Wirtschaftsembargo gegenüber den Verantwortlichen im ehemaligen Jugoslawien zu verhängen. Für diese UN-Resolutionen hat die Bundesregierung politisch gekämpft und wir werden auch weiterhin nachdrücklich für ihre Beachtung eintreten. Die WEU und die NATO haben diesen Ansatz der Vereinten Nationen aufgenommen und wollen helfen, ihm Respekt zu verschaffen. Die Maßnahmen von NATO und WEU, über die wir heute sprechen, sind also keine vereinzelten, leeren Gesten der Ohnmacht. Sie stehen und müssen gesehen werden im Gesamtzusammenhang sämtlicher Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts und sollen als zusätzliche Instrumente dazu beitragen, dass dem Krieg Einhalt geboten werden kann.«8
Hier macht der Außenminister noch einmal deutlich, dass es darauf ankam, den Aggressoren im Jugoslawienkrieg deutlich zu demonstrieren, dass das gezeigte verbrecherische Handeln zu einer Reaktion der internationalen Gemeinschaft führt. Dann erläuterte der Außenminister völlig zutreffend, dass wir »durch unsere Teilnahme nicht zuletzt auch unsere Bündnisfähigkeit unter Beweis stellen und es auch für unsere Soldaten wichtig ist, dass sie sich bei dieser Gelegenheit nicht aus dem Schiffsverband verabschieden müssen, mit dem sie seit Jahren im Mittelmeer zusammen üben. Die von WEU und NATO beschlossenen Überwachungsmaßnahmen stehen eindeutig im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht.«9 An dieser Behauptung sind allerdings erhebliche Zweifel angebracht. Das Waffenembargo war eine einseitige Maßnahme gegen das Selbstverteidigungsrecht von Bosnien-Herzegowina und teilweise auch Kroatien. Wie man dem weiteren Verlauf der Rede entnehmen kann, ging es ihm vor allem darum, erst gar nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass eine Grundgesetzänderung erforderlich sei.
Nicht nur die internationale Rechtmäßigkeit wird in der Rede von Klaus Kinkel weiter beschworen, sondern er fährt dann fort: »Die Bestimmungen des Grundgesetzes stehen der von mir dargelegten Entscheidung der Bundesregierung nicht entgegen. Diese Rechtsauffassung wird im Übrigen einstimmig vom völkerrechtswissenschaftlichen Beirat geteilt, der am 17. Juli 1992 im Auswärtigen Amt getagt hat. Entscheidend für uns ist, dass die fraglichen Einheiten sich an den beschlossenen Maßnahmen unter Ausschluss von Waffengewalt beteiligen. […]
Die Maßnahme fällt in den Eigenverantwortungsbereich der Exekutive. Die Bundesregierung hat aber, schon im Zusammenhang mit den Hilfsflügen der Bundeswehr nach Sarajewo, ausdrücklichen Wert auf vorherige Konsultationen mit dem Bundestag gelegt. 10 […]
Mir wurde dabei von der SPD gesagt, dass sie die Entscheidung nicht mittragen kann. Damit war die Sache klar. Im Übrigen wurde am 16. Juni 1992 in der gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses und des Verteidigungsausschusses die Beteiligung der Bundesmarine an den Überwachungsmaßnahmen im Mittelmeer eingehend erörtert. Ich möchte nachdrücklich betonen, dass der Bundesregierung außerordentlich viel an der Beteiligung des Parlaments bei der Suche nach einem überparteilichen Konsens in so wichtigen Fragen liegt. Aber die Bundesregierung hatte in der konkreten Situation zügig zu entscheiden und sie hat es getan, wissend, dass sie die Mehrheit des Deutschen Bundestages hinter sich hat und wissend, dass die SPD die Entscheidung nicht mittragen würde. Deutschland konnte und kann sich einer gewachsenen Verantwortung nicht entziehen. Dabei geht es nicht um Demonstration militärischer Macht, sondern um einen Beitrag zur Stärkung der Instrumente der kollektiven Friedenssicherung. […]
Wichtig sollte für uns alle sein, es muss der Völkergemeinschaft gelingen, diesen schrecklichen Morden im früheren Jugoslawien, mitten im Herzen Europas, ein Ende zu bereiten.«11
Mir bleibt es noch immer ein Rätsel, wie der Außenminister und FDP-Vorsitzende nach dieser Rede einige Monate später dafür sorgte, dass sich die FDP der Klage der SPD vor dem Bundesverfassungsgericht anschloss und dabei die Solidarität der Bundesregierung auf das Schlimmste verletzte. Welche neuen Erkenntnisse hatten sich ihm hier aufgetan, welche grundsätzlichen Überlegungen sind ihm dabei gekommen, dass er im Grunde genommen seine eigenen Argumente, die er in dieser Rede vorbringt, jetzt für obsolet erklärte und nunmehr eine gegenteilige Haltung vertrat? Natürlich war bei der Brutalität der serbischen Kriegsführung auch in den folgenden Wochen deutlich geworden, dass mit reinen Waffenembargo-Kontrollmaßnahmen den serbischen Politikern nicht beizukommen war. Völlig konsequent hat deswegen der Bundestag in seiner abschließenden Entschließung der Sondersitzung des Deutschen Bundestages vom 22. Juli 1992 festgestellt: »Der Deutsche Bundestag ist der Auffassung, dass die Gewalthandlungen der serbischen Armee gegen die Bevölkerung von Bosnien-Herzegowina nach der UN-Konvention über Verhütung und Bestrafung des Völkermords vom 9. Dezember 1948 den Tatbestand des versuchten Völkermords erfüllen. Der Deutsche Bundestag bittet die Bundesregierung zu prüfen, in welcher Form die zuständigen Organe der Vereinten Nationen damit befasst werden können, gemäß der Charta diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die sie für die Verhütung und Bekämpfung von Völkermordhandlungen für geeignet erachten.«12
Mit dieser Entschließung hatte der Bundestag bereits den konstruktiven Weg gewiesen, der, wenn dieser Weg mit Entschlossenheit gegangen worden wäre, die entsetzlichen Massaker in den folgenden Monaten und Jahren verhindert hätte. Nicht aber indem sich die FDP der Klage der SPD anschloss und damit die geschichtliche Entwicklung zurückgedreht hatte, bis zur Bewegungslosigkeit und Schockstarre gegenüber dem sich immer weiter ausbreitenden Völkermord in Jugoslawien.
Auf die Gefahren, die bei einer falschen Entscheidung Deutschlands entstehen konnten, hatte in dieser Debatte bereits der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Schäuble, mit aller Deutlichkeit hingewiesen. Er sagte: »Es herrscht Krieg mitten in Europa. Wenige Kilometer von uns entfernt sterben jede Stunde Menschen unter grauenvollen Umständen. Es wird ein barbarischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt. Dies ist der Anlass unserer heutigen Debatte. Deswegen ist es in Ordnung, dass der Deutsche Bundestag auch in der sitzungsfreien Zeit über diese Fragen debattiert.« Gegenüber dem SPD-Außenpolitiker Hans-Ulrich Klose sagte er gleich zu Beginn: »Erstens: Das Theater, das Ihre Partei und Fraktion in den letzten Tagen und Wochen veranstaltet hat, war dem Elend der Menschen im früheren Jugoslawien so wenig angemessen wie dem Einsatz der Soldaten unserer Bundeswehr. Das zweite ist noch weniger in Ordnung, und das muss hier in allem Freimut ausgetragen werden: Ich verstehe, dass Sie eine Aktivlegitimation für das Verfahren in Karlsruhe brauchen und für die Zulässigkeit der Klage Gründe schaffen müssen. Sie müssen aber bei der Wahrheit bleiben. Die Wahrheit ist, dass die Bundesregierung, der Bundesaußenminister wie der Bundesverteidigungsminister, vor ihrer Entscheidung mit den Fraktionen des Deutschen Bundestages, auch mit dem Fraktionsvorsitzenden, auch mit Ihnen und mit mir, Kontakt aufgenommen hat und dass vor der Entscheidung der Bundesregierung Absprachen darüber getroffen wurden, dass die Bundesregierung am Dienstag entscheidet und der Deutsche Bundestag dann am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses und Verteidigungsausschusses über diese Entscheidung unterrichtet wird und darüber debattiert.«13 Wolfgang Schäuble fährt fort: »Nur militärische Gewalt, militärische Aggression ist mit humanitärer Hilfe nicht zu beenden. Deswegen reicht humanitäre Hilfe allein nicht aus; das ist ja unser Dilemma. Am liebsten würden wir uns alle auf humanitäre Hilfe beschränken. Noch besser wäre es, wenn noch nicht einmal die Voraussetzungen für die Notwendigkeit humanitärer Hilfe bestünden. Angesichts einer brutalen militärischen Aggression aber reicht die humanitäre Hilfe eben nicht.«14
Wolfgang Schäuble schließlich: »Nun will ich auch betonen, dass meine Fraktion und die Koalition – aber die Kollegen der FDP werden das für ihre Fraktion selber sagen – die Entscheidung der Bundesregierung für politisch richtig und verfassungsrechtlich völlig unbedenklich halten. (Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) […]
Nach unserer Überzeugung, die von der herrschenden Meinung in der deutschen Verfassungs- und Staatsrechtslehre geteilt wird, ist mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen durch das Grundgesetz beispielsweise die Beteiligung der Bundeswehr an friedensbewahrenden wie friedenserhaltenden Maßnahmen der Vereinten Nationen möglich. Nach unserer Überzeugung ist durch das Grundgesetz auch die Beteiligung an gemeinsamen Aktionen der NATO oder eines europäischen Streitkräfteverbundes nicht eingeschränkt. Denn dies ist durch Art. 24 Abs. 1 ausdrücklich geregelt. Darauf nimmt ja Art. 87 a Abs. 2 Bezug. Dort heißt es, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Das tut es in Art. 24 Abs. 2.«15 Die Rede von Wolfgang Schäuble wurde mit anhaltendem, lebhaftem Beifall der CDU/CSU- und der FDP-Fraktion bedacht.
Nach dieser Bundestagssitzung konnte man nicht begreifen, dass die FDP einige Monate später in das Lager der Opposition wechselte. Dass sie dabei weiterhin das Amt des Außenministers bekleidete, ist eine Besonderheit, die ich bis heute nicht verstanden habe. Auch Bundesverteidigungsminister Volker Rühe erklärte in dieser Sitzung: »Sie (Anm. des Verf.: MdB Klose) müssen sich fragen lassen, warum Sie die einzige Partei in dieser Größenordnung in Europa sind, die die Lage anders einschätzt als alle anderen im Bündnis. Das ist die Gretchenfrage für die SPD. (Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)«16
Am Schluss sagte der Verteidigungsminister: »Wir wollen Europa bauen. Wer Europa bauen will, muss auch bereit sein, in einer schwierigen Lage in Kambodscha deutsche Sanitätssoldaten französischen Einheiten zur Hilfe zu geben. Er muss auch bereit sein, seiner Bundesmarine zu sagen: Ihr steuert denselben Kurs wie die französischen, die englischen und die anderen europäischen Schiffe. (Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)« 17 Allerdings hätte uns ein Satz bereits früher in der Rede von Volker Rühe aufmerksam machen müssen. Er sagte: »Eine militärische Option in Jugoslawien kommt für mich nicht in Frage. Ich teile auch die Skepsis, die es in befreundeten Ländern diesbezüglich gibt.«18 Hier bezog er sich offensichtlich auf die britischen Friedensbemühungen, die allerdings in eine völlig andere Richtung gelaufen sind und die auch zu einem Spaltpilz innerhalb der NATO und der WEU geführt haben. Doch auf diese Entwicklung kommen wir etwas später.
Am Schluss sprach Karl Lamers, der Außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und er betonte mit aller Klarheit: »Wir Deutschen dürfen in diesem Konflikt keine Sonderrolle spielen. Worum ringen wir denn im Kern? Im Kern ringen wir um unser Selbstverständnis von unserer Rolle in der Welt, also auch um unser Verhältnis zu unseren nahen und ferneren Nachbarn. Es geht also zunächst um uns selbst. Wie immer, wenn es darum geht, geht es auch und nicht zuletzt um die Lehren aus der Geschichte.«19 Karl Lamers dachte bereits sehr viel gründlicher in die Zukunft. Er erklärte: »Richtig ist eine Äußerung des sozialdemokratischen Parteivorsitzenden, dass es ein solches Gewaltmonopol der Vereinten Nationen nicht gibt. Ich füge hinzu: Sie erheben noch nicht einmal den Anspruch darauf, denn Art. 51 lautet ganz eindeutig: Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zu individueller und kollektiver Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.«20
Hier wird völlig zu Recht die Frage gestellt, ob es denn überhaupt richtig ist, ein Waffenembargo in dieser Situation in Jugoslawien seitens der Vereinten Nationen bzw. auch der europäischen Nationen auszusprechen. Und Karl Lamers fährt fort:
»Mit anderen Worten, verehrte Kolleginnen und Kollegen: Es geht tatsächlich darum, ob Deutschland wiederum eine Sonderrolle einnehmen soll. Der Versuch, sich herauszuhalten, läuft im Grunde auf eine Quasineutralität hinaus. Ich bitte Sie wirklich inständig, diese Folgen für unsere Europafähigkeit bei unserer Diskussion nicht zu vergessen. Ich schließe mich mit allem Nachdruck dem an, was der frühere Kollege Gerster, der heutige rheinland-pfälzische Bundesratsminister, gesagt hat. Er hat nicht nur zu Recht darauf hingewiesen, dass die Charta der Vereinten Nationen Blauhelme überhaupt nicht vorsehe, wohl aber Kampfmaßnahmen, deswegen eine Beschränkung auf nur Blauhelmeinsätze gar nicht zulässig sei, sondern auch vor einer deutschen Sonderrolle gewarnt. Dieser Warnung möchte ich mich mit allem Nachdruck anschließen. Darum geht es im Kern bei unserer heutigen Debatte. (Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)«21





























