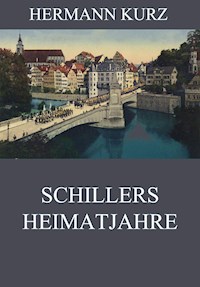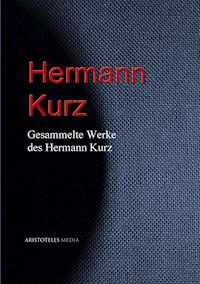Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Der Roman 'Der Weihnachtsfund' von Hermann Kurz entführt den Leser in eine romantische und spannende Geschichte, die zur Weihnachtszeit spielt. Mit seinem detaillierten Schreibstil und seiner Fähigkeit, Atmosphäre zu schaffen, schafft Kurz eine einzigartige Welt, die den Leser in ihren Bann zieht. Der literarische Kontext des Romans zeigt Kurz als Meister seines Fachs, der die Feinheiten des menschlichen Daseins einfängt und in fesselnder Weise darstellt. 'Der Weihnachtsfund' ist ein Buch, das sowohl anspruchsvolle Leser als auch Liebhaber von romantischen Geschichten begeistern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Weihnachtsfund
Books
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
In demselben November 1854, in dem der »Sonnenwirt« das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatte, dachte Kurz an weitere Erzählungen aus der schwäbischen Heimat und wurde von dem unermüdlich treibenden Verleger jenes Romans, Meidinger in Frankfurt, immer wieder darin bestärkt. Gerne wäre er auf der Bahn der Darstellung sozialer Konflikte weiter geschritten. Wenn er früher von einer Darstellung aus dem Bauernkriege geträumt hatte, so dachte er jetzt daran, den Vorläufer desselben, den »Armen Konrad« von 1514 zu schildern. Wenn auch nicht auf diesen, so doch auf andere Gegenstände schwäbischer Vorzeit kam er späterhin zurück, doch nicht mehr in der Form der Novelle. Vorerst aber trat Meidinger mit einem anderen Plan hervor, der rasch Gestalt gewinnen sollte. Er wünschte als Buch für Weihnachten 1855 eine Novelle zu haben; da Kurz diesen Plan aufgriff, aber die vorgeschlagene Wahl eines Stoffes aus der Geschichte der deutschen Dichtung nicht billigte, so wollte er sich auch eine Dorfnovelle gerne gefallen lassen. Kurz ging darauf ein und scheint zuerst an eine novellistische Schilderung aus seiner Vaterstadt Reutlingen gedacht zu haben, wie er solche schon früher mit Glück entworfen hatte. Im Sommer 1855 brachte er längere Zeit bei einem Freunde, dem Pfarrer Buttersack zu Liebenzell im Schwarzwald, zu. Dort wurde die Novelle in kurzer Zeit glücklich vollendet. Sie erschien auf Weihnachten 1855 unter dem dem Inhalt und der Art des Erscheinens angepaßten Titel »Der Weihnachtfund. Ein Seelenbild aus dem schwäbischen Volksleben« (in der 2. Auflage von 1862: »Der Weihnachtsfund. Erzählung aus dem schwäbischen Volksleben«), mit dem Übertitel »Unter dem Tannenbaum«.
Die Novelle ist des Dichters letzte Leistung auf dem Gebiete der objektiv erzählenden Gattung. Er dachte gleich nachher daran, alte Ulmer Geschichten zu bearbeiten, stand aber davon ab. Die 1859 erschienenen »Denk- und Glaubwürdigkeiten« zeigen ihn schon auf der Bahn einer humoristisch-ironisierenden Darstellung in der Art Jean Pauls, auf der ihm noch ein Meisterstück wie die »beiden Tubus« glücken sollte.
Wenn der Sonnenwirt ein großes Zeitgemälde gegeben hatte, so betritt die neue Erzählung das Gebiet der eigentlichen Dorfnovelle im engeren Sinne und Rahmen, wie sie auf schwäbischem Boden von Berthold Auerbach seit einem Dutzend Jahre gepflegt worden war und fast gleichzeitig mit dem Weihnachtsfund durch Melchior Meyr in seinen Erzählungen aus dem Ries bearbeitet wurde. Kurz tritt als ebenbürtiger Meister zwischen beide. Wenn ihn der höhere poetische Flug von dem nüchterneren Meyr entfernt, so steht er in der sprachlichen Behandlungsweise und im Gegenstand ihm doch näher als seinem engeren Landsmann Auerbach. In den Reden der Personen hatte Auerbach, in minderem Maße der Sonnenwirt, gerne nicht den Laut, aber den Rhythmus schwäbischer Zunge nachgebildet, was ihrer Sprache ein starkes Lokalkolorit, aber auch, wenigstens bei Auerbach, öfters etwas Geziertes und inmitten der hochdeutschen Erzählung etwas Buntscheckiges gegeben hatte. Der Weihnachtsfund redet ein planes, kaum durch leichte Lokalanklänge gefärbtes Hochdeutsch, das eher mitunter zu wenig populär klingt. Der Gegenstand scheint frei erfunden, und auch das Lokal ist nicht bestimmt gezeichnet. Wir werden in die intimste Sphäre des Volkslebens, den Verkehr zwischen Mann und Weib geführt, wie bei Meyr fast immer, aber mit mehr Kunst und freier Bewegung als bei dem auf die Länge etwas eintönigen Rieser Erzähler. Jenes lehrhafte Philosophieren, das bei Auerbach oft unangenehm wirkt, ist aufs glücklichste vermieden und ein reiner, behaglicher Gang der Erzählung durchaus eingehalten. Man wird so nicht anstehen, den Weihnachtsfund, das Erzeugnis glücklicher ländlicher Muße, den allererfreulichsten deutschen Dorfgeschichten beizugesellen.
1.
Im roten Löwen, einem ansehnlichen, an einer vielbefahrenen Straße einsam gelegenen Gasthause, ging es am Abend vor Weihnachten lebhaft zu, wiewohl nicht von Gästen; denn die schweren und leichten Fuhrwerke der Reisenden, welchen das Wirtshaus zur Einkehr bequem lag, waren heute ausgeblieben, weil religiöse Scheu, Sitte und Aberglaube das Reisen in der heiligen Zeit verboten, und auch von den Spaziergängern der benachbarten Stadt, die sich sonst reichlich einfanden und den Löwenwein jedem anderen vorzogen, war niemand gekommen, da die einen dem Herkommen der Weihnachtsfeier im häuslichen Kreise huldigten, und die andern sich scheuten, durch Wirtshausbesuch an einem solchen Tage ihren Mitbürgern Ärgernis zu geben. Familie und Gesinde des Hauses waren es also selbst, welche, diese seltenen Stunden der Freiheit von allen Verrichtungen für sich zur Weihnachtsruhe und Weihnachtsfreude anwendend, das Haus mit fröhlichem Geräusch erfüllten. Auf einem Tische der geräumigen Wirtsstube waren die Bescherungen für die Kinder, auf einem anderen für die Knechte und Mägde aufgestellt. Die Kinder jauchzten über ihre Süßigkeiten, bliesen in ihre Trompeten und polterten mit allem, was von ihren Geschenken einen Lärm zu machen geeignet war. Auch am anderen Tische machte sich die Freude laut, denn während die Knechte ihre Gaben erst auf wiederholtes Zureden und mit verlegenem Lachen in Empfang nahmen, machten die Mägde dafür, mit Ausnahme einer einzigen, um so mehr Geschrei und Aufheben von den ihrigen. Doch fehlte es dem Geschrei wenigstens nicht an Wolle, da die Herrschaft ihre Dienstleute wie Familienangehörige behandelte und mit einer Freigebigkeit, die mit dem einträglichen Gange der Wirtschaft gleichen Schritt hielt, den Weihnachtsbaum für sie so reichlich ausgestattet hatte, daß er kaum minder als der der eigenen Kinder glänzte.
Es kam heute noch ein besonderer Anlaß zu dem häuslichen Feste, der dasselbe zugleich zu einer Abschiedsfeier machte. Zwei von den Knechten wollten den Dienst verlassen, und ihre Wanderzeit war, dem Herkommen der Gegend gemäß, das in diesem Punkte seltsam von der sonstigen Heilighaltung der Festzeit abwich, mit Weihnachten eingetreten. Der eine, ein Sohn einer vermöglichen Witwe im nahen Städtchen, hatte seinen Dienst als Freiwilliger versehen, um in Feld und Haus das Nötige zu erlernen. Wenn man aber dem Zeugnis der anderen glauben durfte, hatte er, als ein verweichlichtes Muttersöhnchen, dem nichts an der Arbeit gelegen war, bei dem Unterrichte wenig gewonnen. Auch auf seinen Charakter waren sie nicht gut zu sprechen: obgleich, seinen freundlichen Redensarten nach zu urteilen, sein Herz von Nächstenliebe überzufließen schien und seine gefälligen Manieren im Anfang alle gewonnen hatten, so stimmten sie doch allmählich mit dem alten Philipp, dem Oberknecht, überein, der von ihm zu sagen pflegte: »Hilft alles nichts, der Alex ist eben ein Schleicher, ein Fuchsschwänzer, und wenn er mich übergolden wollt'; zwar das wird er bleiben lassen, denn er ist ein wüster Geizkrag'.« Dagegen ließen sie den andern sehr ungern ziehen: wiewohl von Betragen nichts weniger als einschmeichelnd, war er doch allgemein geachtet und geliebt, denn, pflegte der alte Philipp zu sagen, »die Katz' zu streicheln, ist er nicht der Mann, der Erhard, aber reell ist er, wo ihn die Haut anrührt«. Seine Dienstaufkündigung hatte eine wahre Trauer im Hause verbreitet, alles hatte ihm zugesprochen, sie zurückzunehmen, und der Löwenwirt selbst, der große Stücke auf ihn hielt, hatte ihn zum Bleiben zu bewegen gesucht, allein vergebens; denn der Knecht hatte auf alle Zureden hartnäckig erwidert, es treibe ihn fort, daß ihn nicht tausend Pferde halten könnten, und er fühle den unüberwindlichen Drang, sein Glück in der Fremde zu versuchen. Man munkelte jedoch, was ihn forttreibe, sei nicht sowohl Wanderlust, als vielmehr Liebe zu der Magd Justine, neben welcher er es nicht aushalten könne hoffnungslos fortzuleben, obgleich niemand zweifelte, daß sie ihm gerne die Hand reichen würde, wenn sie nur ein wenig Vermögen miteinander besäßen; denn daß die Justine den Erhard aus irgend einem anderen Grund der Welt ausschlagen könnte, das hätte keins von allen geglaubt. Anders stand es zwischen ihr und dem Alex. Als dieser mit dem Frühjahr in den Dienst trat, konnte man eine Weile glauben, sein glattes Gesicht sei ihr nicht gerade zuwider, und man hatte sie seinen unterhaltenden Reden mitunter nicht unbeifällig lächeln sehen. Doch dauerte es nicht allzu lange, so bemerkte man noch viel deutlicher, daß sie sich mit unverhehlter Geringschätzung von ihm zurückzog; er versuchte zuweilen noch mit einem Scherzwort bei ihr anzukommen, wurde aber jedesmal mit bitterer Verachtung abgestoßen, was um so erklärlicher war, da ein Gerücht verlautete, welches sich auch bald als begründet erwies, daß er eine reiche Frauensperson im Städtchen heiraten wolle, die jedoch mit all ihrem Gelde den verächtlichen Ursprung dieses Reichtums nicht zudecken konnte. Diese Handlungsweise, als deren einzigen Beweggrund man bei den bekannten, sonst nicht eben verführerischen Eigenschaften der Braut den Geiz ansehen konnte, raubte ihm vollends den letzten Rest der Achtung, die er im Hause genossen hatte. Allein nicht bloß die vornehme Welt, auch die ländliche hat ihre Rücksichten und zurückhaltenden Gesellschaftsformen: Alex gehörte einer Familie an, die man nicht ohne weiteres vor den Kopf stoßen durfte, und in seine Heiratsangelegenheiten war niemand berechtigt sich zu mischen; man begnügte sich daher, ihm über seinen Abgang keinerlei Betrübnis zu bezeigen; er erhielt sein Weihnachtsgeschenk so gut wie die andern, nur hatte man dabei keine besonders liebevolle Auswahl und keine überflüssige Verschwendung beobachtet, auch obendrein einen sehr fühlbaren Unterschied gemacht, indem Erhards Bescherung, außer einem Reisebeutelchen mit etlichen neugeprägten Reichstalern, dreimal so reich ausgefallen war, als die seinige. Alex tat jedoch, als merke er nichts davon.
Auch Justine war in einer Weise bedacht worden, woran der Vorzug, den man ihr vor den anderen Mädchen gab, sich erkennen ließ. Sie war der Liebling der Frau vom Hause, die sich nicht glücklich genug preisen konnte, in der unruhigen Wirtschaft ihre Kinder einem so zuverlässigen Wesen anvertrauen zu können. Die Löwenwirtin konnte ganz warm werden, wenn sie bei Gelegenheit die Tugenden des Mädchens herausstrich, ihre gute Art, mit den Kindern umzugehen, die sie stets bei freundlicher Laune zu erhalten wisse, die unverdrossene, liebevolle Sorgfalt, die sie ihnen widme, daneben ihre Anstelligkeit in Küche und Haushalt und endlich über alles ihr bescheidenes, verständiges, gesetztes Wesen, womit sie ihrer Herkunft als eine Waise armer, aber rechtschaffener Eltern Ehre mache, da sie nicht, wie andere ihres Alters, den jungen Burschen nachgucke und zudringliche Gäste, ohne Ungeschick und Grobheit, in geziemender Entfernung zu halten wisse. Diesem Lob entsprach das Aussehen der jungen Magd vollkommen. Ein stillfreundlicher, verständiger Ausdruck lag in ihrem feinen Gesicht, das eine angeborene gesunde Blässe deckte, und ihre gedrungene Gestalt, welche freilich, ein verzärtelter Geschmack schlanker wünschen mochte, hatte dessenungeachtet nichts Unedles, vielmehr war die derbe Tüchtigkeit, die in solchen, wie man sie auf dem Lande zu nennen pflegt, etwas auseinandergegangenen Gestalten sich ausspricht, durch Sanftheit der Haltung und anspruchslosen Anstand gemildert. Dieses gedämpfte Wesen, wodurch das junge Mädchen zu einer unter ihresgleichen nicht gewöhnlichen Erscheinung wurde, hatte jedoch eine Färbung angenommen, die allen auffallen mußte. Sie war stiller als je, und eine Niedergeschlagenheit, die man sie schon einige Zeit her mühsam verbergen sah, wollte sich heute nicht mehr bezwingen lassen. Ihre Gaben hatte sie nicht mit der lärmenden Freude in Empfang genommen, wie die andern Mädchen, und man hätte sie für unzufrieden halten können, wenn man sich nicht so gut wie die Löwenwirtin auf den dankbaren Blick ihres Auges verstand und den Ton ihrer Stimme auszulegen wußte. Sie stand demütig niedergebeugt am Tisch und sah trüb auf die Bescherung, als wäre dieselbe viel zu gut für sie und nicht von ihr verdient. Wenn jemand sie anredete oder die propern Kleiderzeuge, Tüchlein und Bänder, die vor ihr lagen, musterte, so schlug sie mit einem gewissen Entschlüsse die matt überflogenen blauen Augen auf und gab mit gewohnter Freundlichkeit Red' und Antwort, aber ihr gutmütiges Lächeln war von einem unsäglich schmerzlichen Zuge begleitet, und so vielen Zwang sie sich auch antat, so fiel sie doch immer wieder in tiefe und offenbar peinliche Gedanken zurück. Unverkennbar war es, daß ein schweres Seelenleiden auf ihr lastete. Alles blickte sie mit stiller Teilnahme an, ohne sie zu fragen; denn man war einig darin, daß nichts anderes als Erhards Abschied die Ursache ihrer Traurigkeit sei. Mochte auch ein schwermütiges Brüten, das ihr vielleicht von Natur eigen war, schon früher zuweilen an dem stillen Mädchen wahrzunehmen gewesen sein, so war ja doch die völlige Niedergeschlagenheit, so wie sie sich jetzt im täglichen Wachsen bemerklich machte, erst seit seiner Aufkündigung hervorgetreten.
Auch Erhard konnte in seinem ernsten Gesicht den Schmerz nicht ganz verbergen, so fehl er ihn durch männliche Zurückhaltung zu mäßigen wußte. Doch gab er sich alle mögliche Mühe, an der allgemeinen Freude teilzunehmen, die sich durch den Gedanken des Abschiedes zwar auf Augenblicke trüben, aber nicht aus ihrem Rechte verdrängen ließ. Die Krone des Abends war der »Schantiklas«, das nie fehlende, junge und alte Kinder scheuchende heilige Gespenst St. Niklas, in all seiner plump phantastischen Herrlichkeit von dem alten Philipp gespielt. Derselbe hatte sich insgeheim in einen weiten braunen Schafpelz gesteckt und diesen mit Stroh ausgestopft, das an den Händen und am Halse in ganzen Büscheln hervorstarrte, und unter die Füße hatte er Melkstühlchen gebunden, so daß er zu einer riesigen Größe und Dicke angewachsen war. Das Gesicht hatte er mit Ruß geschwärzt. Auf dem Kopfe trug er einen Kübel, über welchem ein Tannenwipfel schwankte, in der Linken einen hohen krummgebogenen Stecken, in der Rechten eine tüchtige Rute und auf dem Rücken einen Sack, aus dem er zur Abwechslung Nüsse unter die Leute warf, wenn er wieder eine Weile in der Stube herumgerutscht war, um die sündige Menschheit groß und klein mit der Rute zu streichen und die Kinder und Mädchen in den Sack zu stecken. In dem kleinen Kreise war es zwar ein öffentliches Geheimnis, daß hinter der fürchterlichen Erscheinung nichts als der alte Philipp stecke, aber dennoch verursachte sie entsetzlichen Lärm. Die Kinder verkrochen sich hinter den Erwachsenen, die Mägde stießen die ihnen eigenen grellen scharfen Schreckenstöne aus, denn, obgleich mit dem inwendigen Menschen des heiligen Butzenmannes wohl vertraut, ertrug ihre ungeübte Einbildungskraft doch das übernatürliche Äußere desselben nicht, und das schrillende Gelächter, wenn sich eine in Sicherheit sah, wechselte mit wildem Kreischen ab, wenn das Ungetüm wieder nahe kam; denn ungeachtet seiner unbeholfenen Bewegungen entging ihm niemand, da, durch eine geheime Verschwörung aller gegen alle, jedes wenigstens einmal im Gedränge eingekeilt und seiner Rute entgegengeschoben wurde. Löwenwirt und Löwenwirtin bekamen so gut wie die andern ihr Teil ab, denn der Weihnachtsscherz kannte keine Grenze, und für den Schantiklas gab es weder Herrschaft noch Gesinde, Doch ließen sich wohl auch in dieser gröberen Art von Weihnachtsbescherungen merkliche Unterschiede empfinden, wobei es freilich den Betroffenen überlassen war, ob sie den Grad der austeilenden Liebe an dem Mehr oder Weniger erkennen wollten. So erhielt zum Beispiel Justine, welche sich dem Gedränge nicht entziehen konnte, zwei Streiche, die sanft aufgetragen waren, so daß sie nur ein wenig lächelte, während Alex eine einzige Berührung des Strafwerkzeuges durch einen Gesichtsausdruck bescheinigte, der einen empfindlichen Hauteindruck zu bekennen schien, bald jedoch jener Miene Platz machte, mit welcher unter ähnlichen Umstanden gescheite, wie dumme Leute die Anerkennung auszusprechen Pflegen, daß man bei Lustbarkeiten fünfe müsse grad sein lassen. Wer aber bei dem Mummenschanz am schlimmsten wegkam, das war Erhard, der sonst immer der Augapfel des alten Philipp gewesen war, »Dich soll –!« brummte der Butzenmann, als ihm derselbe in den Wurf kam, und begann alsbald dieses in Worten nicht weiter ausgedrückte Soll mit der Rute in ein unveräußerliches Haben zu verwandeln. Der Löwenwirt, der eben in der Nähe stand, rief ihm zu: »Wisch ihm nur tüchtig aus, er verdient's nicht anders, der Landläufer, der uns im Stich lassen will!« Der Schantiklas ließ sich das nicht zweimal sagen und handhabte seine Rute mit Kraft. Erhard ließ sich diesen rauhen, aber aufrichtigen Ausdruck des Trennungsschmerzes eine Weile gefallen, bis er des Guten genug zu haben glaubte und sich den Streichen des unbeholfenen Riesen entzog.
Der Löwenwirt hatte unterdessen angelegentlich mit seiner Frau gesprochen, und nachdem diese seinen Worten mehrmals Beifall genickt, kam er zurück, nahm den liebgewonnenen Knecht am Arm und führte ihn aus dem Getümmel in eine Ecke der Stube, Ei führte ihn absichtlich dorthin, wo Justine saß, blieb nicht weit von ihr mit ihm stehen und redete ihn in einer Weise an, daß nur sie ihn hören konnte, zugleich aber so, daß sie notwendig jedes Wort verstehen mußte.
»Was meinst, Erhard?« sagte er, den Blick dazwischen auf das Mädchen heftend, »was meinst? ich will dir einen Vorschlag machen, den du aber keinem Menschen verraten darfst, denn sonst würd' ich zerrissen, und ich kann doch nicht jedem aushelfen. Ich seh' wohl, Erhard, du hast das Dienen satt – sei still,« fuhr er fort, da der Knecht eine abwehrende Gebärde machte, »ich hab's längst gemerkt, du möchtest dein eigener Herr sein und dein Wesen auf selbständigem Fuß treiben. Was ist für manchen ein gefährlich Ding, und manchen: tät's besser, er war' ein Taglöhner sein Leben lang, aber du hast das Zeug dazu, und zu dir Hab' ich alles Vertrauen. Ich weiß dir ein Gütle, das seinen Mann nährt, wenn er umtriebig und sparsam ist und – eine brave Haushälterin zur Frau hat, und das Gut ist grad jetzt sehr billig zu haben. Ich will dir das Geld dazu leihen. Mit dem Abzahlen kannst's nach Umständen halten, ganz wie dir's geschickt ist. Ich seh' ja in deine Wirtschaft hinein, weiß, wann du zahlen kannst und wann nicht, und kann mich auf dich verlassen; papierene Termine hast bei mir nicht einzuhalten, du machst's, wie du kannst, und weißt ja, ich drück' dich nicht. Bist so lang bei mir gewesen, und wir haben dich immer so gern gehabt, mein Weib und ich. Auf die Art könnten wir doch bei einander bleiben, als gute Nachbarn wenigstens. Was meinst?«
Der arme Erhard war bei diesem unerwarteten Anerbieten wie vernichtet von Glück und Unglück zugleich. Wenn ein König ihm die Hälfte seines Thrones angeboten hatte, der Besitz würde ihm nicht halb so lachend gewinkt haben, als jetzt, wo ihm, dem Aussichtslosen, die unmittelbare Möglichkeit geboten war, mit dem Mädchen, auf das er seine Gedanken gesetzt, ein eigen Haus zu errichten. Aber der Schimmer, der ihm wie ein Blitz in das Bild einer holdseligen Zukunft hineinleuchtete, verschwand auch so schnell wieder wie ein Blitz, und er sah nichts mehr als die graue Hoffnungslosigkeit. Auch er hatte, wie der gütige Freund, der ihm zu freiem Eigentum verhelfen wollte, während der Rede desselben unwillkürlich und unverwandt sein Auge auf Justinen ruhen lassen, denn an sie war ja die eine Hälfte des Anerbietens gerichtet, ohne deren Annahme die andere Hälfte für ihn nicht zu verwirklichen war; doch Justine gab kein Zeichen der Zustimmung; auf ihrem Gesicht drückte sich eine Empfindung aus, als ob jedes der menschenfreundlichen Worte ein Stich für sie wäre, sie senkte den Kopf immer tiefer, um ihr Gesicht zu verbergen, und auf die letzte Aufforderung: »Was meinst?«, die, wie sie wohl fühlte, nur ihr selbst gelten konnte, erhob sie sich zur Antwort langsam von der Bank, wie niedergedrückt durch eine schwere Bürde, und flüchtete sich, ohne aufzusehen, in das Gedränge des lärmenden Kreises, wo sie vor jeder weiteren Anmutung geborgen war.
Nie beiden Männer wechselten einen Blick des Einverständnisses, dann sagte Erhard traurig: »Meister, Ihr seid seelengut, Ihr seid der beste Mann von der Welt. Gott woll's Euch lohnen, wie Ihr an mir tut und wie Ihr's mit mir vorhabt. Aber es scheint, mir will's nicht blühen. Damit's nicht undankbar und leichtfertig aussieht, so bitt' ich mir Bedenkzeit bis morgen aus und will Eure große Gutheit jetzt nicht gleich von der Hand weisen. Ihr seid ja nicht schuld, wenn nichts draus wird. Aber, nicht wahr, Meister? wenn ich morgen beim Abschied nichts mehr davon red', dann lasset Ihr's auch ruhen, denn ich möcht' fortgehen wie ein Mann und nicht wie ein Kind. Da, in meinem Herzen, will ich Euch festgehalten und wollt' nur, daß ich's Euch einmal vergelten könnt'.«
Er schüttelte ihm kräftig die Hand und trat ans Fenster.
Der Löwenwirt ging zu seiner Frau zurück und sagte: »Sie will nicht. Ich kann sie eigentlich doch nicht recht begreifen. So eine Gelegenheit kommt nicht so leicht wieder. Will sie denn eine alte Jungfer werden?« Die Löwenwirtin blickte in ihrer ruhigen Art eine Weile vor sich hin und versetzte hierauf: »Sie läßt eben den Verstand walten und will nicht mit Schulden anfangen. Wiewohl, es wundert mich selber, ich hält' sie für weicher gehalten; denn ich bin gewiß, es bricht ihr schier das Herz.«
»Sprich du ihr zu,« sagte er.
»Nein, Mann, das tu' ich nicht,« erwiderte sie, »ich will die Verantwortung nicht auf mich laden; sie muß am besten wissen, was sie zu tun hat. Im Anfang ist's freilich lustig Hausen, aber wenn Unglück und Fehljahr' und Krankheiten kommen und jedes Jahr ein Kind, und man hat nichts vor sich gebracht und soll noch Schulden zahlen, dann hat man die Höll' auf Erden und hätt' sich lieber zehnmal bedacht, als daß man mit ebenen Füßen ins Eh'bett gesprungen wär'. Der ledige Stand ist auch nicht zu verachten. Ich laß der Justine nichts geschehen, wenn sie auch den Kopf fragt und nicht bloß das Herz. Aber ich muß es noch einmal sagen: es nimmt mich doch ein wenig wunder, und ich will nur sehen, ob's ihr bis morgen nicht anders kommt.«
Das eheliche Zwiegespräch wurde durch ein wildes Getöse unterbrochen. Nach dem Vorbild des Weltlaufes, der eine Tyrannei gerne durch eine Empörung ablöst, nahm auch die Zuchtherrschaft des Schanliklas ein Ende. Die Opfer seiner Rute, des langen Duldens müde, kehrten sich endlich einmütig gegen ihn, trieben ihn, was bei seinem hölzernen Gehwerke keine Kunst war, kläglich in die Enge, versetzten ihm Stöße und Püffe, und wie er einmal recht mit der Rute ausholen wollte, um seine rebellischen Untertanen zu Paaren zu treiben, stürzte er auf einmal, von irgend einem unbekannten Stoß an seinen unzuverlässigen Unterstock getroffen, mit einem hauserschütternden Gepolter der Länge nach zu Boden. Er hätte freilich bei diesem Scherze bösen Schaden nehmen können, aber ein kräftiger ländlicher Weihnachtsschwank hat sich niemals viel um solche Kleinigkeiten bekümmert. Der Heilige warf übrigens, hilflos am Boden liegend, schlimme Blicke aus den rußigen Augenrändern auf Alex, der allerdings im Augenblick seines Sturzes nahe genug bei ihm gewesen war. Die anderen richteten ihn vorsichtig auf, aber nur, um die wilde Jagd von neuem zu beginnen, Sie pufften ihn mit dem Geschrei: »Hinaus mit dem Schantiklas!« gegen die Türe, durch die er endlich unter allgemeinem Hellem Jubel brummend und um sich schlagend verschwand.
Nach diesem Spaß trat einige Ruhe ein. Die Hausfrau forderte Justinen auf, ihr die Kinder in der Kammer zu Bett bringen zu helfen, was bei der Aufgeregtheit derselben keine geringe Mühe kostete. Als sie in Schlaf gebracht waren, sagte die Frau: »Ich lass dir die Wahl, Justine, wer von uns heut nacht in die Kirche gehen soll, ich oder du; beide können wir nicht, denn ich mag die Kinder nicht ganz allein lassen.«
»Ich bin ja vorm Jahr drin gewesen,« erwiderte Justine.
»Ja, aber ich gönn's dir Heuer wieder,« versetzte die Löwen-Wirtin gutmütig. »Es ist so gar was Schönes drum. Das ganze Jahr sieht man in der Kirche nichts als leere weiße Wände und den Pfarrer auf der Kanzel, und die Sonne scheint durch die unbemalten Fenster herein, daß mir's oft, verzeih mir's Gott, ganz werktäglich vorkommt. Wenn man eben, wie ich, in einer katholischen Stadt aufgewachsen ist, so möcht' man in der Kirche manchmal auch etwas mehr haben. Drum Hab' ich nichts lieber, als so einen Gottesdienst um Mitternacht, wo die Kirche von Lichtern flimmert und der Altar mit Tannenzweigen verziert ist, daß er wie ein grüner Wald aussieht, und mitten drin das Christkindlein in der Krippe und seine Mutter und sein Pflegevater dabei und die Hirten auf den Knieen umher, und alles das mit kleinen Lampen von unten her beleuchtet, so daß die Farben, rot und blau und gold, wie im Feuer glänzen? und der Geistliche steht daneben und verliest die heilige Geschichte, und die Orgel tönt ganz anders als sonst; und die vielen Menschen sehen in dem Zwielicht' so feierlich aus. Da wacht einem die Seel' auf. Es ist nur schad', daß man so was bloß einmal im Jahre haben kann.«
»Man hört's wohl, Frau, daß Ihr ungern wegbliebet,« sagte Justine. »Ich gönn's Euch auch.«
»Du brauchst mir nicht viel gute Worte zu geben,« sagte die Frau.
»Ich bleib' recht gern daheim,« versicherte Justine. »Ich will gewiß die Kinder nicht versäumen.«
»Kannst dich ja in den alten Großvaterstuhl da setzen und ein wenig nicken, damit du gleich bei der Hand bist, wenn die jüngsten unruhig werden. Nur schlaf' mir nicht zu fest.« – Sie gab ihr noch einige Anweisungen, und Justine verließ die Kammer.
»Jetzt glaub' ich doch, daß sie Meister drüber wird,« sagte die Löwenwirtin zu ihrem Manne, der in die Kammer trat. »Sie will nicht einmal in die Nachtkirche, vermutlich fürchtet sie, der Erhard könnt' sich auf dem Weg an sie machen und ihr mit Bitten zusetzen. Ich seh's wohl, 's ist ihr angst, bis er fort ist. Mir ist's übrigens auch recht, dann gehen wir miteinander.«
»Ja,« sagte der Löwenwirt gähnend und streckte sich in dem Lehnstuhl aus, um bis Mitternacht noch ein wenig zu schlafen.
Das Gesinde hatte sich inzwischen in der Stube um einen Tisch gesetzt, wo es, von der Herrschaft mit einem mürben Kuchen und einem Kruge Wein versehen, die Zeit des mitternächtlichen Gottesdienstes, vor welchem noch besondere Dinge zu verrichten waren, heranwachen wollte. Der alte Philipp, der sich das Gesicht gewaschen und die verstauchten Glieder wieder etwas in Ordnung gebracht hatte, führte den Vorsitz in der Gesellschaft. Auch Erhard durfte bei dem Schmause nicht fehlen, und Justine wurde, als sie aus der Schlafkammer kam, gleichfalls herbeigerufen, obgleich es ihr sehr sauer zu werden schien, mit den Fröhlichen fröhlich zu sein.
Als der Kuchen verzehrt war, seufzte eine kleine wuselige Magd, die noch Appetit hatte: »Wenn nur der Schantiklas noch einmal kam' und brächt' seinen Sack, statt der Nüss', voll Kuchen mit. Soll ich nicht die Hand zur Tür' hinausstrecken?«
»Laß du den Fürwitz,« sagte der alte Philipp verweisend, »jetzt ist's nicht geheuer. Gib acht, es kommt einer, der dir eine Fledermaus in die Hand gibt, dann wird's dich nach keinem Kuchen mehr gelüsten.«
Die Magd stieß einen Schrei aus, wie wenn ihr das kleine Ungeheuer bereits zwischen den Fingern krabbelte, und wurde von den andern ausgelacht.
»Ja,« sagte eine von den Mägden, »um die Zeit darf man keinen Spaß machen. So hat einmal eine Mutter in der Christnacht ihr Kind zur Tür' hinausgeboten, daß ihm das Schreien vergehen soll, und hat dazu gesagt: ›Da, Schantiklas, hast den unartigen Buben!‹ Auf einmal ist etwas daher gesaust wie ein Sturmwind, hat ihr das Kind aus der Hand gerissen und fort mit ihm. Sie hat's nie mehr gesehen und ist vor Schreck und Jammer ihr Lebtag krank gewesen.«
»Das ist schrecklich!« riefen die andern, und die Mädchen rückten näher zusammen.
»Wie kommt's denn,« fragte einer der Knechte, »daß just in der heiligen Zeit das böse Wesen soviel Gewalt hat?«
»O das ist eine alte Sach',« rief eine der Mägde. »In der Zeit gehen alle Hexen und Geister um, mehr als sonst im ganzen Jahr.«
»Woher es kommt, weiß ich nicht,« versetzte der Senior der Knechte, das Wort nehmend, »aber richtig ist's, in den Zwölften geht alles böse und unholde Wesen um, und am ärgsten treiben sie's in der heutigen Nacht. Da reitet der wilde Jäger auf seinem Schimmel durch dick und dünn, und wenn er an einem vorbei kommt, so kann er ganz höflich den Kopf abnehmen, wie man den Hut abzieht und untern Arm steckt; aber er tut auch dem Wanderer, der sich zu einer so schlimmen Zeit hinausgewagt hat, allen möglichen Schabernack an, jagt plötzlich auf ihn los, wie wenn er ihn überreiten wollt', und ist im nämlichen Augenblick wieder weit weg; oder er reitet ihm beständig zur Seiten und treibt ihn aus dem Weg hinaus in Busch und Dorn, daß er sich nicht mehr zurecht finden kann, bis er ihn zuletzt gar in einen Sumpf verführt hat. Und hinter dem Jäger kommt oft das Muotisheer daher gefahren, mit Jagdgeschrei und Hundegebell in den Lüften, manchmal auch mit Musik, aus der man Kinderstimmen heraushört, aber es kommt immer ein Sturmwind hintendrein. Sie fahren ihre eigene Straße, von einem Kreuzweg zum andern, und wer der Jagd begegnet und sich nicht gleich mit dem Gesicht auf den Boden wirft, dem geht's schlimm; aber auch das hilft nicht immer, denn sie haben einmal einen, der sich hingelegt hat, im Darüberhinziehen mit der Axt in Arm gehauen.«
»Hu!« riefen die Mägde. »Ja,« sagte eine, »sie fahren sogar mitten durch Städte und Dörfer hindurch, immer den nämlichen Weg, und wer um die Zeit zum Fenster 'naus sieht, der darf sich in acht nehmen. Ich weiß eine, die sie für ihren Fürwitz angehaucht und blind gemacht haben.«
»Das treiben sie aber nur so lang, bis es zur Nachtkirch' läutet,« fuhr der Erzähler fort. »Mit dem ersten Anschlagen der Glocke verlieren sie ihre Gewalt, wie euch ja selber bewußt ist, daß der Mensch dann allerhand nutzbringende Verrichtungen in Haus und Feld vornehmen kann. Und nicht bloß das, sondern dann hat er Gewalt über sie und kann sie zu seinem Willen zwingen, wenn er Courage hat und das Ding versteht. Wisset ihr, woher der alte Kastenpfleger in der Stadt seinen Reichtum hat?«
»An einem Herrschaftskasten ist gut reich werden,« bemerkte Erhard lachend.
»Nein, nein,« rief ein anderer Knecht, »das weiß ich besser. Man sagt, er Hab' sich vom Teufel Farrensamen geben lassen in der Johannisnacht, und damit kann man alles ausrichten, was man will.«
»Oho,« sagte der alte Philipp mit dem ganzen Übergewicht verborgener Weisheit, »in der Johannisnacht braucht man den Teufel nicht dazu, da kann man den Farrensamen selber gewinnen, wenn man mit dem Ding umzugehen weiß. Aber es wissen's wenige. In der Christnacht aber kann man seiner auch habhaft werden, wenn man auf einem Kreuzweg wartet; dann kommt ein schwarzer Mann und bringt ihn; oder man kann sich auch gleich Geld dafür geben lassen; aber Farrensamen ist besser, denn der macht unsichtbar und verleiht Glück in allen Dingen.«
»Das war'!« rief Alex, etwas ungläubig, aber mit gierig lauernden Blicken, die jedoch dazwischen unruhig nach dem Fenster flogen, wo das Licht seltsame Schatten bildete.
»Kann's ja einer probieren,« versetzte der alte Philipp. »Heut ist die rechte Nacht dazu. Wie man's aber angreifen muß, kann ich nicht sagen, möcht's auch nicht. Nur so viel ist gewiß, daß man kein Wort dabei reden darf. Einmal hat sich einer bedankt und ist gleich dafür in tausend Stück' zerrissen wurden; denn der Teufel will keinen Dank, braucht auch keinen, weil er sich allemal seinen Lohn holt, wenn's Zeit ist.«
»Ja,« sagte eine Magd, »eine solche Bescherung hat noch niemals Segen gebracht. Ich weiß auch einen, dem man nachgesagt hat, daß er auf die Art zu seinem Reichtum kommen sei, aber in seiner Familie ist kein Glück und kein Stern gewesen, seine Kinder sind gestorben und verdorben, und er selber hat sich noch in seinen hohen Alter in der Scheuer gehenkt. Andere haben gesagt, der Teufel Hab' ihm den Hals umgedreht und Hab' ihn nachher hingehenkt.«
Ein Gemurmel des Entsetzens lief durch das Häuflein der Mägde, welche immer näher zusammenrückten und doch wieder dazwischen kicherten.
»Wenn aber die Geister in der Nachmitternacht keine Gewalt mehr über die Menschen haben,« Hub Alex an, welcher sichtbar mit einem Gedanken kämpfte, »so sollt' man ja doch – wie drück' ich mich aus? – um einen billigeren Preis etwas von ihnen gewinnen können.«
Der alte Philipp sah ihn mit langen, stechenden Blicken an. »Das ist auch der Fall,« erwiderte er endlich, »Der Boden beherbergt viel Geld und Gut, das man ohne Teufelswerk heben mag.«
»Und wie?« rief Alex mit weit aufgerissenen Augen.
»Da muß einer 'n Schatzgräber fragen, ich Hab' das Ding nicht studiert. Übrigens weiß ich ein Nest ganz in der Nähe, das man wahrscheinlich ohne Müh' ausnehmen könnt'.«
»Wie? was?« schrien alle zusammen, wo möglich noch schärfer aufmerkend als bisher.
»Wohl, wohl!« fuhr der alte Knecht mit geheimnisvollem Tone fort, indem er den Alex beobachtend im Auge behielt. »Zwei Jahr' sind's jetzt, da Hab' ich in der heutigen Nacht müssen in die Bachmühle gehen, weil schier kein Mehl mehr dagewesen ist; der Müller hat so lang warten lassen, – warum? weil's ihm an Wasser gefehlt hat. Versteht sich, bin ich erst nach dem Läuten fort. Nun, im Hinweg ist mir nichts begegnet, Hab' auch nicht rechts und nicht links gesehen. Wie ich aber zurückkomm' und komm' auf den Kreuzweg draußen im Forchenholz, was seh' ich? In der Höhlung am Steinkreuz, wo vor vielen hundert Jahren einmal ein Mord geschehen sein soll, ist ein blauer Schein gewesen, ganz schwach und tief unten, wie von einem Licht.«
»Und da habt Ihr den Schatz gesehen?« fragte Alex. Er wagte nicht, wie die anderen Knechte, Du zu ihm zu sagen.
»Ich Hab' gedacht: was mich nicht brennt, blas' ich nicht, und bin meiner Weg 'gangen,« erwiderte der Oberknecht. »Aber vorm Jahr, wieder um die gleiche Zeit, was geschieht? Ihr werdet's noch wissen, wie die scheckige Kuh gekalbt hat und wie sie's so hart