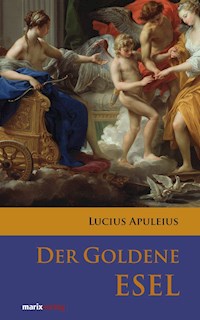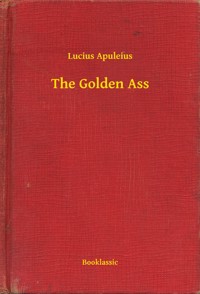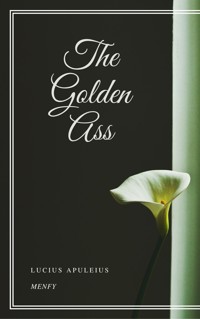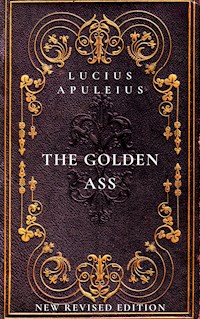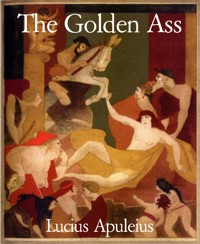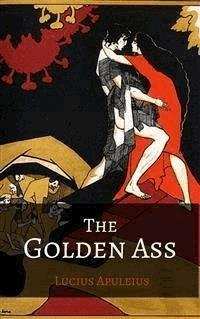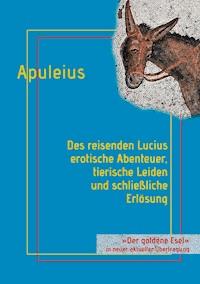
Des reisenden Lucius erotische Abenteuer, tierische Leiden und schließliche Erlösung E-Book
Lucius Apuleius.
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Der heute geläufige Titel des Romans »Der goldene Esel« (»Asinus aureus«) ist erst in der Spätantike (beim Theologen und Philosophen Augustinus) bezeugt. Ebenfalls ist der Roman unter dem Titel »Metamorphosen« (»Verwandlungen«) bekannt. Der Roman gehört - wie Petrons Satyricon - zu den bedeutendsten und gleichzeitig unterhaltsamsten Romanen der Weltliteratur. Verfasst wurde er um 160 n. Chr. von Apuleius aus Madauros (im heutigen Algerien). In der Erzählung wird Lucius, der aus dem griechischen Korinth stammende Romanheld, infolge seiner ausgeprägten Neugier, als er unbedingt hinter die Geheimnisse der Magie gelangen möchte, auf einer Reise durch den hexenbevölkerten Norden Griechenlands im Zusammenhang mit einem amourösen Abenteuer versehentlich in einen Esel verwandelt. Als Esel behält er seine menschliche Wahrnehmung und sein menschliches Denken bei, seine erwähnte Neugier und seine ausgeprägten erotischen Neigungen lassen ihn in ein Abenteuer nach dem anderen geraten … Von diesem Roman voller Spritzigkeit und Verve existiert bisher keine moderne deutsche Übersetzung, welche die Lebendigkeit und Zeitlosigkeit des fantastischen wie satiresken Panoramas dieses Werkes sowie die Buntheit und Flottheit der meisterlich lebendigen Sprachkunst seines Autors in die heutige Zeit angemessen und kongenial hineinholt. Dies wird mit der vorliegenden Übertragung endlich nachgeholt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lector, intende, laetaberis!
»Leser, merk auf, du wirst deinen Spaß haben«
Apuleius im ersten Kapitel an seine Leser
Inhalt
Der Roman
Kapitelübersicht
Erläuternde Anmerkungen des Übersetzers
Hinweis auf Illustrationen zu Apuleius’
Der Goldene Esel
Nachwort des Herausgebers
Zum Autor
Der Übersetzer
Ausführungen des Übersetzers zum Werk sind zu finden als »Untypische Betrachtungen des Übersetzers für Apuleius-Fans« im Internet unter http://www.argiletum.eu/scultetus.
Gestatten, mein Name ist Lucius
Also denn, lieber Leser: ich will dir in diesem Büchlein allerhand erotische und vergnügliche Geschichten zusammentragen und deine Ohren mit genüsslichem Summen und Brummen kitzeln, jedenfalls wenn du nichts dagegen hast, einen Blick auf meine Papyrusblätter zu werfen, die ich mit spitzigem Nil-Schilfrohr beschrieben habe. Da kannst du nämlich nur so darüber staunen, was mit manchen Leuten passiert ist und wie sie in andere Gestalten verwandelt und dann wieder zurückgebildet wurden.
Auf gehts, viel Spaß! – Und wer ist dieser Lucius1, der uns das alles erzählt? – Hör’s ganz kurz: Der Berg Hymettos in Attika, der Isthmos bei Ephyra2, der Berg Tainaros im Land der Spartaner, alles prächtige griechische Landschaften, in noch prächtigeren Büchern besungen, die sind die Heimat meiner Sippschaft. Dort hab’ ich mich erstmals als Kind in der griechischen Sprache bewährt. Dann hab’ ich in der Lateinerhauptstadt als Zugereister in reiner Knochenarbeit ohne jeden Pauker das Idiom der römischen Honoratioren angepackt und perfekt gelernt. Weil aber aller guten Dinge drei sind, hab’ ich mir – wie man hier sieht – von meinem Sklaven Flavus3 aus Germanien auch die teutonische Sprache beibringen lassen.
Thessalien4 übrigens ist die Wiege meiner Familie mütterlicherseits mit dem berühmten Historiker Plutarchos5 und danach dem Philosophen Sextus, seinem Neffen. Alles eine große Ehre für mich!
Auf Reisen durch Thessalien …
In diesem Thessalien reiste ich mal in Geschäften umher. Ich quälte mich durch zerklüftetes Bergland, morastige Täler und erdiges Gelände. Dabei hockte ich auf einem einheimischen Schimmel, und der Gaul war schon verdammt schlapp. Mir war das Gefühl aus Hintern und Beinen abhanden gekommen6. So sprang ich auf die Füße, wischte dem Pferd mit Laub den Schweiß ab, kraulte es hinter den Ohren, nahm ihm die Trense herunter, trottete gemächlich mit ihm weiter, bis es sich vom lästigen Grund seiner Schlappheit mit zischend schießendem Harnstrahl befreite. Und schon drehte es das Maul zur Seite und machte sich ans Grün der Wiesen heran, um sozusagen ein ambulantes Frühstück einzunehmen.
So holte ich zwei Kerle aus unserer Gruppe ein, die ein wenig Vorsprung gewonnen hatten, und gesellte mich als dritter dazu. Als ich da die Ohren aufsperrte, um was von ihrer Unterhaltung mitzukriegen, sagte der eine unter Gelächter: »Hör auf mit diesem Schwachsinn und diesen abartigen Lügen!« Ich hörte das. Auf Neuigkeiten bin ich ja immer ganz scharf und meldete mich:
»Lasst mich doch an eurem Gespräch teilnehmen! Neugierig bin ich nicht. Aber ich will alles wissen. Und dann quält uns der Höhenzug da, auf den wir uns raufschleppen müssen, nicht mehr so, wenn wir uns ein paar interessante witzige Sachen erzählen.«
Aber der Bursche, der vorhin schon losgeredet hatte, meinte: »Deine Lügengeschichte ist ganz gewiss wahr! So wahr, wie wenn jemand sagte, dass auf magisches Geraune hin wilde Flüsse rückwärts brausen, das Meer zu zähem Brei erstarrt, der Wind zur Flaute wird, die Sonne stehen bleibt, der Mond zerfließt, die Sterne herunterfallen, das Tageslicht ewiger Nacht weicht …«
Da ging ich entschlossen dazwischen und sagte: »He du, der du zuerst den Mund aufgemacht hast, sei nicht sauer! Erzähl nur den Rest!« Und zu dem andern Typ: »Deine Ohren sind weißgott verstopft und dein Hirn ist blockiert. Eine möglicherweise wahre Geschichte willst du nicht hören!? Natürlich – beim Herkules – das kapierst du nicht, dass das kein Schwachsinn ist, bloß weil du’s noch nicht gehört oder gesehen hast, oder weil es dein Fassungsvermögen übersteigt. Wenn du der Sache aber nur ein bisschen genauer nachgehst, dann wirst du sehen, dass man’s nicht nur problemlos erfahren, sonder auch leicht machen kann. So wäre ich z. B. gestern abend ums Haar verreckt: Runterwürgen wollte ich nämlich um die Wette mit meinen Saufkumpels einen allzu dicken Brocken Käsepolenta. Da blieb mir der zähe Brei im Halse stecken und verstopfte mir den Atemweg. Das bei mir!
Und doch hab’ ich in Athen vor der Bunten Halle7 mit diesen beiden Blinkern einen Zirkusakrobaten gesehen: Ein rasiermesserscharfes Reiterschwert – Spitze voran – schluckte er herunter. Und dann hat derselbe Kerl für ein paar Pfennige einen Jagdspieß, einen, womit sonst abgemurkst wird, mitten in seine Gedärme gerammt. Und jetzt pass auf: Hinter der Lanzenspitze, wo ihm der Schaft des Spießes aus dem nach hinten verrenkten Rachen ragt, da kraxelt ein wunderhübscher Bub drauf und vollführt in verdrehten Windungen einen Akrobatenakt, als hätte er keine Muskeln und Knochen. Total baff waren wir! Da hättest du denken können, es wäre der Stab8 des Medikus-Gottes Äskulap, den er da an seinen abgestutzten Ästen und Knoten fest in der Hand hält und um den sich geschmeidig die besagte Schlange herumschlingt!
Also los jetzt, Kumpel! Fang mit der Geschichte noch mal von vorn an! Ich allein will sie dir glauben, an Stelle von dem da, und in der erstbesten Kneipe spendiere ich dir dafür eine anständige Brotzeit. Mit der Belohnung kannst du sicher rechnen.«
Hexen trinken Blut
Und da sagt dieser Bursche: »Was du mir da versprichst, nehme ich herzlich gerne an, und ich will alles noch mal von vorn beginnen. Doch zuvor schwöre ich beim Sonnengott da oben, der alles sieht, dass ich dir die reine Wahrheit erzähle, nämlich, was ich am eigenen Leib erfahren habe; und wenn ihr nach Thessalien in die nächste Stadt kommt, dann vergeht euch jeder Zweifel. Dort reden nämlich alle Leute noch über das, was ich mitgemacht habe. Erst hört mal, aus welcher Ecke ich komme und wer ich bin: Aristomenes aus Aigion. Und hört, mit was für einem Job ich mich über Wasser halte: Mit Honig, Käse und dergleichen Kram für die Kneipen mache ich kreuz und quer durch Thessalien, Ätolien und Böotien.
Neulich schnappte ich also auf, dass in Hypata, der Perle von ganz Thessalien, frischer Käse von Supergeschmack für ein paar Kröten verhökert wird: Nix wie hin, um alles an mich zu raffen! Doch – wie das halt so kommt – ich war mit dem linken Fuß losgesaust, und die Hoffnung auf einen guten Gewinn ging flöten. Den ganzen Mist hatte mir nämlich tags zuvor Herr Wolf – so ein Großhändler – weggeschnappt. Von dem nutzlosen Gehetze war ich jetzt fix und fertig und tappte in der Abenddämmerung zur Badeanstalt. Und da sehe ich meinen alten Kumpel Sokrates. Im Dreck hockte er und war von einem löchrigen Umhang halbverhüllt; kaum wiederzuerkennen vor Blässe; zur Jammergestalt abgemagert; wie so ein Tippelbruder, der an Straßenkreuzungen betteln geht. Zu dem ging ich näher hin, ganz unsicher, obwohl er doch eigentlich ein alter Freund von mir war.
›Hallo, Sokrates!‹, sagte ich, ›was issen los? Wie siehst du denn aus? So eine Schande! Und zu Hause hat man sich deinetwegen schon die Augen herausgeheult und dich dann für tot erklären lassen. Deine Kinder haben vom Kreisgericht einen Vormund bekommen. Deine Frau hat sich nach der Leichenfeier vor lauter Trauer und Jammern fast umgebracht, die Augen halb blind geweint. Und jetzt machen ihr die Eltern Dampf, deine verlassne Hütte mit einem neuen Mann und der Freude einer Hochzeit zu erfüllen. Aber du – was für eine Affenschande! – lässt dich hier wie ein Gespenst sehen!‹
›Aristomenes,‹ sagte er, ›du hast keinen blassen Dunst von den glitschigen Pfaden des Glückes, von seinen unberechenbaren Wendungen und Drehungen.‹
Kaum hielt er die Klappe, da zerrte er seine Lumpen hoch über seine Rübe, die vor Scham längst knallrot angelaufen war. Dabei zeigte er dann seinen nackten Unterleib vom Nabel bis zu den Schamhaaren. Dieses Schmierentheater hielt ich nicht aus, packte ihn an, zerrte an ihm, damit er sich aufrappelte. Doch der Kerl, wie er da hockte, mit verhülltem Kopf, jammerte:
›Hör auf! Soll doch das Schicksal seinen Spaß haben an mir elendiglich Zerschmettertem!‹
Ich kriegte es dennoch hin, dass er mir folgte. Ich streifte ihm eines meiner neuen Gewänder über und bekleidete, besser: bedeckte ihn damit, und dann schnellstens ins Bad mit dem Stinktier! Salböl und Rubbeltuch lieferte ich ihm gratis; eine zentimeterdicke Schmutzkruste kratzte ich ihm herunter. Fertig damit schleppte ich ihn – der Kerl konnte sich ja vor Schwäche kaum aufrecht halten – selbst abgeschlafft, wie ich war, aus dem letzten Löchlein pfeifend, in einen Gasthof, steckte ihn in ein warmes Bett, stopfte ihn mit Essen voll, gab ihm einen guten Schluck zu trinken und erzählte ein paar abgestandene Witze. Schon plauderten und quakten wir vergnügt miteinander und fingen zaghaft an, uns gegenseitig aufzuziehen, da stieß er aus tiefster Brust einen gottserbärmlichen Seufzer aus und drosch sich mit der rechten Hand vor die Stirne:
›Ich Unglücksrabe! Nur weil ich wie ein Blödmann hinter so einem berühmten Gladiatorenkampf her war, bin ich in diesen Schlamassel geraten. Denn du weißt ja ganz gut, dass ich als Geschäftsmann nach Makedonien9 losgezogen war. Nach neun Monaten machte ich mich mit platzend vollem Geldbeutel auf den Heimweg. Bevor ich Larissa10 erreichte, wollte ich durch eine Schlucht abkürzen, um das Spektakel anzusehen. Da fallen in einem weglosen, zerklüfteten Talkessel die Räuber, Riesenkerls, über mich her und knöpfen mir alle Moneten ab. Ich kann immerhin abhauen und komme fix und fertig zu einer Kneipwirtin reingehechelt. Die heißt Meroë11, ist ältlich, eine recht nette Weibsperson. Da bleibe ich und berichte ihr den Grund meiner Weltumseglung, vom Pech auf der Heimreise, und wie man mich völlig ausgenommen hat.
Da fängt sie an, mich verdammt nett zu behandeln. Fressalien kriege ich umsonst. Doch dann kommt die Kehrseite der Medaille: Von mächtiger Geilheit überwältigt zerrt sie mich in ihr Schlafzimmer. Und ich Depp! Sobald ich’s mit ihr getrieben habe, ziehe ich mir dafür eine jahrelange, gottverfluchte Hörigkeit zu. Selbst die Lumpen, die mir die gutmütigen Räuber gelassen hatten, hab’ ich ihr vermacht. Ich schuftete dann als Ladearbeiter für sie – damals hatte ich noch Mumm –, bis mich diese liebe Frau und mein verfluchtes Missgeschick in die Jammergestalt verwandelt haben, die du grad’ gesehen hast.‹
›Allmächtiger Himmel,‹ sprach ich, ›du hast es weißgott verdient, in der Scheiße zu hocken, falls es nicht noch was Schlimmeres gibt. Deine saugeile Geilheit und eine verhurte Hure hast du Heim und Herd vorgezogen!‹
Aber der hielt vor Entsetzen erstarrt den Zeigefinger vor’s Maul: ›Ruhe, Ruuhee!‹ – so brüllte er und blickte sich um, ob er ungestört reden könnte. Dann flüsternd: ›Vorsicht vor dem Hexenweib! Sonst hast du mit deinem losen Mundwerk gleich einen Schaden weg.‹
›He,‹ sagte ich, ›ist die so mächtig, diese Kneipenkönigin?‹
›Eine Hexe ist sie,‹ sagte er. ›Mit ihrer satanischen Macht holt sie den Himmel herunter, stemmt die Erde hoch. Quellen werden steinhart, Berge flüssig. Tote zerrt sie aus den Gefilden der Unterwelt, Götter verbannt sie dort hinein. Sterne löscht sie aus und bringt dafür Licht in die Hölle da unten.‹
›Bitte, bitte,‹ sagte ich, ›weg das ganze Theater mit all seinem Brimborium! Drück dich gefälligst normal aus!‹
›Willst du,‹ sagte er, ›das eine oder andere, ja, jede Menge von dem Zeug hören, das sie angerichtet hat? Denn dass in sie nicht nur die Mitbürger verliebt sind, sondern ganz Afrika und Indien, ja sogar die Leute, die auf der Rückseite der Erde leben, das sind doch nur läppische Kleinigkeiten ihrer Kunst. Was aber eine Menge Leute miterleben konnten, wie sie’s gerad’ machte, das hör an:
So ein Liebhaber von ihr hatte eine andere vergewaltigt. Da hat sie ihn mit einem Wort in einen Biber verwandelt. Wenn nämlich dieses Vieh Angst hat, man könnte es fangen, um wie üblich aus seinen Hoden12 Manneskraft zu saugen, beißt es sich diese halt selbst ab, lässt sie liegen und rennt ums Leben. Und so sollte es dem gehen, weil er’s mit einer andren getrieben hatte.
In der Nachbarschaft wohnte ein Kneipwirt und machte ihr Konkurrenz. Den verwandelte sie in einen Frosch. Der Greis schwimmt jetzt im eigenen Weinfass herum und begrüßt die Stammmgäste – in die Hefe geduckt – mit unterwürfigem Gequake.
Einen Mann vom Marktplatz, der gegen sie eine Gerichtsrede gehalten hatte, den hat sie in einen Widder verwandelt. Und so führt er eben als Schafsbock weiter seine Prozesse.
Und die Frau eines ihrer Geliebten hatte sich über diese Hexe das Maul zerrissen. Da hat sie die – sie war gerade in anderen Umständen – zu ewiger Schwangerschaft verdammt. Alle rechnen’s nach: Die Ärmste wird jetzt schon durch die Last von acht Jahren ausgeleiert, als wollte sie einen Elefanten zur Welt bringen.
Weil sowas überall passierte und schon viele zu Schaden gekommen waren, köchelte allmählich die Volksseele so vor sich hin, und man beschloss, das Weib am nächsten Tag vermittels ausgiebiger Steinigung totzuschmeißen und so ihrer Strafe zuzuführen. Doch die kam diesem Plan mit der Macht ihrer Zauberkünste zuvor, und sie machte es wie die sagenhafte Medea: Die bekam ja von Herrn Kreon nur einen einzigen Tag Aufschub, und da verbrannte diese Hexe sein ganzes Haus samt Tochter und seiner Alten mit ihrem glühenden Stirnreif. Und so ähnlich machte es die Meroë jetzt, nur mit einem Leichenzauber an einer Gruft. Im Suff hat sie’s mir erzählt, wie sie’s gemacht hatte: Durch stumme Geistermacht bannte sie alle Leute in ihre Häuser. Volle zwei Tage lang konnte kein Riegel abgerissen, keine Tür aus den Angeln gehoben und nicht mal eine Wand aufgebrochen werden. Endlich einigte man sich und schrie unisono im Chor und schwor die heiligsten Eide, man werde ihr nichts antun, und wenn’s jemand anderes vorhabe, werde man ihr wirkungsvoll zu helfen wissen.
So hat sie gnädig die ganze Stadt wieder laufen lassen. Den Anstifter dieser Revolution verschleppte sie aber in zappendusterer Nacht samt ganzem Haus, also mit Mauern, Fundament und Estrich, zugesperrt, wie’s war, in eine andere Stadt, die hoch auf einem Berg liegt und daher nach Wasser lechzt. Und weil das Häusergewimmel keinen Platz für den neuen Gast bot, schleuderte sie die Hütte vor’s Stadttor und verduftete.‹
›Interessantes und auch grässliches Zeug‹ – sprach ich, ›erzählst du mir da, mein Sokrates. Schließlich hast du mir keinen kleinen Schreck eingejagt: Ich bin geschockt! Das ist gewissermaßen kein Mückenstich, nein, einer mit der Lanze! Was ist, wenn die alte Hexe mittels dienstbarer Geister jetzt gleich von unserer Unterhaltung erfährt? Daher gehn wir besser etwas früher zu Bett und machen uns dann im Morgengrauen auf und davon, so weit die Füße tragen.‹
Noch gab ich gutgemeinte Ratschläge, da lag der gute Sokrates schon flach – vom ungewohnten Alkohol und der ewigen Plackerei erschöpft – und sägte und orgelte. Ich mache die Tür zu, schiebe den Riegel vor, stelle das Bettchen hinter die Türangeln und verziehe mich drauf. Zuerst bleibe ich vor Schiss noch eine Weile wach. Dann – so um Mitternacht – fange ich an zu rüsseln. Doch kaum penne ich, da werden die Türflügel mit Mordsgewalt nach innen gedrückt, mit mehr Wucht, als wären’s nur Räuber. Mit zerbrochenen, ja, herausgefetzten Angeln stürzen sie um. Mein liebes olles Bettchen, für mich Lulatsch ohnehin zu kurz – außerdem endete ein Bein in einem Stumpf – überschlägt sich durch den brutalen Anprall. Ich kugle herum, fliege heraus und klatsche auf den Boden. Das umgedrehte Bett verschüttet mich mit Haut und Haar.
Da reagierte ich total anders, als man es erwartet hätte: So wie man nämlich immer mal wieder vor Freude heult, konnte ich mir jetzt den Lachanfall nicht verkneifen, weil aus mir, dem Aristomenes, mit dem Bett auf dem Buckel eine Schildkröte geworden war.
Im Mist liege ich also und schiele raus, was denn hier los ist – verdeckt und versteckt durch den tollen Schutz und Schirm des Bettes! Da sehe ich zwei ziemlich verhutzelte Weiber stehen. Die eine hat eine brennende Lampe mitgebracht, einen Schwamm und ein nacktes Schwert die andere. In dieser Aufmachung umzingelten sie den lieben Sokrates, der gemütlich vor sich hin schnärchelte. Die mit dem Schwert reißt die zahnlose Klappe auf:
›Da ist er ja, Schwesterchen Panthia13, mein göttlicher Liebhaber und Bettgeselle. Tag und Nacht hat er in meinen besten Jahren an mir herumgefummelt, der Kerl, und jetzt?! Jetzt hat er von meiner Schönheit und Liebe die Nase voll, reißt blöde Witze über mich und will auch noch dazu abhauen. Und ich?! Wie anno dazumal die Kalypso, die der trickreiche Odysseus hat hocken lassen, so werde ich in alle Ewigkeit vereinsamt heulen wie ein Schlosshund.‹ Und dann streckte sie den rechten Arm nach mir hin, zeigte mich ihrer Schwester Panthia und sabbelte:
›Aber der Kerl da, das ist sein prima Anstifter Aristomenes. Der hat diesen Fluchtplan ausgeheckt. Nun aber hat er sein eigenes Abkratzen schon vor Augen; platt auf dem Boden ausgestreckt liegt er unter dem Bett und beglotzt sich das alles. Und der Schuft meint, ich lasse ihn ungeschoren davonkommen. Na warte, Bürschlein! Demnächst, nein bald, nein jetzt gleich wirst du diese Äußerungen aus deinem Schandmaul und deine Neugier bereuen.‹
Wie ich das begriff, schoss mir der Angstschweiß aus sämtlichen Poren; ich schlotterte bis in die Gedärme, dergestalt, dass das Bettchen durch meinen Schüttelfrost ins Taumeln geriet und auf meinem Buckel zuckend tanzte. Aber die gutmütige Panthia meinte:
›Lass den Quatsch, Schwesterherz! Erst machen wir uns über den anderen her. Wir zerfetzen ihn nach Bacchantinnen-Art, oder wenigstens säbeln wir ihm die männlichen Anhängsel herunter.‹
Darauf entgegnet Meroë – so hieß das Weib tatsächlich, und der Name passte zum Gerede des Sokrates wie die Faust aufs Auge:
›Eija! Dann soll der halt überleben, um die Leiche dieses elenden Wichtes mit einem bisschen Erde zuzumachen.‹
Dann biegt sie Sokrates’ Kopf zurück und rammt ihm auf der linken Seite der Kehle das Schwert bis an den Griff in den Leib – rein und wieder raus! Das Blut schießt wild hervor. Da hält sie einen kleinen Schlauch dran und fängt alles so genau auf, dass nirgendwo ein Blutstropfen zu sehen ist. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen! Dann lässt die liebe Meroë – wie eine echte Opferpriesterin bei einem Schaf – den rechten Arm durch die Wunde glitschen, wühlt in den Eingeweiden herum und zerrt schließlich das zuckende Herz meines armen Kumpels heraus.
Der aber ließ da, wo sie ihn aufgeschlitzt hatte, so ein Geräusch, hm, ein Zischen herausfahren, und dann – blubb-blubb-blubb – verröchelte er seinen Geist. Und da, wo der Spalt der Wunde breit klaffte, zwängte Panthia den Schwamm hinein und murmelte folgenden Hexenspruch:
›Hallo Schwamm – im Meer geboren – geh in einem Fluss verloren!‹
Kaum hatte sie das von sich gegeben, da zerrten beide im Gehen das Bett weg und hockten sich breitbeinig auf meine Visage und entleeren ihre Blase drüber, bis sie mich schließlich endlich in der Jauchebrühe ihres Urins eingeweicht hatten.
Schon waren sie verduftet, und da sprangen die Türflügel wieder an die alte Stelle. Die Angeln fanden ihre Löcher wieder, an die Pfosten sausten die Querhölzer zurück, die Riegel schnappten in die Schlösser.
Ich aber lag noch immer in Dreck und Pfütze, halbtot, nackt, eiskalt und mit Pinkelbrühe begossen, wie frisch aus dem Mutterleib gekrochen, aus den letzten Löchlein pfeifend; ich hatte mich schon selbst überlebt. Natürlich war ich Kandidat Nr. 1 für die nächste Kreuzigung und sagte zu mir:
›Was wird morgen passieren, wenn sie den massakrierten Sokrates finden? Wer wird schon für wahr halten, was ich vorbringe?‹
›Du hättest wenigstens um Hilfe schreien können, wenn du, so ein starker Mann, sich nicht gegen eine Frau wehren konntest. Vor deinen Augen wird jemand abgestochen, und du hältst das Maul! Warum hat dich das Weib nicht auf ähnlich satanische Weise umgebracht? Warum hat sie trotz ihrer grässlichen Blutgier – nur damit man sie später verpetzen kann – den Zeugen laufen lassen? Also, wenn du da schon dem Tod entronnen bist, marsch! jetzt schnellstens zu ihm zurück mit dir!‹
Das alles wiederholte ich mir ununterbrochen. Die Nacht ging, der Tag kam. Da schien es mir das Schlauste zu sein, mich noch vorm Morgengrauen in aller Heimlichkeit zu verziehen und mich mit – zugegeben – schlotternden Knien auf den Weg zu machen. Ich schnappte also meinen Rucksack, steckte den Schlüssel unter den Riegel und wollte ihn zurückdrehen. Aber diese verdammt zuverlässige Tür, die in der Nacht ganz von selbst aufgesprungen war, ließ sich jetzt nur mit aller Kraft öffnen, und ich arbeitete am Schlüssel wie ein Berserker. Endlich auf dem Korridor schrie ich:
›He, Pförtner, wo steckst du? Reiß mir die Herbergstür auf, ich will vor Tagesanbruch fort.‹
Der Bursche pennte hinter dem Eingang auf dem Boden und grunzte im Halbschlaf:
›Was?! Weißt du denn nicht, dass Räuber auf den Straßen ihr Unwesen treiben, wenn du dich mitten in der Nacht auf den Weg machst? Und falls du eine Schandtat auf dem Kerbholz hast und deshalb dein Leben riskierst, kannst du Gift drauf nehmen, dass unsereiner nicht einen derartigen Hohlkopp hat, dass wir für dich abkratzen wollen, nur weil wir dich laufen lassen.‹
›Es wird ja schon hell, und außerdem: Was können Ganoven schon so einem bettelarmen Reisenden wie mir wegnehmen? Du Blödman, weißt du denn nicht, dass auch zehn Bademeister einen Nackedei nicht weiter ausziehen können?‹
Der faule Sack aber wälzte sich auf die andere Seite und blökte:
›Und woher soll ich wissen, ob du nicht deinen Kumpel, mit dem du gestern hier hereingeschneit bist, den Hals abgeschnitten hast und jetzt dein Heil in der Flucht suchst?‹
In dieser Sekunde – ich weiß es noch ganz genau – spaltete sich vor mir gewissermaßen die Erde. Ich sah bis zum Grund der Hölle und dort den Hund Kerberos, der voller Gier nach mir schnappte. Jetzt begriff ich, dass die gutmütige Meroë meine Kehle nicht aus Erbarmen verschont hatte. Nein, in ihrer Heimtücke hatte sie mich tatsächlich für die Kreuzigung aufgespart.
Also trollte ich mich zurück ins Schlafzimmer und überlegte, wie ich mich möglichst schmerzlos selbst umbringen könnte. Aber Frau Fortuna14 stellte mir keinerlei todbringende Waffen zur Verfügung, nur das Bettchen stand in der Gegend herum. Das redete ich wie folgt an:
›Ach, du Bettlein, herzallerliebstes Bettlein, das du den ganzen Schlamassel miterlebt und miterlitten hast, du einziger Augenzeuge der nächtlichen Ereignisse, du, den ich vor Gericht als einzigen Zeugen meiner Unschuld aufrufen könnte, spendiere du mir die segensreiche Waffe, damit ich ins Reich der Toten fliehen kann.‹
Sprachs und machte mich über den Strick her, mit dem es notdürftig zusammengeschnürt war, löste den Knoten, warf das Seil über einen Balken, der oberhalb des Festers aus der Wand ragte, zog das Ende zu einer Henkersschlinge zusammen, kletterte aufs Bett und streckte hoch oben stehend den Kopf hindurch. Dann stieß ich mit einem Fuß die Stütze weg, die mich hielt, damit durch die Kraft des Gewichtes meine Gurgel zugeschnürt würde. Doch da riss das vergammelte Seil mitten durch, und ich fiel von oben herunter auf meinen Sokrates. Der lag nämlich ganz in der Nähe. Ich klatschte also auf ihn und rollte mit ihm zusammen auf den Boden.
Da! Im selben Moment platzt der Türsklave rein und brüllt wie ein Stier: ›Wo bist du, Kerl!? In stockfinsterer Nacht hattest du’s verflixt eilig, und jetzt sägst du wohl wieder, in deine Decken eingerollt.‹
In diesem Augenblick – entweder weil ich auf ihn gefallen war oder wegen dieses abscheulichen Gezeters – wurde Sokrates aus dem Schlaf gerissen, sprang noch vor mir in die Höhe und tobte: ›Mit Fug und Recht verfluchen doch sämtliche Gäste diese Herbergsfritzen. Da dringt dieser neugierige Bursche hier – mir nichts dir nichts – ein, vermutlich um was zu klauen, und zerrt mich ohnehin klapprigen Mann aus tiefstem Schlaf.‹
Ich taumelte, total hin vor Freude, nun auch empor und schrie: ›Oh edelster Herr Pförtner! Da ist er, mein Gefährte und Bruder! Und du hast nächtens im Vollrausch abgesondert, ich hätte ihn umgebracht, du Depp!‹
Dann küsste ich den Sokrates gründlich ab und umarmte ihn. Aber der schauderte angeekelt zurück vor dem widerlichen Duft der Jauche, mit der mich ja die Hexen gedüngt hatten, und wütete: ›Hau ab, du! Du pestest wie der letzte Donnerbalken.‹
Anschließend fragte er freundlich nach der Ursache des Geruches. In meiner Not erfand ich ganz schnell einen ordinären Witz und lenkte ihn rasch ab auf ein anderes Thema. Dann legte ich ihm die Pfote auf die Schulter und sagte: ›Auf, Kumpel, bade die irdsche Brust im Morgenrot!‹
Ich nahm den Rucksack auf den Buckel, zahlte dem Wirt die ausgemachten Penunzen, und schon gewannen wir die Straße.
Ein beträchtliches Stück hatten wir schon hinter uns. Der Sonnenaufgang überstrahlte alles. Ich aber stierte mit nicht enden wollender Neugier auf die Kehle meines Kumpels, genau dahin, wo ich den Säbel hatte runtersausen sehen, und sagte zu mir selbst:
›Du Blödmann! Besoffen, wie du warst, hast du das Letzte geträumt. Der Sokrates da, der ist putzmunter und gesund. Wo ist die Wunde? Wo steckt der Schwamm? Wo ist schließlich die Narbe, die breite, die frische?‹ Und zu ihm:
›Vollkommem zu Recht verkünden die lieben Ärzte, diese treuen Seelen, dass vollgefressene Leute im Rausch grausige Alpträume haben. Und ich hab’ ja gestern hemmungslos Wein reingebechert. Daher hat mir die Nacht grässliche und wüste Bilder serviert. Noch jetzt kommt es mir vor, als wäre ich mit Menschenblut bespritzt.‹
Sokrates grinste breit: ›Nein, nicht mit Menschenblut, mit Pinkelbrühe hat man dich vollgeschüttet. Allerdings kam es auch mir im Traum so vor, als würde ich abgemurktst. Denn mein Hals da tat weh, und ich glaubte, das Herz riss mir jemand aus dem Leibe. Noch jetzt keuche ich vor Atemnot, die Knie schlottern, und ich taumle so dahin. Also brauche ich dringend was Essbares, um wieder zu Kräften zu kommen.‹
›Kein Problem,‹ sprach ich, ›das Frühstück steht für dich bereit.‹
Sagte es und zerrte den Rucksack von der Schulter, reichte ihm hektisch Käse und Brot und meinte: ›Da unter der Platane können wir uns hinhocken.‹
So machten wir’s. Und ich holte mir auch selbst was heraus. Dann betrachtete ich ihn, wie er gierig schlang, dabei immer mehr in sich zusammenfiel und gelb anlief. Schließlich war er käseweiß, wie tot. Da dachte ich wieder an die nächtlichen Satansweiber, und vor Entsetzen blieb mir ein Bissen Brot – gerade erst in den Schlund befördert – mitten im Halse stecken, obgleich er winzig war. Nicht nach oben, nicht nach unten wollte er marschieren. Außerdem belebten zu meinem Schrecken erste Wanderer die Straße: Wer nämlich könnte glauben, wenn der eine Kumpel umgebracht ist, dass der Lebende nicht der Mörder ist!?
Sokrates hatte mittlerweile jede Menge in sich hineingeschoben, und fürchterlicher Durst begann ihn zu foltern, denn von meinem Käse hatte er gierig den größten Teil verschlungen.
Nicht weit weg, dicht neben der Platane, glitt sanft und träge, fast wie ein Teich aussehend, ein wie Silber oder Glas blinkender Fluss vorüber. ›Da, sagte ich, da ist helles Quellwasser! Trink dir den Wanst voll!‹
Der steht auf, sucht sich eine flache Uferstelle aus, geht in die Knie und beugt sich lechzend nach dem Trank hinab. Aber kaum berühren die vorgewölbten Lippen den Wasserspiegel, da klafft an seinem Hals die Wunde weit auf und zeigt einen tiefen Spalt. Der Schwamm stürzt heraus; ein bisschen Blut tröpfelt hinterher. Schon platscht die Leiche ins Wasser. Ich aber kriege sie an einem Fuß zu fassen und zerre sie mit letzter Mühe ans Ufer. Hier heul’ ich mir eins, und in aller Hast verscharre ich ihn dann im Ufersand, gleich neben dem Fluss.
Dann machte ich mich vor Todesangst schlotternd durch wegloses Gelände aus dem Staub, ganz so, als hätte ich ihn ermordet. Heim und Herd ließ ich links liegen, stürzte mich freiwillig ins Exil und lebe jetzt hier in Ätolien. Da hab’ ich mir eine neue Frau genommen …«
…auf nach Larissa zum alten Milo
Ja, das erzählte mir Aristomenes. Aber sein Reisegefährte von ganz vorhin, dieser Mann voller verstockter Ungläubigkeit, spuckte auf diesen Bericht: »Das war eine selten blöde Geschichte,« sagte er, »nichts ist dämlicher als so eine Flunkerei.« Und zu mir: »Hast du etwa – nach deinem Aussehen bist du ja ein besserer Herr – für so ein Gefasel was übrig?!«
»Ja, ich halte grundsätzlich nichts für unmöglich,« sprach ich. »Die Macht des Schicksals bestimmt, was bei uns Menschen vor sich geht. Mir und dir und allen Leuten stößt viel Wunderbares und Unerhörtes zu. Wenn man aber keine Ahnung davon hat, mag man’s nicht glauben. Ich jedenfalls traue diesem Burschen da, jawohl, und bin ihm irrsinnig dankbar dafür, dass er uns mit so einer packenden Sache abgelenkt hat. Hab’ ich doch so diesen verflixt rauen und endlosen Weg mühelos und ohne herumzufluchen überstanden. Ich denke, selbst mein Gaul hat seinen Spaß dabei gehabt. Ich hab’ ihm nämlich nicht besonders zugesetzt, hab’ ihn nicht zuschanden geritten, sondern bin ganz Ohr nebenher gelaufen, und das bis hierher zum Stadttor.«
Das aber war das Ende zugleich des Weges und unserer Unterhaltung, denn die Reisekameraden bogen beide nach links ab zu einer kleinen Bauernhütte. Ich dagegen hinein in die Stadt und in die erste Kneipe, die mir ins Blickfeld rückte. So eine alte Wirtin zapfte ich gleich an:
»Ist das hier die Stadt Hypata?«
Sie nickte.
»Kennst du den Milo, so ein hohes Tier von hier?«
Sie grinste über sämtliche Backen: »Klar ist der ein hohes Tier. Der wohnt nämlich ganz außerhalb der Stadt.«
»Oh, Scherz beiseite, beste Madame, sag mir lieber, was für ein Typ er ist und wo genau er haust!«
»Siehst du da hinten die Fenster? Die da, die vor der Stadt in die Gegend schauen! Und auf der anderen Seite die Tür, die nach der nächsten Gasse geht? Da drin haust dein Milo, ein Geldsack mit Moneten wie Heu, aber verdammt verhasst wegen seines unmenschlichen Geizes. Er verleiht Gold und Silber gegen Wucherzinsen, ja, Tag und Nacht! Dabei verschanzt er sich immer in seiner kleinen Hütte und hockt auf seinen Geldkisten herum. Seine Frau hat er als Leidensgefährtin dabei. Sonst verköstigt er nur noch eine einzige kleene Dienerin namens Photis15 und spaziert grundsätzlich wie ein Bettler durch die Gegend.«
Mir platzte das Lachen heraus:
»Oh, wie gut und fürsorglich hat sich mein Kumpel Demeas um mich gekümmert! Schickt der mich doch tatsächlich auf meiner Reise zu einem Kerl, in dessen gastlichem Hause man weißgott keine Angst vor lästigen Küchengerüchen haben muss.«
Sprachs, lief ein Stückchen weiter, kam zu einem Haustor, brüllte he und hallo und bearbeitete das Holz mit Fäusten. Endlich trat ein ganz junges Weibchen heraus und sagte:
»He du da! Was verdrischst du so die Tür!? In welcher Form willst du bei uns Geld leihen? Oder bist du zu blöd zu wissen, dass wir uns nur mit Gold und Silber abgeben?«
»Oh,« sprach ich, »wie wärs mit einem bisschen mehr Höflichkeit? Es wäre nett, wenn du mir sagen könntest, ob ich deinen Chef zu Hause vorfinden kann.«
»Klar, gewiss,« meinte sie, »aber was soll die Frage?«
»Ich habe einen Brief für ihn, von Demeas aus Korinth.«
»Gut! Während ich dich anmelde, kannst du hier draußen auf mich warten.« Sie schloss die Klappe und die Haustür zugleich und machte sich nach drinnen. Ein Weilchen später kreuzte sie wieder auf, ließ mich hinein und meinte spitz: »Er lässt dich bitten!«
Ich ging also zu ihm hinein: Er lag auf einer Art Zwergsofa und wollte gerade essen. So fand ich ihn vor. Zu seinen Füßen hockte seine Frau. Der Tisch war leer. Doch Milo zeigte drauf und sprach zu mir: »Bitte sehr, bediene dich!«
»O.K.,« antwortete ich und überreichte ihm sofort den Brief des Demeas. Er überlas ihn flüchtig und sagte:
»Ich liebe meinen Demeas dafür, dass er mir dich, einen so wertvollen Gast, geschickt hat.«
Dann herrschte er seine Frau an: »Verschwinde!« Sie ging und ich sollte an ihrer Stelle Platz nehmen. Da ich wohlerzogener Mensch noch zögerte, packte er mich an der Joppe und zog mich zu sich runter: »Hock dich endlich hin! Aus ständiger Angst vor Räubern können wir uns nämlich keine Stühle anschaffen und auch sonst keine bessere Einrichtung.« Ich setzte mich, und er sagte:
»Du hast einen prachtvoll anzusehenden Körper, und schüchtern bist du wie eine Jungfrau. Da vermute ich wohl richtig, dass du aus einem guten Hause stammst, und das meldet mir ja auch mein Dameas in dem Brief da. Stör dich also bitte nicht an der Enge unserer Hütte. Das angrenzende Schlafzimmer – guck da! – wird dir eine anständige Bleibe bieten. Sieh also zu, dass dir’s hier bei uns gut gefällt, denn du ehrst mein Haus, wenn du bei uns bleibst. Wenn du mit einem bescheidenen Dach über dem Kopf zufrieden bist, gleichst du dem sagenhaften Theseus, der die armselige Einkehr bei der alten Hekale16 nicht für unter seiner Würde hielt.«
Und dann rief er die Kleine, seine Magd: »Photis, nimm das Säckel unseres Gastes und bring es ordentlich in dem Zimmer da unter. Hol dann rasch aus der Vorratskammer Öl zum Einreiben, Handtücher zum Abrubbeln und was man sonst noch so braucht. Bring ihn dann in die nächste Badeanstalt. Der hat eine lange Reise hinter sich und ist gewiss müde.«
Das hörte ich mir an und dachte an Milos geizige Art. Weil ich mich bei ihm lieb Kind machen wollte, sagte ich also: »Von all dem Kram brauch’ ich nichts. Das hab’ ich auf jeder Reise dabei, und nach der Badeanstalt kann ich mich selbst durchfragen. Viel wichtiger ist mir mein Gaul, der mich so brav hierher getragen hat. Photis, könnstest du ihm Heu und Gerste kaufen? Da hast du ein paar Talerchen …«
Amtliche Hilfe zum Verhungern
Als das abgemacht und meine Sachen im Zimmer verstaut waren, lief ich los zum Bad. Um aber zunächst was zum Vespern für uns zu beschaffen, ging ich auf den Lebensmittelmarkt. Dort sah ich leckere Fische ausgestellt und fragte nach dem Preis. Der Händler sagte mir: »Hundert Groschen.«
»Das ist ja Wahnsinn,« antwortete ich und bekam’s für zwanzig Groschen. Grad’ wollte ich fortgehen, da kreuzte Pythias auf, mein Mitschüler aus Athen. Seit ewigen Zeiten hatte er mich nicht mehr gesehen, erkannte mich aber sofort, stürzte sich auf mich, drückte mich ab, küsste mich freundschaftlich und sprach:
»Gottchen, das ist aber lange her, dass wir dich zuletzt gesehen haben, ja bei Gott, seit wir unseren Lehrer Clythias verlassen haben. Aber warum hast du dich auf diese Reise begeben?«
»Gedulde dich bis morgen,« sagte ich, »aber was ist denn das? Herzlichen Glückwunsch zur Wahl! Denn dich umgibt – wie ich sehe – das ganze Gefolge eines Beamten und du steckst in einer dazu passenden Uniform.«
»Wir kümmern uns,« sagte er, »um die Lebensmittelversorgung der Stadt und sind hier die Polizei. Wenn du also was kaufen willst, stehen wir dir gerne zur Seite.«
Ich schüttelte den Kopf, denn für meinen knurrenden Magen stand ja schon die prächtige Fischportion bereit. Aber Pythias beäugte den Korb und schüttelte die Fische auf, um sie besser begutachten zu können: »Ts-ts, was hast du denn für den Mist da bezahlt?« »Kaum,« sprach ich, »haben wir den Fischer dazu gebracht, dafür 20 Groschen zu akzeptieren.«
Pythias hörte das, grabschte nach meiner Hand, zerrte mich auf den Markt zurück und grollte: »Und von wem von diesen Kerlen da hast du den Dreck erstanden?« Ich zeigte auf den Opa. In einer Ecke hockte er. Den brüllte Pythias sofort mit der typischen Kontrollbeamten-Stimme an: »Ja, verflucht noch mal! Jetzt lasst ihr nicht mal unsere Gäste und Freunde in Ruhe! So ein Wucherpreis für ein paar dreckige Fische! Hypata, die blühende Hauptstadt Thessaliens, macht ihr zur Wüstenei durch eure unverschämte Lebensmittelverteuerung. Aber nicht ungestraft! Sofort werde ich dir beibringen, wie übel es den Gaunern und Ganoven unter meiner Herrschaft ergeht.«
Er schüttete die Fische auf den Gehsteig und ließ sie von einem der Hilfspolizisten völlig zerstampfen und zertrampeln und zermalmen. Durch die Strenge seiner Maßnahmen war er dann ganz befriedigt, mein guter Pythias, und riet mir, mich zu verziehen: »Es genügt mir völlig, mein Lucius,« sagte er, »diesen Tattergreis so blamiert zu haben.«
Ich aber war von einer dergestalten Amtshandlung völlig konsterniert, total baff! Also schlich ich wenigstens zum Bad. Der hochintelligente Einfall meines Freundes hatte mich ja um Essen und Geld gebracht. Frisch gebadet schleppte ich mich dann zurück zu Milo und geradewegs ins Schlafzimmer.
Abendbrot bei Milo
Doch da, verflixt! Schon erschien strahlend die zuckersüße Magd Photis: »Milo lässt dich bitten, lieber Herr Gast!«
Doch ich entschuldigte mich höflich, denn ich kannte ja Milos Geiz:
»Oh, liebe Photis, ich bin von der Reise ganz fertig und möchte jetzt lieber schlafen gehen. Ich habe gar keinen Appetit,« log ich. Sie richtete es ihm aus, aber da erhob er sich in eigener Person, kam, kriegte mich am Wickel zu fassen und fing an, mich wegzuzerren. Ich zögerte, widerstrebte, warf mit faulen Ausreden um mich: umsonst!
»Nicht eher,« sagte er, »gehe ich hier weg, als bis du mir folgst, das schwöre ich dir bei Jupiter und allen Göttern des Himmels.« Also gab ich mich seiner ekligen Zudringlichkeit geschlagen, und er führte mich zu seinem altbekannten winzigen Sofa. Ich hockte mich hin, und er fing an zu schwatzen: »Und!? Unser Demeas? Seine Frau? Was is los mit seinen Kindern? Und seine Sklaven?«
Ich erzählte alles, was ich wusste; er fragte nach klitzekleinen Einzelheiten und den Gründen meiner Reise. Kaum hatte ich alles brav berichtet, wollte er jeden Kleinkram über unsere Stadt und die Politiker dort und schließlich über den Bürgermeister wissen, und das in allen möglichen Details. Oh ich Pechvogel!
Dann merkte dieser kluge Mensch endlich doch, dass ich von der Strapaze der Reise wirklich halbtot war, mir sogar das Erzählen über die Kräfte ging, ich mitten beim Berichten schlaftrunken stecken blieb und nur noch wirres Zeug hervorstotterte. Da erlaubte er mir gnädig, mich aufs Ohr zu hauen. So entkam ich schließlich halbverhungert dem Geschwafel des stinkigen Alten. Vom Gewicht der Speisen wurde ich weißgott nicht zu Boden gedrückt, dafür war ich bis oben hin voll von blödem Gebrabbel. Also schleppte ich mich ins Schlafzimmer und warf mich selig in Morpheus’ Arme.
Wie niedlich ist doch unser »Strahlemann«!
Die Sonne vertrieb die Nacht; ein neuer Tag brach an, und ich schnellte aus Schlaf und Bett zugleich. Ich war nämlich schon ganz versessen darauf, Wunder und Zaubereien zu entdecken. Schließlich war ich jetzt mitten in Thessalien, und in aller Welt rühmt man diese Gegend für ihr ausgeprägtes Hexenwesen. Auch die Horrorgeschichte des Aristomenes, gestern noch mein Reisegefährte, hatte ja in dieser Stadt gespielt. Total verrückt danach also und voller Wissensdurst beguckte ich mir alles ringsumher in Hypata.
Es gab jetzt dort nichts mehr, das ich für das hielt, was es war. Alles war vom Gezischel der Hölle erfüllt, alles in andere Gestalten verzaubert. Die mäßig verlegten Steinplatten der Straße, an denen ich mir die Zehen blutig stieß, waren versteinerte Menschen. Die Vögel, die ihr Gezwitscher hören ließen, waren gefiederte Menschen. So flatterten sie in der Gegend herum. Und die Bäume überall? Belaubte Menschen! Die sprudelnden Brunnen? Verflüssigte Menschen! Statuen und Mauern, meinte ich, müssten sprechen und gehen, Rindviecher und anderes Getier die Zukunft vorhersagen können; ja, vom Himmel herab und aus der Sonnenscheibe müssten Orakel kommen.
So war ich total aus dem Häuschen, vor Sucht nach Hexerei bis zum Irrsinn gespannt. Überall bummelte ich herum, ohne aber davon auch nur den Hauch einer Spur zu entdecken, und geriet plötzlich wieder auf den Marktplatz, ganz unabsichtlich. Und da kreuzte eine Frau auf, umwimmelt von jeder Menge Dienern. Ich nix wie hin! Sie die Klamotten voller Gold, teils als Broschen eingeklipst, teils aufgestickt. Na also, eine Dame! So dachte ich. An ihrer Schokoladenseite klebte so ein alter Kerl, ein steinalter Mann.
Wie ich dem in den Blickwinkel gerate, schreit er: »Ach du liebes bisschen! Das ist ja Lucius!« Schon schmatzt er mich ab und brummelt der Dame was ins Ohr, was für mich Unverständliches. Dann zu mir: »Wie wärs, wenn du zu deiner Tante gingst und ihr einen guten Morgen wünschtest?!«
»A-a-aber,« sprach ich, »ich kenne die Dame doch gar nicht.« Ich lief knallrot an und blickte zu Boden. Die aber warf das eine oder andere Auge auf mich und girrte: »Na, schau dir das mal an! Ganz der goldigen Mama Silvia ähnlich, die sich übrigens auch immer so anstellt. Auch sonst bist du ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, bei Gott! Normale Größe, voller Saft und Kraft und dennoch schlank; rosige Farbe; blondes Haar, mit Geschmack geschnitten; blaue Augen, wache, funkelnde, wie vom Adler; ein niedliches Gesicht; und wie süß, dieser stolze, flotte Schritt!« Sie schöpfte Atem:
»Ich hab’ dich, Lucius, als Baby mit diesen meinen Händen aufgezogen, klar? Ich bin mit deiner Mama blutsverwandt, und wir waren einst unzertrennlich. Wir kommen nämlich beide aus Plutarchos’ Familie und hatten das Vergnügen, Muttermilchersatz bei derselben Amme zu trinken, ganz wie Zwillinge. So sind wir gewissermaßen Schwestern geworden. Nichts als die gesellschaftliche Stellung trennt uns heutzutage: Sie hat ein hohes Tier, ich einen Privatmann geheiratet. Ich bin die Byrrhena. Vielleicht haben mich deine Pauker ab und an mal erwähnt. Du kannst natürlich bei mir wohnen und dich ganz wie zu Hause fühlen: Mein Haus ist auch dein Haus.«
Inzwischen hatte sich die Feuerfarbe meines Gesichtes verflüchtigt. Ich sprach also: »Nichts zu machen, Tantchen! Der Milo wäre stinksauer, wenn ich ihn mir nichts dir nichts verlasse. Aber wenn ich ihn nicht vergrätze, tue ich, was ich kann: Immer wenn ich in deine Nähe gerate, schaue ich bei dir herein.«
Eine tolle Hütte
Wir tauschten diese und andere Liebenswürdigkeiten aus, und schon erreichten wir Byrrhenas Haus: Was war da für eine überwältigend schöne Eingangshalle! In jeder der vier Ecken stand eine Säule mit einer Statue drauf, z.B. die Siegesgöttin Nike mit ausgebreiteten Flügeln: Mit ihren himmlischen Füßchen berührt sie wie im Fluge eine dahinrasende Kugel, ohne darauf gehen zu müssen. Da! Aus herrlichem Marmor die Göttin der Jagd Diana! Sie nimmt genau die Mitte des Raumes ein. Eine fantastische Bildhauerarbeit! Das Gewand weht im Winde. Alles voller Bewegung! Sie eilt den Eintretenden entgegen in göttlicher Erhabenheit! Aus Stein gehauene Hunde flankieren sie. Welch drohende Augen! Gespitzte Ohren! Geblähte Nasenlöcher! Gefletschte Zähne! Wenn’s hier irgendwo wild kläffte, man müsste glauben, das Bellen käme aus den Marmorrachen. Und dann das Meisterstück des Super-Bildhauers: Die Hunde bäumen sich nach vorne auf, recken sich auf den Hinterläufen. Dabei scheinen die Vorderfüße davonzustürmen. Hinter der Göttin erhebt sich ein Fels mit Höhle. Allerhand Grünzeug wächst drauf: Moose, Gräser, Büsche, Weinlaub. In die Grotte hinein schimmert mit weißem Glanz die göttliche Statue. Am äußersten Rand des Felsens hängen Früchte und Trauben herab – meisterhaft gestaltet, ganz wie natürlich! Man könnte vermuten, es sei die schöne bunte Herbsteszeit, und all die Köstlichkeiten warteten nur drauf, gepflückt zu werden. Und bückt man sich über die Quelle, die zu Dianas Füßen perlt und sprudelt, sieht man, wie sich täuschend echt die hängenden Trauben im Spiegelbild bewegen. Mitten zwischen dem Laubwerk verborgen sieht man den sagenhaften Jäger Aktaion. Mit neugierigem Blick beugt er sich zur Göttin hin. Er ist zur Strafe schon halb zum Hirsch verwandelt und lauert immer noch drauf, dass Diana sich auszieht, um sie beim Bade in der Quelle endlich nackend beobachten zu können. Gleich werden ihn, den Hirsch, dafür die eigenen Hunde in Stücke reißen. 17
Ich bestaunte das alles mit größten Entzücken. »Alles, was du siehst, gehört dir,« sagte Byrrhena. Dann schickte sie sämtliche Anwesenden fort, um mit mir unter vier Augen zu sprechen:
Eine ernste Warnung
Möge dich diese jungfräuliche Göttin da schützen, lieber Lucius! Ich bin wahnsinnig besorgt um dich. Ich hab’ Angst. Ich will mich ja gründlich um dich kümmern. Pass also auf! Vorsicht, Vorsicht vor den satanischen Künsten der Pamphile→, die mit deinem so genannten Gastgeber, dem Milo, verheiratet ist. Sie ist als Zauberin berühmt-berüchtigt und Meisterin der Schwarzen Magie. Mit allerhand Kräutern, Steinen und dergleichen Zeug schafft sie z. B. die Sterne nach unten in die Hölle … Und kaum tritt ihr ein hübscher junger Kerl unter die Augen, wird sie von unbeschreiblicher Liebesglut und Liebeswut gepackt und hext dem Burschen das rasendste Verlangen nach ihr an. Will aber trotzdem jemand nicht so, wie sie grad’ will, oder hat sie endlich von ihm die Nase voll, verwandelt sie ihn ruckzuck zu Stein oder in ein Schaf oder sowas oder bringt ihn um. Dass dir’s so ergehen könnte, lässt mich zittern. Daher meine Warnung. Denn dieses Flittchen ist Tag und Nacht mannstoll und geil, und du niedliches Jüngelchen bist für sie ein gefundenes Fressen.« So Byrrhena in namenloser Angst um mich.
Ganz anders ich. Neugierig war ich ja ohnehin. Wie ich sie aber so von Magie reden hörte, dachte ich gar nicht dran, mich vor Pamphile in Acht zu nehmen. Nein! Ich war mit Haut und Haaren bereit, dort in die Lehre zu gehen und mich notfalls kopfüber in den Abgrund zu stürzen. Hals über Kopf machte ich mich also von Tantchens Hand los, als wäre sie eine Klette, rief noch hastig: »Machs gut!« und rannte schon vergnügt und wie verrückt zu Milos Haus. Wie von Sinnen beschleunigten sich meine Schritte.
»Auf, los, Lucius!« – sprach ich zu mir – »wach auf! Reiß dich zusammen! Da hast du endlich die heißersehnte Gelegenheit. Jetzt kannst du dich – wie du willst – mit Wundergeschichten vollsaugen. Weg mit der kindischen Gespensterfurcht! Wirf dich sehenden Auges in die Sache hinein! Nur lass dich besser nicht mit Pamphile auf Sex ein und setze dem guten Milo keine Hörner auf! Mach dich statt dessen nach allen Regeln der Verführungskunst über die Magd Photis her! Sie hat eine tolle Figur und ist auch sonst ein flotter Käfer. Das hast du doch schon gestern Abend zu spüren bekommen, als sie dich zu Bette brachte. Wie nett führte sie dich ins Zimmer, wie sanft hat sie dich hingelegt, wie lieb zugedeckt und wie süß auf die Stirn geküsst! Wie gerne wäre sie zu dir unter die Bettdecke gekrochen! Das hat doch ihr ganzer Gesichtsausdruck verraten. Wie oft hat sie sich im Gehen noch umgeblickt und ist stehen geblieben! Also Glück und Segen bei ihr, lieber Lucius! Es kommt auf den Versuch an. Und wenn sie nicht will: Was soll’s?«
Dies Mägdlein ist bezaubernd schön
Schon trat ich bei Milo ein und hatte damit sozusagen meinem Antrag stattgegeben. Doch der Herr samt Frau war ausgeflogen. Nur die süße Photis war da. Sie machte den Herrschaften Klöße mit Gulasch samt Soße, und – das erschnupperte ich gleich – Roulade. Wie lecker!
Sie selbst steckte in einem Leinenkleidchen und war mit einem rotglänzenden Band gleich unter den Brüsten schick gegürtet. Sie schwang gerade den Topf mit ihren rosigen Patschhändchen hin und her. Dabei geriet ihr ganzer Körper im Gleichtakt sanft ins Schwibbeln und Schwabbeln. Die Hüften gingen auf und ab, der Rücken wiegte sich behände in feiner Wellenbewegung. Dieser Anblick machte mich toll. Wie gebannt vor Verzückung stand ich still. Es stand auch ein Glied, das vorher schlaff gehangen hatte. Schließlich fand ich die Sprache wieder:
»Wie süß und reizend, meine Photis, schlenkerst du Topf und Hintern zugleich! Welche Köstlichkeiten zum Vernaschen hältst du da bereit! Ein Glückspilz erster Güte, den du da seinen Finger hineinstecken lässt!« Darauf antwortete das ausgekocht freche Mädchen:
»Hau ab! Armer Kerl! Zieh dich zurück von meiner Feuerstelle, so weit es geht! Denn wenn du dich an meinem heißen Ofen versengst, dann brennst du gleich in hellen Flammen. Niemand kann dann deine Glut löschen, nur ich alleine. Mit süßer Würze verstehe ich es nämlich, Topf und Bett zu schaukeln …« Dabei sah sie mich schelmisch an und lachte. Ich aber wich nicht von ihrer Seite, bis ich sie ganz genau in Augenschein genommen hatte.
Immer war es mir besonders darauf angekommen, bei den Frauen Kopf und Haar zu beschauen. Das machte ich in aller Öffentlichkeit, um dann das Ganze zu Hause im Rückblick zu genießen, und das mit Fug und Recht. Dieser Körperteil ist nämlich überall sichtbar und begegnet unseren Blicken zuerst. Was für den übrigen Körper ein schönes Kleid ist, das ist beim Kopf die Haarpracht. Nun ziehen sich ja vor uns Männern die meisten Mädchen gleich sofort sämtliche Lümpchen aus, um sich in nackter Schönheit zu präsentieren. Sie wollen den Herren der Schöpfung natürlich eher durch ihre rosige Haut als durch bunte Kleider gefallen. Wenn eine aber – grässlich wär’s und ich wills keiner wünschen – wenn eine aber glatzköpfig wäre, hätte ihr Gesicht seinen natürlichen Schmuck verloren. Sie könnte von den Göttern droben kommen, wie Venus selbst aus dem Schaum des Meeres entstiegen sein, sämtliche verführerischen Grazien und Amor-Gesellen im Reigen um sich geschart haben, um die schlanke Taille einen Liebesgürtel tragen, nach Parfüm und Riechwässern jedweder Art duften: käme sie glatzköpfig dahergeeilt, könnte Venus selbst ihren Gatten Vulcanus, dem stinkenden hinkenden Feuergott, nicht gefallen.
Wenn aber das Haar der Geliebten in schön gefärbtem Schimmer gleißt, gegen das Sonnenlicht munter aufblitzt und lieblich widerscheint, wie himmlisch! Auch wenn es in lebhaftem Kontrast der ganzen Erscheinung Abwechslung gibt, wenn es goldflimmend in sanftes Honiggelb übergeht, bald so tiefschwarz wie ein Taubenhals ist, wenn es mit Arabiens Duftstoffen parfümiert und von feingezahntem Kamm gescheitelt und nach hinten gerafft ist, wenn es so dem Geliebten in die sehnsüchtigen Augen fällt, wie herrlich! Aus seinen Augen heraus – wie aus einem Spiegel – scheint ein um so bezaubernderes Bild zurück. Oder wenn es sich in üppiger Fülle auf dem Scheitel türmt, oder in breitem Strome über den Rücken fließt, wie wunderbar!
Die Frisur also ist für jede Frau enorm wichtig: Sie mag sich mit Gold, Edelsteinen, Kleidern und Schmuck aller Art behängen, kommt sie mit schmuddeligen Haaren daher, wird kein Mann rufen: hallo, süßes Ding!
Meine Photis trug das Haar ungekünstelt. Aber gerade die natürliche Pracht erhöhte den Reiz des Mädchens: Dichte Locken ringelten sich um den Hals, verteilten sich nach unten, lagen luftig duftig leicht auf dem Kragen, waren am Ende zusammengefasst und nach oben in einem Knoten vereint.
Nicht länger konnt’ ichs aushalten. Die Lust hatte sich zum Irrsinn gesteigert. Ich beugte mich über sie und hauchte ihr einen honigsüßen Schmatz auf die goldene Krone ihres Haars. Da drehte sie den Kopf, zwinkerte mir ganz schelmisch zu und sprach: »He du, Schlaumeier, du schnappst nach einem bittersüßen Bissen. Pass bloß auf! Zu viel Honig genascht, und schon kommt die Gallenkolik!«
»Ist mir egal, du mein Goldkind. Ich bin bereit, kriege ich auch nur einen Kuss dafür als Erfrischung, mich über deinem Feuer flach längelang ausgestreckt rösten zu lassen.« Sprachs, presste sie fest an mich und begann, sie abzuschlecken. Sie war sofort in gleicher Lust entbrannt, sofort zum Liebesspiel bereit und mit mir ein Herz und eine Seele: Aus weit offenem Mündchen schoss sie nach Liebe lechzend ihre köstlich duftende Zunge in meinen Mund.
»Ich sterbe,« flüsterte ich, »nein, ich bin schon tot, wenn du mich nicht erhörst.« Sie küsste mich darauf noch einmal: »Du kannst fest mit mir rechnen,« gurrte sie, »denn dein Wille ist auch mein Wille. Ich bin mit Haut und Haaren deine Sklavin. Unser höchstes Vergnügen soll nicht länger verschoben werden. Beim ersten Lampenschein bin ich in deiner Kammer, und dann … Geh also jetzt und halte dich dort bereit. In der ganzen Nacht will ich nämlich tapfer und beherzt viele, viele Ringkämpfe mit dir austragen.«
So zogen wir uns auf bevor wir uns trennten. Eben war erst der Mittag gekommen. Da schickte mir Byrrhena Gastgeschenke: ein fettes Spanferkel, fünf Brathähnchen und einen Krug köstlichen alten Weines.
»He Photis,« rief ich, »sieh mal! Der Weingott Liber, Antreiber und Waffenträger der Venus, kommt ganz unaufgefordert zu uns. Den Wein da wollen wir heut nacht ganz und gar wegsüffeln. Er soll uns den Rest an Scham austreiben und frische Lust eintrichtern. Denn nur das braucht Venus auf ihrer nächtlichen Tour: Öl für die Lampe und den Weinbecher.«
Milos zweites Nacht-»Mahl«
Den Rest des Tages verbrachten wir mit Baden und Essen. Auch der gute Milo hatte mich zum Mahle gebeten, nur gab’s fast gar nichts. Da lag ich also bei ihm zu Tische und passte auf, dass ich Pamphiles lüsternen Augen möglichst entging. Byrrhenas Warnungen wollte ich lieber nicht in den Wind schlagen. Ich wich also ihren Blicken aus wie vor der Hölle selbst und sah fortwährend zu Boden oder, so oft es ging, seitwärts nach Photis, die den Butler zu spielen hatte. Mann! Ihr Anblick war Labsal. Da war’s schon Abend. Pamphile blickte die Öllampe an und meinte:
»Es wird morgen ein Sauwetter geben.« Ihr Gatterich fragte: »Und woher weißt du das?« »Die Lampe verkündet es,« sagte sie. Milo schlug die Hände vor den Wanst, um vor Lachen nicht zu platzen: »Hahahaa! Eine vorzügliche Prophetin, diese Tranfunzel da. Natürlich überschaut sie von ihrer hohen Halterung aus alle vier Himmelsrichtungen und sogar die Sonne! Hahaa! Wie witzig!« Ich mischte mich ein: »Es gibt erstklassige Beweise für diese Art von Zukunftsdeutung. Kein Wunder! Das da ist nur ein kleines Feuerchen und von Menschen angezündet. Dennoch denkt es vielleicht an das gigantische Himmelsfeuer, von dem es abstammt. Was hoch oben im Himmel geschehen wird, weiß es in himmlischem Vorgefühl und verkündet es uns.