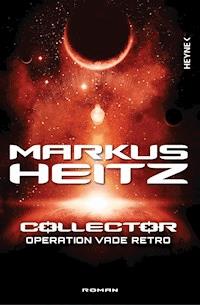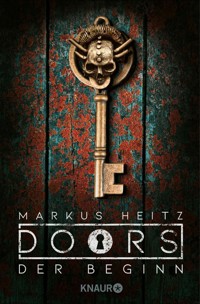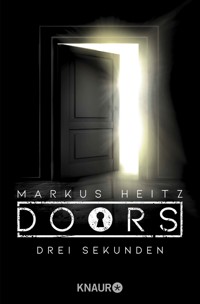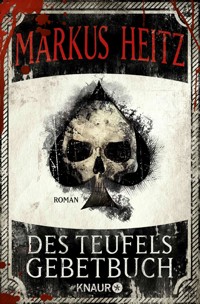
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der neue Urban-Mystery-Thriller von Bestseller-Autor Markus Heitz ist ein perfekter Mix aus Unheimlichem, Bösen und subtilem Horror: Der ehemalige Spieler Tadeus Boch gelangt in Baden-Baden in den Besitz einer mysteriösen Spielkarte aus einem vergangenen Jahrhundert. Alsbald gerät er in einen Strudel unvorhergesehener und mysteriöser Ereignisse, in dessen Zentrum die uralte Karte zu stehen scheint. Die Rede ist von einem Fluch. Was hat es mit ihr auf sich? Wer erschuf sie? Gibt es noch weitere? Wo könnte man sie finden? Dafür interessieren sich viele, und bald wird Tadeus gejagt, während er versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Plötzlich steigt der Einsatz: Es ist nicht weniger als sein eigenes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 852
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Markus Heitz
Des Teufels Gebetbuch
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Bube, Dame, König, Tod
Der ehemalige Spieler Tadeus Boch gelangt in Baden-Baden in den Besitz einer mysteriösen Spielkarte aus einem vergangenen Jahrhundert. Alsbald gerät er in einen Strudel unvorhergesehener und mysteriöser Ereignisse, in dessen Zentrum die uralte Karte zu stehen scheint. Die Rede ist von einem Fluch. Was hat es mit ihr auf sich? Wer erschuf sie? Gibt es noch weitere? Wo könnte man sie finden? Dafür interessieren sich viele, und bald wird Tadeus gejagt, während er versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Plötzlich steigt der Einsatz: Es ist nicht weniger als sein eigenes Leben.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
– INTERMEDIUM – CAPITULUM I
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
– INTERMEDIUM – CAPITULUM II
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
– INTERMEDIUM – CAPITULUM III
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
– INTERMEDIUM – CAPITULUM IV
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
EPILOGOS
Nachwort
Anhang
Verwendete Literatur
Gewidmet den Kartenspielern und Zockern, die mit ihren Erlebnissen und Geschichten wahre Legenden bildeten, von denen heute noch berichtet wird: Lachen, Streit, Ärger, Freude, große Auftritte und kleinlaute Abgänge.
Wie damals in meiner ersten Mau-Mau-Runde: Eine verdammte 7 mehr, und der Sieg wäre mein gewesen! Aber als hätte der Teufel seine Klauen im Spiel gehabt …
Prolog
Ostsee, 18 Seemeilen nordwestlich von Tallinn (Estland)
Surrend wickelte sich das nasse Drahtseil auf die Trommel, die Kraft des Motors zog die Beute aus der Tiefe des Meeres. Schmutzig graue Tröpfchen lösten sich vom ölschmierigen Tau und fielen zurück in die sachten Wellen. Meter um Meter ging es aufwärts.
Zwei Taucher, deren schwarze Neoprenköpfe wie dunkle Ballons auf der wogenden See trieben, beobachteten das Emporhieven aus einigem Abstand. Ihre Arbeit war getan, doch sie blieben auf Position, um bei einem Abrutschen der Halterung die Bergung wiederholen zu können. Sofern es das schlechter werdende Wetter zuließ.
Die Scheinwerfer und Positionslichter der Anatevka waren trotz der anbrechenden Dämmerung gelöscht. Niemand durfte wissen, was sie auf dem umgebauten Trawler taten. Eine Genehmigung für ihre Unternehmung gab es nicht.
»Rechtzeitig«, kommentierte Kapitän Lugaschin lakonisch. Die Arme auf die Reling gestützt, rauchte er eine russische filterlose Zigarette. Mit der Skippermütze auf den kurzen schwarzen Haaren und in dem dicken Pullover sah er aus wie eine Werbefigur, wahlweise für Kippen oder Alkohol.
»Aye.« Ein Matrose in Marinemantel und mit abgegriffenem Schiffchen bediente zwei Schritte neben ihm die Winde, blickte abwechselnd zum Seil und auf die einfachen, schwach leuchtenden Armaturen.
Angespannt verfolgte Anjelica Clark den Vorgang. Der signalgelbe Plastikmantel schützte sie vor Wind und Gischtschleiern, die Schwimmweste trug sie aus reiner Vorsicht. Sie hatte die Hände in die Taschen gesteckt, in ihrem linken Ohr saß ein Bluetooth-Set, mit dem sie telefonierte; das Satellitentelefon ruhte geschützt in ihrer Hose. »Wir sind gleich so weit, Sir«, meldete sie den Fortgang an ihren Auftraggeber.
Der Rumpf der Anatevka hob und senkte sich spürbar. Die Wellen rollten heran und zeigten den Seeleuten, dass sie allerhöchstens noch eine halbe Stunde an dieser Stelle bleiben konnten, bevor der anrückende Sturm sie an die sichere Küste zwang.
»Die Wettermeldungen sehen schlecht für Ihren Standort aus«, hörte Anjelica ihren Boss sagen, der in einem britischen Clubsessel bei Tee, Scones und Sandwiches saß, während sie den Gewalten trotzte. »Ist das korrekt, Clark?«
»So ist es, Sir. Da zieht was auf.« Anjelica blickte auf den Gegenstand, der unter der bleigrauen Wasseroberfläche als rechteckiger schwarzer Schemen erkennbar wurde. Gleich darauf durchbrach er die Wellen, weiße Bläschen blieben auf dem dunkelbraunen Holz zurück. Mehrere breite Gurte spannten sich um die Fracht und hielten sie sicher umschlungen.
»Langsamer«, befahl Lugaschin gelassen und rührte sich keinen Millimeter.
»Aye«, sagte der Matrose und fing das Schwingen der riesigen Truhe geschickt über das Manövrieren mit dem Lastarm ab.
»Wir haben sie, Sir«, sprach Anjelica laut, um das zunehmende Surren des Windes zu übertönen. »In einem Stück und ohne Beschädigung.«
»Ausgezeichnet!« Freudige Erregung erklang in der Stimme des Auftraggebers. »Lassen Sie meinen Schatz nicht vom Haken!«
»Nein, Sir.«
Der Matrose ließ die geschnitzte Eichenholztruhe behutsam hochziehen und holte sie mit einem Schwenk des Metallgalgens über die Reling, wobei sie Millimeter an Lugaschin vorbeischwebte.
Der Kapitän dachte nicht daran, sich zu bewegen. »Raus mit euch«, rief er den Tauchern zu und schnippte die beinahe aufgerauchte Zigarette in die Ostsee.
Die Männer gaben bestätigende Handzeichen und schwammen auf die Leiter zu.
Anjelica ging zur Truhe, die rumpelnd aufsetzte. Wasser sickerte aus den breiten Spalten und angebrochenen Holzlatten, Schlamm und Bröckchen verteilten sich ringsherum. Der Wind wehte ihr einen modrigen Geruch zu, der alte Schlick schien sie mit Gestank vertreiben zu wollen. Das letzte Sonnenlicht tauchte das Deck in Dunkelgold und ließ die Umrisse verschwimmen.
»Machen Sie Licht, Kapitän«, bat Anjelica.
Als Antwort zog der Skipper eine Taschenlampe vom Gürtel und leuchtete herüber, blieb am Geländer stehen, als lehnte er an einem Bartresen. »Alles andere sieht man zu weit. Die Küstenwache ist aufmerksam, und in der Nähe findet ein Marinemanöver statt. Die werden sich schon wundern, warum wir noch draußen sind und keine Kennung senden.«
Der Matrose beugte sich zur Kiste, löste die Halterung der schlaff herabhängenden Bänder, und auf Anjelicas bestätigendes Nicken hin knackte er das verrostete, korrodierte Schloss mit einem Bolzenschneider.
Nach mehrmaligem Hebeln und dem Einsatz eines Stemmeisens zersprang der Deckel und gab den Blick auf den Inhalt frei.
»Sagen Sie mir, dass mein Schatz da ist, wo ich ihn vermutet habe«, hörte Anjelica ihren Auftraggeber begierig raunen.
Neugierig beugte sich der Matrose über die Ladung, korrigierte verblüfft den Sitz seines Schiffchens. Dann lachte er auf und wechselte einige russische Worte mit dem Kapitän.
»Ist das wahr?« Lugaschin steckte sich die nächste Zigarette in den Mund und zündete sie an. »Kein Gold?« Er fluchte deutlich durch den Wind. »Dann kann ich meine Beteiligung abschreiben.«
Anjelica sah im Schein der Lampe schwarzgrauen Schlamm, die Reste von zersetztem organischem Material und noch mehr Schlick, aus dem Krebse und andere Tiere krochen, um vor dem grellen Licht zu flüchten. Seufzend zog sie ihre Finger aus den Taschen und grub sich durch das eiskalte Sediment. Sie hatte nicht an Handschuhe gedacht und hoffte, weder in scharfkantige noch spitze Dinge zu greifen.
Sie stieß auf Widerstand.
Behutsam zog Anjelica den Gegenstand heraus und hielt eine Flasche mit einem Drahtkorbverschluss in der Hand. Mit Gischtwasser, das sie von den Balken wischte, reinigte sie die Flasche, so gut es ging. Das Dümpeln des Trawlers nahm zu, ihr wurde flau im Magen.
»Clark, machen Sie es nicht unnötig dramatisch«, flüsterte der Mann in ihrem Ohr nervös.
»Sir, ich muss sicher sein. Eine Flasche ist es auf alle Fälle, und« – Anjelica hielt den Korken in den Lichtstrahl – »ich sehe einen Anker darauf. Wir haben mindestens einen Treffer, Sir! Alles Weitere, sobald ich den Inhalt …«
»Los, Clark! Ich bin live dabei, wenn Sie mich reich machen«, unterbrach er sie lachend und schlürfte laut am Tee. »Beste Unterhaltung.«
Anjelica sah zum Matrosen. »Haben Sie was zum Säubern? Einen Wasserschlauch zum Spülen?«
Er nickte knapp und stapfte über das Deck, um gleich darauf mit dem Verlangten zurückzukehren. Auf ihre Anweisung hin schwemmte er nach und nach den Schlick aus der Kiste, der in breiten Schlieren aus den Holzspalten über die Metallplatten der Anatevka lief.
Lugaschin verfolgte das Treiben und rief den Tauchern etwas zu, ohne den Kopf zu wenden. Sie wuchteten sich fluchend an Bord und halfen sich gegenseitig beim Abnehmen der schweren Sauerstoffflaschen.
Unverdrossen gab Lugaschin den unbeweglichen Beleuchter. »Was ist das?«
»Was zu trinken«, gab Anjelica zurück. »Ungenießbar. Wird nicht viel bringen.«
»Mit wem reden Sie, Clark?«, wollte ihr Auftraggeber wissen.
Die Böen rauschten in ihren Ohren und über die Stimme. »Mit dem Skipper.«
»Sagen Sie ihm nicht, welchen Schatz er an Bord hat«, schärfte er ihr ein. »Sie hätten das niemals alleine angehen dürfen.«
»Die Zeit lief uns davon, Sir. Das Unwetter und das Manöver hätten die Bergung unmöglich machen können. Wir hatten Glück, dass wir das Wrack überhaupt vor allen anderen fanden.« Der gedrosselte Wasserstrahl legte vor ihren Augen Flasche um Flasche frei. Manche Korken zeigten den Anker, andere nicht. Das konnte den Fund sogar älter und lukrativer machen als erhofft. Anjelica überschlug die Anzahl. »Soweit ich es sehen kann, sind es um die sechzig, Sir. Das Doppelte des ersten Fundes«, erstattete sie leise Bericht, um dann lauter hinzuzufügen: »Ach herrje. Es bleibt dabei. So eine Enttäuschung. Kein Schatz.«
»Übertreiben Sie nicht, Clark«, kam es prompt über das Satellitentelefon. »Sonst wird er misstrauisch. Laden Sie die Ware um.«
»Sicher, Sir.« Sie bat den Matrosen, die großen bereitstehenden Plastikboxen mit Meerwasser zu füllen, und packte eine Flasche nach der anderen in die gepolsterten Styroporständer. Damit würde der edle Tropfen den weiteren Weg überstehen. Experten des Auftraggebers, die sich auf den Weg nach Tallinn gemacht hatten, übernahmen die Inspizierung an Land und würden sich bei Bedarf um die Konservierung der uralten Korken kümmern, damit sie dicht blieben.
»Ist das Wein?« Lugaschin stand ungerührt an der Reling, leuchtete und winkte zum Kommandostand hinauf. Der Steuermann schaltete daraufhin den Motor der Anatevka ein und lichtete den Anker, um die Rückkehr in den Hafen vorzubereiten.
»Ja«, log Anjelica.
»Und Sie wussten, dass es ihn gibt.« Lugaschin schwenkte den hellen Strahl hin und her. »Sie haben die richtigen Transportboxen dabei. Ist ja wohl kein Zufall.«
»Stimmt. Aber eigentlich hätten wir Gold finden müssen.« Sie ließ sich nichts anmerken und sah aus den Augenwinkeln, wie der Matrose im verbliebenen Schlick wühlte, als wolle er die Hoffnung nicht aufgeben, doch noch Schätze zu entdecken. »Der Wein ist nur ein Mitbringsel. Der Segler sollte laut unseren Aufzeichnungen wichtige Depeschen und Geschenke des französischen Königs Ludwig XVI. an den russischen Zaren überbringen. Ich rechnete mit mindestens einer kleinen Kiste Diamanten, Geschmeide oder dergleichen.« Sie zeigte auf die Wellen. »Die Ostsee hatte etwas dagegen.«
Lugaschin lachte. »Verarschen kann ich mich selbst.«
»Was ist?«, fragte Anjelicas Auftraggeber. »Was redet der Mensch die ganze Zeit?«
»Später, Sir«, wisperte sie.
Die Anatevka tuckerte los und wendete in einem großen Bogen, schwankte, als sie kurz quer zu den Wellen fuhr, und nahm Fahrt auf. Die Scheinwerfer blieben aus, das natürliche Licht genügte, um die ersten Seemeilen ohne gleißende Lampen zurückzulegen, auch wenn die Sonne mittlerweile versunken war.
»Reden wir nochmals über die Beteiligung.« Der Kapitän senkte die Taschenlampe und hob sein Smartphone. »Ich habe hier was gefunden, über einen ähnlichen Fund zwischen Schweden und Finnland. Champagner. Ergab mindestens dreiundfünfzigtausend Euro. Pro Flasche.«
»Nein, Sie irren sich«, wiegelte Anjelica ab.
»Soll ich Ihnen den Bericht vorlesen? Müsste Veuve Clicquot sein, hergestellt irgendwann um 1772, ausgeliefert ab 1782. Markenzeichen ab 1798: Auf dem Korken ist ein Anker.« Lugaschin leuchtete auf die Flaschen. »Dieses Symbol hat in der Champagne nur dieser Hersteller verwendet, heißt es im Artikel.«
»Clark, was will dieser Mensch?«
»Mehr Geld, Sir.«
»Wir reden von etwa drei Millionen. Davon will ich meine abgemachten fünf Prozent. Und weil Sie versucht haben, mich zu verarschen« – der Kapitän sog genüsslich an der Kippe –, »schlage ich weitere fünf drauf. Sonst gehen Sie über Bord. So was passiert bei einem Sturm. Die Schwimmweste wird nicht viel bringen.« Die Taucher traten neben ihren Kapitän an Deck, stumm und bedrohlich in ihren schwarzen Neoprenanzügen, auch wenn sie an kleine Seelöwen erinnerten.
Der Bug des Trawlers bohrte sich durch die Wogen, gabelte sie auf und teilte sie. Wasser und Gischt ergossen sich im sterbenden Licht auf das Boot.
Anjelica seufzte wieder und klappte einen Plastikdeckel zu. Sie schmeckte das Salz auf ihren Lippen. »Sechs Prozent. Und es ist nicht garantiert, dass wir drei Millionen bekommen. Wenn er nicht mehr trinkbar ist, dann …«
»Ist das was wert?« Der Matrose barg einen Pfeifenkopf aus Ton aus der Truhe, erhob sich und hielt ihn in die Runde. Sofort richtete Lugaschin den Strahl der Taschenlampe zu ihm. Auf dem Pfeifenkopf war der Oberkörper einer dunkelhaarigen Frau abgebildet.
»Ich fürchte, nein«, sagte Anjelica, irritiert von der Unterbrechung. »Ich bin keine Expertin für …«
»Schade.« Achtlos warf der Matrose den Pfeifenkopf aufs Deck, wo er zerschellte. »Dann weiter mit den Verhandlungen.«
Einer der Taucher stieß ein Lachen aus und stapfte auf sie zu.
»Sieben Prozent!« Anjelica erhöhte rasch ihr Angebot. Lugaschin hatte recht: Sie wäre in der eisigen Ostsee so gut wie tot.
Aber der Taucher ging an ihr vorbei, nahm sich eine Flasche und schlug den Hals ab, der absolut glatt brach. Sprudelnd stieg Champagner heraus, das Getränk hatte noch genügend Bläschen, um zu schäumen. Grinsend nahm der Taucher einen Schluck. »Schmeckt. Hat aber Kork.« Er kehrte unter Gelächter zu den anderen zurück. Die Flasche aus dem 18. Jahrhundert kreiste in der kleinen Runde.
»Der älteste Champagner der Welt.« Lugaschin steckte die Lampe weg, trank und lachte. »Das ist das Teuerste, was ich jemals im Mund hatte.«
»Das ziehe ich Ihnen von Ihrem Anteil ab«, giftete Anjelica. »Und es bleibt bei sieben.«
»Sehr gut, Clark«, lobte ihr Auftraggeber. »Bringen Sie mir meinen Schatz.«
»Sicher, Sir.«
Der Matrose neben der Truhe stieß einen verblüfften Ruf aus. Er schob das Schiffchen mit dem Unterarm weiter nach hinten und hielt eine notizbüchleinflache Schatulle in die Höhe, die sich nach einem Schwall Wasser aus dem Schlauch als angelaufenes Silber entpuppte. Ein verplombtes Schloss sicherte den Inhalt.
Der Skipper zog die Taschenlampe erneut hervor und schwenkte den Strahl darauf.
Anjelica erkannte ein unbekanntes Wappen sowie eine szenische Darstellung. Erst eine Reinigung und eine genaue Analyse würden Aufschluss über den Fund bringen. »Sir, haben Sie in den Aufzeichnungen zufällig etwas von einer gravierten Silberbox gefunden?«
»Ich wusste nur von dem Champagner«, lautete die Antwort. »Aber es gehört ebenso mir wie die Flaschen. Bringen Sie mir das.«
»Gewiss, Sir.«
Der Matrose reinigte das Behältnis mit klarem Wasser und zeigte auf eine Schicht aus rotem Siegelwachs, die verhinderte, dass Feuchtigkeit ins Innere eindrang.
Darunter sah Anjelica die Linie einer Lötnaht. Jemand hatte sichergehen wollen, dass der Inhalt den Zaren unversehrt erreichte. Sie vermutete, dass es sich um eine persönliche Nachricht an den Herrscher handelte. Infrage kam kaum König Ludwig, sondern eher der Champagner-Hersteller.
»Würden Sie es mir bitte geben?« Anjelica streckte die Hand danach aus.
Der Matrose blickte zu Lugaschin, und dieser wiederum schüttelte den Kopf, rückte an der Schirmmütze.
»Verhandelt der impertinente Drecksack schon wieder?«, erregte sich ihr Auftraggeber.
»Zehn Prozent«, sagte der Kapitän, der wie festgeschweißt an der Stelle verharrte. Die eingeschaltete Lampe klemmte er sich unter die Achsel. Hinter ihm glitten die schäumenden Wellen dahin, die Anatevka stampfte vorwärts zur Küste. Die Dunkelheit nahm den Himmel zunehmend in Besitz und drückte die Sonne unter den Horizont, als wollte er sie im Meer ertränken.
»Sir? Er will zehn.«
»Wegen des Silberkrams?«
»Ja, Sir.«
»Den kann er meinetwegen behalten, und es bleibt bei sieben.«
Anjelica gab das Angebot weiter. Ihr Auftraggeber handelte ihrer Meinung nach richtig. Der Silberwert lag nicht sonderlich hoch, mehr als zwanzigtausend würde diese flache Schatulle nicht bringen, auch nicht im historischen Kontext. Das Werbegeschenk einer Kellerei, die auf mehr Bestellungen des Zarenhofs hoffte, würde höchstens Veuve Clicquot für die hauseigene Sammlung interessieren.
Lugaschin verzog das Gesicht und steckte sich die nächste Zigarette mit dem Rest der letzten an. »Einverstanden. Aber jammern Sie nicht, wenn das Ding später mehr Millionen bringt als Ihr Gesöff.« Er ließ sich die Flasche wiedergeben, in der ein verbliebener Schluck gegen die Wände schwappte. »Wollen Sie versuchen?« Anbietend streckte er den Arm aus.
Bevor Anjelica etwas erwidern konnte, zerbarst das dickwandige Glas in Lugaschins groben Händen. Die scharfkantigen, grünlichen Splitter klirrten vor seinen Schuhen aufs Deck, der Champagner mischte sich mit Ostseewasser.
»Das war ungeschickt«, sagte Anjelica ärgerlich. Zu gerne hätte sie gekostet. Da die Flasche schon offen war, wäre es ein Privileg gewesen.
Lugaschin starrte auf seine zerschnittenen Finger und rutschte an der Reling herab, schlug auf den nassen Boden, ohne sich abzustützen. Die Zigarette blieb an seinen Lippen haften, Funken flogen auf und reisten mit dem Wind hinfort. Nach einem trockenen, erstickenden Laut entspannte sich sein Körper. Die Mütze fiel vom Haar, die Böen nahmen sie mit ins Meer. Die Taschenlampe glitt unter ihm hervor und warf ihren hellen Schein flach über das Deck.
»Was hat er?« Anjelica machte einen Schritt nach vorne, als zuerst der rechte Taucher ächzend zusammensackte, und danach auf der Stirn des linken ein Loch entstand, aus dem Blut rann. Auch er knickte ein und stürzte mit dem Gesicht voran auf den stählernen Untergrund.
Anjelica duckte sich und machte sich klein. »Scheiße«, wisperte sie furchtsam. Sie hatte sich niemals in Situationen mit Feuergefechten befunden, doch sie wusste, dass lautlose Schüsse die Männer umgebracht hatten. Von wo die Kugeln kamen, wusste sie hingegen nicht. Anjelica blickte sich nach dem Matrosen an der Kiste um und legte eine Hand vor den Mund, um den Schrei zu unterdrücken.
Der Mann lag rücklings auf dem Deck, mit ausgebreiteten Armen und Beinen, als sei er bei dem Versuch eingeschlafen, Gymnastik zu treiben. Der Lampenstrahl fiel auf ihn. Blut breitete sich um seinen Oberkörper aus und mischte sich mit dem Alkohol und dem Meereswasser; der Stoff des Schiffchens sog sich gierig voll.
»Sir, wir werden angegriffen«, rief sie aufgeregt und hechtete hinter die Winde. Ihr Herz wummerte in ihr wie der Bordmotor, ihr war heiß vor Angst. Ein kurzer Blick hinauf zur schummrig beleuchteten Brücke zeigte ihr beschlagenes, rot gesprenkeltes Glas. Der Mörder hatte den Steuermann ebenso eliminiert. Bei einer Beute im Wert von drei Millionen fiel dem Unbekannten das Töten offenbar leicht.
»Angegriffen?«, echote ihr Auftraggeber entsetzt. »Meine Schätze!«
Flackernd erwachten die Scheinwerfer der stampfenden, wogenden Anatevka, und gleißendes Licht flammte über das gesamte Deck.
»Und mein Leben, Sir!« Geblendet schloss Anjelica für Sekunden die Augen. »Rufen Sie die Polizei, die Küstenwache, irgendwen«, flüsterte sie hastig, als würde es verhindern, dass der Mörder von ihrer Existenz erfuhr.
Der Sprung in die Ostsee erschien ihr plötzlich verlockend. Aber die Kälte des Meeres würde sie ebenso umbringen wie eine Kugel, nur langsamer.
»Was ist mit der Mannschaft, Clark?«
»Tot. Jedenfalls all die, die ich sehen kann.«
Der Auftrag bedeutete ihr nichts, doch vielleicht konnten Verhandlungen mit dem Phantom an Bord ihr Leben retten. »Nehmen Sie die Flaschen!«, schrie Anjelica. »Ich weiß nicht, wer Sie sind und wie Sie aussehen! Lassen Sie mich am Leben! Bitte!«
Sie kam sich bei aller Furcht kindisch vor. Jemand, der kaltblütig mordete, würde sich von ihrem Betteln nicht abhalten lassen. Aber was blieb ihr sonst?
Die Maschine des Trawlers orgelte abrupt unter Volllast auf. Die Auspuffrohre röhrten schwarzen Qualm in die Höhe, und das Boot legte sich hart steuerbord.
Das überraschende Manöver ließ Anjelica aufschreiend hinter ihrer Deckung herausrutschen. Die Leichen von Lugaschin und seinen Leuten rollten und glitten über das nasse Deck und vollführten dabei grotesk-puppenhafte Bewegungen. Gebrochene Augen starrten sie an und durch sie hindurch.
»Clark? Halten Sie durch! Ich rufe ein paar Leute an! Ihre Position habe ich.«
Anjelica war ein viel zu leichtes Ziel, das wusste sie. Sie versuchte sich an einem verzweifelten Sprung zurück, doch bevor sie sich hinter die Winde werfen konnte, erhielt sie einen Schlag durch die Schwimmweste auf die rechte Schulter. Keine zwei Sekunden darauf folgte ein stechender Schmerz, der sich heiß in Arm und Rücken ausbreitete. Aus einem Impuls legte sie die Hand auf die Stelle und fühlte das warme Blut. Der unbekannte Mörder hatte sie getroffen.
Sofort sackte ihr Kreislauf ab, der Schock ließ den Blutdruck ins Bodenlose fallen.
»Halten Sie durch!«, vernahm sie die leiser werdende Stimme des Auftraggebers.
Alles in Anjelica verlangte die Flucht an einen Ort, wohin ihr der Killer nicht folgen würde. Sie kroch auf die Reling zu, mit der festen Absicht, sich lieber ins Meer zu werfen. Ihre Überlebenschancen erschienen ihr in den eisigen Fluten höher als gegen ein Magazin tödlicher Projektile. Vor ihr drehte sich alles, die Umgebung verschwamm.
Bei der nächsten Woge rutschten die Boxen mit dem uralten, wertvollen Champagner umher; eine davon stürzte um, und die Flaschen kullerten über die Anatevka.
Anjelica schob sich unter Schmerzen auf die Bordwand zu, die aufziehende Ohnmacht verdunkelte ihre Sicht. Das Deck schoss auf und nieder, mal sah sie weiße Schaumkronen auf den Wellenkämmen, dann aschgrauen Himmel mit nachtblauen Wolken.
Die silberne Schatulle rutschte unvermittelt an ihr vorbei und prallte gegen die Reling.
Dann schritt ein Paar gelber Gummistiefel in ihren Sichtbereich, um die der Saum eines grünen Friesennerzes pendelte. Die Gestalt, die ihren Kopf mit einer Kapuze schützte und unkenntlich war, bückte sich langsam und hob das Kistchen auf, steckte es in die Tasche.
Der Unbekannte wandte sich ihr zu, wie sie an den Schuhkappen sah.
»Nehmen Sie den scheiß Champagner«, sagte Anjelica keuchend und kraftlos. »Lassen Sie mich am Leben …«
»Clark! Clark, ich habe jemanden erreicht!«, rief ihr Auftraggeber. »Die Küstenwache macht sich auf den Weg.«
Eine der Flaschen hopste zwischen ihr und dem Unbekannten hindurch, zerschellte an der Bordwand, ohne dass der Killer Anstalten machte, den Verlust zu unterbinden. Schäumend verging der kostbare Alkohol wie bei einer nachträglichen Schiffstaufe. Es hätte den Mann nur eine kurze Fußbewegung gekostet, geschätzte 53000 Euro zu erhalten.
»Bitte, ich …« Anjelica sah plötzlich etwas Metallisches mit einem Ping vor sich auf das nasse Deck prallen, aufhüpfen und sich wirbelnd drehen, gefolgt von einem weiteren, gleichen Gegenstand.
Sie hatte Schwierigkeiten, die Dinge in ihrer schwindenden Wahrnehmung zu erkennen. Münzen waren es keine.
Dann kamen Schmerzen, neue Schmerzen, unmittelbar in ihrem Rücken, die sich grell durch Fleisch und Mark schnitten, sodass sie kraftlos den Kopf sinken lassen musste. Das Herz trommelte in ihrer Brust, dass es sie mehr peinigte als ihre Verletzungen.
Während die beiden leeren Patronenhülsen über Bord gespült wurden, starb Anjelica Clark durch zwei Schüsse, ohne den Grund für ihren Tod zu kennen.
Ein spieler ist nit gottes fründ.
Die spieler sind des tüfels kind.
aus Daß Narrenschyff ad Narragoniam (1494), von Sebastian Brant (1457–1521)
– INTERMEDIUM – CAPITULUM I
Heiliges Römisches Reich, Kurfürstentum Sachsen, Leipzig, Januar 1768
Ich habe selten, ach, was sag ich, noch nie einen derart talentierten Mann in meinem Lohn gehabt.« Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, der das gleichnamige Verlagshaus mit Druckerei gemeinsam mit seinem Vater führte, hob das Blatt mit dem Kupferstich. »Dürers Ritter, Tod und Teufel. Und Ihr habt wie lange zum Stechen dieser Platte gebraucht, Kirchner?«
»Einen halben Monat, Herr Breitkopf.« Bastian hielt die Kappe mit beiden Händen, die Finger fest darum geschlossen, als wollte er sie auswringen. Seine Aufregung machte ihm zu schaffen. Er stand vor dem Schreibtisch in Breitkopfs eindrucksvollem Arbeitszimmer und wusste nicht so recht, wie er sich verhalten sollte. Die Standuhr in der Ecke tickte überlaut, von draußen erklang das Klappern von Fuhrwerken. »Aber ich stach es nur, ich hab’s nicht entworfen.«
»Einen halben Monat, sagt er, als wär’s nichts.« Breitkopf, schon etwas älter, mit Weißhaarperücke und vornehm gekleidet, wie es sich für einen Mann seiner Position schickte, sah zu seinem Werkstattmeister, der schräg hinter Bastian stand. »Hat Er das gehört, Stock?«
»Das hab ich, Herr Breitkopf.« Stock führte die Aufsicht über die Druckerei und hatte entsprechend viel Erfahrung mit Kupferstechern.
»Und gelernt habt Ihr darüber hinaus« – Breitkopf sah auf Bastians Papiere – »Formschnitzer und Kartenmacher. Aus Altenburg.«
»Jawohl, Herr Breitkopf.« Bastian nickte und schämte sich heimlich für seine allzu einfache Garderobe. Für mehr hatte das Geld nicht gereicht. »Das Kupferstechen habe ich mir selbst beigebracht. Es fiel nicht schwer. Ist nur umgekehrt wie das Holzschnitzen.«
»Ihr seid wie alt?«
»Dreiundzwanzig.«
»Seit wann in Leipzig?«
»Vier Jahre, Herr Breitkopf. Vorher hatt ich eine kleine Werkstatt in Altenburg.«
»Und habt ein Weib und drei Kinder und vermögt das alles?«
»Wie gesagt, es fällt mir leicht.«
»Drei Kinder, ja, da kann man sagen, dass es Euch leichtfällt.« Er lächelte. »Ist die Frau mit Euch hierhergekommen?«
»Nein, Herr. Sie stammt aus Leipzig, Susanna, geborene Schöne, und vermag beinahe so viel wie ich. Das Kartenmachen lehnt sie ab, aber beim Kupferstechen liegt sie gleichauf mit mir.«
Breitkopf bekam sich vor Lachen nicht mehr ein. »Mein lieber Stock! Sage Er mir doch gleich nochmals, woher Er diesen Teufelskerl gezaubert hat!« Er schaute auf den Druck. »Unglaublich! Einfach un-glaub-lich!«
»Meister Kirchner kam vor einer Weile auf der Suche nach Arbeit zu mir und hörte sich um, ob es wohl was zu stechen gäbe. Kleinigkeiten, Illustrationen für Bücher und Romane und derlei«, holte Stock aus, dessen Kleidung anzusehen war, dass ihr Träger nicht schlecht verdiente. Er war etwa doppelt so alt wie Bastian. »Als ich mit meinen eigenen Augen sah, wie schnell und fein er stichelt und ritzt, nahm ich ihn in die Dienste. Inzwischen ist der Mann so gut, dass ich es besser fände, er arbeitete nur für Sie, Herr Breitkopf. Bekäme ihn die Konkurrenz, stünd’s baldigst schlecht um uns.«
»Famos! Ganz famos!« Breitkopf lehnte sich nach vorne, faltete die Finger zusammen, an denen Tintenspuren hafteten. »Wo wohnt Ihr, Kirchner?«
»Mit meiner Frau und meinen drei Kindern im Stadtpfeiffergässchen, zur Untermiete bei einem Amtmann, Herr Breitkopf.«
»Das geht nicht. Da ist die Stadt leidlich hässlich.« Breitkopf schlug einmal auf den Tisch. »Ihr zieht in die ausgebaute Dachkammer des Verlagshauses, in meinen Silbernen Bären, neben meinen guten Stock, damit Ihr noch mehr lernen könnt.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen!« Bastian konnte sein Glück kaum fassen. »Danke!«
»Und Ihr unterrichtet mir den Goethe gleich mit. Wenn er von zwei Meistern lernt, kann nur Gutes daraus entstehen. Das Salär, nun, es wird sich eine Summe finden, die um einiges über dem liegt, was Ihr gerade für einen Monat im Beutel habt. Soll mir keiner Hunger leiden, der für mich arbeitet.«
»Herr Breitkopf, ich weiß nicht, wie ich Ihre …«
»Papperlapapp. Ihr dankt mir mit Eurer Arbeit, Kirchner. Ihr seid übertalentiert.« Breitkopf pochte auf das Blatt mit dem Kupferstich. »Entweder es nimmt mit Euch ein gutes oder ein schreckliches Ende. Ein Mensch wie Ihr kann nichts dazwischen sein.« Er sah zufrieden zu Stock. »Das hat Er bestens gedeichselt. Meine Glückwünsche.«
»Zu Diensten, Herr Breitkopf.« Stock, der auf eine Perücke verzichtete und die längeren Haare im Nacken zu einem Zopf trug, grinste. »Aber wissen Sie: Ich wollt einfach weniger Arbeit haben, und mit einem Kupferstecher wie dem hier« – er schlug Bastian auf die Schulter und schüttelte ihn freundlich durch – »ist es gewiss.«
Die Männer lachten.
»Dann hinaus und den Umzug organisiert. Und über die Kartenherstellung reden wir bei Gelegenheit«, sagte Breitkopf. »Der Notenhandel erwartet mich. Da habe ich aus Italien ein paar schöne Liedchen bekommen, die vervielfältigt werden wollen.«
Bastian und Stock verließen das Besprechungszimmer von Breitkopf junior, das am Alten Neumarkt lag, am Sperlingsberge, wo die Verlagsfamilie ihren Hauptsitz errichtet hatte.
Bastian hatte schon gehört, mit welchen kaufmännisch geschickten Leuten er es bei den Breitkopfs zu tun hatte. Neben der Druckerei am Sperlingsberge hatten sie nach Abbruch des Ausspanngasthofes Zum Goldnen Bär ein stattliches Haus errichten lassen, was ihnen das Druckerzeichen des Bären beschert hatte. Als Vorder- und Hintergebäude nicht mehr ausreichten, hatten sie bis letztes Jahr noch ein weiteres Haus errichten lassen: der Silberne Bär. Ginge das Geschäft weiter, vor allem wenn der Notendruck mehr nachgefragt wurde, würden beide Häuser nicht mehr ausreichen.
Es roch in den Fluren und Treppenhäusern nach Druckerfarbe. Aus dem Erdgeschoss, wo sich die Druckerei und das Buchladengeschäft befanden, tönte das gelegentliche Rumpeln der Hand- und Schnellpressen, die harschen Zurechtweisungen der Gesellen, wenn die Lehrlinge sich dumm anstellten, aber auch das Plaudern und Parlieren der Kundschaft, die nach Büchern fragte und sich über die Inhalte der Werke austauschte.
Bastian liebte diese Stimmung und vermochte nicht zu glauben, dass er unter dem gleichen Dach wie dieser Zauber leben sollte. »Susanna wird sich überschlagen vor Glück.« Er reichte Stock die Hand. »Nehme Er meinen Dank.«
Der Mann schlug ein. »Aber nur, wenn wir uns duzen. Du bist mir ebenbürtig, vielmehr überlegen, und so müsst ich das Er oder Sie benutzen.«
»Es ist mir eine Ehre!«
Sie gingen die Treppen des dreistöckigen Gebäudes hinab, nahmen ihre Mäntel vom Haken.
Bastian setzte seine Kappe auf die kurzen, schwarzen Haare. Ein kalter Wind, der Schnee mit sich brachte, wehte die Menschen in die Gaststuben und Weinkeller oder in die Behausungen, je nachdem, wo sie sich wohlfühlten. »Sehen wir uns nachher in Auerbachs Keller?«
»Wenn dich deine Susanna vor die Türe lässt?«
»Ach, das wird sie. Ich feiere rasch mit ihr, danach mit dir und den anderen.« Bastian tat, als würde er Spielkarten halten. »Bei einer schönen Partie.«
Stock hob die Augenbrauen. »Hast du wieder Karten selbst gemacht? In der breitkopfschen Werkstatt?«
»Pssst!«, machte Bastian und blickte sich um.
»Du weißt, dass es verboten ist, eigene Karten zu erstellen. Die Steuer …«
»Ich verkaufe sie doch nicht. Ich … spiele nur damit«, gab er lachend zurück. »Die anderen sind mir einfach viel zu hässlich. Da macht nicht mal das Gewinnen Spaß, wenn ich die groben Gesichter der Damen darauf sehe. Und das Verlieren wird zum reinen Schmerz.«
Stock lachte. »Mir soll’s recht sein.« Er öffnete die Tür. »Bis nachher. Die erste Runde geht auf mich.«
Bastian folgte ihm hinaus und stemmte sich gegen den heulenden Sturm, der den glockenförmigen Mantel mal aufplusterte, damit die Wärme hinausfuhr, oder ihn zu einem Segel machte, gegen dessen Druck der junge Mann durch das Weiß stapfte, den Kopf gesenkt. Seinen Schal hatte er vergessen, die Handschuhe auch.
»He, Kirchner!«, traf ihn der Ruf durch das Heulen in den Rücken. »Auf ein Wort.«
Bastian blieb stehen und sah den jungen Goethe angelaufen kommen, der eigentlich nach Leipzig geschickt worden war, um sich dem Studium der Juristerei zu widmen; stattdessen wurde er zusehends zum Dichter, Denker und Künstler. »Ah, unser junger Dichter. Was gibt’s? ’s ist zu kalt zum Schwatzen.«
»Ein Gedicht! Aus dem letzten Jahr.« Goethe hielt den Dreispitz mit einer Hand fest, damit er auf dem Schopf blieb.
»Bitte nicht.«
»Doch, ich wag’s:
Ich sah, wie Doris bey Damöten stand,
Er nahm sie zärtlich bey der Hand;
Lang sahen sie einander an;
Und sahn sich um, ob nicht die Aeltern wachen,
Und da sie niemand sahn,
Geschwind – Genug sie machten’s, wie wir’s machen.«
Bastian grinste. »Ist mir zu barock.«
»Gedruckt wird’s später dennoch. Darauf könnt ich wetten.« Goethe, der sich in Gedichten und einer zarten Romanze mit einem Käthchen anstelle der Paragrafen versucht hatte, schien beleidigt. »Sehen wir uns im Auerbachs? Wir brauchen jeden Spieler, sei’s Whist, Deutsch Solo, Trente et quarante, Paffedix oder L’Hombre. Oder Schafkopf? Nach was immer uns der Sinn steht.« Er sah ihn treuherzig an. »Wein gäb’s auch.«
»Ein feiner Studenticus bist du.« Bastian wollte zusagen, als er einen hundegroßen Schatten ausmachte, der im Schneegestöber um sie herumschlich.
»Bei meiner Treu! Ein Vorwurf! Ich studiere eifrig: die Mitmenschen und ihre Gewohnheiten, um sie in meinen …« Goethe verfolgte Bastians Blick. »Siehst du den schwarzen Hund durch Schnee und Sturm streifen?«
»Ich sah ihn lange schon. Er schien mir nicht wichtig.« Das war gelogen. Bastian spürte, dass von dieser Kreatur nichts Gutes ausging.
»Betracht ihn recht! Für was hältst du das Tier?«
Bastian strengte seine Augen an. »Für einen Pudel. Einen … ziemlich großen.«
Goethe wich vor dem Tier zurück. Es schien ihm ebenso unheimlich zu sein. »Ist das üblich, wie er sich benimmt? Bemerkst du, wie in weitem Kreise er um uns her und immer näher jagt?«
Bastian drehte sich mit dem streunenden Hund, der unentwegt um sie pirschte und geschickt die hellen Stellen unter den Straßenlaternen vermied. Das Tier bewegte sich mit einer drohenden Lässigkeit, hielt den Blick auf die Männer gerichtet, als wären sie das Wild, das er für seinen Herrn stellte.
Bastian wollte nicht glauben, was er dann sah: Der Hund legte eine glühende Spur um sie! Die Pfotenabdrücke glommen gelbrot im Schneeweiß.
»Und irr ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel auf seinen Pfaden hinterdrein«, wisperte Goethe neben ihm entsetzt. »Ich trank keinen Schluck, ich schwör’s bei meinem Leben!«
Bastian sagte sich, dass es nicht sein konnte. »Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel. Es mag wohl Augentäuschung sein«, erwiderte er und ging vorsichtig weiter.
Doch Goethe verfiel in Kopflosigkeit, klammerte sich an ihn und seinen Hut. »Mir scheint es, dass er magisch leise Schlingen wie zu einer Fessel um unsre Füße zieht!«
»Studiosus, entsinne dich deines Verstandes«, sagte Bastian mit einem gespielten Lachen, um sich und ihm die Angst zu nehmen. »Ich seh ihn unsicher und furchtsam, weil er statt seines Herrn zwei Unbekannte sieht.«
Aber Goethe wollte sich nicht beruhigen »Der Kreis wird eng! Schon ist er nah!« Er schob Bastian vor sich. »Weg mit dir, Bestie! Fahr in die Hölle, der du entstiegen bist.«
Der Pudel blieb stehen, seine Größe übertraf die eines herkömmlichen Exemplars. In seinen Augen reflektierte das wenige Licht, und die Blicke wanderten zwischen den Männern hin und her, als suchte er sich aus, wen er zuerst angreifen wollte.
Dann, vollkommen überraschend, setzte er sich in den Schnee, als überließe er es den beiden, was als Nächstes zu tun sei. Wie vom eisigen Wind hinfortgezogen, war das Unheimliche verschwunden, als er plötzlich mit dem Schwanz wedelte und bellte und die Männer zum Spielen aufforderte.
Bastian löste Goethes Hände von seinem Arm. »Du siehst, Studiosus, es ist ein Hund und kein Gespenst. Er wedelt. Alles Hundebrauch.« Er lachte ihn aus. »So wirst du kein Held.«
»Wollt ich nie sein. Ich schreibe nur gerne über sie.« Goethe musste grinsen. »Ich benehme mich wie ein Tor.«
»Ein großer.« Bastians Zähne klapperten, die Böen hatten die Wärme restlos aus der Kleidung geblasen. Und er wollte endlich Susanna die herrliche Nachricht überbringen. »Bis später, Studiosus. Im Auerbachs.« Er lief zügig los. »Und lass dich nicht vom Geisterpudel beißen und in die Hölle zerren, zu seinem Herrn Mephistopheles!«
Goethe winkte ab und ging in die andere Richtung davon, wurde von den Flocken verschlungen.
Der Hund jedoch verharrte auf der Stelle und verwandelte sich in einen schwarzen Schatten im wirbelnden Weiß.
Bastian erreichte die Unterkunft im Stadtpfeiffergässchen, das Breitkopf als unansehnlich bezeichnet hatte. Er mochte dem Mann nicht widersprechen. Das düstere Sträßchen wand sich, die überwiegend hölzernen Gebäude, die dem Stadtrat gehörten, hatten ihre besten Tage hinter sich gelassen. Hier wohnten Schreiber, Ratsbedienstete und nicht zuletzt die Stadtpfeifer, von denen das Gässchen seinen Namen hatte.
Bastian, Susanna und die Kinder wohnten in einem Loch zur Untermiete, weil es dem eigentlichen Mieter, ein Gerichtsdiener mit einem Stall voll Nachwuchs, in den Wintermonaten zu kalt und zugig war. Durch das Dach und die Decke tropfte es bei Regen, weswegen sich Bastian über den harten Winter freute, auch wenn der Preis dafür häufiges Frieren bedeutete. Die Kinder hatten an den Eisblumen ein ewiges Staunen.
Bastian sperrte die Tür des schiefen, krummen Häuschens auf und rauschte mit einem lauten Jubelruf in die Stube, sodass Susanna und die Kinder erschrocken herumfuhren. In dicken, groben Jacken saßen sie um den Abendbrottisch; die Suppe dampfte in der Kühle des Raumes, es roch nach Fleischeintopf.
»Wer stürmt denn da herein wie die Wilde Jagd?«, rief Susanna halb vorwurfsvoll, halb glücklich. Ihr geflochtenes, blondes Haar schimmerte im Kerzenschein.
Bastian warf den Mantel an den Haken, die Kappe hinterher und stellte sich an den Bollerofen, reckte die gefrorenen Finger dagegen, um die Wärme aufzusaugen. »Die frohe Kunde, würde ich meinen.« Er sah, dass überwiegend Bohnen in der Suppe schwammen, die mit Mehl eingedickt worden war. Fleisch hatten nur die Kinder auf den Tellern.
»Frohe Kunde wird gern genommen. Lass hören.« Susanna füllte ihm eine Schüssel. »Ein neuer Auftrag?«
»Rate weiter.« Bastian grinste die Kinder an. »Ihr auch, los!«
»Zwei Aufträge!«, rief Johann.
»Gold«, krähte Ilse, und Armin war zu klein, um ein gescheites Wort zu sprechen, und brabbelte etwas vor sich hin.
»Wir ziehen um.« Bastian setzte sich mit geheimnistuerischer Miene zu ihnen. »Ich hatte eine Unterredung mit dem Breitkopf.«
Susanna lachte herzenswarm. »Welcher von den vielen?«
»Dem, der das meiste Sagen hat, wie ich denke. Johann Gottlob Immanuel.« Bastian griff ihre Linke und drückte sie, was seiner Frau Verwunderung auf ihre schönen Züge legte. »Ich bin angestellt. Bei der Buchdruckerei Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn.« Susanna ließ die Kelle fallen und schlug vor Freude eine Hand vor den Mund. »Und umziehen werden wir auch. Raus aus dem Loch und ab unter das Dach des Verlagshauses!«
»Ich … bei Gott dem Herrn!«, rief Susanna und fiel Bastian um den Hals. »Die ganze Arbeit, die ganze Mühe, die wir uns gegeben haben! Es zahlt sich aus!«
»Wir sind reich!«, rief Johann.
»Gold!«, rief Ilse erneut und patschte mit dem Löffel in die Suppe, dass es spritzte. Armin klatschte und lachte fröhlich, weil er die gute Stimmung sah und spürte.
Bastian stand auf und kramte im Schrank mit den Vorräten, fand eine verschlossene Flasche mit abgefülltem Fasswein. »Darauf stoßen wir an.« Er goss übermütig zwei Becher damit voll und kehrte zu seinen Lieben an den Tisch zurück. »Auf dass unsere Kinder besser leben als wir.«
»Und uns soll es auch gut gehen«, fügte Susanna mit einem schelmischen Lächeln hinzu und stieß mit ihm an. »Dagegen hätte ich fürwahr nichts einzuwenden.«
»Taler und Glück für uns!« Bastian küsste Susanna, die seine Zärtlichkeit erwiderte. Dann trank er von dem Wein, dem die lange Aufbewahrung nicht gutgetan hatte.
»Oh!« Susanna hustete. »Der braucht … Honig und Gewürze, fürchte ich fast. Viel Honig.«
»Ich weiß was Besseres.« Bastian nutzte die Gelegenheit für einen Vorwand. »In Auerbachs Keller will ich uns neuen holen.« Er stand auf und versuchte verstohlen, seine selbst gemachten Spielkarten aus der Schublade zu ziehen. »Sollte es später werden, dann musste ich mich durchprobieren, welcher der Beste ist.«
Susanna lachte. »Denkst du, ich merke es nicht?«
Bastian errötete und wandte sich um, versuchte sich an einem treuen Blick. »Was meinst du?«
Sie zeigte auf seine Tasche. »Du hast die Karten eingesteckt. Daher wird es lange dauern, und zwar ohne den vorgeschobenen Wein.« Susanna erhob sich, gab den Kindern Anweisung, mit dem Essen fortzufahren, und stellte sich vor ihn, legte ihre Arme auf seine Schultern und streichelte seinen Nacken. »Ich weiß um deine Leidenschaft für die Karten und das Kartenmachen. Aber ich sagte dir auch, dass ich es nicht gutheiße.«
»Susanna, die anderen Bilder sind hässlich, und …«
»Es ist zum einen verboten, Liebster. Wenn sie dich erwischen, droht eine Strafe. Und die Anstellung beim Breitkopf verlierst du obendrein«, unterbrach sie ihn sachte. »Und zum anderen erwächst nichts Gutes vom Spiel.«
»Wir treiben kein Hazard.«
»Und doch sind die Karten des Teufels Gebetbuch.«
»Auch die Geistlichen spielen damit.« Bastian räusperte sich. Er wollte sagen, dass Breitkopf sogar darüber nachdachte, in Bälde eine Kartenmanufaktur in sein Verlagshaus aufzunehmen, um nicht nur Bücher, Schriften und Noten zu drucken. Stock hatte es ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut. Aber er blieb stumm. Vielleicht würde sie ihm sonst die Anstellung dort verbieten.
»Das ist kein Grund und macht weder das Spiel noch die Pastoren und Pfaffen besser.« Susanna schmiegte sich an ihn, sie roch nach Lavendelseife und Frühling. »Lass es zu Hause.«
»Diesen einen Abend noch«, hielt er dagegen und küsste sie zärtlich auf die Nasenspitze. Dann machte er sich los und warf sich den Mantel um. »Bis nachher, meine Liebe, meine Herz-Dame!« Er sah zu den Kindern. »Und ihr: Hört auf eure Mutter!«
Bastian warf sich hinaus in den Schneesturm, bevor er ihre Antwort hören konnte, die ihm unter Umständen nicht gefiel. Seine Laune sollte nicht sinken, er fühlte sich gut und beschwingt.
Die Linke um sein Kartenspiel geschlossen, spurtete er das Stadtpfeiffergässchen entlang und erreichte den Eingang zu Auerbachs Keller, eine von Leipzigs ältesten Weinschenken, eingerichtet vor mehr als zweihundert Jahren vom Leipziger Stadtrat, Arzt und Hochschullehrer Stromer. Dass es die Wirtschaft so lange geben würde, hatte sich ihr Gründer gewiss nicht ausgemalt.
Bastian stolperte die steilen, ausgetretenen Stufen hinab und begab sich in die unterirdischen Weinstuben, vorbei an betagten, auf Holz gemalten Bildern.
Eines zeigte den Magier und Astrologen Faustus pokulierend mit den Studiosi, das andere ließ ihn auf einem Weinfass zur Türe hinausreiten. Bastian hatte Goethe einst starrend und sinnierend davor gefunden, benebelt vom Wein. Auf die Frage, warum er den Faustus so begaffe, hatte Goethe erwidert, er sei fasziniert vom Streben, Suchen, Irren und Doch-nicht-Finden, ohne den Verstand zu verlieren.
»Hier! Hier drüben, Kirchner!«, rief Stock durch die wabernden Unterredungen der Gäste, einem Rauschen, durch das Lachen und Rufe klangen.
In den Gewölbekellern saßen sie alle, die Ratsherren und Handwerker, die Gesellen und die Studiosi, die Verliebten und Verheirateten, umnebelt von Wein und Tabakdampf, bei Spiel und Musik, wenn jemand ein Instrument zur Hand hatte. Ansonsten wurde gesungen, wie Bastian von weiter weg hörte. Die kräftigen Stimmen ließen ein Lied erschallen, das von den Gewölbedecken zurückhallte.
Stock hatte zusammen mit Goethe und einem Rudel junger Leute einen Tisch ergattert. Krüge und Becher standen bereits darauf, Karten waren verteilt, teils ausgespielt, teils in den Händen.
Bastian erkannte das deutsche Blatt, von einfacher Wirtshausqualität und sicherlich oft nach vielen Stunden Spiel gerade gepresst, damit es länger hielt. Er sah die Flecken auf den Kartenrückseiten. Leichteste Übung für einen Winkelspieler, die Duelle für sich zu entscheiden, sofern er gut im Memorieren war.
»Da seid ihr!« Bastian bahnte sich einen Weg durch die Bänke und Menge, entschuldigte sich artig bei Remplern und hob Hüte auf, die er hinabfegte.
»Setz dich.« Goethe schob die jungen Kerle neben sich zur Seite. »Darf ich vorstellen: die Herren Frosch, Brandner, Siebel und Altmayer, tapfere Studiosi allesamt. Und wie man sieht: kein Geld für guten Zwirn.«
Bastian grüßte in die Runde und setzte sich, legte Mantel und Kappe hinter sich.
Die jungen Männer tagten schon länger und vertrieben sich die Zeit mit den schlechten Karten. Ihr Ton war rau und laut, die Scherze über Gegner oder andere Gäste im Keller waren grob. Man wollte die Partie Schafskopf noch zu Ende bringen, um dann etwas Neues anzufangen.
Der Gedanke, das fleckige Blatt anzufassen, widerte Bastian an. Das deutsche Spiel hatte ihm ohnehin nie gefallen. Er mochte die französischen Farben viel lieber, weil sie eleganter daherkamen.
»Was ist? Will keiner trinken? Keiner lachen?«, rief der pausbackige Frosch in die Runde, dem der Schalk aus den Augen leuchtete. »Ihr schaut, als spielten wir auf einem Sarg. Ich will euch lehren, andere Gesichter machen! Ihr seid ja heut wie nasses Stroh und brennt sonst immer lichterloh.«
»Er reimt wieder«, raunte Goethe kopfschüttelnd. »Das tut er immer, wenn er was getrunken hat.«
Bastian grinste.
»Oh, das vermag ich auch. Das liegt an dir. Du bringst ja nichts herbei«, murrte Brandner, der eine immense falsche Lockenpracht auf dem Kopf trug, und tätigte einen Stich. »Nicht eine Dummheit, keine Sauerei.«
»Ah, es liegt an mir, ja?« Frosch nahm seinen Becher und goss den Wein über Brandner aus. »Da hast du beides!«
Die Runde lachte, und auch Bastian musste grinsen.
»Zum Teufel mit dir, du doppelt Schwein!«, rief Brandner, wischte sich das Rot aus den Augen und warf die Karten auf den Tisch, die sich in der Pfütze sofort voll Rotwein sogen. »Das Spiel ist dahin. Und meine Perücke auch.«
»Als ob du mit dem Blatt gewonnen hättest«, erwiderte Siebel und legte lachend seine Hand offen. »Stich um Stich, mein Freund. Und rotes Haar kommt bei den Frauen gut an.«
»Weg damit, nur weg.« Altmayer, dessen linke Wange ein frischer Schmiss zierte, ließ sich von der Bedienung ein Tuch bringen, um den Wein aufzunehmen. »Spielen wir anderes.«
Bastian sah, dass Goethe fleißig in sein Notizbüchlein schrieb, als führte er Protokoll wie vor Gericht. Vermutlich ging es um Inspiration für eine neue Geschichte oder ein Gedicht. Dann fiel sein Blick auf den Tisch, grob gezimmert und das Holz feucht vom vergossenen Wein. Er wusste, dass sie darauf warteten, dass er ihnen die neuen Karten zeigte. Aber sie waren Bastian zu schade. Sie hatten weder Fettfinger noch andere Schmutzspuren verdient.
Frosch ließ sich mit dem Rücken gegen die Wand sinken. »Ach, was für ein schöner Abend.«
»Ja, mein Leipzig lob ich mir«, murmelte Goethe. »Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute.«
»Eingebildet, das kann man wohl von manchen im Keller sagen«, hielt der grobschlächtige Siebel dagegen und schaute zu Bastian. »Nun, was ist? Heraus mit deinen Karten!«
Bastian blickte zu Goethe, der versuchte, ein unschuldiges Gesicht zu machen, und sich in sein Büchlein vertiefte. »Woher weißt du, dass ich Karten habe?«
»Freund Goethe hat’s verraten.« Altmayer beugte sich nach vorne. »Aber wir behalten es für uns.«
»Nur sehen würden wir sie gerne«, fügte Brandner hinzu und orderte mit Gesten neuen Wein. »Es sollen Meisterwerke sein, hat er geprahlt. Und bei dir will er wie von Stock noch mehr die Feinheit im Schnitzen und Stechen lernen.«
Stock sah zu Bastian und schüttelte andeutungsweise den Kopf.
Aber die fordernden Blicke der Studenten und der Drang, Lob und Bewunderung für seine Arbeit zu erhalten, die er von Susanna nicht bekam, brachten ihn dazu, die Linke aus der Tasche zu ziehen und das Kartenspiel mit den französischen Farben zu zeigen. Den Platz für den Steuerstempel auf dem Herz-Ass hatte er ausgespart, um sich nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, er hätte das Kurfürstentum betrogen oder den Stempel gar gefälscht.
»Hier ist es.« Bastian gab die Karten einzeln in die Runde. »Meine Herren, vermeidet Flecken. Sie sind zu schön, um beschmutzt zu werden.« Kaum war die erste unterwegs, sonnte er sich in dem Staunen, das er auf den Zügen der jungen Männer sah. Auch Stock verzog anerkennend den Mund, was bei einem Meister wie ihm von größerer Bedeutung war als bei den Studenten. »Ich weiß, es gibt noch manches zu verfeinern. Aber wenn Breitkopf sich entschließt, ins Kartengeschäft einzusteigen, werd ich ihm die besten Blätter schaffen.«
»Daran zweifle ich nicht«, sagte Brandner beeindruckt.
»Nicht einen Herzschlag lang«, fügte Siebel hinzu. »Ich würd es auf der Stelle kaufen!«
Bastian lächelte glücklich und verfolgte den Lauf der Karten mit Sorge, es könnte seinen papiernen Kindern unterwegs etwas zustoßen, bevor sie wieder bei ihm ankamen. »Ich darf es nicht, Siebel.«
»Ach, es ist doch nur eine Frage der Taler«, warf Altmayer ein. »Bei wie vielen kommst du ins Straucheln?«
»Es ist nicht erlaubt«, blieb Bastian hart und fühlte Beklemmung.
Die Karten wurden nun munter zwischen den Studenten hin und her gegeben. Sie drehten und wendeten sie, hielten sie gar gegen das Licht, um zu prüfen, ob man hindurchsehen konnte, was die Aufmerksamkeit an den anderen Tischen weckte.
»Nun geschwind zurück zu mir!«, verlangte Bastian. Susanna hatte ihn gewarnt, dass es keine gute Eingebung sei, und recht behalten.
»Nur nicht so hastig.« Frosch streichelte die Kreuz-Dame. »Damit würd ich siegen.«
Bastian wandte sich um und warf Blicke durch das Gewölbe, ob sich die Ordnungsmacht oder ein Ratsherr auf den Weg zu ihnen an den Tisch machte.
Und tatsächlich: Ein Mann, geschätzte sechzig und in einem schlichten Gehrock, dessen Schnitt ebenso Eleganz und Militärisches anhafteten, kam leicht hinkend herüber. Die Augen wirkten alt, als hätten sie hundert Jahre gesehen und mehr. Die langen, schwarzen Haare mit den Silbersträhnen trug er im Zopf, gehalten von einem dunklen Samtband. Vom verzierten Dreispitz tropfte Schmelzwasser.
Bastian erstarrte. An seiner Seite lief der übergroße, schwarze Pudel, der ihn und Goethe im Schneegestöber erschreckt hatte. Er sah auf den Boden des Kellers, ob sich an den Pfoten glühende Abdrücke abzeichneten, aber das Kunststück blieb aus.
»Die Karten her!«, zischte er in die Runde und streckte die Hände aus.
Schon hatte sie der Mann erreicht. Der schwarze Hund setzte sich neben ihn, die Augen abwechselnd auf den Kartenmacher und Goethe gerichtet, als wollte er Lob von seinem Herrn, dass er die Männer erneut aufgespürt hatte.
Wie Wild gestellt.
»Guten Abend«, grüßte der Mann mit sonorer Stimme, und die Studenten fuhren erschrocken zusammen, bemerkten ihn erst in dieser Sekunde. »Verzeiht, die Herren Studiosi, aber ich kam nicht umhin, diese Karten« – er streckte eine dürre Hand mit langen, gefeilten Nägeln aus, und der Zeigefinger richtete sich auf das Spiel – »zu bemerken. Sie sind meisterlich. Wem gehören sie, und wo kann man sie erstehen?«
Die Männer sahen sich schweigend an und suchten nach einer Ausflucht. Goethe stierte auf den Pudel und machte sich noch kleiner.
»In Frankreich hab ich sie gekauft«, sagte Bastian schließlich mit allem Mut zur wahrhaftigen Lüge. »Noch ganz frisch. Aus Lyon.«
»Ah, Lyon. Die Stadt der Kartenmachermeister.« Der Mann deutete eine Verbeugung an. »Dietrich mein Name. Aus dem schönen Leipzig. Nun, wenn sie aus Lyon sind, frage ich mich, wo der Steuerstempel auf dem Kreuz-Buben abgeblieben ist?«
Bastians Herz schlug bis zum Hals. »Oh, ich … sie fielen mir ins Wasser, und …«
Dietrich lachte freundlich. »Fürchtet mich doch nicht, mein Herr. Ich bin kein Mann der Obrigkeit, sondern ein Freund und Liebhaber der Karten.« Er beugte sich zu ihm. »Ihr wart es. Ihr habt sie gemacht.«
»Es sind nur Proben«, versuchte es Bastian wieder. »Um einem Fabrikanten zu beweisen, dass ich es kann.«
»Ihr könnt es, ganz ohne Zweifel. Ihr seid ein besserer Meister als der Stock.« Grüßend nickte er zu dem Mann, der aufgrund seines Alters in der Runde junger Leute auffiel. »Es ist nicht bös’ gemeint.«
»Ich weiß, wie Ihr es meint. Und es ist die Wahrheit«, sagte Stock, auf dessen Gesicht Misstrauen geschrieben stand. »Die Probedrucke werden wir gleich verschwinden lassen. Es geschah von Kirchner nicht aus verbrecherischer Absicht.«
»Ich weiß, ich weiß.« Dietrich lächelte und zeigte frische weiße Zähne, unverbraucht und ohne Färbung, wie Bastian sie nur von kleinen Kindern kannte. »Macht Ihr mir ein Spiel? Nach meinen Vorgaben, Herr Kirchner? Es soll Euer Schaden nicht sein.« Wie aus dem Nichts hielt er einen Lederbeutel in der krallenhaften Hand, in dem es klirrte. »Wie schnell könntet Ihr das bewerkstelligen?«
»Hey, da! Alter Mann! Ich fragte Kirchner zuerst«, beschwerte sich Siebel.
»Und ich habe mehr Geld«, warf Altmayer ein. Ihre Blicke, die sie dem Betagten zuwarfen, wurden feindselig.
Der Pudel knurrte drohend und zog die Lefzen zurück. Es gefiel ihm anscheinend nicht, wie mit seinem Herrn gesprochen wurde.
Bastian rückte weg von dem Tier und wäre auf der Stelle gegangen, wenn die Gruppe nicht noch seine Karten gehabt hätte.
»Aber, aber, die Herren Studiosi«, beschwichtigte Dietrich sie mit einem fröhlichen Lachen und setzte sich. »Wir müssen uns um nichts streiten, was wir ohnehin nicht bekommen.« Er sah Bastian an. »Ist es nicht so?«
Bastian sah in die uralten Augen, in deren Pupillen Flammen tanzten und Blut floss, das das Weiß färbte und dem Mann etwas Dämonisches verlieh. »Noch habe ich das Recht nicht dazu«, stammelte er und war kurz davor, dem Unbekannten dennoch zuzusagen. Aus Angst. Das Geld im Beutel, das beim Klimpern nach Gold klang, scherte ihn nicht.
»Ihr könntet es heimlich tun, und es müsste niemand erfahren«, raunte Dietrich verführerisch. »Tut mir den Gefallen. Ich erfülle Euch dafür jeden Wunsch, den Ihr Euch erdenken könnt.«
»Lass es gut sein, Dietrich«, rief Siebel. »Kirchner gehört zu uns.«
»Da hört, was er verspricht! Jeden Gefallen, sagt er! Pah! Nur Gott und der Teufel vermögen alles auszurichten, aber nicht Ihr«, maßregelte Altmayer den Alten mit erhobenem Zeigefinger, als wäre er ein Pfarrer. »Aber nicht der Mensch.«
»Den Teufel spürt das Völkchen nie. Und wenn er sie beim Kragen hätte«, erwiderte Dietrich und nahm den Krug mit Wein entgegen, den eine Kellnerin brachte. Er zahlte, die Runde ging auf ihn. »Aber nun lasst uns auf den geheimen Kartenmeister trinken und unseren Zwist vergessen. Möge er bald seine Spiele machen und uns damit erfreuen.« Er erhob sich, um die Becher und Gläser der Studenten zu füllen.
Bastian glaubte zu sehen, dass Dietrich kurz vor dem Ausgießen eine Prise weißliches Pulver, fein wie Mehl, in den Wein rieseln ließ. Aber mit dem nächsten Blinzeln war es weg. Er konnte sich getäuscht haben.
Dietrich verteilte den Wein, der seltsamerweise nur für Siebel, Brandner, Frosch und Altmayer reichte, und bestellte flugs eine neue Karaffe.
»Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!«, rief Altmayer ausgelassen nach dem ersten Schluck und lachte gellend und hysterisch. Er hielt das Glas an den Tischrand und tat, als würde er aus dem Holz zapfen. »Ha, schaut! Noch mehr Rebensaft! Ich seh ja, wie es aus dem Tisch gluckert und sprudelt.«
Bastian verfolgte mit Unglauben, wie die vier Studenten spielten, als käme der Nachschub direkt aus dem Möbel gelaufen, sehr zur Erheiterung der übrigen Besucher. Er nutzte die Gelegenheit, um hastig seine Karten zu greifen und einzustecken. Goethe schrieb wie besessen in sein Büchlein.
Dietrich erhob sich. »Ich sehe schon, die Herrschaften vergnügen sich und andere. Da suche ich das Weite.« Er beugte sich nach vorne. »Was die Karten angeht, Meister Kirchner, denkt an mein Angebot. Es mag sein, dass Ihr es doch annehmen wollt.« Er ging leicht hinkend hinaus.
Bastian schauderte, als der schwarze Riesenpudel ihm noch einen Blick zuwarf, sich gähnend erhob, als wollte er seine gefährlichen Zähne zum Abschied zeigen, und hinter seinem Herrn hertrottete. Das Vieh entspringt der Hölle.
Seine Gedanken wurden von lautem Gezeter an seinem Tisch und Gelächter aus dem Gewölbe unterbrochen. Die Gäste hatten ihren Spaß mit den betrunkenen Studenten, die sich mit entrückten Gesichtern von ihren Stühlen erhoben und sich umschauten, als stünden sie nicht in einem Gewölbe, sondern würden etwas anderes sehen.
»Wo bin ich? Welches schöne Land umgibt mich?«, rief Altmayer begeistert.
»Weinberge!«, sagte Frosch freudig. »Seh ich recht?«
Siebel langte an die Nase von Brandner. »Und Trauben gibt es hier. Lecker und saftig.« Er zog sein Messer, und ein Aufschrei ging durch die Umstehenden. Das Vergnügen drohte einen unerwarteten Ausgang zu nehmen. »Die schneiden wir uns gleich vom Stock.«
Die vier fassten sich gegenseitig an die Nasen und packten die Taschenmesser aus. Aber bevor sie sich etwas antun konnten, fielen ihnen Bastian, Goethe, Stock und einige Beherzte in die Arme und hielten sie davon ab.
Da war Dietrich zusammen mit seinem unheimlichen Hund längst verschwunden.
Kapitel I
Fürstentum Monaco, Monte Carlo
Enrico Pedro García Hermano trug einen klassischen, sehr teuren Smoking mit schmaler Krawatte und kam sich damit fehl am Platze vor. In der stadtberühmten Buddha-Bar verkehrten zwar Reiche wie er, aber die meisten im Casual-Look. Zwar musterte man ihn nicht – in Monaco war man es gewohnt, Abendgarderobe zu sehen –, aber er spürte zunehmend Unlust, länger zu verweilen.
Mit einer Hand rührte Enrico den Drink, der vor ihm auf dem Tresen stand. Der Geschmack sagte ihm zu. Der Barkeeper hatte »very sophisticated« genuschelt, und Very Sophisticated stellte sich als Wodka mit irgendwas heraus, vermutlich Ingweressenz und selbst gemachter Sirup. Doch das beschwingte Gefühl, das der Alkohol zuerst hatte entstehen lassen, war verflogen.
Sein Abenteuer hätte längst beginnen sollen. Der Zweiundvierzigjährige rief sich selbst zur Ordnung. Der Ort, der sehr schick und gediegen ausgestattet war, konnte nichts für seine Unruhe.
Der mit dunklem Holz vertäfelte Gastraum wurde beherrscht von der Bar auf der einen und dem geschätzt drei Meter großen, sitzenden Buddha auf der gegenüberliegenden Seite. Während man sich im Erdgeschoss mit Drinks und Snacks begnügte, wurde auf der Empore und in den Nebenräumen wie in einem Restaurant gespeist. Ein DJ, der furchtbar angesagt war und dessen Namen sich Enrico partout nicht merken wollte, legte blubbernde Club-Musik auf. Das Licht war angenehm, leise Gespräche waberten unter der Musik entlang, gelegentlich erklang ein Lachen.
In regelmäßigen Abständen lief die modelhafte Empfangsdame in weißem Kleid, mit Tablet-PC, Headset und einem Bodyguard aufmerksamkeitserregend durch das Lokal, um einen neuen Gast persönlich an seinen Platz zu geleiten. Dazu gehörten lokale Größen ebenso wie VIPs aus Hollywood oder aus dem Gesellschaftsleben der Welt. Monaco blieb beliebt.
»Un autre, Monsieur? Peut-être un …«, bemühte sich der Barkeeper um Enrico.
»No, merci.« Er lächelte ihm freundlich zu, da ja auch der Angestellte nicht für seine schlechte Laune verantwortlich war, und lehnte sich gegen den Tresen, zog sein Smartphone hervor. Vielleicht verscheuchte eine nette Nachricht seine Ungeduld. In der Tat beinhalteten die E-Mails Erfreuliches.
Erstens: Sein Gestütsverwalter ließ ihn wissen, dass der Kauf des Araberhengstes aus Abu Dhabi nach langen Verhandlungen durch sei.
Zweitens: Die neuesten Umsatzzahlen besagten, dass er den Absatz von Schnittrosen nach Russland um einundzwanzig Prozent steigern konnte. Seine Kontakte und die neuen Moskauer Geschäftspartner, mit denen man sich besser nicht anlegte, zahlten sich endlich aus. Da von jeder verkauften Rose umgerechnet zwei Eurocent in eine wohltätige Stiftung flossen, hatten auch die Glücklosen was davon.
Zudem wünschte ihm seine Verlobte einen wunderschönen Abend via Kurznachricht.
Enrico steckte das Smartphone mit gestiegener Laune weg und gratulierte sich zur besten, schönsten, liebevollsten Freundin der Welt. Er korrigierte den Sitz des Platinrings an seiner rechten Hand, der in Form einer Rose und mit einem Diamantenensemble als Tautropfen gestaltet war. Kitschig. Teuer. Pure Absicht. Passend für Florecita, das Blümchen, wie man ihn wenig schmeichelnd in seiner Heimat Ecuador nannte, weil er seine Millionen mit dem Export von langstieligen Rosen machte.
Enrico grinste. Ihm war egal, wie sie ihn nannten und zu beleidigen versuchten. Lieber spielte er mit dem Image, was seine Neider weiter anstachelte.
»Monsieur!« Er winkte den Barkeeper zu sich und streifte die lockigen braunen Haare aus den Augen. Einen Drink würde er noch nehmen und anschließend ins Casino wechseln. »Vôtre meilleur Wodka. Pure et sans des glaçons.«
»Bien sûr, Monsieur.«
Enrico hatte das Getränk auf seinen Reisen zu schätzen gelernt. Der lukrative russische Markt war besonders umkämpft, da die Damen dort solche Aufmerksamkeiten ihrer Männer und Verehrer schätzten. Seit er sich mit ein paar Herren aus Moskau getroffen hatte, um eine Vereinbarung zu schließen, lief es besser als je zuvor. Seine Eltern kümmerten sich um die Rosenfelder, er um die Geschäftsfelder.
Das viele Geld floss sowohl in wohltätige Projekte, die er gemeinsam mit seiner Verlobten aussuchte, und in seine universelle Sammelleidenschaft – falls es gerade keine neuen Pferde zu kaufen gab. Deswegen befand er sich in Monaco. In Monte Carlo. In der Buddha-Bar. Auf Abruf.
Enrico hatte schon lange nicht mehr warten müssen, und er versuchte, sich einzureden, dass es seine Vorfreude auf das Ereignis steigerte.
Das geschliffene Glas mit dem kristallklaren Wodka wurde vor ihm abgestellt, der Alkohol schwappte gegen den Rand und rann langsam in Schlieren herab.
Sein Smartphone vibrierte, als er nach dem Drink greifen wollte. Ein Anruf.
In der Hoffnung, es sei die erlösende Nachricht, die sein Herumsitzen beendete, nahm er das Gespräch des unbekannten Anrufers entgegen. »Oui?«
»Verzeihen Sie mir, dass ich Englisch mit Ihnen spreche, Señor García Hermano«, vernahm er eine ältere Männerstimme, die mit einem leichten Akzent redete. »Mein Spanisch ist nicht besonders gut, und das Französisch liegt mir nicht, auch wenn man damit in Monaco am besten fährt.«
»Kein Problem, Señor.«
»Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen.«
Enrico runzelte die Stirn. Es ging offenbar nicht um das Abenteuer, auf das er wartete. »Tut mir leid, aber ich …«
»Sie haben etwas, das ich gerne erwerben würde«, redete der Mann einfach weiter. Er schien es gewohnt zu sein, dass man ihm zuhörte.
»Das kann vieles sein, Señor. Ich wünsche Ihnen einen …« Er nahm das Smartphone vom Ohr und wollte den Anruf beenden, bevor das Gespräch das bisschen gute Restlaune ruinierte.
»Wenn Sie es mir nicht verkaufen, wird es übel für Sie. Beim Supérieur«, drang die Stimme leise durch die Musik des Clubs.
Enrico hielt inne. Wenn er etwas noch weniger mochte als das Warten, dann waren es Drohungen. Rasch hob er das Telefon in die alte Position. »Ihren Namen, Señor? Den habe ich nicht verstanden.«
»Der spielt erst dann eine Rolle, wenn wir beide ins Geschäft kommen. Ich weiß, dass Sie gerade in Monte Carlo sind und gedenken, den Gegenstand meiner Begierde leichtfertig aufs Spiel zu setzen.«
Nun schlug der Ärger in Unbehagen um. »Ich denke nicht, dass ich ihn verkaufe. Weder an Sie noch jemand anderes.«
»Ich biete Ihnen …«
Dieses Mal fiel Enrico dem Unbekannten ins Wort. »Geld interessiert mich in diesem Fall nicht, Señor.«
»Nun gut. Sie sollten wissen, dass Sie später einem meiner Leute begegnen werden. Ein sehr guter Mann. Es wäre für Sie ein Gewinn, wenn Sie mir den Gegenstand jetzt verkaufen.«
Enrico blickte sich in der Bar um. »Sind Sie hier?« Es gab außer ihm im Erdgeschoss niemanden, der telefonierte.
»Nein, Señor. Aber ich kann das spielend leicht arrangieren, wenn Sie mir dieses Wortspiel erlauben.«
»Rufen Sie mich nie wieder an.« Enrico drückte das Gespräch weg und steckte das Smartphone ein. Gleich morgen früh würde er seinen Sekretär fragen, ob es Anrufe des Unbekannten in Ecuador gegeben hatte. Dass Enrico sich in Monaco aufhielt, war kein großes Geheimnis, aber dass der Unbekannte weitere Informationen hatte, erzeugte kein gutes Gefühl.