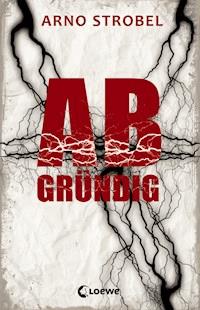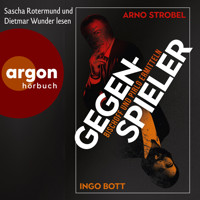9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du hast die App auf deinem Handy. Sie macht dein Zuhause sicherer. Doch nicht nur die App weiß, wo du wohnst ... Der neue Psycho-Thriller von Nr. 1-Bestseller-Autor Arno Strobel Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Hamburg-Winterhude, ein Haus mit Smart Home, alles ganz einfach per App steuerbar, jederzeit, von überall. Und dazu absolut sicher. Hendrik und Linda sind begeistert, als sie einziehen. So haben sie sich ihr gemeinsames Zuhause immer vorgestellt. Aber dann verschwindet Linda eines Nachts. Es gibt keine Nachricht, keinen Hinweis, nicht die geringste Spur. Die Polizei ist ratlos, Hendrik kurz vor dem Durchdrehen. Konnte sich in jener Nacht jemand Zutritt zum Haus verschaffen? Und wenn ja, warum hat die App nicht sofort den Alarm ausgelöst? Hendrik fühlt sich mehr und mehr beobachtet. Zu recht, denn nicht nur die App weiß, wo er wohnt … »Bei Arno Strobels Thrillern brauchen Sie kein Lesezeichen, man kann sie sowieso nicht aus der Hand legen. Packend und nervenzerreißend!« Sebastian Fitzek
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Arno Strobel
Die App – Sie kennen dich. Sie wissen, wo du wohnst.
Psychothriller
Über dieses Buch
Du hast die App auf deinem Handy.
Sie ist unheimlich praktisch.
Du kannst dein ganzes Zuhause damit steuern.
Jederzeit. Von überall.
Die App ist sicher.
Das sagen alle.
Aber was, wenn nicht?
Deine Frau verschwindet.
Es gibt keine Spur.
Keiner glaubt dir.
Du bist allein.
Und sie wissen, wo du wohnst.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arno Strobel liebt Grenzerfahrungen und teilt sie gern mit seinen Lesern. Deshalb sind seine Thriller wie spannende Entdeckungsreisen zu den dunklen Winkeln der menschlichen Seele und machen auch vor den größten Urängsten nicht Halt.
Alle seine bisherigen Thriller waren Bestseller, »Offline« stand wochenlang auf Platz 1 der Bestsellerliste. Arno Strobel lebt als freier Autor in der Nähe von Trier.
www.arno-strobel.de
www.facebook.com/arnostrobel.de
@arno.strobel
Außerdem bei FISCHER Taschenbuch erschienen:
»Der Trakt«, »Das Wesen«, »Das Skript«, »Der Sarg«, »Das Rachespiel«,» Das Dorf«, »Die Flut«, »Im Kopf des Mörders – Tiefe Narbe«, »Im Kopf des Mörders – Kalte Angst«, »Im Kopf des Mörders – Toter Schrei«, »Offline«, »Sharing«, »Fake«, »Der Trip«, »Stalker«, »Mörderfinder – Die Spur der Mädchen«, »Mörderfinder – Die Macht des Täters«, »Mörderfinder – Mit den Augen des Opfers«, »Mörderfinder – Stimme der Angst«
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Epilog
Nachwort
Wichtiges Update
Podcast-Hinweis
Für Nina
Computer sind Geschöpfe menschlicher Geschöpfe
Andreas Tenzer, deutscher Philosoph und Pädagoge
Prolog
Als er aufwacht, fühlt es sich so an, als müssten seine Lider gegen einen Widerstand ankämpfen.
Während sein träge arbeitender Verstand zu verstehen versucht, was das zu bedeuten hat, nimmt er verwaschene, konturlose Flecken wahr. Er zwinkert ein-, zweimal, was das Bild allerdings nicht klarer macht. Er überlegt, ob er am Vorabend zu viel getrunken hat, kann sich aber seltsamerweise nicht erinnern.
Er möchte die Hand heben, um sich mit Daumen und Zeigefinger die Schlieren von den Pupillen zu wischen, doch sein Arm gehorcht ihm nicht. Mehr noch, er spürt ihn nicht mehr.
Panisch versucht er, den anderen Arm zu heben, ohne Erfolg.
Binnen weniger Schläge beschleunigt sein Herz vom gleichgültigen Ruherhythmus zum Spurt. Ist er gefesselt? Was für ein absurder Gedanke. Zudem würde er dann ja seine Gliedmaßen spüren können. Aber was, zum Teufel, passiert eigentlich gerade?
Hat er ungünstig gelegen, und der Arm ist ihm eingeschlafen? Das war schon öfter passiert, allerdings immer nur bei einem Arm oder Bein, die restlichen Gliedmaßen ließen sich ganz normal bewegen.
Sein Verstand brüllt ihn an, dass er sich sofort aufrappeln soll, dass er unmöglich gelähmt sein kann. Unter Aufbietung aller Willenskraft versucht er erneut, die Lage der Arme zu ändern, der Beine, der Füße, wenigstens einen Finger zu heben … Nichts. Nicht einmal den Kopf kann er auch nur einen Zentimeter drehen. Lediglich seine Augenmuskeln funktionieren, so dass er die Augen bewegen kann und zumindest die Schlieren verschwinden.
Er starrt gegen eine mit mattsilbernen Alu-Paneelen abgehängte Decke. Nicht sein Schlafzimmer.
In der zunehmenden Panik atmet er immer hektischer.
Konzentrieren, befiehlt er sich. Du musst dich, verdammt nochmal, konzentrieren. Schau dich um.
Schräg über ihm ist eine flache, quadratische Lampe angebracht, durch deren Milchglas sich das kalte Licht von Neonröhren drückt.
Sein Blick richtet sich nach links, heftet sich auf eine weitere Lampe, etwas kleiner als die über ihm. Am unteren Rand seines Sichtfeldes schimmert etwas Dunkles, das seine Position verändert. Doch um es deutlicher sehen und erkennen zu können, müsste er den Kopf wenigstens ein kleines Stück zur Seite drehen, was er aber trotz aller Anstrengung nicht schafft.
Er befürchtet, dass die Angst schon bald völlig von ihm Besitz ergreifen und auch seine Gedanken lähmen wird. Das darf er nicht zulassen. Er muss sich zwingen, strukturiert zu denken.
Vielleicht ist das alles nur ein Traum? Sein Unterbewusstsein hat ihm im Schlaf schon die verrücktesten Dinge vorgegaukelt. Dass er in eine bodenlose Dunkelheit gefallen ist oder dass er fliegen konnte.
Aber das ist kein Traum, denn egal, wie deutlich diese Sequenzen gewesen waren, sie haben sich nie so real angefühlt wie die Situation jetzt. Zudem tauchen unvermittelt Erinnerungsfetzen auf, und diese Bruchstücke reichen aus, seinen Pulsschlag noch weiter zu beschleunigen.
Er ist von einem Geschäftsessen nach Hause gekommen. Und, ja, er hatte einige Gläser Wein getrunken, aber er war nicht betrunken gewesen. Seine Frau hatte Nachtdienst. Er ist in die Küche gegangen, hat sich Saft aus dem Kühlschrank genommen und ein paar Schlucke getrunken. Anschließend hat er das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet und wollte zur Couch gehen, aber … er kann sich nicht erinnern, sie erreicht zu haben. Zwischen diesen wenigen Sekunden und seinem Erwachen gerade gähnt ein dunkles Loch.
Ein Geräusch neben ihm zieht seine Aufmerksamkeit zurück in den Raum mit der silbernen Decke. Ein … Klappern.
Er möchte »Hallo!« rufen und »Hilfe!«, doch seine Stimmbänder gehorchen ihm ebenso wenig wie seine Gliedmaßen. Erneut greift die Panik mit kalten Klauen nach ihm, und er spürt, dass er sich ihr nicht mehr lange widersetzen kann.
Ruhig, beschwört er sich selbst. Denk nach. Es muss eine Erklärung für all das geben.
Wieder Geräusche neben ihm. Jemand befindet sich mit ihm in diesem Raum, da ist er sich jetzt ganz sicher. Ist es derjenige, der ihn in diese Situation gebracht hat? Natürlich muss er es sein. Wer sonst würde irgendwelchen Beschäftigungen nachgehen, während jemand gelähmt neben ihm liegt?
Er überlegt, ob er nackt ist, und fragt sich im selben Moment, ob es nichts Wichtigeres gibt, über das er sich Gedanken machen sollte. Zum Beispiel die Frage, was dazu geführt hat, dass er anscheinend bewegungsunfähig ist, aber trotzdem atmen und seine Augen bewegen kann.
Vielleicht liegt er ja in einem Krankenhaus? Nach einem Schlaganfall? Aber würde dann nicht seine Frau an seinem Bett sitzen und ihm die Hand halten? Mit ihm reden und ihm erklären, was passiert ist?
Also muss etwas anderes geschehen sein. Etwas, von dem sie nichts weiß, denn wenn …
Der Kopf schiebt sich so unvermittelt in sein Sichtfeld, dass er befürchtet, sein Herz bliebe stehen.
Mund und Nase des Mannes sind von einer grünen Stoffmaske bedeckt, die Haare unter einer Haube in gleicher Farbe verborgen, so dass lediglich die Augen zu sehen sind.
Ein Arzt. Ein Chirurg. Also doch ein Krankenhaus?
Als sich der Mann etwas weiter über ihn beugt und eine Hand auftaucht, während die Augen des Mannes offenbar eine Stelle auf seiner Brust fixieren, stockt ihm der Atem. Die in einem Gummihandschuh steckenden Finger umschließen ein Skalpell, dessen Klinge im diffusen Licht silbrig glänzt und das sich langsam auf seinen Brustkorb senkt.
Nein!, schreit er innerlich auf. Tu das nicht! Ich bin nicht narkotisiert. Siehst du denn nicht, dass meine Augen geöffnet sind und sich bewegen?
Als hätte der Mann seine innere Stimme gehört, hebt sich die Hand und verschwindet wieder aus seinem Sichtfeld. Vor Erleichterung füllen sich seine Augen mit Tränen, so dass er den Kopf nur noch verschwommen sieht. Doch eine weitere Erkenntnis, die ihm endgültig den Verstand zu rauben droht, drängt die Erleichterung beiseite.
Auch wenn er nicht einmal den kleinen Finger rühren kann, ist offenbar eines nicht ausgeschaltet: seine Empfindungen. Er hat deutlich die Tränen gespürt, als sie ihm über das Gesicht gelaufen sind, also wird er auch etwas anderes empfinden können. Schmerz. Sein Blick sucht hektisch nach der Hand mit dem Skalpell, bleibt am Oberkörper des noch immer über ihn gebeugten Mannes hängen und liefert die nächste, grausame Erkenntnis:
Das ist kein Krankenhaus, und der Mann ist kein Arzt.
Ein Arzt in einem Krankenhaus trägt keine über und über mit Blut beschmierte weiße Gummischürze.
So etwas trägt ein Schlachter.
1
»Danke für das phantastische Essen.« Linda hob ihr Weinglas und prostete Hendrik zu, die Blicke ineinander versunken. »Und für den wundervollen Abend.«
»Ja, er war wundervoll«, entgegnete Hendrik und hob ebenfalls sein Glas. »Und er ist es noch immer.«
Während sie tranken, fiel sein Blick auf den schimmernden Ring an ihrem Finger, und wie jedes Mal, wenn er daran dachte, dass sie in wenigen Tagen heiraten würden, fühlte es sich an, als wollte sein Herz überlaufen.
Sie stellten die Gläser auf dem massiven Esstisch ab. »Bist du aufgeregt?«
Ein sanftes Lächeln umspielte ihre Lippen. »Wegen der Reise nach Namibia?«
Er schmunzelte. »Ich dachte eher an den Grund für diese Reise.«
»Ja, ich bin aufgeregt.« Linda ergriff seine Hände und hielt sie fest. »Und ich freue mich sehr. Obwohl wir schon ein Jahr zusammen hier wohnen … es wird anders sein.«
Für einen Moment betrachtete er ihr von langen schwarzen Haaren eingerahmtes Gesicht, dem der italienische Einschlag von der Familie ihres Vaters deutlich anzusehen war, dann trafen sich ihre Lippen zu einem zärtlichen Kuss.
Nachdem sie sich wieder voneinander gelöst hatten, wischte er in einer übertriebenen Geste durch die Luft und blickte verklärt gegen die Decke. »Die Namib … Wir werden nachts im Dachzelt unseres Jeeps liegen, nackt, um uns herum absolute Stille, über uns ein unglaublicher Sternenhimmel. Millionen Sterne, so dass es aussieht, als wären sie alle miteinander zu einer funkelnden Decke verbunden. Ich weiß, du wirst begeistert sein.«
»Ja, ganz sicher.« Linda schmunzelte und stieß im nächsten Moment einen überraschten Laut aus, als sich wie auf ein geheimes Kommando hin alle Lampen gleichzeitig so weit herunterdimmten, dass es für einen Augenblick dunkel wurde, Sekunden nur, dann war der Spuk auch schon wieder vorbei.
»Was war das denn?«
Hendrik zuckte mit den Schultern und betrachtete die über ihnen hängende Lampe. »Keine Ahnung. Vielleicht eine Spannungsschwankung. Das hatte ich früher in meinem alten WG-Zimmer öfter.«
»Hm …«, brummte Linda und sah sich um. »Da waren wahrscheinlich die Stromleitungen marode. Aber in einem neuen Haus? Hier, in Winterhude?«
»Wer weiß … vielleicht hat Adam sich einen Spaß erlaubt.«
Adam war der Name des Smart-Home-Systems, das ein Jahr zuvor beim Bau des Hauses eingesetzt worden war.
Sie können Ihre gesamte Haustechnik per App über das System steuern, hatte der Verkäufer ihnen damals versichert. Ob Beleuchtung, Heizung, Kühlschrank oder Fernseher, selbst der Saugroboter arbeitet, digital gesteuert, zuverlässig und ganz nach Ihren Wünschen. Dann hatte er augenzwinkernd hinzugefügt: wie im Paradies, was wohl den Namen erklären sollte.
Bisher hatte das System auch fehlerfrei gearbeitet. Egal, ob es sich um die Beleuchtung handelte, die Adam einschaltete, wenn sie selten genutzte Räume betraten, und wieder ausschaltete, wenn sie sie verließen, oder die Rollos, die entweder bei Einbruch der Dunkelheit oder auf Kommando hin herunterfuhren – alles funktionierte bisher tadellos. Sogar die Waschmaschine meldete sich auf ihren Smartphones oder blendete am unteren Bildschirmrand des Fernsehers eine Nachricht ein, wenn der Waschgang beendet war.
Linda nickte. »Wundern würde es mich nicht. Je komplizierter die Technik, desto anfälliger ist sie auch.«
»Wer weiß, was das gerade war.« Hendrik beugte sich über den Tisch. »Ich finde, du solltest mich küssen, das hilft bestimmt.«
Sie lächelte. Doch bevor ihre Lippen sich berührten, begann Hendriks Smartphone auf der Kommode neben ihnen zu vibrieren, während gleichzeitig der Refrain des Songs Doctor! Doctor! von den Thompson Twins ertönte.
»O nein«, entfuhr es Linda, die wusste, dass es sich um Hendriks Klingelton für Anrufe aus dem Krankenhaus handelte. »Nicht jetzt.«
Hendrik löste die Hände von ihren, stand auf und griff nach dem Telefon.
»Zemmer«, meldete er sich knapp.
»Beate hier«, sagte die Assistentin seines Chefs. »Er braucht Sie. Ein schwerer Autounfall. Not-OP.«
»Okay, ich mache mich sofort auf den Weg.«
Hendrik beendete das Gespräch, ließ das Telefon in seiner Hosentasche verschwinden und sah zu Linda hinüber. Die erhob sich und kam um den Tisch herum auf ihn zu. Er betrachtete ihre zierliche Gestalt und spürte wie jedes Mal, wenn er sie ansah, das Bedürfnis, sie in die Arme zu schließen und gegen alles und jeden zu beschützen.
»Tut mir leid.«
Linda zuckte mit den Schultern. »Schon okay. Das ist eben dein Beruf. Ich warte auf dich und halte das Bett warm.«
Keine fünf Minuten später verabschiedete er sich von ihr und verließ das Haus.
Morgens im Berufsverkehr brauchte Hendrik für die knapp drei Kilometer zum Universitätsklinikum etwa zwanzig Minuten. Nun, kurz vor Mitternacht, herrschte kaum noch Verkehr, so dass er sein Ziel in der Hälfte der Zeit erreichen würde.
Während er den Wagen aus der Garage lenkte und in die Straße Richtung Eppendorf abbog, überlegte er, was ihn wohl dieses Mal im OP erwarten würde. Diese nächtlichen Einsätze kamen zwar bei weitem nicht mehr so häufig vor wie während seiner Zeit als Assistenzarzt in der Chirurgie, waren aber nach Unfällen Routine. Hendrik hatte sich als Chirurg auf komplizierte Gelenks- und Knochenoperationen spezialisiert und sich auf diesem Gebiet mittlerweile auch überregional einen Namen gemacht. Aus ganz Deutschland kamen Patienten nach Hamburg, um sich mit einem von ihm entwickelten schonenden Verfahren an den Schultern operieren zu lassen. Intern war er als Oberarzt seit einem guten Jahr Paul Gerdes’ rechte Hand und sein Stellvertreter. Der Preis dafür waren unter anderem Einsätze auch außerhalb der normalen Dienstzeit. Er wischte die Gedanken beiseite und dachte an Linda.
Standesamt. In weniger als einer Woche.
Dabei hatte er noch vor einem Jahr im Brustton der Überzeugung behauptet, die Institution Ehe sei für ihn nach dem erfolglosen ersten Versuch kein Thema mehr und dass man nicht nur genauso gut, sondern wahrscheinlich sogar besser ohne Trauschein zusammenleben könne.
Sechsundzwanzig war er gewesen, als er und Nicole geheiratet hatten. Sie dachten beide, es wäre die große Liebe, die ein Leben lang halten würde. Es wurden lediglich dreizehn Jahre, von denen bereits die letzten nur noch wenig mit Liebe zu tun gehabt hatten. Vielleicht war er damals einfach zu jung gewesen? Oder sie? Immerhin war Nicole drei Jahre jünger als er. Und brauchte immer Action, wie sie es nannte. Dieses ständige Bedürfnis nach Ablenkung hatte Hendrik ihr nicht erfüllen können, sein Job war dafür einfach zu fordernd. So war sie oft allein oder mit Freundinnen unterwegs gewesen, während er sich von einem anstrengenden Dienst erholte. Im Laufe der Zeit hatte sie sich so ein eigenes soziales Umfeld aufgebaut, mit dem er nichts mehr zu tun hatte.
Wie auch immer, es hatte nicht funktioniert, und was als der Himmel auf Erden begann, endete in einem Rosenkrieg und mit Anwälten, die das Feuer am Köcheln hielten, weil sie daran eine Menge Geld verdienten.
Nun, mit zweiundvierzig Jahren, würde er es also noch einmal wagen. Nicht mehr so blauäugig wie damals, war er dennoch überzeugt, in Linda die Frau gefunden zu haben, mit der er sein Leben verbringen wollte.
Er stellte den Wagen auf dem für ihn reservierten Parkplatz in der Tiefgarage ab und ging zum Aufzug.
Prof. Dr. Paul Gerdes sah nur kurz auf, als Hendrik in OP-Kleidung aus der Umkleideschleuse in den Waschraum trat, und nickte ihm zu. »Gut, dass du da bist.« Dann widmete er sich der Desinfektion seiner Hände und Unterarme. »Tut mir leid, dass ich dich wieder einmal aus dem verdienten Feierabend reißen musste, aber ich brauche dich. Patient ist vorbereitet. Polytrauma. Milzruptur und Beckenfraktur, Os sacrum und vorderer Ring, laut FAST-Sonographie massive Einblutung. Überraschungen beim Öffnen nicht ausgeschlossen.«
Als sie kurz danach den Operationssaal betraten, warteten dort schon die Anästhesistin, OP-Pflegerinnen und -Pfleger sowie zwei junge Assistenzärzte, die erst seit wenigen Wochen im UKE beschäftigt waren.
Der etwa dreißigjährige Patient hatte keine weiteren, bei Röntgen und Sonographie nicht entdeckten Verletzungen, dennoch war vor allem die Stabilisierung und Verschraubung des mehrfachen Beckenbruchs kompliziert.
Als sie nach über drei Stunden im Nebenraum Mundschutz und OP-Hauben abstreiften, strich Gerdes sich über die graumelierten, schweißnassen Haare und legte Hendrik eine Hand auf die Schulter. »Das war nicht ohne. Danke noch mal. Und jetzt sieh zu, dass du nach Hause kommst, den Rest machen die anderen. Es reicht, wenn du um neun wieder hier bist. Ich bleibe da und lege mich in eines der Bereitschaftsbetten. Grüß bitte Linda von mir und sag ihr, ich mache es wieder gut.«
»Das tue ich. Wir sehen uns« – Hendrik warf einen Blick auf die Uhr – »nachher.«
Gerdes, seit drei Jahren geschieden, war seitdem keine feste Beziehung mehr eingegangen. Hier und da tauchte er mit einer Frau an seiner Seite auf, die meist um einiges jünger war als er selbst, doch Hendrik konnte sich nicht erinnern, eine dieser Frauen ein zweites Mal mit seinem Chef gesehen zu haben. Als er ihn einmal darauf angesprochen hatte, hatte Gerdes nur gelächelt und gesagt: »Gebranntes Kind …«
Eine halbe Stunde später drückte Hendrik die Autotür sanft ins Schloss und verriegelte sie mit der Fernbedienung. Um Linda nicht zu wecken, hatte er darauf verzichtet, den Wagen in die Garage zu fahren, und außerdem war er sowieso nur für vier Stunden zu Hause.
Während er die wenigen Schritte zur Haustür ging, atmete er tief durch und genoss die angenehm laue Luft der Morgendämmerung. Hätte er nicht sowieso kaum Zeit zum Schlafen gehabt, wäre er eine Stunde früher aufgestanden und vor dem Dienst noch joggen gegangen. Dreimal in der Woche brauchte er das als Ausgleich. Und damit er so schlank blieb, wie er war. Er nahm es sich für den nächsten Tag vor.
Hendrik strich mit dem Finger über das dafür vorgesehene Feld, betrat das Haus und drückte die Tür leise hinter sich zu. Als er sich umwandte und einen Schritt in die Diele machte, flammte die Deckenbeleuchtung auf. »Licht aus«, sagte er leise, woraufhin es sofort wieder dunkel wurde. Es dauerte nur zwei, drei Wimpernschläge, bis seine Augen sich an das schwache Morgenlicht gewöhnt hatten, das durch die Glaselemente der Tür in den Flur drang, und er die Umgebung wieder schemenhaft erkennen konnte.
Behutsam zog er die Schuhe aus und ging zur Treppe. Als er den Fuß auf die unterste Stufe setzte, aktivierte Adam die Nachtbeleuchtung, kleine LED-Punkte, die die nächsten zwei Stufen so weit beleuchteten, dass Hendrik sehen konnte, wohin er trat, während sie hinter ihm wieder erloschen, sobald er den Fuß anhob.
Oben angekommen, blieb er verwundert stehen, als auch im Flur die Nachtbeleuchtung kurz aufleuchtete.
Die Schlafzimmertür stand offen, was sehr ungewöhnlich war. Wenn Linda im Bett lag, war die Tür immer geschlossen, weil sie einen extrem leichten Schlaf hatte und sogar von dem Nachtlicht im Flur aufwachte. Noch immer möglichst jedes Geräusch vermeidend, betrat er das Zimmer.
Wie in der Diele sorgte auch hier das Licht, das von außen durch die beiden Fenster fiel, dafür, dass Hendrik seine Umgebung schemenhaft erkennen konnte. Auch das Bett. Es war leer.
»Adam, Licht!«, sagte Hendrik mit verhaltener Stimme und sah sich irritiert um. Die glatte Tagesdecke lag über dem Bett. Die Schiebetür zum angrenzenden begehbaren Kleiderschrank stand weit offen, der Raum war dunkel.
»Seltsam«, murmelte Hendrik und wandte sich um. Zurück auf dem Flur, hielt er einen Moment inne und lauschte. Nichts. Im ganzen Haus herrschte eine geradezu bedrückende Stille.
Während er die Stufen wieder hinabstieg, breitete sich ein seltsames Gefühl in ihm aus, als zöge eine Vakuumpumpe langsam, aber unerbittlich seine inneren Organe zusammen.
»Linda?«, sagte er viel zu leise und rief gleich darauf lauter: »Schatz? Bist du da?«
Eine völlig unsinnige Frage. Wo sollte sie morgens um halb fünf schon sein? Dennoch erhielt er keine Antwort.
Unten angekommen, ging er zum Wohnzimmer, obwohl er befürchtete, dass er Linda auch dort nicht finden würde. Er knipste die Beleuchtung an und sah sich kurz um. Sie hatte den Tisch abgeräumt, und auch die offene Küche war blitzblank.
Hendrik ging zurück in den Flur, rief erneut Lindas Namen, lauschte … Nichts. Mit wachsender Unruhe suchte er Raum um Raum nach ihr ab, um nach wenigen Minuten ratlos wieder im Wohnzimmer zu stehen.
Es gab keinen Zweifel – Linda war nicht im Haus. Aber wohin konnte sie um diese Uhrzeit gegangen sein? Ohne eine Nachricht zu hinterlassen?
Mit einer Mischung aus Sorge und Ärger fischte Hendrik sein Smartphone aus der Tasche und drückte die Kurzwahltaste mit Lindas Nummer. Es dauerte nur zwei Sekunden, dann hörte er die Ansage ihrer Mailbox, in der sie freundlich erklärte, dass sie zurzeit nicht erreichbar sei und man nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen könne. Sie hatte das Telefon also entweder ausgeschaltet, oder dort, wo sie sich gerade aufhielt, gab es kein Netz.
Ungeduldig wartete er den Ton ab. »Linda, wo steckst du denn? Ich bin gerade nach Hause gekommen und mache mir Sorgen. Melde dich bitte sofort, wenn du diese Nachricht abhörst.«
Er legte auf und dachte einen Moment darüber nach, ob er ihre Eltern anrufen sollte, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Sie wohnten in Hannover, hatten aber noch ein Haus auf Langeoog, wo sie einen Großteil des Sommers verbrachten. Linda hatte sich ganz bestimmt nicht mitten in der Nacht auf den Weg zu ihnen gemacht, zumal erst am Morgen wieder eine Fähre von Bensersiel aus zu der kleinen Insel ablegte. Das Einzige, was er mit einem Anruf bei den beiden erreichen würde, war, dass sie in Panik gerieten.
Aber es gab naheliegendere Möglichkeiten. Vielleicht war sie auch einfach zu einem kleinen Spaziergang unterwegs, weil sie nicht schlafen konnte? Aber dagegen sprach, dass das Bett vollkommen unbenutzt aussah. Und sie ihm keine Nachricht hinterlassen hatte. Nein, Lindas Verschwinden musste einen anderen Grund haben.
2
»Ich verstehe ja Ihre Aufregung, Herr Zemmer«, sagte der Polizist am Telefon, der sich als Kommissar Mertes vorgestellt hatte. »Aber Ihre Verlobte ist eine erwachsene Frau, die das Haus verlassen hat, weil sie vielleicht noch etwas trinken gehen wollte und …«
Hendrik schüttelte den Kopf, obwohl sein Gesprächspartner das nicht sehen konnte. »Morgens um halb fünf?«
Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Nachdem er eine Stunde durchs Haus getigert war, hatte er es schließlich nicht mehr ausgehalten und mit wachsender Sorge die Nummer der Polizei gewählt.
»Sagten Sie nicht, Sie haben das Haus kurz nach Mitternacht verlassen? Vielleicht ist sie gleich darauf aufgebrochen? Oder eine Freundin hat angerufen und …«
»Hören Sie«, unterbrach Hendrik den Mann unwirsch, »Linda zieht nicht einfach mitten in der Nacht los, wenn ich ins Krankenhaus gerufen werde. So was würde sie nie tun. Und sie hat auch keine Freundin, die sie um diese Uhrzeit anrufen würde. Zumindest keine, mit der ich nicht schon gesprochen habe. Irgendetwas muss passiert sein.«
»Gibt es Einbruchspuren? An der Haustür? Einem Fenster?«
»Nein, ich, ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht darauf geachtet. Außerdem bin ich Arzt, kein Kriminaltechniker.«
»Haben Sie eine Alarmanlage?«
»Ja. Sie ist mit dem Fingersensor der Tür gekoppelt und wird automatisch deaktiviert, wenn Linda oder ich die Tür entsperren.«
»Gab es schon einmal eine Fehlfunktion?«
»Ganz am Anfang, ein Mal, danach nicht mehr.«
»Haben Sie im Haus etwas Ungewöhnliches festgestellt? Unordnung? Umgestoßene Möbel? Offene Schränke? Irgendetwas, das auf einen Kampf hindeutet?«
»Nein.«
»Also keinerlei Anzeichen, die dafür sprechen, dass jemand ins Haus eingedrungen ist oder Ihre Verlobte das Haus unfreiwillig oder unter Zwang verlassen hat?«
Hendrik verstand die Logik hinter diesen Fragen, doch das machte die Situation um keinen Deut besser.
»Nein, aber trotzdem …«
»Wie ist denn das Verhältnis zwischen Ihrer Verlobten und Ihnen?«
»Was? Das ist super.«
»Haben Sie sich gestern Abend vielleicht gestritten, bevor Sie ins Krankenhaus gerufen wurden?«
»Nein. Es war ein sehr harmonischer Abend. Wir haben gemeinsam gegessen, uns über unsere bevorstehende Hochzeit unterhalten und festgestellt, wie glücklich wir beide sind.«
»Hm … also, ich schlage vor, Sie warten jetzt einfach mal ab. Sie werden sehen, dass Ihre Verlobte bald wieder auftaucht und es eine plausible Erklärung für alles gibt.«
Als Hendrik nicht antwortete, fügte der Mann mit beruhigender Stimme hinzu: »Noch einmal: Es deutet absolut nichts darauf hin, dass jemand gewaltsam in das Haus eingedrungen oder Ihrer Verlobten etwas passiert ist. Ich verstehe Ihre Sorge, aber Erwachsene, die im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind, haben das Recht, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen, auch ohne dass Angehörige, Freunde oder Sie vorher informiert werden. Es ist nicht Aufgabe der Polizei, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen, wenn keine Hinweise auf eine Gefahr für Leib oder Leben vorliegen.«
»Ich kenne Linda seit zwei Jahren.« Hendrik besann sich auf Geduld als eine seiner Tugenden und versuchte es noch einmal mit ruhiger Stimme. »Wir wohnen seit einem Jahr zusammen, und ich sage Ihnen, Sie würde niemals einfach so mitten in der Nacht das Haus verlassen.«
Deutliches Schnauben war zu hören. »Also gut, ich schicke Ihnen zwei Kollegen vorbei, die schauen sich mal im Haus um, okay?«
»Danke«, sagte Hendrik erleichtert und fragte sich, warum der Beamte nicht gleich auf diese Idee gekommen war.
Er ging in die Küche, schaltete den Kaffeevollautomaten ein und berührte auf dem farbigen Touchscreen das Symbol für Café crème. Mit der dampfenden Tasse in der Hand ging er kurz darauf zurück ins Wohnzimmer, setzte sich auf die Couch, und während er in kleinen Schlucken den Kaffee trank, zermarterte er sich den Kopf auf der Suche nach einer Erklärung für Lindas Verschwinden.
Er hatte nicht auf die Uhr geschaut, schätzte aber, dass seit dem Telefonat mit dem Polizisten maximal zehn Minuten vergangen waren, als es an der Tür läutete. Hendrik hoffte darauf, dass es Linda war, die ihn entschuldigend anlächeln würde, sobald er die Tür öffnete. Es war nicht Linda.
»Guten Morgen, Herr …« Der linke der beiden Uniformierten, ein Mittdreißiger mit kurzen schwarzen Haaren, warf einen Blick auf einen kleinen Block in seiner Hand. »… Zemmer. Sie vermissen Ihre Verlobte?« Ein erneuter Blick auf die Notizen. »Frau Linda Mattheus?«
»Ja, das ist richtig.«
Der Mann nickte. »Oberkommissar Breuer, das ist mein Kollege, Kommissar Grohmann. Man hat uns hergeschickt, damit wir uns mal ein wenig umschauen.«
Hendrik trat einen Schritt zur Seite und gab den Eingang frei. »Bitte, kommen Sie doch rein.«
Bevor sie seiner Aufforderung nachkamen, zog Oberkommissar Breuer eine kleine Stifttaschenlampe aus der Tasche, beugte sich nach vorn und betrachtete eingehend das Türschloss. Als er sich wieder aufrichtete, schüttelte er den Kopf. »Keine Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen schließen lassen.« Dann deutete er auf das schmale Feld, in dem der Fingerprint-Sensor untergebracht war.
»Wessen Fingerscans sind dort hinterlegt?«
Hendrik zuckte mit den Schultern. »Meiner und der von Linda. Sonst keiner.«
In der Diele blieben sie stehen und warteten, bis Hendrik die Tür geschlossen hatte. »Seit wann genau wird die Person vermisst?«, wollte der etwas jüngere Beamte wissen, den Breuer als Kommissar Grohmann vorgestellt hatte.
»Das habe ich Ihrem Kollegen doch schon am Telefon gesagt.«
»Würden Sie es uns bitte trotzdem noch einmal sagen?«
»Ich habe das Haus kurz nach Mitternacht verlassen. Ich bin Arzt und musste zu einer Not-OP ins Krankenhaus. Die hat eine Weile gedauert. Als ich gegen halb fünf zurückkam, war Linda nicht mehr da. Seit wann sie weg ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, sie hätte das Haus nicht freiwillig verlassen, ohne mir eine Nachricht zu schreiben oder mich anzurufen.«
Die beiden Beamten tauschten einen schnellen Blick aus, dann deutete Breuer ins Haus. »Dürfen wir uns mal umschauen?«
»Ja, bitte.«
Der Rundgang der beiden, den Hendrik begleitete und bei dem sie vor allem die Fenster und die beiden Terrassentüren genauer unter die Lupe nahmen, dauerte knapp zehn Minuten, dann standen die drei Männer wieder im Wohnzimmer.
Breuer schürzte die Lippen. »Tja, Herr Zemmer, wir konnten weder Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen feststellen noch sonst irgendetwas, das auf ein Verbrechen hindeutet.«
»Sie haben doch oben neben Ihrem Schlafzimmer diesen Raum, in dem die Kleidung untergebracht ist.«
Hendrik sah Grohmann fragend an. »Sie meinen den begehbaren Kleiderschrank?«
»Ja. Haben Sie schon mal einen Blick auf die Kleidungsstücke Ihrer Verlobten geworfen?«
»Nein, warum?«
»Vielleicht fehlen ja einige ihrer Sachen? Und wie sieht es mit Koffern aus? Sind alle noch da?«
Obwohl es offensichtlich war, brauchte Hendrik einen Moment, bis er endlich verstand, worauf Grohmann hinauswollte.
»Aber ich habe Ihnen doch schon mehrfach gesagt, dass Linda nie einfach so …«
»Würden Sie bitte trotzdem nachschauen?«, unterbrach ihn Breuer.
Resigniert hob Hendrik die Hände und nickte. »Von mir aus. Einen Moment.« Er wandte sich ab und ging zur Treppe. Warum, verdammt, wollten die Polizisten ihm nicht glauben, dass Linda niemals mitten in der Nacht einfach so verschwinden würde? Sogar wenn sie sich bis aufs Messer gestritten hätten, bevor er das Haus verlassen hatte, würde sie so etwas trotzdem nicht tun.
Er ging durchs Schlafzimmer und betrat den begehbaren Kleiderschrank, woraufhin in den Regalen und hinter den Stangen, an denen Lindas Kleider und Blusen auf der einen und seine Anzüge, Hemden und einige Pullover auf der anderen Seite hingen, die indirekte Beleuchtung ein angenehmes Licht verbreitete.
Vor Lindas Seite blieb Hendrik stehen und ließ seinen Blick über die Kleidungsstücke wandern. Einige Blusen, mehrere Blazer, Kleider und Röcke in verschiedenen Farben und Mustern. Er wusste nicht, wie viele. Daneben in Regalen ihre Jeans, Shirts und ein Stapel dickere Pullover. Alles, was er sah, kam ihm bekannt vor, aber … fehlte etwas? Hendrik zog die Stirn kraus, als ihm klarwurde, dass er das nicht beurteilen konnte. Sicher, er kannte im Großen und Ganzen Lindas Sachen, ob jedoch etwas fehlte oder nicht … Aber es war sowieso Unsinn, dass er darüber nachdachte.
Hendrik wandte sich ab, verließ das Schlafzimmer und steuerte auf den schmalen Raum neben dem Badezimmer zu, in dem sie alles abstellten, das sonst nirgendwo einen Platz hatte, aber dennoch nicht auf den Dachboden sollte. Zum Beispiel die beiden Koffer.
Als er die Tür öffnete, dachte er daran, dass Linda wenige Wochen zuvor noch schelmisch lächelnd gemeint hatte, das wäre doch ein optimales Kinderzimmer.
In diesem Raum schaltete sich das Licht nicht automatisch ein, so dass Hendrik den Schalter neben der Tür betätigen musste, bevor er seinen Blick auf die Stelle richtete, an der sein schwarzer und ihr dunkelbrauner Rimowa-Koffer standen. Gestanden hatten, korrigierte er sich.
Lindas Koffer fehlte.
3
Die Augen des Mannes fixieren ihn mit dem kalten, mitleidlosen Blick, mit dem ein Forscher sein Versuchstier beobachtet. Und dennoch hat er das Gefühl, diese Augen nicht zum ersten Mal zu sehen.
Die Hand mit dem Skalpell ist aus seinem Sichtfeld verschwunden, was ihn ein wenig erleichtert.
»Du fragst dich, was mit dir geschehen ist, nicht wahr?« Die Stimme klingt durch die Maske etwas dumpf, zudem hat der Kerl die Worte sehr leise gesprochen.
»Ich will es dir erklären. Auch wenn das, was ich hier tun muss, für dich äußerst unangenehm wird, bin ich kein Unmensch. Eines vorab: Du bist nicht gelähmt, keine Angst.«
Etwas im Blick des Mannes verändert sich ein wenig, und doch scheint es, als könnte er einen Hauch von Häme darin erkennen.
»Wobei … doch, Angst darfst du haben.« Dieses Flüstern … es macht die Situation noch unheimlicher. Er muss sich konzentrieren, um die Worte verstehen zu können.
»Du hast sogar allen Grund, Angst zu haben. Aber vielleicht lenkt es dich ein wenig ab, wenn ich dir erkläre, in welchem Zustand du dich befindest und was diesen Zustand herbeigeführt hat.«
Ich will, dass es aufhört, schreit alles in ihm, und die Angst schnürt ihm die Kehle zu.
»Weißt du, was eine Schlafparalyse ist? Hat sie das mal erwähnt? Sie weiß es ganz bestimmt.«
Sie? Der Kerl tut so, als müsste er wissen, wer mit diesem sie gemeint ist, aber er hat keine Ahnung.
»Der Begriff bezeichnet zunächst nur den Zustand des Körpers während des Schlafs: Man ist nahezu vollständig bewegungsunfähig – ausgenommen sind Atem- und Augenmuskulatur.«
Noch immer ist es kaum mehr als ein Flüstern, aber der Kerl spricht so langsam, dass er ihn versteht.
»Diese vorübergehende Lähmung ist völlig natürlich und schützt den Körper davor, die Bewegungen im Traum tatsächlich umzusetzen. Normalerweise bekommen wir von dieser Paralyse nichts mit, weil sie sofort beendet wird, wenn wir aufwachen, doch es kann passieren, dass dieser Zustand nach dem Aufwachen andauert – man spricht dann auch von einem Wachanfall. Das Gehirn ist schon wach, aber die Muskeln sind noch im Schlafmodus. Die Folge: Die Betroffenen sind unfähig, zu sprechen oder sich zu bewegen. Normalerweise ist der Spuk nach spätestens zwei Minuten vorbei – entweder kehrt die Muskelkraft zurück, oder man schläft wieder ein. Ist dieser Zustand allerdings medikamentös herbeigeführt worden, wie das bei dir der Fall ist, kann man ihn beliebig lange aufrechterhalten.«
Aber warum?, möchte er dem Mann entgegenschreien. Warum tust du mir das an?
Seine Gedanken überschlagen sich, er versucht, sie in dem Chaos, das in seinem Kopf herrscht, zu ordnen und zu begreifen, was mit ihm geschieht. Von einer Schlafparalyse hat er noch nie zuvor gehört, aber was auch immer es ist – warum hat man ihn künstlich in diesen Zustand versetzt? Er denkt an die Hand, die ein Skalpell gehalten hat. Und an den Blick, der dabei auf eine Stelle an seiner Brust gerichtet war.
Als hätte der Mann seine Gedanken gehört, nickt er und sagt bedauernd: »Nun muss ich meinen kleinen Vortrag aber leider beenden. Die Arbeit ruft.«
Eine Hand ohne Skalpell taucht auf und bewegt sich auf das Gesicht des Mannes zu, greift nach dem Mundschutz und zieht ihn nach unten. Noch bevor auch die Haube von den Haaren abgestreift wird, erkennt er, wen er vor sich hat, und beginnt zu ahnen, warum er in dieser Situation ist.
Er möchte sich aufbäumen, seine Muskeln dazu zwingen, sich den Drogen zu widersetzen und ihm zu gehorchen, damit er seine Hände um den Hals dieses Schweins legen und zudrücken kann. Zum ersten Mal in seinem Leben verspürt er den Wunsch, zu töten, so ausgeprägt, dass er für einen kurzen Moment sogar seine Angst vergisst.
Unvermittelt taucht die Hand mit dem Skalpell wieder vor seinem Gesicht auf und verharrt für einen Moment, so als wolle der Scheißkerl die kleine, blitzende Klinge von ihm begutachten lassen, bevor sie sich langsam senkt. Dabei verzieht sich der Mund zu einem diabolischen Grinsen und verzerrt das Gesicht zu einer Fratze. »Du weißt, warum du hier bist, nicht wahr?« Nun flüstert der Mann nicht mehr. »Ich kann dir versichern, dass meine Kandidaten normalerweise von dem, was jetzt passiert, nichts mitbekommen. Ich bin ja kein Unmensch. Aber in deinem Fall mache ich gern eine Ausnahme. Versuch es zu genießen, es ist eine wirklich einmalige Erfahrung.«
Seine Blase entleert sich, warme Feuchtigkeit breitet sich an den Innenseiten seiner Oberschenkel aus. Es ist ihm egal. Alles ist egal angesichts dessen, was nun unweigerlich folgen wird.
Die Hand mit dem Skalpell berührt seinen Brustkorb, kurz spürt er die Spitze der Klinge, einen Stich … dann explodiert ein Schmerz von solcher Intensität in ihm, dass er das Bewusstsein verliert.
Doch nur für einen kurzen, gnädigen Moment.
4
Hendriks Gedanken überschlugen sich bei dem Versuch, zu verstehen, was gerade passierte, doch bei allem Chaos, das über seinen Verstand hereingebrochen war, stand eine klare Erkenntnis wie ein Fanal über allem: Die Polizisten hatten recht. Es hatte weder einen Einbruch noch ein Verbrechen gegeben. Linda war einfach gegangen, ohne ein Anzeichen für diese Entscheidung, ohne ein Wort der Erklärung. Und das, nachdem sie sich noch am Abend gegenseitig versichert hatten, wie sehr sie sich auf die Hochzeit freuten.
Noch nie in seinem Leben war Hendrik von einer Erkenntnis so sehr überrascht worden wie von dieser. Noch nie war er so enttäuscht worden.
Aber … warum? Es war nichts zwischen ihnen geschehen, das ihn auch nur andeutungsweise hätte ahnen lassen, dass Linda ihn verlassen wollte. Ohne ihm die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern.
Hendrik wusste nicht, wie lange er so dagestanden und auf die leere Stelle gestarrt hatte, als ihn eine Stimme zusammenfahren ließ.
»Herr Zemmer?«
Er wandte sich um. »Ja?«
Oberkommissar Breuer blickte an ihm vorbei in den Raum. »Alles in Ordnung?«
Hendrik warf erneut einen Blick auf die Stelle, an der nur noch ein Koffer stand, wo eigentlich zwei stehen sollten. »Nein«, sagte er und wandte sich dem Polizisten zu. »Nichts ist in Ordnung. Lindas Koffer fehlt.«
Breuer nickte, als hätte er das erwartet. »Sind Sie sicher?«
»Ja, er … er steht immer dort, gleich neben meinem.«
»Das tut mir leid.«
»Ja. Mir auch.«
Unvermittelt setzte Hendrik sich in Bewegung, lief zur Treppe und nach unten, wo Kommissar Grohmann noch in der Diele stand und mit seinem Smartphone beschäftigt war. Als er Hendrik bemerkte, steckte er das Gerät in die Jackentasche.
Hendrik ging langsam an ihm vorbei. »Tut mir leid, dass Sie extra …«, setzte Hendrik an, beendete den Satz aber nicht. Die Leere, die sich in ihm ausbreitete, war so absolut, dass sie ihm sämtliche Kraft raubte und er sich an Ort und Stelle auf den Boden setzen wollte. Stattdessen lehnte er sich mit dem Rücken gegen die Wand.
»Es mag für Sie vielleicht höhnisch klingen«, sagte Breuer, der sich wieder zu seinem Kollegen gesellt hatte, mit sanfter Stimme, »aber … immerhin ist Ihrer Verlobten nichts geschehen, wie Sie es befürchtet hatten.«
Hendrik nickte. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre ich jetzt gern allein.« Er wunderte sich, wie dünn seine Stimme klang.
»Selbstverständlich. Kommen Sie klar?«
»Was?«
»Sind Sie so weit okay, dass Sie mit der Situation klarkommen?«, wiederholte der Oberkommissar.
»Ja, ich … ich muss nur nachdenken. Danke noch mal.«
Als die Tür hinter den Männern ins Schloss gefallen war, ließ Hendrik sich an der Wand entlang nach unten gleiten, bis er auf dem Boden saß. Die Unterarme auf die Knie gestützt, starrte er auf die gegenüberliegende Wand, an der eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Linda hing. Sie trug darauf ein luftiges Sommerkleid und lächelte verträumt in die Kamera. Das Foto war erst drei Monate zuvor entstanden, an einem ungewöhnlich warmen Tag im Frühling.
War ihr da schon klar gewesen, dass sie ihn verlassen würde?
Er wollte nachdenken, hatte er gerade gesagt. Aber wie sollte man etwas in Worte fassen, für das man keine Worte hatte?
Irgendwann raffte Hendrik sich auf, ging ins Wohnzimmer und öffnete die Tür des Sideboards, hinter der eine ganze Batterie von Flaschen stand. Er griff nach dem Whisky, nahm aus dem Fach daneben ein Long-Drink-Glas und goss zwei Finger breit ein. Die Flasche noch in der Hand, setzte er das Glas an die Lippen und leerte es in einem Zug. Er überlegte, dass es wohl das erste Mal in seinem Leben war, dass er morgens auf nüchternen Magen Alkohol trank. Dann schenkte er nach, stellte das Glas auf dem niedrigen Couchtisch ab und ließ sich in einen der beiden wuchtigen Sessel fallen.
Mit geschlossenen Augen ließ er den vergangenen Abend Revue passieren, dann den Tag davor und schließlich die letzte Woche. Sosehr er sich auch konzentrierte, er fand keinen einzigen Anhaltspunkt, nichts, was Linda gesagt oder getan hatte, nicht einmal einen Blick von ihr, der darauf hingedeutet hätte, dass sie plante, ihn zu verlassen.
Hatte sie es tatsächlich geplant? Oder hatte es ganz plötzlich, in dieser Nacht, einen Grund dafür gegeben, dass sie verschwunden war?
Er nahm einen weiteren Schluck aus dem Glas, behielt es in der Hand und bemerkte, wie der Alkohol neben der Wärme auch ein Gefühl der Wut in ihm aufsteigen ließ. Sollte es das jetzt wirklich gewesen sein? Linda verschwand sang- und klanglos mitten in der Nacht aus seinem Leben, und er betrank sich und zermarterte sich das Hirn darüber, was falsch gelaufen war? Ob er etwas falsch gemacht hatte? Akzeptierte er tatsächlich einfach so Lindas vermeintliche Entscheidung, ohne etwas zu unternehmen?
Hendrik kippte den Rest Whisky hinunter und knallte das Glas auf den Tisch.
Sein Blick suchte das Smartphone und entdeckte es dort, wo es meistens lag – auf dem Sideboard.
Eine halbe Minute später saß er wieder in dem Sessel und hielt sich das Telefon ans Ohr. Erst nach mehrmaligem Klingeln wurde abgehoben.
»Hendrik?« Susannes Stimme klang heiser. Verschlafen. »Was … Ist alles okay? Wie spät ist es überhaupt?«
»Kurz nach sechs. Tut mir leid, dass ich dich wecke. Aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Linda ist weg. Als ich vorhin um halb fünf vom Krankenhaus nach Hause kam, war sie nicht da. Und auch keine Nachricht von ihr. Du bist ihre beste Freundin, weißt du irgendwas?«
»Wer, zum Teufel, ist das um diese Uhrzeit?«
Hendrik hörte undeutlich eine mürrische Männerstimme. Jens, Susannes Mann. Er hatte ihn noch nie gemocht.
»Es ist Hendrik. Irgendwas mit Linda …«
»Verdammt, muss das mitten in der Nacht sein?«
»Schlaf einfach weiter … Hendrik? Was meinst du damit, Linda ist weg? Wo soll sie denn sein?«
»So, wie es aussieht, hat sie mich verlassen.«
»Was?« Alle Müdigkeit war aus Susannes Stimme verschwunden. »Was soll das heißen, sie hat dich verlassen?«
»Wie viele Deutungsmöglichkeiten lässt dieser Satz denn zu?«, entgegnete Hendrik, bemerkte den aggressiven Unterton in seiner Stimme und fügte, als Susanne mit eisigem Schweigen reagierte, sofort hinzu: »Tut mir leid, ich … ich bin ziemlich durch den Wind. Sieht aus, als hätte sie ihren Koffer gepackt und wäre gegangen, während ich im Krankenhaus war.«
»Gegangen? Linda? Das kann nicht dein Ernst sein. Das glaube ich einfach nicht.«
»Susanne, ich will es auch nicht glauben, aber … sie ist weg, ebenso ihr Koffer. Das sind Fakten. Hat sie dir gegenüber eine Andeutung gemacht, dass etwas nicht stimmt? Dass sie unglücklich ist oder wütend wegen irgendetwas? Oder dass sie vielleicht Angst vor der Hochzeit hat? Falls ja, wäre jetzt der richtige Moment, es mir zu sagen.«
»Nein, nie. Sie hat sich sehr auf die Hochzeit gefreut. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Wenn da etwas gewesen wäre, wüsste ich davon.«
Hendrik atmete tief durch, bevor er weitersprach. »Gibt es vielleicht einen anderen Mann?«
»Spinnst du? Definitiv nicht.«
»Sie hat nie jemand anderen erwähnt?«
»Nein, verdammt. Es gab und gibt niemanden außer dir. Sie liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Wie kannst du nur denken, sie würde einfach so abhauen? Kennst du sie wirklich so wenig?«
Eine berechtigte Frage. Wie gut kannte er Linda? Hendrik zögerte einige Sekunden, bevor er antwortete: »Bis vor zwei Stunden hätte ich beide Hände für sie ins Feuer gelegt.«
»Ach, und jetzt nicht mehr? Du sagst, Linda ist verschwunden, ohne einen Hinweis, ohne dass irgendetwas zwischen euch vorgefallen ist. Und statt dir Sorgen zu machen und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um herauszufinden, wo sie ist, zweifelst du an ihrer Liebe zu dir? Ernsthaft?«
»Ich …«
»Hast du die Polizei verständigt?«
»Ja, sie waren eben hier. Die haben mich ja erst auf die Idee gebracht, nach Lindas Koffer zu sehen. Sie sagten, fast immer, wenn ein erwachsener Mensch verschwindet, hat er sich freiwillig dafür entschieden, zu gehen.«
»Sich freiwillig entschieden zu gehen? Eine Woche vor der Hochzeit? Hörst du dir eigentlich zu? Was, zum Teufel, ist mit dir los? Sieh gefälligst zu, dass du deinen Arsch hochbekommst, und fang an, alle Freunde und Bekannte abzutelefonieren. Ich bin in einer halben Stunde bei dir.« Damit legte Susanne auf, bevor Hendrik noch etwas entgegnen konnte.
Er ließ das Smartphone sinken und starrte blicklos auf den Couchtisch vor sich. Hatte Susanne recht, wenn sie ihm vorwarf, zu schnell an Linda zu zweifeln? Ja, das hatte sie, und er fragte sich, was eigentlich in ihm vorging. Reichten wirklich ein fehlendes Gepäckstück und irgendwelche Polizeistatistiken aus, alles in Frage zu stellen, was er in den vergangenen beiden Jahren mit Linda erlebt hatte?
5
Als er Susanne die Tür öffnete, hatte Hendrik schon jeden angerufen, der ihm eingefallen war, sowohl Lindas Freunde als auch einige entferntere Bekannte. Doch außer mitfühlenden Worten und der wiederholten Zusicherung, dass sich alles aufklären würde, hatten die Telefonate nichts gebracht. Was nicht ganz stimmte, denn mit jedem Anruf, mit jeder Freundin und jedem Bekannten, mit denen er gesprochen hatte, war es Hendrik klarer geworden, dass Linda nicht freiwillig fortgegangen war. Dass etwas oder jemand sie dazu gezwungen haben musste.
»Und?«, fragte Susanne, noch bevor sie das Haus betrat. Sie trug Jeans-Shorts und ein weißes T-Shirt. Ihre schlanken Beine waren leicht gebräunt, was daran lag, dass sie in den Sommermonaten jede freie Minute in ihrem Garten verbrachte, wie Hendrik von Linda wusste.
»Nichts. Niemand hat eine Ahnung, wo sie sein könnte.«
»Okay, ich brauche erst mal einen Kaffee.« Susanne drückte sich an ihm vorbei und ging geradewegs in die Küche. Hendrik schloss die Haustür und folgte ihr.
»Was ist mit der Polizei?«, erkundigte sie sich, während sie den Kaffeeautomaten einschaltete und sich eine Tasse aus dem Schrank nahm.
»Die wollten schon nichts unternehmen, bevor ich festgestellt habe, dass Lindas Koffer fehlt. Ich fürchte, bevor nicht ein paar Tage ohne Nachricht von ihr vergangen sind, tun die auch weiterhin nichts.«
»Oder bis es Hinweise darauf gibt, dass ihr tatsächlich …«
»Dass ihr was?«
Susanne schüttelte den Kopf. »Hast du mal nachgeschaut, ob sie ihren Koffer vielleicht woanders hingestellt hat? Ihr wart doch vor kurzem erst in Rom. Vielleicht hat sie …«
»Nein, ich selbst habe die Koffer nach dem Auspacken wieder in dem Zimmer abgestellt.«