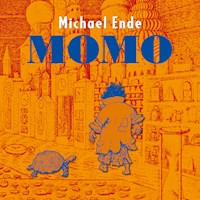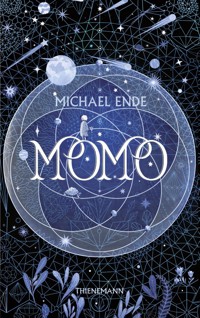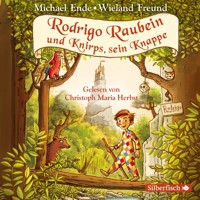9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Archäologie der Dunkelheit« ist die Niederschrift eines mitreißenden Künstlergesprächs. Michael Ende erzählt in noch nie dagewesener Weise von der Malerei seines Vaters und seiner eigenen Beziehung zur Literatur: Mitte der 80er treffen sich die beiden Schriftsteller Jörg Krichbaum und Michael Ende, um über einen Künstler zu sprechen, der von den Nazis als »entartet« verdammt wurde: Michael Endes Vater Edgar Ende. Ursprünglich als reines Informationsgespräch gedacht, entwickelt sich der Austausch rasch zu einem spannenden Gespräch über die Kunst und Malerei des 20. Jahrhunderts, das schließlich mehrere Tage dauert. Welchen Bezug gibt es von den visionären Bildern des Vaters zur magischen Zauberwelt des Sohnes wie in der »unendlichen Geschichte«? Stößt man bereits in den Werken Edgar Endes auf Hinweise darauf, womit Michael Ende Leser auf der ganzen Welt begeistern wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Michael EndeJörg Krichbaum
Die Archäologie der Dunkelheit
Gespräche über Kunst und das Werk des Malers Edgar Ende
Vorwort
Wenn man etwas ganz Bestimmtes von einem Menschen wissen möchte, dann überlegt man sich in der Regel ziemlich genau, was und wie man ihn fragt. Und dass man sich zu diesem Zweck natürlich die entsprechenden Notizen macht, versteht sich von selbst. Dazu kommt, dass man, das Ziel der Unternehmung vor Augen, zugleich eine recht konkrete Vorstellung davon hat, wie lange solch eine Befragung, solch ein Interview dauern sollte.
Was jedoch passiert, wenn man den Anlass ein wenig aus den Augen verliert und während des Gesprächsweges an Kreuzpunkte gelangt, von denen Pfade, Straßen oder Alleen abzweigen, die verführerische Ausblicke verheißen? Man könnte zum Beispiel ein Stückchen mitgehen, wenn durch alles vorher Gesagte geradezu versprochen ist, dass auch abseitige Schritte reichlichen Ertrag bringen werden.
Der Anlass für das Gespräch mit Michael Ende war sein Vater, der Maler Edgar Ende, dessen Todestag sich 1985 zum zwanzigsten Male jährt und über den im kommenden Jahr eine Monographie erscheinen wird, mit deren Herausgabe ich befasst bin. Es ging also, wie man so schön sagt, um Daten, Fakten und Hintergründe. Und nicht um das atemberaubende, strahlende und teilweise befremdliche Panorama, welches sich stattdessen vor uns aufspannte. Selbstverständlich, man hätte angesichts des Befragten mit derlei rechnen können, aber man hätte es wohl kaum planen können.
Der Maler Edgar Ende ist heute, obwohl ein mächtiges und in seiner Vielfalt beeindruckendes Œuvre vorliegt, so gut wie unbekannt. Als Maler geistiger Welten beeinflusste er nicht nur das Schaffen von Mac Zimmermann, sondern auch das von Fabius von Gugel und Eberhard Schlotter und nicht zuletzt das seines Sohnes Michael, dessen Bücher mittlerweile in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt wurden.
Um es kurz zu machen: Das Gespräch verschaffte sich bereits nach wenigen Minuten seinen eigenen Anlass. Offensichtlich wollte es den Fragenden wie den Befragten gleichermaßen in die Pflicht nehmen, wollte über Gott und die Welt reden und den eigentlichen Kern wohl nur am Rande streifen, sodass es einige Mühe kostete, angesichts sich disparat gebender Weltanschauungen und spürbarer Neigungen, jeden gefundenen Faden dem Gewebe einzuverleiben, wenigstens die bedeutsamsten Informationen und Vermutungen in Bezug auf die Malerei des Vaters gesprächsweise zu überprüfen und, wo möglich, dingfest zu machen.
Überraschend für mich in diesem Zusammenhang die erst nachträglich, also erst bei der Durchsicht des Gesprächs-Manuskriptes deutlich sich zeigende Offenheit oder besser: diese Direktheit in der gegenseitigen Ansprache, dieser eigenartige, einer Sinuskurve vergleichbare Rhythmus, dieser Parlando-Ton, der wohl mehr als jede sich nach grammatikalischer Korrektheit streckende Sprechweise in der Lage ist, die Kunst und die Mystik, die Geometrie und das Leben in einem Klang zu vereinen.
Jedenfalls wurden aus den geplanten vier Stunden etwas mehr als vier Tage. Und ich bin mir nicht sicher, ob man diese Gespräche, wann immer die Gelegenheit sich bieten mag, nicht einfach weiterführen sollte, mit demselben Mut.
Rom
Jörg Krichbaum
Erster Tag
Krichbaum: Herr Ende, vermutlich ist Ihnen ebenso wie mir bewusst, dass Interviews oft wie jene Streitgespräche sind, bei denen allen Teilnehmern erst im Nachhinein die treffenden Antworten bzw. die hieb- und stichfesten Vergleiche einfallen. Dennoch möchte ich es wagen, Sie gerade in dieser Form über das Leben und das Werk Ihres Vaters zu befragen. Wie Sie wissen, arbeite ich seit einiger Zeit an einer Monographie über Edgar Ende, und die Recherchen waren bisweilen sehr mühsam und brachten auch oft recht Widersprüchliches zutage. Verwunderlich für mich zum Beispiel, dass viele in den Lexika aufgeführten Fakten in Bezug auf Ihren Vater nicht ganz richtig oder sogar falsch sind …
Ende: Dass die Daten und Fakten falsch sind, ist mir, ehrlich gesagt, unbekannt. Aber ich habe auch nicht alle Lexika daraufhin durchgestöbert.
Krichbaum: In Herders Enzyklopädie der Malerei steht, dass Ihr Vater angeblich 1933 Malverbot erhielt. Das kam aber erst 1936. Dann soll er 1947 die Neue Gruppe mitbegründet haben. Das geschah aber schon ein Jahr früher. Aus dem Kindler Lexikon darf man erfahren, dass Edgar Ende heute ein »allgemein anerkannter« Maler ist. Dabei ist es schon ein Erfolg, Kunstsachverständige zu treffen, die wenigstens den Namen noch kennen. Der Brockhaus behauptet schlicht: Ende gehöre zu den Surrealisten. Das ließe sich fortsetzen. Doch was mich am meisten irritierte, waren die hanebüchenen Interpretationen.
Ende: Dass die Interpretationen falsch sind oder genauer: Dass die Arbeit meines Vaters sehr häufig missverstanden wurde, ist tatsächlich ein Kapitel für sich. Das liegt wohl daran, dass mein Vater mit seinen Werken so wenig hineinpasste in den üblichen Kunstbetrieb, in die zu seiner Zeit üblichen Weltanschauungen, dass er gewissermaßen missverstanden werden musste, dass man etwas in seine Werke hineininterpretierte und dass man ihn ständig in Zusammenhang bringen wollte mit irgendwelchen künstlerischen Bewegungen, die eben zu der Zeit gerade Mode waren, zu denen er aber in Wirklichkeit gar nicht gehörte: wie zum Beispiel der französische Surrealismus, zu dem er nun wirklich nicht gehörte und von dem er sich ständig distanziert hat.
Krichbaum: Was mich in diesem Zusammenhang interessiert: Ihr Vater war, zumindest geht das für mich aus vielen Artikeln hervor, die über ihn erschienen sind, so etwas wie der Prototyp eines Künstlers. Und das in sehr bewegten Zeiten. Den Ersten Weltkrieg hat Ihr Vater, Jahrgang 1901, bewusst erlebt, ebenso die Machtergreifung Hitlers, den Zweiten Weltkrieg, den Zusammenbruch und die später verordnete und zunächst zaghaft praktizierte Demokratie. Ganz allgemein: Was hat ein Künstler mit derlei Dingen zu tun? Wirken sie in sein Werk hinein?
Ende: Sie haben in das Werk meines Vaters ganz eindeutig hineingewirkt. Wenn Sie allein daran denken, dass er ja durch das Heraufkommen der Nazis die größten Lebensschwierigkeiten bekam, dass sein Werk zur Entarteten Kunst gezählt wurde, dass er Malverbot bekam und schließlich nicht einmal Farben und Pinsel kaufen konnte, weil man dazu Mitglied der Reichskulturkammer sein musste und das natürlich für ihn nicht infrage kam. Also insofern hat die Weltgeschichte ganz unmittelbar auf das Leben meines Vaters gewirkt. Darüber hinaus aber noch in ganz anderer Form, indem er eben die ganze Entwicklung der europäischen Kultur eigentlich mit großer Trauer, mit großer Bestürzung erlebte und ihn alles das, was da geschah, in eine sehr einzelgängerische Position hineinzwang, geradezu hineinstieß. Er musste praktisch in die innere Emigration gehen oder in eine Opposition zu seiner ganzen Zeit. Das ist ihm mit Sicherheit nicht leichtgefallen. Das hat ihn sehr, sehr viel Kraft gekostet. Auch im künstlerischen Sinn. Wenn Sie einfach mal die Bilder vergleichen, die er in den ersten Jahren seiner malerischen Tätigkeit gemacht hat, also die Bilder aus den frühen 20er Jahren, dann werden Sie dort noch zum Teil eine, ich möchte beinahe sagen, idyllische Welt finden. Es sind dort Gartenszenen, die sehr friedvoll sind. Es gibt dort zum Beispiel das Ölgemälde Das Aquarium, eines seiner schönsten Bilder, ein Bild, das einen ganz eigentümlichen, harmonischen Zauber besitzt. Aber später dann, im Grunde schon Ende der 20er und zu Beginn der 30er Jahre, kommt dann eine ganz andere Phase, in der eben diese eigenartigen Schreckensvisionen plötzlich auftauchen, weil er eben vorausspürte, was nun geschehen würde.
Krichbaum: Also eine konkrete Wirkung auf Leben und Werk durch die Zeit …
Ende: Absolut. Es setzt sich bei ihm alles in seine Bilder um.
Krichbaum: Leider jedoch vermag die Kunst nur wenig zu ändern, jedenfalls kurzfristig – oder hat der Künstler eine ganz andere Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft?
Ende: Das ist eine wirklich schwer zu beantwortende Frage. Eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft sicher nicht in dem Sinne, wie man das in den letzten vierzig Jahren in der Bundesrepublik immerfort gepredigt hat, nämlich dass der Künstler sozusagen das Gewissen oder gar der Schulmeister der Nation zu sein hat. In diesem Sinne ganz gewiss nicht. Ich glaube aber, dass jeder Künstler nicht so sehr aus Pflichtgefühl, sondern aus einem inneren Wunsch heraus das Bedürfnis hat, sich seiner Gesellschaft verständlich zu machen. Sich seiner Gesellschaft mitzuteilen, und dass es für jeden Künstler schwer wird, wenn er merkt, dass diese Gesellschaft ihn nicht akzeptiert, seine Mitteilungen nicht wahrnimmt oder einfach nicht zur Kenntnis nimmt.
Krichbaum: Aber trotz der widrigen Umstände hätte der Künstler die Verpflichtung, im künstlerischen Sinne aufrichtig zu sein, seine wahrhaftige Meinung wie auch immer in Wort, Bild oder Ton seiner Gesellschaft mitzuteilen?
Ende: Ich würde das anders sagen. Ich würde sagen, wenn der Künstler wirklich in seiner Zeit lebt, dann setzen sich bei ihm ganz von selbst die Probleme seiner Zeit in seiner Kunst um. Ich glaube nicht so sehr, dass der Künstler, weder im Sinne einer Pflicht noch im Sinne einer Ambition, auf die Gesellschaft schielen sollte. Er sollte sich in erster Linie der Kunst verantwortlich fühlen. Er sollte sich seinem künstlerischen Gewissen verantwortlich fühlen und eigentlich erst in zweiter Linie dabei an die Gesellschaft denken, der er seine Kunst nun übergibt.
Krichbaum: Das ist ein schöner Hinweis: das Gewissen quasi als integraler Bestandteil der Kunst oder der künstlerischen Äußerung. So gesehen könnte dann wirkliche Kunst nie verlogen sein.
Ende: Nein, wenn es Kunst ist, kann sie nicht verlogen sein. Wenn sie wirkliche Kunst ist.
Krichbaum: Aber hätte dann nicht, wo der Künstler nun diese gewisse Form der Wahrheit vertritt und die Gesellschaft das vermutlich auch spürt und in einigen Fällen sogar erkennt, die Gesellschaft nicht eine Verpflichtung dem Künstler gegenüber, eine moralische beispielsweise?
Ende: Sicher hat die Gesellschaft dem Künstler gegenüber eine Verpflichtung, eine Verantwortung. Aber das ist sehr schwer festzulegen, weil es einfach Schicksalsfügungen sein müssen, die da stattfinden. Man kann das nicht programmieren, man kann das nicht zu einer Pflicht machen. Denken Sie nur an die vielen Künstler, angefangen von Rembrandt bis van Gogh, die von der Gesellschaft eben nicht oder erst sehr viel später oder erst nach ihrem Tod akzeptiert wurden. Da weiß ich nicht, ob es richtig ist, der Gesellschaft daraus einen Vorwurf zu machen. Es passiert doch immer wieder, dass ein Künstler dem Bewusstsein seiner Zeit voraus ist, und es wäre quasi unbillig, von den Menschen zu verlangen, dass sie nun alle ebenso weit voraus sein müssten, wie es der Künstler ist. Ich glaube, man muss das Tragische im Leben vieler Künstler einfach akzeptieren. Man muss es gelten lassen. Es gehört mit zum Erscheinungsbild dieses jeweiligen Künstlers. Man kann in einer wirklichen Tragödie nicht dem einen oder dem anderen einen Vorwurf machen und sagen: Diese Tragödie hätte es nicht gegeben, wenn die Beteiligten nur alle vernünftiger gewesen wären. Das ist sinnlos. Eine Tragödie muss sich eben vollziehen. Und so gibt es auch die Tragödien der Künstler, die nicht begriffen worden sind von ihrer Zeit. Das gehört mit zu ihrem Leben.
Krichbaum: Mit einem Satz: Der Künstler, wenn er Künstler ist, ist einsam.
Ende: Der Künstler ist auf jeden Fall einsam. Ob er nun Erfolg hat und akzeptiert wird oder ob er nicht Erfolg hat und nicht akzeptiert wird. Glauben Sie etwa, dass Picasso nicht einsam war, obwohl er der erfolgreichste Künstler dieses Jahrhunderts war? Er war ganz bestimmt einsam.
Krichbaum: Und Sie selber, Sie sind auch einsam?
Ende: Selbstverständlich.
Krichbaum: Und Sie spüren das ständig oder vor allem dann, wenn Sie sich darüber Gedanken machen?
Ende: Nein, ich spüre das ununterbrochen.
Krichbaum: Als ständige Erinnerung, dass Sie Künstler sind – oder auch manchmal als Lähmung, als Bedrohung vielleicht?
Ende: Nein, nicht als Lähmung oder als Bedrohung, sondern als eine selbstverständliche Voraussetzung meiner Existenz. Ich glaube, wer nicht einsam ist, der kommt gar nicht auf die Idee, Kunst oder Literatur zu machen.
Krichbaum: Aber man könnte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass der einsame Künstler, weil er ja ohnedies einsam ist, ohne die Gesellschaft auskommt?
Ende: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Denn wenn ich etwas mitteile, dann teile ich es ja jemandem mit. Ich kann doch nicht immerfort ins Leere hinein reden.
Krichbaum: Obgleich dieser Jemand unter Umständen gar nicht versteht, was Sie ihm mitteilen …
Ende: Obgleich der gar nicht versteht, was man ihm mitteilt. Und trotzdem spricht man zu ihm! Das ist im Leben eines Künstlers nicht anders als in vielen menschlichen Beziehungen.
Krichbaum: Dann wäre also Kunst eher eine Form der vorausschauenden Kommunikation?
Ende: Ja. Auch das gibt es. Obwohl man das nicht verallgemeinern sollte. Aber das gibt es zweifellos, dass ein Künstler zu einem Publikum spricht, was erst hundert Jahre später da sein wird.
Krichbaum: Also eine weit in die Zukunft hineinrufende Kunst bekommt Antwort und Echo, wenn der, der diese Kunst geschaffen hat, nicht mehr lebt.
Ende: So ist es.
Krichbaum: Ist das auch Ihrem Vater bewusst gewesen?
Ende: Mein Vater war eigentlich ziemlich sicher, dass man eines Tages verstehen würde, was er gemalt hat und warum er es so gemalt hat.
Krichbaum: Jetzt fühle ich mich an Max Beckmann erinnert, der das ähnlich formulierte. Dennoch, so wenig gelitten war Ihr Vater in seiner Zeit nun auch wieder nicht. Ich denke da vor allem an die Ausstellungen, die Ihr Vater bis Ende der 30er Jahre und dann natürlich nach dem Krieg in verstärktem Maße gemacht hat und an denen immerhin Künstler beteiligt waren wie beispielsweise Picasso, Kubin, Giorgio de Chirico, Trökes oder Mac Zimmermann. Das liest sich streckenweise wie ein Gotha der modernen Malerei …
Ende: Das ist richtig. Mein Vater war beim kunstverständigen Publikum durchaus bekannt und akzeptiert. Doch zugleich wurde er auch für einen Außenseiter gehalten. Und man hält ihn heute noch dafür. Ich glaube, das liegt wohl auch daran, dass er ganz bewusst auf alle Bestechungsversuche des Betrachters verzichtete. Ich meine damit, er bemühte sich nicht um eine schöne Peinture; er wollte nicht durch eine wie auch immer geartete altmeisterliche Maltechnik überzeugen, quasi als Selbstzweck, als Element, das jeder sofort erkennen und abhaken konnte. So wie man das bei Fuchs …
Krichbaum: Sie meinen jetzt Ernst Fuchs?
Ende: Ja, den Wiener Phantasten. Diese virtuose Technik, die oft darüber hinwegtäuscht, dass das Bild ganz leer ist, die aber beim Publikum phantastisch ankommt.
Krichbaum: Und das dann die Technik schon für die Aussage hält.
Ende: Ja. Mein Vater hat jedenfalls auf alle diese Dinge verzichtet. Dazu kommt, dass er auch nicht so leicht einzuordnen war, dass er seinen eigenen Weg ging und sich vermutlich auch deswegen von den französischen Surrealisten distanziert hat. Mit dieser Art von Malerei, die aus dem Unterbewusstsein kam, das Unterbewusste darstellte, konnte er nichts anfangen. Ihm ging es eigentlich mehr um das Wiederfinden der mythischen Regionen im Menschen. Um das »Überbewusste«, wenn Sie so wollen. Das ist nicht gleichbedeutend mit dem Absurden oder dem Unterbewussten im freudschen Sinne. Dieser Urschlamm interessierte ihn nicht. Trotzdem blieben viele Betrachter angesichts der Bilder ratlos. Sie waren und sie sind noch immer schwer zu verdauen. Keine Idyllen, nichts Dekoratives, was man sich so ohne Weiteres ins Wohnzimmer hängen würde.
Krichbaum: Aber vielleicht ins Schlafzimmer, wie den Turm der Blauen Pferde von Herrn Marc …
Ende: Heute. Ja. Vielleicht kommt das noch.
Krichbaum: Dennoch, mich irritiert die Tatsache, dass es bereits 1928, da war Ihr Vater gerade siebenundzwanzig Jahre alt, regelrechte Lobeshymnen auf das Werk Ihres Vaters gab. Also zu einer Zeit, wo er bestenfalls, das als Behauptung, vierzig Bilder gemalt hatte. Hugo Sieker beispielsweise scheute sich nicht, die Werke Ihres Vaters, besonders die Darstellung des Menschen und die Behandlung des Hintergrunds mit denen von Marées zu vergleichen und ihn als legitimen Nachfolger zu apostrophieren. Das finde ich außerordentlich.
Ende: Na ja, Hugo Sieker war auch fast so etwas wie ein Studienkollege …
Krichbaum: Diesen Vergleich finde ich trotzdem sehr treffend.
Ende: Er ist auch treffend. Mein Vater war Ende der 20er Jahre tatsächlich dabei, sich einen Namen zu machen. Sogar Franz Roh wurde auf ihn aufmerksam und kam ihn besuchen. Es gab in der Tat eine ganze Reihe von bedeutenden Kunstkritikern, die sich sehr positiv über das Werk meines Vaters äußerten. Aber wie das halt so ist, zum Beispiel bei Franz Roh, den ich selber noch gut gekannt habe, der war natürlich immer sehr erpicht darauf, mit seinen Kritiken an der Spitze der jeweiligen Kunstentwicklung zu stehen. Er hat ja dann auch sehr schnell das Interesse an dem verloren, was er für Surrealismus hielt, weil dann die abstrakte Malerei kam, das war dann viel aktueller. Und die Nazis kamen dann auch. Da war es vorbei mit den Lobeshymnen in dieser Richtung. Und es gab auch keine Möglichkeiten mehr auszustellen. Man hatte meinem Vater sogar verboten, Farben zu kaufen.
Krichbaum: Trotz dieser unseligen Zeiten durfte Ihr Vater bis 1938 seine Arbeiten ausstellen. In Deutschland und auch im Ausland. Sogar in den Vereinigten Staaten.
Ende: Die Ausstellungen in Pittsburgh waren nur möglich, so lange Amerika noch nicht in den Krieg eingetreten war.
Krichbaum: Nach grober Schätzung konnte man damals Ihren Vater zu jenen Malern zählen, die mit am häufigsten an Ausstellungen beteiligt waren und deren Werk von einigen der besten Museen angekauft wurden. Sogar nach dem Krieg, ich glaube 1946, konnte er sofort wieder ausstellen. Es ist für mich nur schwer nachzuvollziehen, dass ein solcher Maler so in Vergessenheit geraten kann, wie es heute der Fall ist. Woran liegt das?
Ende: Das kann ich nicht beantworten. Ich habe das auch nie verstanden. Und ich habe mich wirklich zu vielen Gelegenheiten darum bemüht, auch nach dem Tod meines Vaters …
Krichbaum: Im Dezember 1965.
Ende: Ja, bis heute bemühe ich mich, ihm den Platz zu verschaffen, der ihm meiner Ansicht nach zusteht.
Krichbaum: Vergessen wie Eberhard Schlotter.
Ende: Was vergessen ist, ist immerhin einmal da gewesen; er war nie richtig da. Es gab da eine Art stille Übereinkunft bei den Kunsthändlern, die offen sagten: Ach, den Ende, den kann man so schwer verkaufen. Ich weiß noch, kurz nach dem Krieg, da gab es einen Kunsthändler, der sich sehr intensiv für ihn eingesetzt hatte. Das war der Booth in München. Und selbst der sagte immer: Wissen Sie, Herr Ende, ich verkaufe eher 20 Baumeister, ehe ich einen Ende verkaufe. – Also Bekanntheit und Verkäuflichkeit hängen nun mal zusammen. Und es ist klar, ein Baumeister passt problemlos zum Mobiliar. Aber stellen Sie sich mal Die Zelte an der Wand vor und rundherum ist Art Deco.
Krichbaum: Diese Leute wären besser mit den Sachen der Lempicka bedient.
Ende: Zum Beispiel. Ein Käufer fällt mir gerade ein, der hat das wunderbar gemacht, und zwar mit dem Bild Die brennende Fahne. Der hat sich tatsächlich eine Nische in die Wand seines Musikzimmers hauen lassen, über dem Flügel – und man konnte dann durch eine Zimmerflucht auf das Bild zugehen. Die Bilder sind unheimlich dominierend. Und überhaupt nicht gefällig, dekorativ. Sie fordern sehr viel.
Krichbaum: Da bin ich etwas anderer Meinung. Zudem stellt sich mir das Werk so dar, als ob es aus zwei Teilen oder Phasen bestünde: der Vorkriegs- und der Nachkriegsphase. Der Teil, der bis ca. 1940 entstandenen Arbeiten erscheint mir, mit dem heutigen Bewusstseinsstand, als »leicht« zu verstehen. Das nach dem Krieg entstandene Œuvre wirkt auf mich sperriger. Das Werk eines Suchenden, eines Experimentierers, bis hinein in die Farbgebung. Und viele Kritiker sagen auch, dass die Vorkriegsphase die bedeutendere ist.
Ende: Ich nenne das immer seine klassische Phase, bis Ende der 30er Jahre. Da wurden seine Bilder beherrscht von einer mythisch-klassischen Atmosphäre. Ob die besser war, weiß ich nicht, jedenfalls war sie nicht leichter zu konsumieren. Im Gegenteil, die Leute haben sogar Angst bekommen. Es gab Leute, die wurden ohnmächtig angesichts seiner Bilder. Denen verschlug es buchstäblich den Atem vor der Einsamkeit auf seinen Bildern. Eine vorweltliche Einsamkeit. Und eigentlich mache ich mir selbst und allen jenen, die ihm ständig reinzureden versuchten, wirklich Vorwürfe.
Krichbaum: Wo wollte man ihm reinreden?
Ende: Dauernd haben wir ihm gesagt, er soll doch ein bisschen farbiger werden, zum Beispiel mehr Wert auf Peinture legen, auf die durch die Maltechnik bestimmten Reize und all diese Dinge, die so weit weg von seinen Vorstellungen waren. Aber er hat dann tatsächlich versucht, nachdem er mit einigen Kollegen zusammen in Paris war und dort die französische Malerei gesehen hatte, rauszukommen, weg von diesen erdigen Tönen, diese Grautöne zum Leuchten zu bringen. Er hat das schon versucht, ein bisschen gefälliger zu werden. Und damit natürlich all diejenigen enttäuscht, die ihn anders kannten. So hat er sich Schwierigkeiten gemacht, ein Leben lang. Die einen hat er verschnupft, und die anderen hat er nicht erreicht.
Krichbaum: Wenn man das Werk Ihres Vaters Revue passieren lässt, scheint mir das, jetzt nach Ihren Erklärungen, fast sichtbar zu sein. Sichtbar wird allerdings auch etwas ganz anderes: nämlich die Perfektion von Anfang an. Ich meine damit, dass gleich die ersten Bilder wie die eines fertigen Malers wirken. Und nicht wie die eines Autodidakten, der sich erst in vielen Bildern seine Technik und Thematik erarbeiten musste. Wie kommt es, dass jemand mit neunzehn, zwanzig Jahren anfängt, als ob er schon fertig sei?
Ende: Mein Onkel erzählte mir, dass mein Vater schon als Kind, ganz früh mit dieser Bilderwelt vertraut war. Die beiden haben sich vor dem Schlafengehen gegenseitig erzählt, was sie so sehen, haben sich die Bilder geschildert, die in ihren Köpfen auftauchten, kurz vor dem Einschlafen. Und das waren schon diese Bilder. Seine Bilder. Das war von vornherein da. Die einzige Frage für ihn war nur noch, wie setze ich das um. Wie. Auf eine Leinwand? Mit einem Wort: Die Welt auf seinen Bildern, die Themen, die musste er nicht suchen, die war ihm gegeben, von Anfang an.
Krichbaum: Ein Maler ohne Vorläufer.
Ende: Er kannte gar keine Maler, damals.
Krichbaum: Dennoch, Ihr Vater hat in Hamburg-Altona die Kunstgewerbeschule besucht und sich das Handwerkszeug angeeignet. Nebenher arbeitete er als Anstreicher, um sich das Geld für das Malen seiner Bilder zu verdienen. Hatte er zu der Zeit keinen Kontakt zu anderen Malern?
Ende: Wenn, dann nur sehr wenig. Auch mit de Chirico, was oft erwähnt wird, stimmt das nicht so ganz. Mein Vater kam aus sehr kleinen Verhältnissen. Und er hat de Chiricos Bilder erst kennengelernt, als er selber schon längst so malte. Eine Koinzidenz, wenn Sie so wollen, dass es zwei Maler gibt, die jeweils eine metaphysische Welt hingestellt haben.
Krichbaum: Moment, es gab über de Chirico die Beziehung zu Böcklin, und auch dessen Werke hatte Ihr Vater gekannt …
Ende: Auch erst viel später. Es gibt ein Bild, auf das kam er immer wieder zu sprechen. Das war für ihn wie eine Initialzündung, weder von Böcklin noch von de Chirico. Das Floß der Medusa, na helfen Sie mir …
Krichbaum: Von Géricault.
Ende: Da muss er fünfzehn oder sechzehn gewesen sein, als er das Bild sah. Das hat er später gesagt, dass er da sofort gespürt hätte, die Richtung gefunden zu haben. Auch das Pathos. Das suchte er. Und er ist ja einer der wenigen modernen Maler, die Pathos in ihren Bildern riskieren.
Krichbaum: Gut, also nur ein ganz klein wenig Böcklin.
Ende: Böcklin hat er nicht sehr gemocht.
Krichbaum: Obwohl es bei Böcklin Pathos gibt, ganz zu Schweigen von der Einsamkeit. Die wichtigsten Themen Ihres Vaters, Tod, Vergänglichkeit, Einsamkeit, die wichtigsten Themen auch bei Böcklin …
Ende: Das würde ich so nicht sehen. Die Böcklinsche Einsamkeit ist eine Stimmungseinsamkeit, gewissermaßen eine Einsamkeit, die sich greifen lässt, nehmen Sie zum Beispiel die Toteninsel oder etwas in der Art. Bei meinem Vater wird das zu einer kosmischen, also einer mythischen Einsamkeit. Endlose leere Räume, in denen irgendwo etwas stattfindet, sich ereignet. Es ist eine gänzlich andere Einsamkeit.
Krichbaum: Die leeren Räume, das ist richtig. Das gibt es so bei Böcklin nicht. Da ist fast reale Natur mit im Spiel …
Ende: Die Böcklin-Bilder sind voll. Es gibt Blumen, Gräser, Blätter, ausgearbeitete Strukturen …
Krichbaum: Ja, ich verstehe.
Ende: Und auf der anderen Seite, bei den Bildern meines Vaters, diese Weltraumleere. Und er war sehr darauf bedacht, diese zu erhalten. Das war ihm sehr wichtig, dass seine Bilder nicht vollgemalt wurden, weil er der Meinung war, dass dadurch das dargestellte, in der Leere stattfindende Ereignis entwertet würde, wenn zu viele Details vorkämen. Das Wichtigste für ihn war das Weglassen: so viel wegzulassen, wie irgend möglich war, und sich immer mehr zu konzentrieren auf diesen einzigen Vorgang, der wichtig war und der eben nicht gedanklich konzipiert war.
Krichbaum: Das verstehe ich nicht.
Ende: Es waren die Vorgänge, die Bilder, die in ihm auftauchten, die er, ich möchte fast sagen, lediglich notiert hatte und bei denen er sich schwer hütete, sie selber zu interpretieren. Worum es ihm immer zu tun war, das war das Geheimnis. Ein Schlüsselwort im Übrigen. Denn er sagte, das Absurde ist nicht geheimnisvoll. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Es gibt zwei verschiedene Arten, nicht zu verstehen. Das Absurde ist auf der intellektuellen Ebene nicht zu verstehen. Es ist paradox. Er meinte vielmehr das Mythische, das Metaphysische, das aus einem anderen Grund nicht zu verstehen ist, weil es geheimnisvoll ist und bleibt. Weil es, wie er sagte, vor dem Gedanken kommt. Es ist ursprünglicher als jeder Gedanke. Und eben das hat er ständig zu finden versucht.
Krichbaum: Ich würde gern noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die leeren Räume und das Stichwort Einsamkeit zurückkommen. Denn mir scheint es sehr merkwürdig, hier einen Maler zu haben, der schon in seinen ersten Werken nicht nur sein Thema, sondern auch die Art der Darstellung gefunden hat. Oder ist das eher ein böses Omen.
Ende: Das kann sein. Und was merkwürdig ist, dass er als Mensch ganz und gar nicht so wirkte. Er war eher ein freundlicher, ein durchaus geselliger, ja ein jovialer Mensch, der sehr viel Wärme um sich herum verbreiten konnte. Ich erinnere mich an eine Dame, die das nicht verstand; die Bilder von ihm gesehen hatte und zu Besuch kam, völlig empört war, ihn für einen Hochstapler, nicht für den Maler hielt und ihn als Lügner bezeichnete. Sie hatte sich einen hageren Asketen mit glühenden Augen vorgestellt, umgeben von einer Atmosphäre von Jenseitigkeit. Stattdessen kam ihr ein rundlicher Mann mit Embonpoint und einem sehr freundlichen Gesicht entgegen, der in seiner persönlichen Ausstrahlung nichts von dem hatte, was in seinen Bildern ist. Doch wenn ich mir die Summe seines Lebens jetzt vor Augen führe, dann glaube ich, dass hinter dieser persönlichen Erscheinung irgendetwas in ihm war, was tatsächlich das ganze Leben lang einsam geblieben ist und was für uns alle unerreichbar blieb. Und das hat er eigentlich gemalt.
Krichbaum: Rein quantitativ wurde es ein gewaltiges Werk. Abgesehen von den vielen Gemälden und Zeichnungen, die verbrannt oder verschollen sind. Ein Werk jedoch, dem der Erfolg versagt blieb, bis heute. Auf der einen Seite der Maler Edgar Ende, auf der anderen Seite der Sohn, der Schriftsteller Michael Ende. Misserfolg und Erfolg. Man sagt, dass Sie der erfolgreichste Schriftsteller der Nachkriegszeit sind. Ist das ausgleichende Gerechtigkeit?
Ende: Ach, wissen Sie: Erfolg oder nicht Erfolg, ich glaube, das hat im Grunde genommen nichts mit Qualität zu tun. Nicht, dass ich damit sagen will, nur mangelnde Qualität ist erfolgreich. Das wäre Unsinn. Es gibt großartige Bücher wie den Don Quichotte, die sofort erfolgreich waren, regelrechte Bestseller in ihrer Zeit. Und es ist nach wie vor ein großartiges Buch. Oder denken Sie an Goethes Werther. Und es gibt andere Bücher, wie die von Kafka, die es sehr schwer hatten, überhaupt verstanden zu werden, selbst im engsten Freundeskreis …
Krichbaum: Und was später kam, hat er dann nicht erfahren, weil fast nichts zu Lebzeiten publiziert wurde.
Ende: Bis auf eine Erzählung, ja. Ich will damit auch nur sagen: Woher Erfolg oder Misserfolg kommen, das hat mit der Intensität, der Ernsthaftigkeit oder der Qualität eines Werkes überhaupt nichts zu tun. Das liegt an der Zeit. Bei meinem Vater kann man regelrecht sagen, dass für ihn immer die falsche Zeit war. Gerade, wenn er anfing, Erfolg zu haben, geschah etwas, was diesen Erfolg zunichtemachte. In den 30er Jahren, als er anfing, Erfolg vor allem im Ausland zu haben, kamen die Nazis und haben das unterbunden. Als der Krieg dann vorbei war und er nun dachte, endlich ist die Zeit da, jetzt kann ich malen und ausstellen, wie ich will, war die offizielle Kunstszene nicht mehr am Surrealismus in seiner Gesamtheit interessiert: Plötzlich gab’s nur noch Abstrakt oder Monochrom, mit allen Zwischenstufen. Und Ende galt als veraltet, weil er an seiner Art zu malen festhielt. Er hat seiner Sache die Treue gehalten. Und als dann die Zeit der Wiener Schule kam, so in den frühen 60er Jahren, also die Zeit, in der man auch seine Werke hätte rezipieren können, da starb er, gerade 64 Jahre alt.
Krichbaum: Zur selben Zeit entwickelte sich auch das politische Bewusstsein zum Beispiel in der Studentenschaft, der Prager Frühling war nicht mehr fern …
Ende: