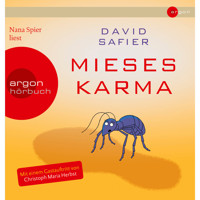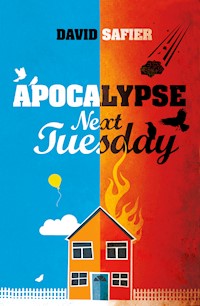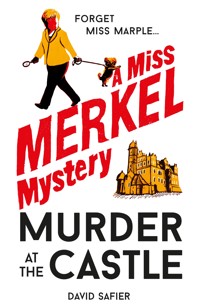9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das große Abenteuer Liebe Die einäugige Hündin Narbe kann sich nicht vorstellen, dass eine wie sie jemals geliebt werden könnte. Doch dann verirrt sich der sanfte Hund Max zu der Müllkippe, auf der Narbe lebt. Er erzählt ihr von seinem wunderschönen Zuhause bei den Menschen und in der Hoffnung auf ein besseres Leben begleitet Narbe den Fremden auf die gefährliche Heimreise. Unterwegs wird Max von Alpträumen geplagt, in denen die beiden ein Liebespaar sind, aber von einem Menschen getötet werden. Aber sind es wirklich Alpträume oder vielmehr Erinnerungen? Narbe wehrt sich anfangs dagegen, dass es ihr Schicksal sein soll, Max zu lieben. Doch kaum beginnt sie zaghaft an das Gute zu glauben, taucht der Mensch aus den Träumen auf... "Safier erzählt eine große, packende Geschichte von tragischer Wucht, die ihre Leser nicht verfehlen wird." FAZ über 28 Tage lang
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
David Safier
Die Ballade von Max und Amelie
Roman
Über dieses Buch
Das große Abenteuer Liebe
Die einäugige Hündin Narbe kann sich nicht vorstellen, dass eine wie sie jemals geliebt werden könnte. Doch dann verirrt sich der sanfte Hund Max zu der Müllkippe, auf der Narbe lebt. Er erzählt ihr von seinem wunderschönen Zuhause bei den Menschen und in der Hoffnung auf ein besseres Leben begleitet Narbe den Fremden auf die gefährliche Heimreise.
Unterwegs wird Max von Albträumen geplagt, in denen die beiden ein Liebespaar sind, aber von einem Menschen getötet werden. Aber sind es wirklich Albträume oder vielmehr Erinnerungen? Narbe wehrt sich anfangs dagegen, dass es ihr Schicksal sein soll, Max zu lieben. Doch kaum beginnt sie zaghaft an das Gute zu glauben, taucht der Mensch aus den Träumen auf …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagillustration Oliver Kurth
ISBN 978-3-644-30039-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Max.
Und natürlich für Marion,
Ben und Daniel.
Ihr seid mein Licht.
«In der Nacht des Goldenen Lichts begann unser ewiges Leben. Unser ewiges Sterben. Unsere ewige Liebe.»
1
Ich sah Max das erste Mal, als ich noch nicht Amelie hieß. Auf der Müllkippe jener Stadt tief im Süden. Zu einer Zeit, in der ich noch nicht wusste, dass es noch andere Städte gab oder gar andere Länder. Bevor ich das Salz des Meeres gerochen hatte, die goldenen Blätter der Wälder gesehen und den Schnee auf meiner Zunge geschmeckt. Oder den Hass unseres Verfolgers gespürt.
Bevor ich ahnte, dass ich eine unsterbliche Seele besaß.
Die Sonne stand hoch am Himmel und brannte unerbittlich auf die unzähligen Hügel. Krähen segelten hinab, um sich Essen zu picken, Ratten raschelten durch den Menschenunrat, in dem Ameisen Hügel um Hügel bauten, und ich lag in einer schattigen Mulde, umgeben von Säcken. Einen davon hatte ich mit den Zähnen aufgerissen. In dem Sack steckte eine Fischdose, die ich ausschlecken wollte. Die Reste, die an den Innenseiten klebten, waren noch nicht so schlecht geworden, dass ich mir den Magen daran verderben würde. Gerade schob ich meine Zunge hinein, ganz vorsichtig, damit ich mich nicht an den scharfen Rändern schnitt, da hörte ich, wie ein Hund die andere Seite des Müllbergs hinauflief. Die Schritte klangen schwerer als meine und die meiner Geschwister, dieser Hund musste also größer und kräftiger sein. Ein Fremder.
Ich schaute den Müllberg hinauf und sah in der flirrenden Hitze, wie der Fremde die Kuppe erreichte. Solch einem Hund war ich noch nie begegnet: Er war größer als alle Vierbeiner, die auf der Müllkippe herumstreiften, und hatte langes schwarzes Haar. In meinem Rudel besaßen alle ein kurzes, sandfarbenes Fell. Nur ich hatte ein paar dunklere Haare an einer runden Stelle auf meinem Rücken. Ihretwegen hatte mir meine Mutter bei der Geburt den Namen Fleck gegeben. Und ihretwegen hatten meine Brüder und Schwestern mich ausgelacht, herumgeschubst, manchmal sogar gequält. Dieser Stelle hatte ich es jedoch auch zu verdanken, dass ich seit meiner Jugend zu einer Kämpferin geworden war, die sich nichts gefallen ließ. Bis zu jenem Tag, an dem Mama so krank wurde, dass mein großer Bruder Blitz die Führung des Rudels für sich beanspruchte.
Ich hätte ihm nicht widersprechen dürfen.
Ich selbst wollte gar nicht der Leithund sein. Aber ich wollte mich meinem Bruder nicht unterordnen. Auf Mama zu hören war mir immer ganz natürlich erschienen. Eines meiner Geschwister jedoch als überlegen zu akzeptieren und dann auch noch Blitz, der mich stets am meisten gequält hatte, widerstrebte mir. So sehr, dass ich ihn noch am gleichen Tag, an dem er die Macht an sich riss, zum Kampf herausforderte.
Und so standen Blitz und ich uns an einem kalten Wintermorgen gegenüber und knurrten uns an. Es hatte in der Nacht geregnet, der Sand unter unseren Pfoten war nass, unser Fell glänzte vor Feuchtigkeit. Ich bemühte mich, mir meine Furcht, die sich von meinem Herzen aus allmählich in mir ausbreitete und mich zu lähmen drohte, nicht anmerken zu lassen. In der törichten Hoffnung, Blitz einschüchtern zu können, knurrte ich noch lauter, obwohl er meine Angst doch riechen konnte. So standen wir eine Weile da, ohne dass ich mich traute, ihn zu attackieren. Plötzlich rannte Blitz auf mich zu, sprang mich mit einem Satz an und riss mich zu Boden. Seine gefletschten Zähne ragten drohend über meinem Gesicht auf. Ich zitterte vor Angst. Ehe ich ihm überhaupt den Hals hinhalten konnte, um mich zu unterwerfen, biss er mir das linke Auge heraus. Der Kampf war vorbei, bevor er überhaupt begonnen hatte.
Ich jaulte und winselte, mein Bruder ließ von mir ab, und ich schlich mit eingezogenem Schwanz davon und suchte mir ein Versteck hinter einem Bretterhaufen. Unfassliche Schmerzen erfüllten meinen Körper. Zugleich hatte ich Panik, dass Blitz mir folgen würde, um mich zu töten. Er tat es nicht.
Noch in der gleichen Nacht bekam ich Fieber. Die Wunde am Auge hatte sich entzündet, und der Schmerz breitete sich wie Feuer in mir aus. Ich konnte tagelang nicht aufstehen, weil ich zu schwach war. Nur Erstgeborener besuchte mich an meinem Platz. Er ließ Wasser, das er in seinem Maul zu mir getragen hatte, in meine Kehle rinnen. Damit widersetzte er sich heimlich Blitz, der die Geschwister und meine todkranke Mutter angewiesen hatte, die Natur entscheiden zu lassen, ob ich am Leben blieb oder nicht.
Die Winterkälte setzte mir zu, auch wenn sie nicht so unerbittlich war wie jene, die ich auf meiner Reise mit Max in den Norden noch kennenlernen sollte.
Für mich war es wohl ein Segen, dass ich nur den eisigen Wind und den prasselnden Regen ertragen musste. Im Sommer wäre ich meiner Entzündung gewiss erlegen. So aber konnte ich mir nach einer Weile wieder etwas zu fressen suchen und aus Pfützen trinken. Es dauerte lange, bis die Wunde aufhörte zu eitern, und noch länger, bis sie vollständig vernarbt war. Als ich schließlich zu meinem Rudel zurückkehrte, wurde ich nicht mehr Fleck genannt, sondern Narbe.
Dass mich irgendjemand einmal schön finden könnte, wäre mir niemals in den Sinn gekommen.
Der große schwarze Hund, der den Müllberg herunterlief, wirkte gehetzt und verängstigt. Außerdem hörte ich Menschenschritte, nicht so schwer wie die der Männer, die mit ihren rollenden Höhlen den Müll abluden. Die Schritte stammten eher von Menschenkindern. Sie streunten immer wieder in kleinen Rudeln über die Müllkippe, um Metalle einzusammeln. Was sie damit machten, konnten meine Familie und ich uns nicht vorstellen, aber irgendeinen Wert mussten sie für die Menschenkinder haben. Es war ungewöhnlich, dass sie sich in unser Revier trauten. Menschen, egal ob groß oder klein, gingen uns stets aus dem Weg. Auch die anderen Hunde, die über die Müllkippe streiften, respektierten uns. Sie kannten die Geschichte von Blitz, der seiner eigenen Schwester ein Auge ausgerissen hatte. An manchen Morgen tröstete ich mich damit, dass mein Verlust wenigstens das Leben unseres Rudels sicherer machte.
Fünf Menschenkinder rannten jetzt über den Hügel, darunter ein Weibchen mit schwarzem Haarschopf. Auch eines der Männchen fiel mir auf. Es trug nicht wie die anderen am ganzen Körper das falsche Fell der Menschen. Nur seine Beine waren damit verhüllt, der obere haarlose Körper war nackt. Ich konnte dort sämtliche Knochen erkennen, so mager war der Junge.
Wie alle Menschenkinder, denen ich bisher begegnet war, stanken auch diese schon von weitem nach Angst. Irgendwo musste es einen Rudelführer geben – einen Vater, eine Mutter oder einen Bruder wie Blitz –, den wir nie zu Gesicht bekamen und der sie das Fürchten lehrte. Das Weibchen mit den schwarzen Haaren roch außerdem nach frisch verbranntem Fleisch. Als es näher kam, erkannte ich kleine Wunden an seinen Armen.
Bald würden die Menschenkinder den fremden Hund eingeholt haben. Welcher Hund war langsamer als Zweibeiner? Nur einer, der ohnehin dem Tod geweiht war.
Doch dieser Hund wirkte zwar geschwächt – seine Zunge hing ihm aus dem Maul, als hätte er lange nichts getrunken –, aber er hatte mehr Fleisch auf den Rippen als ich jemals in meinem Leben. Der Fremde war also nicht schwach, jedenfalls nicht körperlich. Aber er stank ebenfalls nach Angst. Im Gegensatz zu den Menschenkindern jedoch, bei denen der Angstgeruch schon zu ihrer Natur zu gehören schien, war die Furcht des schwarzen Hundes offenbar frisch. Als würde er sich das erste Mal in seinem Leben ängstigen.
Wie konnte das sein? Vielleicht weil er so groß war und ihn bisher niemand attackiert hatte? Allerdings war der Fremde kein Kämpfer, von ihm ging nicht mal ein Hauch von Narbenhautgeruch aus, also hatte er noch nie eine schlimme Verletzung erlitten. Die Menschenkinder bewarfen ihn mit allem, was sie in die Finger bekamen: Dosen, Mülltüten, Holzlatten.
Warum knurrte der schwarze Hund sie nicht an? Warum biss er nicht einen von ihnen ins Bein, damit sie wussten, wer hier das Sagen hat? Was war das für ein Hund, der sich so etwas gefallen ließ?
Mit einem Mal humpelte er. Nicht etwa, weil ihn eines der Menschenkinder am Bein getroffen hatte, sondern weil er mit seiner linken Hinterpfote offenbar in scharfes Metall getreten war. Sehen konnte ich die Wunde nicht, aber ich roch das Blut. Und dieser Geruch wurde immer stärker. Was immer es war, das ihn verletzt hatte, es bohrte sich mit jedem Schritt tiefer in seine Pfote.
Die Menschenkinder hatten ihn inzwischen eingeholt. Sie standen im Kreis um ihn herum, bewarfen ihn jetzt auch mit Steinen und hatten anscheinend Spaß daran. Dass ich mich in ihrer Nähe aufrichtete, bemerkten sie nicht. Auch der Fremde sah sich nicht nach mir um oder bellte mir zu. Er hätte mich riechen müssen. Aber er war offenbar zu sehr von seiner Angst beherrscht.
Warum, bei Hundsmutter, wehrte er sich nicht? Ich verachtete ihn dafür. Noch mehr, als er anfing, jämmerlich zu jaulen. Ein Hund durfte nicht jaulen, egal, wie groß der Schmerz war. Das war gleichbedeutend mit Aufgeben.
Meine Mutter war den ganzen Sommer, den ganzen Herbst und den halben Winter von ihrer Krankheit zerfressen worden, aber sie hatte kein einziges Mal geklagt und war unsere Anführerin geblieben. Bis zu jenem verregneten Tag, an dem ihre Schmerzen unerträglich wurden.
Der Fremde sollte verdammt noch mal aufhören zu jaulen!
Er humpelte hilflos hin und her auf der Suche nach einer Lücke, durch die er fliehen könnte. Doch selbst wenn ihm das gelänge, käme er mit seiner verletzten Pfote nicht weit. Er musste sich endlich, endlich wehren!
Das kleine Menschenmädchen mit dem schwarzen Haarschopf hob eine Holzlatte vom Boden auf. Langsam, geradezu genüsslich, ging es auf den Hund zu, während die anderen Menschenkinder aufhörten, ihn zu quälen. Der schwarze Hund schien gar nicht zu verstehen, was gleich geschehen würde. Aber ich tat es.
Ich machte einen Satz und stand nun auf dem Hügel. Jetzt hätten die Menschenkinder mich bemerken können, wenn sie in meine Richtung geschaut hätten. Oder mich riechen müssen, wenn ihre Nasen nicht so verkümmert wären.
Ich bellte jedoch nicht, um den Fremden zu warnen, sondern zögerte wieder. Dieser Hund gehörte nicht zu meinem Rudel. Warum sollte ich ihm helfen? Für jedes meiner Geschwister hätte ich gekämpft. Selbst für Blitz. Aber für einen so verachtenswerten Schwächling?
Das Weibchen schlug mit der Holzlatte zu.
Der schwarze Hund jaulte auf, wankte, hielt sich aber auf den Beinen. Der Schmerz schien ihn überrascht zu haben. Er stank jetzt nicht mehr nur nach Angst, sondern beißend nach Panik. Das Weibchen schlug wieder auf ihn ein. Kräftiger. Diesmal gegen den Kopf. Und noch mal. Und noch mal. Bis der Fremde zusammenbrach.
Die Menschenkinder johlten vor Freude. Noch war der schwarze Hund bei Bewusstsein, aber er jaulte nicht mehr, er winselte nur noch. Das Mädchen ging triumphierend um ihn herum, in seinen Händen die blutige Latte.
An der Schläfe des Fremden klaffte eine Wunde. Gleich würde das Weibchen wieder zuschlagen, es hob die Holzlatte schon über den Kopf. Wollte es den Hund zu Tode prügeln, weil es den Menschenanführer, der den Kindern anscheinend so viel Leid zufügte, nicht bekämpfen konnte? Jubelten die anderen Kinder, weil sie jemanden für ihre Angst, ihr Leid bluten oder gar sterben sehen wollten?
Ja, der schwarze Hund war ein Schwächling. Aber ich wollte nicht zuschauen, wie Menschen einen Hund töteten. Das Mädchen holte aus, angefeuert von dem Bellen der anderen Menschenkinder. Und ich bellte auch. Lauter als sie. Tiefer. Die Kinder drehten sich überrascht zu mir um. Ich begann zu knurren und genoss die Angst in ihren Gesichtern. Mit meinem vernarbten Auge und den gefletschten Zähnen sah ich für sie gewiss furchterregend aus. Ich rannte auf das Rudel zu. Die Menschenkinder flüchteten. Aber ich wollte sie nicht davonkommen lassen. Sie durften sich nie wieder in diesen Bereich der Müllkippe wagen.
Ich lief vorbei an dem schwarzen Hund. Er lag seitlich auf dem Boden, die Beine von sich gestreckt. Das Menschenmännchen mit nacktem Oberkörper stolperte und fiel hin. Es wäre eine leichte Beute gewesen. Doch ich wollte die Schwarzhaarige mit der Latte. Und so rannte ich weiter. Das Mädchen, das nun fast die Kuppe des Müllbergs erreicht hatte, schaute über die Schulter und erkannte, dass ich es einholen würde. Es blieb abrupt stehen, drehte sich zu mir um und brüllte, die Holzlatte wild um sich schwingend. Ich musste aufpassen, dass es mich nicht erwischte, denn sonst drohte mir das gleiche Schicksal wie dem schwarzen Hund. Aber ich wollte dem Mädchen unbedingt eine Lektion erteilen. Es sollte sich hier nicht nur nie mehr blickenlassen, es sollte auch niemals wieder einen Hund prügeln! Ich war Narbe. Die Kämpferin. Ich scheute keine Gefahr. Vor dem Tod hatte ich keine Angst! Es gab sogar dunkle Nächte, in denen ich mich nach ihm sehnte.
Ich rannte auf das Menschenmädchen zu und stieß es zu Boden. Dabei fiel ihm das Holzstück aus der Hand. Ich stand nun mit allen vieren über ihm. Aus den Augen des Mädchens trat salzig riechendes Wasser. So reagieren Menschen also, wenn sie dem Tod ins Auge sehen.
Nun winselte das Mädchen, fast wie ein Hund, und hielt mir instinktiv die Kehle hin. Es wäre einfach gewesen zuzubeißen. Blitz hätte es getan. Nur so konnte ich sicher sein, dass das Menschenkind und sein Rudel nie wieder zurückkehrten. Im Grunde war es meine Pflicht zuzubeißen.
Bisher hatte ich nur Insekten getötet. Kein anderes Tier. Keine Mäuse. Keine Krähen. Auch keine Katzen, die von allen Tieren am wenigsten Respekt vor uns hatten und manchmal unser Revier durchstreiften, als wäre es ihres. Erst recht hatte ich keinen Menschen getötet.
Mein Speichel tropfte auf das Mädchen hinab. Ich knurrte es an, fletschte die Zähne, riss das Maul auf. Aber ich zögerte zuzubeißen. Ich war nicht Blitz. Ich konnte nicht so sein wie er. Wollte es auch nicht. Also ließ ich von dem Mädchen ab und wandte mich zur Seite, um ihm zu bedeuten, dass es verschwinden solle. Ich hörte, wie das Kind sich hinter mir hastig aufrappelte und über den Müllberg davonlief. Ich trottete zu dem schwarzen Hund, der inzwischen fast das Bewusstsein verloren hatte. Ich schnüffelte an seiner Wunde am Kopf. Das Blut trocknete bereits. Die Wunde konnte also nicht tief sein. Ich sah mir seine Hinterpfote genauer an. Eine kleine rostige Metallspitze hatte sich in das Fleisch gebohrt. Wenn sie dort blieb, könnte der Fremde schwer krank werden. Er hatte sich zwar bei den Menschenkindern dumm angestellt, aber sterben sollte er nicht.
Ich beugte mich mit meiner Schnauze über die Pfote, nahm die Spitze des Metalls vorsichtig zwischen meine Zähne und zog sie mit einem Ruck aus der Wunde. Der schwarze Hund jaulte auf, das Blut sprudelte aus seiner Pfote, und ich sagte: «Ruhig, ganz ruhig.»
Wider Erwarten schien ihn meine Stimme tatsächlich zu beruhigen. Ich leckte erst das Blut von seiner Pfote und rieb danach meinen Speichel in die Wunde, damit sie sich nicht entzündete. All dies ließ der schwarze Hund über sich ergehen, obwohl es gewiss schmerzhaft war.
Als ich fertig war, richtete ich mich auf. Er sah mich kurz an, dann fielen ihm die Augen wieder zu. Murmelte er etwas? War es ein Dank? Wollte er mir erklären, wer er war?
Ich legte mich dicht neben ihn, bis meine Schnauze fast sein Maul berührte. So nah war ich noch nie einem Hund gekommen, der nicht zu meinem Rudel gehörte. Als ich noch Fleck hieß, habe ich manchmal davon geträumt, mit meiner Schnauze die eines Männchens zu berühren. Seitdem ich die Narbe trug, wusste ich, dass solche Träumereien eben genau dies waren: Träumereien.
Kurz bevor das Augenlid des Fremden das letzte Mal flackerte und er das Bewusstsein verlor, konnte ich endlich verstehen, was er sagte: «Ich will nach Hause.»
2
Der schwarze Hund zuckte im Schlaf mit den Beinen und wimmerte leise vor sich hin. Vermutlich wurde er im Traum noch weiter von den Menschenkindern verfolgt. Ich stand neben ihm und beobachtete ihn, unschlüssig, was ich nun tun sollte.
Mein Magen knurrte. Konnte ich den schwarzen Hund einfach liegen lassen und zu der Dose mit den Fischresten zurückkehren? Ich zögerte, obwohl ich im Grunde wusste, dass die Gefahr für ihn zu groß war. Nicht so sehr wegen der Menschenkinder, auch wenn es nicht ausgeschlossen war, dass sie mit Verstärkung zurückkamen. Die pralle Sonne war die größte Bedrohung für ihn. Blieb er bewusstlos, würde er den restlichen Tag in der Hitze liegen. Zu viel Wärme ertragen wir Hunde nicht. Sie staut sich unter unserem Fell und führt schon nach kurzer Zeit zum Hitzschlag. Der schwarze Hund schwitzte zwar an seinen Pfoten und verschaffte sich so ein klein wenig Kühlung, da er aber bewusstlos war, konnte er nicht hecheln. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass er den heißen Tag bis zum Einbruch der Dunkelheit überstand, wäre er in der Nacht viel zu schwach, um die Ratten zu vertreiben, die dann aus ihren Löchern krochen. Die erste Ratte, vielleicht auch noch die zweite und die dritte, würde er noch wegbeißen können, doch wenn sie Beute witterten, kamen die Biester in Scharen.
Mein Magen knurrte inzwischen vernehmlich und erinnerte mich daran, endlich zu der Fischdose zurückzukehren. Aber wenn ich den Fremden hier liegen ließ, wäre mein Einsatz für ihn vergeblich gewesen. Genauso gut hätte ich das Menschenweibchen weiter auf ihn einprügeln lassen können. Also beugte ich mich zu dem schwarzen Hund herunter und sagte: «Wenn du nicht aufstehst, stirbst du hier.»
Natürlich hörte er das nicht.
Ich stupste mit meiner Schnauze gegen seine und befahl: «Steh auf.»
Er rührte sich nicht.
Ich stupste ihn noch mal, heftiger. «Steh auf!»
Er blieb weiter liegen.
Ich zwickte ihm ins Ohr.
Er zuckte nur ein wenig.
«Steh auf, sonst verreckst du!», kläffte ich und biss gleich noch mal, diesmal so stark, dass sein Ohr blutete. Der Fremde jaulte im Schlaf auf, öffnete für einen kurzen Augenblick leicht die Augen – ob er in diesem Moment überhaupt wach war, konnte ich nicht erkennen – und schloss sie sogleich wieder. Was sollte ich tun? Ihn mit dem Maul in den Schatten zu ziehen, würde ich niemals schaffen, er war ja kein Müllsack, sondern groß und schwer. Unruhig lief ich um ihn herum. Sollte ich dem Fremden nicht wenigstens ein bisschen Trost spenden, wenn ich ihm schon nicht helfen konnte? Selbst wenn er es vielleicht gar nicht wahrnahm?
Ich konnte nicht gut mit Worten umgehen. Diese Begabung hatte eher meine Schwester, die den Namen Lied trug, weil sie so schöne Geschichten sang.
Irgendetwas musste ich dem fremden Hund doch zum Trost sagen können. Oder besser noch, Worte finden, die ihm die Kraft zum Aufstehen verliehen. Ich wollte ihn nicht aufgeben.
Als ich damals im Fieberwahn und mit der eiternden Wunde dalag, hatte mich ein Gedanke am Leben gehalten. Nicht etwa die Vorstellung, mich an Blitz zu rächen. Auch nicht die Erinnerung an die Liebe meiner Mutter, die mich kein einziges Mal in meinem Versteck besuchte. Es war die Hoffnung, noch einmal ohne Fieber in den Nachthimmel sehen zu können und davon zu träumen, wie die Sterne – wie Lied es uns oft in ihren Geschichten erzählte – miteinander sprachen.
Hoffnung. Das war es. Ich musste dem Fremden Hoffnung geben! Doch wie? Ich wusste nichts von ihm. Außer dass er heimwollte. Wo war sein Zuhause? Der schwarze Hund war wohlgenährt, nicht so dünn und sehnig wie wir, die wir uns unser Essen mühsam zusammensuchen mussten. Wo immer der Fremde auch herkam, es musste dort Nahrung im Überfluss geben. Aber auch etwas Schreckliches, vor dem er hatte fliehen müssen. Sonst wäre er ja dortgeblieben und nicht zu uns auf die Müllkippe gekommen. Doch wenn sein Zuhause wirklich fürchterlich war, warum wollte er dann zurück? Das ergab alles keinen Sinn. Es hatte auch keinen Zweck, weiter darüber nachzugrübeln. Ich musste dem Fremden die Hoffnung geben, in seine Heimat zurückzukehren. Ihm sagen, dass ich ihn dorthin bringen würde.
Ich musste ihn also anlügen.
Hunde, jedenfalls die, die ich kenne, sagen nicht die Unwahrheit. Mit Taten lügen wir immer wieder. Wir knurren, um unsere Angst zu verbergen. Oder bellen, um nicht vorhandene Stärke zu zeigen. Und wenn ein Hund weder knurren noch bellen kann, gibt es für ihn noch andere Wege, die Wahrheit zu vermeiden: Einfach nichts zu sagen. So wie es meine Mama getan hatte, als sie bereits sehr krank war. Meine Schwester Lied hatte sie gefragt, ob es ihr auch wirklich gutginge, und Mama hatte sich, statt zu antworten, schweigend in eine Mulde verzogen.
Das Lügen entsprach also nicht unserer Natur. Und dennoch dachte ich darüber nach und entschied, dass eine Lüge in dieser Situation das Richtige war. So beugte ich mich zu dem fremden Hund herunter und flüsterte ihm ins Ohr: «Ich bringe dich nach Hause.»
3
Die Augen des Hundes flackerten kurz und öffneten sich mit einem Mal. Sie sahen aus wie vom Regen geschliffene schwarze Kiesel. Er blickte mich an. Hilflos. Hoffend.
«Ich bring dich nach Hause», sagte ich noch einmal, damit er nicht sogleich wieder die Lider schloss.
«Wirklich?», fragte er kaum hörbar.
«Wirklich. Aber dafür musst du aufstehen und mir folgen.» Und tatsächlich richtete sich der Fremde langsam auf. Erst rollte er sich auf den Bauch, dann stellte er die zittrigen Beine auf. Ich merkte ihm an, dass es ihn alle Kraft kostete und es ihm anfangs noch schwerfiel, auf der verletzten Pfote zu stehen.
«Kennst du denn den Weg?» Seine Stimme war nun ein wenig deutlicher. Die Hoffnung schien ihn zu stärken.
«Du kennst ihn nicht?», fragte ich erstaunt zurück.
«Nein», antwortete er traurig.
Der Fremde hatte sich ganz offensichtlich verirrt. Wenn ich ihn nicht weiter anlog, würde er wieder mutlos in sich zusammensinken. So antwortete ich: «Dafür weiß ich aber, wie du nach Hause kommst.»
«Schön», sagte er erleichtert und stand gleich ein wenig fester. Er glaubte mir. Ich musste ihn jetzt nur noch ein paar Schritte in den Schatten führen, der ihn vor der Sonne schützte. Dort konnte der Fremde genug Kraft schöpfen, um die Nacht zu überleben. Aber plötzlich kam mir ein fürchterlicher Gedanke: Wenn Blitz ihn hier entdeckte, würde er unser Revier gegen den Eindringling mit aller Macht verteidigen. Gegen meinen Bruder hätte der harmlose Fremde keine Chance. Blitz würde ihm nicht nur das Auge ausreißen, er würde ihn töten. Um Gnade für den schwarzen Hund könnte ich nicht bitten. Auf mich würde Blitz nicht hören. Das hatte er noch nie getan, und seitdem ich ihm nicht den Gefallen getan hatte zu sterben, redete Blitz nicht einmal mehr mit mir. Mein Bruder wartete, so war jedenfalls mein Gefühl, doch nur auf den geeigneten Anlass, um mich zu verjagen. Ich war immerhin die Einzige, die es gewagt hatte, seinen Führungsanspruch in Frage zu stellen. Wenn ich mich für den Fremden einsetzte, würde er mich aus dem Rudel verstoßen. Nur, wo sollte ich dann hin?
«Wir müssen dir erst einmal einen sicheren Platz für die Nacht suchen», sagte ich zu dem schwarzen Hund.
«Ich will aber nach Hause», protestierte er. Seine Stimme war überraschend tief, sogar dunkler als die von Erstgeborenem. Sie musste beeindruckend klingen, wenn der Fremde bellte.
«Du bist zu schwach für einen langen Marsch.»
Der schwarze Hund wollte schon widersprechen, aber er schien zu merken, dass ich recht hatte. Fieberhaft dachte ich nach, wo er die Nacht sicher verbringen könnte. Auf der Müllkippe gab es keinen solchen Ort. Ich musste ihn also zum Fluss bringen. Das Wasser hatte Mama uns immer verboten. Sie sagte, wenn wir hineinspringen, würden wir untergehen und keine Luft mehr bekommen. Um uns zu zeigen, dass uns das Wasser die Luft zum Atmen nahm, ließ sie uns beim nächsten Gewitter die offenen Mäuler gen Himmel halten. Wir durften die Regentropfen erst ausspucken, wenn Mama uns die Erlaubnis dazu gab. Unsere Schnauzen füllten sich, ich sah die panikgeweiteten Augen meiner Geschwister. Es war das erste Mal, dass ich ahnte, ich könnte die Mutigste von uns sein. Erst als Mama uns erlaubte, das Wasser auszuspucken, ging es uns wieder ein wenig besser. Seit diesem Tag hatten wir mehr als nur Respekt vor dem Fluss. Wir hatten Todesangst.
Ich hatte gedacht, Mama wollte mit dieser Prüfung nur sicherstellen, dass wir nicht ertranken, aber mein schmächtiger Bruder Denker, sicherlich der Klügste von uns, war anderer Meinung. Denker argwöhnte, unsere Mutter wolle verhindern, dass eines ihrer Kinder jemals in die Stadt lief, in der sie vermutlich schreckliche Dinge mit den Menschen erlebt hatte, von denen sie uns nichts erzählen mochte. Denker glaubte gar zu wissen, dass Mama uns etwas verheimlichte. Immer wieder nannte sie ihn Klein, obwohl er nicht so hieß. Und Blitz nannte sie manchmal Wolf. Aber es waren keine neuen Namen, die sie ihnen gab, sondern schlicht falsche. Mama wirkte dann immer ein wenig verwirrt. Und danach tieftraurig, als wäre ihr ganzer Körper in Schatten gehüllt.
Als sie Denker an einem Tag gleich zweimal Klein nannte, sagte er vor dem Einschlafen zu mir: «Ich schätze, sie hatte vor uns schon einmal einen Wurf Welpen. Auf der anderen Seite des Flusses. In der Stadt. Und die sind alle gestorben.» Daran musste ich fortan immer denken, wenn Mama nachts von einem Berg der Müllkippe auf die Lichter der Stadt blickte.
«Komm mit», sagte ich jetzt zu dem Fremden, ging voran und merkte erst nach ein paar Schritten, dass er mit seiner verletzten Pfote nur humpeln konnte. Ich passte mich seinem Tempo an und lief stets zwei Hundelängen voraus. Ich überlegte mir, was für ihn besser war: den direkten Weg über die Müllberge zu nehmen oder unten um sie herum zu marschieren, auch wenn dies die längere Strecke war. Kaum hatte ich das gedacht, staunte ich über mich: Warum überlegte ich überhaupt? Ich führte, er musste folgen! Ich wählte den direkten Weg, und er kam hinterher, ohne zu jammern, obwohl ihm seine Verletzung und die Hitze sicher schwer zusetzten. Auch ich hechelte, sobald wir aus dem Schatten traten und uns in der prallen Sonne die Müllberge hinaufkämpften. Der Fremde sagte die ganze Zeit kein Wort. Und auch ich schwieg. So musste ich ihn nicht weiter anlügen.
Nach drei Müllbergen blieb der schwarze Hund im Schatten stehen. Ich hätte ihn antreiben sollen, war ich doch die Anführerin, aber auch ich war froh über eine kleine Verschnaufpause.
«Ich heiße Max», sagte er unvermittelt und mit der Klarheit eines Hundes, der nur einen Namen im Leben hatte.
«Was bedeutet Max?», fragte ich, hatte ich dieses Wort doch noch nie gehört.
«Es ist einfach nur mein Name.»
«Aber er muss doch eine Bedeutung haben.»
«Es ist einfach der Name, den mir mein Frauchen gegeben hat.»
«Frauchen? Meinst du deine Mutter?», hakte ich nach und setzte mich wieder in Bewegung. Jetzt jedoch gingen wir nebeneinander.
«Meine Mutter hat mir nie einen Namen gegeben», sagte er.
«Ist sie bei der Geburt gestorben?» Mama hatte mir und meiner Schwester Lied erklärt, dass so etwas manchmal passierte. Im Gegensatz zu Lied hatte mir ihre Warnung keine Angst eingeflößt. Entstellt wie ich war, würde ich ohnehin keinen Hund finden, der mit mir Nachkommen zeugen wollte.
«Nein, meine Mama war ganz gesund», antwortete der Fremde mit dem ungewöhnlichen Namen. «Sie sagte zu uns: Ich bekomme so viele Kinder, und ich muss mich von allen trennen. Da will ich euch keine Namen geben.»
Das klang schrecklich. Und sinnlos. Das machte es noch fürchterlicher.
«Was ist mit den Welpen deiner Mutter passiert?», fragte ich.
«Mich hat sie an mein Frauchen verschenkt.»
«Du hast mir immer noch nicht gesagt, was das ist, ein Frauchen?»
«Du weißt nicht, was ein Frauchen ist?»
«Nein, verdammt noch mal!»
«Der Mensch, der für mich da ist», erklärte der Fremde, als wäre es das Natürlichste von der Welt.
Was redete er da? Eine Mutter, die ihre Kinder verschenkte? Ein Mensch, der für ihn da war? Das war doch Irrsinn! Die Sonne musste ihm mehr zugesetzt haben, als ich dachte. Ich sah in seine Augen. Sein Blick war nicht irre, sondern klar. Jedenfalls klarer als der meiner Mutter, als sie meine Geschwister mit falschen Namen ansprach oder diese in ihren letzten Nächten gar in den Nachthimmel jaulte: Klein. Wolf. Tänzerin. Glas.
Mama hatte ihrem ersten Wurf Namen gegeben. Und uns auch. Meine Mutter hatte mich geliebt. Die meiste Zeit jedenfalls. Vielleicht bis ans Ende. Falls der Schmerz, der sie zerfraß, nicht alle Liebe in ihr abgetötet hatte. Etwas, was ich selbst in meinen finstersten Stunden nie glauben wollte.
«Was ist mit deinem Auge geschehen?», fragte der Fremde.
«Das geht dich nichts an», zischte ich.
«Es muss sehr weh getan haben», sagte er sanft.
Mitgefühl. Keines meiner Geschwister hat je so etwas geäußert. Auch Erstgeborener nicht, als er mir das Wasser brachte. Er hatte nur nicht gewollt, dass ich vor Mama starb, und erzählte was von der natürlichen Abfolge des Todes, die es zu bewahren galt. Ich hätte auch kein Mitgefühl gewollt. Und das des Fremden machte mich wütend. Weil ich mich schwach fühlte. Ich war nicht schwach!
Ich lief wieder voran und schwieg, hoffte, der schwarze Hund würde meinem Beispiel folgen. Als er wieder sprach, klang es fast so, als habe er durch sein Mitgefühl selbst an Kraft gewonnen: «Wie ist das mit deinem Auge geschehen?»
«Ich hab gesagt: Das geht dich nichts an!», kläffte ich nun.
«Ich wollte dich nicht verärgern. Verzeih.»
Verzeih? Wenn man als Hund einen Fehler begeht, dann schweigt man! Um Verzeihung zu bitten war ein Zeichen von Schwäche wie das Jaulen bei Schmerz. Ich sollte diesen Weichling auf der Stelle allein lassen, sollte er doch sehen, wie er mit den Ratten klarkam. Oder mit Blitz.
«Und wie heißt du?», fragte er.
Ich schnaubte verächtlich.
«Willst du es mir nicht sagen?»
«Kannst du es nicht erraten?»
«Nein, kann ich nicht», antwortete er erstaunt.
«Narbe», zischte ich noch verächtlicher.
In seinen Augen lag nun noch mehr Mitgefühl. Damit er jetzt das Maul hielt, knurrte ich. Schweigend erklommen wir den letzten Müllberg. Man konnte das Wasser bereits riechen, da flüsterte der Fremde mit einem Mal: «Danke.»
«Danke?»
Denker war der Letzte gewesen, der mir gedankt hatte. In jener Nacht, als ihm klarwurde, dass Mama vor uns schon einmal Welpen geboren und sie verloren hatte. Obwohl es eine laue Sommernacht gewesen war, bat Denker mich, sich an mich kuscheln zu dürfen, und ich ließ ihn gewähren. Dass ich in dieser Nacht auch seine Nähe brauchte, behielt ich für mich.
«Du hast mich gerettet», fuhr der schwarze Hund fort, und seine tiefe Stimme wurde weich, was mir gefiel, auch wenn ich es eigentlich als ein weiteres Zeichen von Schwäche hätte werten müssen. Und dann sagte er traurig: «Ich habe noch nie solche Menschenkinder erlebt.»
«Ich kenne nur solche», erwiderte ich.
«Lilly ist ganz anders.»
«Lilly?» Schon wieder so ein merkwürdiger Name. Wie Max. Ich wusste immer noch nicht, was er bedeuten sollte, und er kam mir auch nicht über die Zunge.
«Das kleine Mädchen, das bei uns im Haus lebt.»
Ich konnte es kaum fassen: Der schwarze Hund wohnte in einer der Behausungen der Menschen? Die großen Kästen, die wir von den höchsten Müllbergen aus sehen konnten und die bei Nacht leuchteten, bis sie irgendwann erloschen?
«Lilly ist lieb und lässt mich immer in ihrem Bett schlafen, auch wenn Frauchen das nicht möchte.» Seine Stimme wurde nun noch weicher. «Aber eigentlich will Frauchen es doch, denn Lilly hat nachts Albträume. Aber wenn ich bei ihr schlafe, dann träumt sie nichts Böses. Wenn Frauchen mich aus Lillys Bett vertreibt, lege ich mich einfach davor. Und wenn Frauchen aus dem Zimmer geht, springe ich wieder hinein. Ich glaube, Frauchen weiß das und lässt es zu, weil sie will, dass Lilly keine Angst im Schlaf hat.»
Ich verstand kaum ein Wort. Bett war wohl so etwas wie ein Schlafplatz für Menschenkinder. Und der schwarze Hund mochte Lilly gerne. So viel war klar. Doch warum schlief der Hund nicht bei anderen Hunden, sondern bei Menschen? Roch er deswegen so süßlich? Jetzt, wo das Blut nicht mehr aus seiner Pfote floss und sein Angstschweiß langsam verflog, nahm ich Reste eines süßlichen Geruchs wahr. Ich kannte den Duft eigentlich nur von Plastikflaschen, die die Menschen auf die Müllkippe warfen. Sie enthielten Reste eines bitteren Breis, mal himmelblau, mal rosa. Hatte der Fremde so eine Flasche mit den Zähnen aufgerissen und sich darin gewälzt, oder hatten die Menschen ihn mit dem Inhalt eingerieben? Viel merkwürdiger noch: Wie konnte ein Hund mit Menschen zusammenleben und das auch schön finden?
Wir erreichten die Kuppe des Müllbergs und erblickten den Fluss, der sich unter uns erstreckte. Im Herbst und Winter rauschte er schnell dahin, jetzt lag er friedlich da. Wir Geschwister tranken nicht oft daraus. Es gab genug kleine Regentümpel zwischen den Müllbergen, und selbst wenn die in der Sommerhitze zu Pfützen schrumpften, reichte das Wasser allemal für uns. Manchmal leckten wir auch süße, klebrige Säfte aus nicht ganz geleerten Flaschen. Einige dieser Säfte waren ein Genuss, andere bereiteten uns Bauchschmerzen. Wie wir sie unterscheiden konnten, hatten wir schon als Junghunde herausgefunden.
Vor nicht allzu vielen Sommern hatte der Berg, den ich jetzt mit dem Fremden herunterlief, noch gar nicht existiert. Die Müllkippe war dem Fluss schon recht nahe gekommen. Ob sie ihn eines Tages unter sich begraben würde?
«Da unten müssen wir hin», sagte ich zu dem schwarzen Hund und rannte nun vor, um sein verwirrendes Gerede von Lilly und dem Bett und dem Frauchen nicht mehr weiter anhören zu müssen. Auf sein Humpeln musste ich keine Rücksicht mehr nehmen, hatte er doch jetzt das Ziel vor Augen.
Am Fluss angekommen, löschte ich erst einmal meinen Durst. Das Wasser war klarer als das Pfützenwasser, obwohl kleine Fliegen über dem Fluss flogen und Müll darin schwamm. Im Herbst und Winter waren es Becher und Dosen, jetzt im Sommer kleine Plastikbällchen, die nie unterzugehen schienen, ganz im Gegensatz zu dem weißen Papier und der bunten Pappe, die sich mit Wasser vollsogen und sanken. So wie wir Hunde es auch tun würden, sollten wir so verrückt sein, in den Fluss zu steigen.
Der Fremde trat zu mir und trank hastig, bis auch sein erster Durst gestillt war. Danach funkelte er mich aus tiefschwarzen Augen an und fragte: «Warum springst du nicht rein?»
«Ich soll ins Wasser springen?»
«Natürlich. Ich schwimme für mein Leben gern. Wenn meine Pfote nicht so brennen würde, wäre ich schon längst im Fluss», antwortete er und klang dabei das erste Mal ein wenig fröhlich.
Schwimmen? Der schwarze Hund musste verrückt sein!
«Leg dich da hin.» Ich deutete auf einen Busch, der nahe am Ufer stand. Auf unserer Seite des Flusses war der Strauch das einzige Grün, das aus dem staubigen Boden wuchs. Auf der anderen Seite bildeten die Büsche ein Dickicht.
Der Fremde hörte auf mich und kroch unter den Strauch, die Beine fluchtbereit ein wenig angewinkelt. Dabei fragte er: «Und morgen bringst du mich zu Lilly, nicht wahr?»
«Natürlich», log ich erneut, bevor er die Augen schloss. Ich wollte ihm noch nicht die Wahrheit sagen. Erst morgen.
4
Die Sonne versank schon über der Müllkippe, als ich gesättigt zu unserem Rudel zurückkehrte. Keines meiner Geschwister beachtete mich. Bis auf Blitz, der verächtlich schnaubte. Ihm würde es vermutlich gefallen, wenn ich unvorsichtigerweise etwas Giftiges fressen würde. Wie damals unser zweitgeborener Bruder Kratz, der von Mama so genannt wurde, weil er als Welpe beim Milchtrinken seine Krallen besonders fest in ihren Bauch schlug. Eines Tages fanden wir Kratz tot und mit blutendem Schaum vor dem Mund neben dem Rest eines Stückes Fleisch, das bitter roch. Auf der Müllhalde lagen immer wieder solche Fleischbrocken herum. Manchmal sahen wir, wie die Menschen, die den Müll abluden, die giftigen Leckerbissen auslegten. Hoffentlich war der Fremde nicht so dumm, einen davon zu fressen, wenn er aufwachte.
Meine Geschwister – Blitz, Denker, Erstgeborener, Lied – genossen die letzten Sonnenstrahlen auf einem Haufen prall gefüllter Müllsäcke. Ich blieb in einigem Abstand stehen. Nur an sehr kalten Tagen legte ich mich zu ihnen, wenn ich ihre Wärme dringend benötigte. Heute stieß mich wie so oft der scharfe Geruch ihrer Verachtung ab. Blitz hatte ihn schon immer stark verströmt. Bei den anderen wurde der Gestank von Tag zu Tag intensiver. Meine Narbe erinnerte meine Geschwister daran, dass ihr eigenes Fleisch verletzlich war, das Leben gar endlich, und das konnten sie nicht ertragen.
Denker hatte mich bereits im Frühling gefragt, warum ich mich nicht einem anderen Rudel anschließe. Er meinte es nicht böse, es schien ihm einfach vernünftig zu sein. Obwohl Denker der Klügste von uns war, hatte er bei seiner Frage eines nicht bedacht: Kein anderes Rudel hätte einen Krüppel wie mich aufgenommen.
Lied machte sich wie jeden Abend daran, eine Geschichte zu singen. Oft sang sie von den längst vergangenen Zeiten, in denen die ersten Hunde gegen die ersten Wölfe kämpfen. In einer schier endlos währenden Schlacht litten beide Rudel unter vielen Toten, und vermutlich hätte keines von ihnen überlebt, wenn Wolfsvater und Hundsmutter nicht bei einem heimlichen Treffen einen Pakt geschlossen hätten. Im Mondlicht, begleitet nur von den engsten Vertrauten, tauschten sie ihre Erstgeborenen aus. Hundsmutter nahm Wolfssohn in ihre Familie auf, Wolfsvater Hundstochter in die seine. So wurde der Friede sichergestellt, denn hätte ein Rudel das andere angegriffen, wären die Erstgeborenen getötet worden. So aber wuchsen Hundstochter und Wolfssohn in der jeweils fremden Familie auf und lernten sie zu lieben. Als sie groß genug waren, wurden sie zu den Anführern ihrer neuen Gefährten und schlossen auf ewig Frieden, in dem sie zusammen Welpen zeugten. Lied sang die alten Geschichten mit tiefer Inbrunst. Manchmal sang sie auch von Mamas Anfängen auf der Müllkippe. Wie sie sich geweigert hatte, sich anderen Rudeln anzuschließen, und dem Werben der Männchen widerstand.
Blitz mochte die Geschichten von Mama nicht. Es hätte ihm besser gefallen, wenn Lied Heldenlegenden, die ihn preisten, dargeboten hätte. Aber sein Leben war bisher nicht so reich an tapferern Taten gewesen wie Mamas. Blitz hatte nicht wie sie ein neues Zuhause für uns gefunden und auch nicht unser Revier gegen andere Rudelführer verteidigen müssen. Sein größter Kampf war der gegen seine eigene Schwester gewesen. Nachts, wenn ich abseits von den anderen lag, hörte ich manchmal, wie Lied ihm zuliebe auch von dieser Tat sang. Hob sie dazu an, schlich ich mich noch weiter weg, auf einen anderen Müllberg, zu dem der Wind ihre Melodien nicht mehr trug.
«Was soll ich euch heute singen?», fragte Lied.
Erstgeborener antwortete zuerst: «Sing von den Sternen.»
Die Sterne. Ich liebte es, wenn Lied von ihnen sang. Wenn ein Hund starb, flog sein Herz in den Himmel und wurde zu einem Stern. Lied heulte in dem traurigen Stakkato der Hunde die Geschichte von dem Stern, der seine Liebe suchte:
Pfote liebte Schwarzohr,
Schwarzohr liebte Pfote.
Pfote starb,
Schwarzohr jaulte.
Jede Nacht blickte sie zu den Sternen,
wollte zu ihrer Liebe.
Doch Schwarzohr wurde alt,
ohne Pfote.
Als Schwarzohr endlich starb,
prangte am Himmel ein neuer Stern.
Doch keiner um sie herum war Pfote.
Sie fragte den Stern neben sich:
Kennst du Pfote?
Der Stern antwortete:
Such den Stern, der für dich am hellsten strahlt!
Schwarzohr sah sich um,
suchte den ganzen Himmel ab.
Unter all den Sternen funkelte einer am hellsten.
Es war Pfote.
Und jetzt war sie es, die am hellsten strahlte.
Sie wollte zu ihm.
Doch Schwarzohr war ein Stern,
und konnte sich nicht bewegen.
Sie konnte nur für ihre Liebe leuchten.
Lieds Jaulen verhallte in der Dämmerung. Ohne mich von meinen Geschwistern zu verabschieden, schlich ich mich davon. Auch sie wünschten mir keine gute Nacht. Das taten sie nie.
Ich legte mich auf der andere Seite des Bergs zwischen zwei Müllsäcke und betrachtete den Stern, der am hellsten strahlte. Für den anderen Stern, den er so liebte. Er war einsam, gewiss. Dennoch war ich neidisch. So eine Liebe würde ich niemals empfinden dürfen. Weder als Hund noch als Stern.
Ich wandte den Blick zur Stadt. Die Lichter der Behausungen funkelten nicht wie die Sterne, dafür erstrahlten sie in den verschiedensten Farben. Von irgendwoher dort draußen musste der Fremde gekommen sein. Da lebte er mit diesem Menschenkind Lilly, das ihm so viel bedeutete. Ich fragte mich, hinter welchem Licht sich sein Heim verbarg. So wie ich mich sonst nur fragte, welcher Stern wohl Mama war.
5
Obwohl die Sonne noch nicht lange am Himmel stand, wurde es bereits heiß. Während ich den letzten Müllhügel auf dem Weg zum Fluss hinaufhechelte, ging kein Wind. Nicht mal ein laues Lüftchen wehte Gerüche von dem Fremden zu mir herüber. Aufgeregt – viel mehr, als ich es hätte sein sollen – überlegte ich, wie es ihm wohl in der Nacht ergangen war. Hatte er Ratten abwehren müssen, oder war er am Ende doch an seiner Entzündung gestorben?
Als ich die Spitze des Hügels erklomm, konnte ich den schwarzen Hund endlich wittern. Er roch nicht mehr nach Angst, auch nicht nach frischem Blut. Seine Wunden verheilten gut. Dann konnte ich ihn auch hören. Er schlabberte Wasser aus dem Fluss. Und schließlich, als ich schon fast am Fuß des Berges angekommen war, setzte auch mein schwächster Sinn ein, und ich sah, wie der Fremde sich in meine Richtung drehte. Anscheinend hatte auch er mich wahrgenommen. Er kam mir ein paar Schritte entgegen. Er humpelte nicht mehr. Kaum hatte er mich erreicht, schnüffelte er an mir. Gestern war er dafür zu geschwächt gewesen. Jetzt aber wirkte er munter und kräftig, und er wollte wissen, mit wem er es zu tun hatte. Als er von mir abließ, legte er den Kopf leicht zur Seite, als wäre er unsicher, was er von mir halten sollte. Ich wartete darauf, dass er etwas sagte, doch er blieb still.
«Wie war deine Nacht?», fragte ich ihn. Ich erwartete, dass er mir vielleicht von den Ratten erzählen würde oder von Schmerzen. Stattdessen sagte er: «Ich habe von dir geträumt.»
«Von mir?»
«Von uns.»
Der Hund schien davon genauso erstaunt zu sein wie ich. Mehr noch, er wirkte durcheinander. Geradezu aufgewühlt.
«Davon, wie ich dich vor den Menschenkindern gerettet habe?», fragte ich. «Oder wie ich dich hierhergeführt habe?»
Wenn ich träumte, dann meist von den Ereignissen des Tages. Ganz selten kehrte ich im Schlaf zu Dingen zurück, die schon länger vergangen waren. So wie dieser eine Tag, als ich noch eine kleine Hündin war. Eine graue Krähe hatte mir ein schimmeliges Stück Brot streitig machen wollen. Ich erwischte sie mit der Pfote so schwer am Flügel, dass sie nicht mehr wegfliegen konnte. Ihr Gekreische verfolgte mich noch in mancher Nacht.
«Ich habe von etwas anderem geträumt.»
Was anderem? Wir hatten doch sonst nichts gemeinsam erlebt.
«Überall um uns herum lag hoch Schnee.»
«Schnee? Wie kann der liegen?», wunderte ich mich. Auf der Müllkippe verwandelten sich die Flocken, wenn sie im Winter überhaupt mal fielen, sofort in Wasser.
«In meinem Traum schneite es schon seit Tagen. Unser Fell war ganz weiß. Der Schnee auf dem Boden reichte mir bis zu den Knien und dir fast bis zum Bauch. Die Äste der Bäume bogen sich unter seiner Last. Und diese Bäume waren die größten, die ich je gesehen hatte. Hundert Hunde hoch.»
Bäume kannte ich nur aus der Ferne. Von besonders hohen Müllbergen aus konnte ich sie schemenhaft erkennen. Aber keiner von ihnen schien auch nur annähernd hundert Hunde hoch zu sein.
«Wir rannten durch den Schnee.»
«Jagten wir etwas?»
«Wir wurden gejagt.»
«Von wem?», wollte ich wissen.
«Von einem Menschen.»
Der schwarze Hund strahlte plötzlich wieder Angst aus.
«Was für ein Mensch?»
«Er hatte den Kopf eines Raben.»
«Er war ein Rabe?»
«Er hatte den Kopf eines Raben. Es war kein echter Kopf. Der Mensch trug eine Maske aus Metall. Und in ihrem langen Schnabel waren duftende Blütenblätter. Rose. Erdbeere. Flieder.»
Allesamt Gerüche, die ich nicht kannte.
«Er atmete sie ein, um nicht den Gestank der Toten ertragen zu müssen. Und er roch nach Hass.»
«Ich habe noch nie in einem Traum etwas gerochen.»
«Ich auch nicht», antwortete der schwarze Hund leise. «Und du … du hattest …»
«Ich hatte was?»
«Du hattest unsere Welpen im Bauch.»
Seine Worte trafen mich wie ein Schlag. Welpen. Ich habe nie geglaubt, irgendwann Kinder zu haben. Ich war Narbe. Und jetzt träumte dieser Hund, dass ich Welpen bekam. Von ihm.
«Das erste Mal witterten wir den Menschen mit der Rabenmaske in einer schmalen Gasse der Stadt, in der wir lebten. Er war der einzige Mensch, der ohne Furcht zu sein schien, obwohl die Pest wütete. Als ob sie ihm nichts anhaben konnte.»
Ich mutmaßte, dass Pest eine Krankheit war, ähnlich der, die Mama dahingerafft hatte.
«Er hielt mit seinem Gaul vor uns. Seine Stimme rasselte, wegen der Maske.»
«Was hat er gesagt?»
«Ich werde euch erst die Kinder nehmen. Dann euer Leben.»
Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass etwas in mir gegen die Innenwand meines Bauches trat.
«Der Mensch zückte ein langes, scharfes Messer. Ich stellte mich vor dich. Wollte dich und unsere ungeborenen Welpen schützen. Der Mensch lachte scheppernd und sagte: ‹Rennt!›
Und wir rannten. Um unser Leben. Um das unserer ungeborenen Kinder. Wir eilten durch Gassen, vorbei an Leichen, die voller schwarzer Beulen waren, aus denen Eiter quoll, und erreichten die Stadtmauer. Das Tor stand weit offen. Die Wachen hatten längst aufgegeben. Im Gegensatz zu uns Hunden ahnten sie noch nicht einmal, dass es die Ratten waren, die ihnen die Krankheit gebracht hatten. Kaum hatten wir das Tor hinter uns gelassen, liefen wir in den Wald. Dort war der Schnee besonders tief. Die Flocken fielen immer dichter, aus der Ferne hörten wir das Getrappel der Pferdehufe. Ich sagte zu dir: ‹Hab keine Angst, Freya.›»
«Freya?», fragte ich.
«Wir hatten andere Namen. Mein Name war Balder. Der Töpfer, bei dem wir bis zu dessen Pesttod lebten, hatte uns nach Göttern aus längst vergangenen Zeiten benannt.»
Ich wusste nicht, was Götter waren, und konnte mir, im Gegensatz zu allen anderen Worten, die der schwarze Hund benutzte, auch keinen Reim darauf machen.
«Wir sahen auch anders aus», erzählte der schwarze Hund weiter. «Du hattest langes dunkelbraunes Fell und beide Augen.»
Ich spürte die Leere in meiner Augenhöhle so intensiv wie lange nicht mehr.
«Und ich war ein Schäferhund.»
So wie der schwarze Hund das Wort aussprach, konnte ich mir fast vorstellen, wie ein Schäferhund aussah.
«Es waren nicht wir … und doch waren es wir!»
«Ich verstehe das alles nicht.»
«Glaubst du etwa, ich verstehe das?», kläffte er. «Das war kein normaler Traum! Solche Dinge habe ich noch nie geträumt!»
Er ging ein paar Schritte weg von mir und schüttelte sich, als wollte er die Erinnerung an den Traum vertreiben.
«Du hattest solche Angst, Freya …»
Er sprach mich mit dem Namen aus dem Traum an.
«… und ich fürchtete mich viel mehr als gestern vor den Menschenkindern. Viel mehr. So eine Furcht hatte ich noch nie empfunden.»