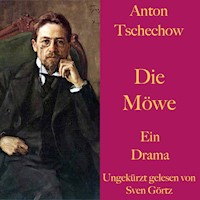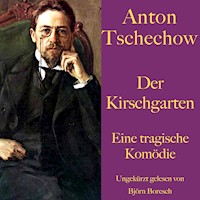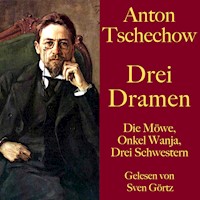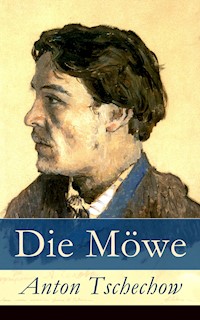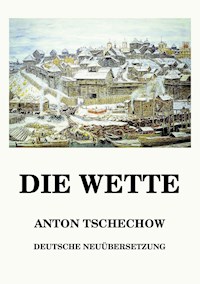Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Anthologie 'Die bekanntesten Geschichten von Anton Tschechow' präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl der eindrucksvollsten Kurzgeschichten Tschechows, ergänzt durch die einfühlsame Übersetzung und Kommentare von Wladimir Czumikow. Diese Sammlung offenbart die Vielschichtigkeit von Tschechows Erzählkunst, die das menschliche Dasein in seiner brüchigen Komplexität einfängt. Die Geschichten variieren zwischen bittersüßer Komik und tiefgründiger Tragik, was Tschechows Meisterschaft im Erfassen der Nuancen russischer Gesellschaft und seiner zeitlosen psychologischen Einsichten unterstreicht. Die Kombination von Tschechows tiefgreifenden Geschichten und Czumikows kenntnisreicher Bearbeitung bietet einen einzigartigen Blick in die russische Seele und Kultur des späten 19. Jahrhunderts. Czumikow, ein renommierter Übersetzer und Slawist, bringt seine eigene literarische Sensibilität ein, um die Nuancen und sprachlichen Feinheiten Tschechows für ein modernes Publikum zugänglich zu machen. Diese Zusammenarbeit gewährleistet eine authentische und zeitgemäße Lesart, die sowohl die historischen Kontexte berücksichtigt als auch die universellen Themen von Menschlichkeit und moralischer Ambiguität hervorhebt. Diese Sammlung ist ein unverzichtbares Werk für alle, die die Tiefe der menschlichen Natur und die Feinheiten der russischen Literatur verstehen möchten. 'Die bekanntesten Geschichten von Anton Tschechow', herausgegeben von Wladimir Czumikow, lädt seine Leser ein, sich auf eine literarische Reise zu begeben, die vertieft, bereichert und den kulturellen sowie menschlichen Horizont erweitert. Ein Band, der in keiner literarischen Sammlung fehlen sollte und der zum Dialog zwischen den Werken und den Lesenden anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 986
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die bekanntesten Geschichten von Anton Tschechow
Books
Inhaltsverzeichnis
Geschichten in Grau
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Der Taugenichts
Inhaltsverzeichnis
Übersetzt von Alexander Eliasberg
I
Inhaltsverzeichnis
Mein Chef sagte mir: »Ich behalte Sie nur mit Rücksicht auf Ihren ehrenwerten Herrn Vater, sonst wären Sie schon längst hinausgeflogen.« Ich antwortete: »Exzellenz tun mir zu viel Ehre an, wenn Sie annehmen, daß ich fliegen kann.« Und dann hörte ich ihn noch sagen: »Schaffen Sie diesen Herrn fort, er geht mir auf die Nerven.«
Nach zwei Tagen war ich entlassen. So habe ich, seitdem ich sozusagen erwachsen bin, zum großen Kummer meines Vaters, des Stadtarchitekten, bereits neun Stellungen gewechselt. Ich war in allen möglichen Ressorts angestellt gewesen, aber alle neun Stellungen glichen sich wie die Wassertropfen: überall mußte ich sitzen, schreiben, dumme oder rohe Bemerkungen anhören und warten, daß man mich entläßt.
Mein Vater saß, als ich zu ihm kam, tief in seinem Sessel und hielt die Augen geschlossen. Sein mageres, trockenes Gesicht mit einem bläulichen Schimmer auf den rasierten Stellen – (er hatte einige Ähnlichkeit mit einem katholischen Organisten) drückte Demut und Ergebenheit aus. Ohne meinen Gruß zu erwidern und ohne die Augen zu öffnen, sagte er zu mir:
»Wenn meine teure Frau, deine Mutter, noch lebte, so wäre dein Leben für sie eine Quelle unaufhörlicher Schmerzen. In ihrem frühen Tode erblicke ich Gottes Vorsehung. Ich bitte dich, du Elender,« fuhr er fort, die Augen öffnend, »sag' einmal selbst, was soll ich mit dir machen?«
In früheren Jahren, als ich noch jünger war, wußten alle meine Verwandten und Bekannten sehr gut, was mit mir zu machen wäre: die einen rieten zum Einjährigendienst, andere zu einer Stellung in einer Apotheke, und die dritten zu einer am Telegraph. Jetzt, wo ich fünfundzwanzig Jahre alt bin und die ersten grauen Haare an den Schläfen habe, wo ich bereits Einjähriger, Apothekerlehrling und Telegraphist gewesen bin, scheint alles Irdische für mich erschöpft, und man rät mir nichts mehr, sondern seufzt nur oder schüttelt den Kopf.
»Was denkst du dir eigentlich?« fuhr mein Vater fort. »Andere junge Leute haben in deinem Alter schon eine sichere soziale Position; aber was bist du? Ein Proletarier, ein Bettler, der seinem Vater zur Last fällt!«
Und er begann, seiner Gewohnheit gemäß, davon zu sprechen, daß die Jugend von heute an Unglauben, Materialismus und übermäßiger Einbildung zugrunde gehe und daß man die Liebhaberaufführungen verbieten müsse, weil sie die jungen Leute von der Religion und von ihren Pflichten ablenkten.
»Morgen gehen wir zusammen hin, du wirst deinen Chef um Entschuldigung bitten und ihm versprechen, deine Pflicht gewissenhaft zu tun,« so schloß er seine Rede. »Keinen einzigen Tag darfst du ohne eine soziale Position bleiben.«
»Ich bitte Sie, hören Sie mich an, sagte ich mürrisch. Ich erwartete nichts Gutes von diesem Gespräch. »Das, was Sie eine gesellschaftliche Position nennen, ist ein Privileg des Kapitals und der Bildung. Aber die Besitzlosen und die Ungebildeten verdienen sich ihr Stück Brot durch körperliche Arbeit, und ich sehe gar nicht ein, warum ich eine Ausnahme bilden soll.«
»Wenn du von körperlicher Arbeit zu sprechen anfängst, so sind deine Worte immer dumm und abgeschmackt!« sagte mein Vater gereizt. »Begreif es doch, du stumpfsinniger Mensch, begreife es doch, du Schafskopf, daß du außer der rohen körperlichen Kraft auch noch einen Geist Gottes, ein heiliges Feuer in dir hast, das dich im höchsten Maße vom Esel oder vom Reptil unterscheidet und der Gottheit nahebringt! Dieses Feuer ist im Laufe von Jahrtausenden von den besten unter den Menschen gewonnen worden. Dein Urgroßvater, der General Polosnjew hat bei Borodino gekämpft, dein Großvater war Dichter, Redner und Adelsmarschall, dein Onkel – Schulmann, und endlich ich, dein Vater, bin Architekt. Alle Polosnjews haben das heilige Feuer gehütet, nur damit du es auslöschst!«
»Man muß gerecht sein,« sagte ich. »Der körperlichen Arbeit unterziehen sich Millionen von Menschen.«
»Sollen sie sich ihr nur unterzieben! Sie können eben nichts anderes. Körperliche Arbeit kann jeder leisten, selbst der größte Dummkopf und Verbrecher, sie charakterisiert den Sklaven und den Barbaren, während das heilige Feuer nur wenigen gegeben ist!«
Dieses Gespräch fortzusetzen, hatte gar keinen Zweck. Mein Vater vergötterte sich, und für ihn war nur das überzeugend, was er selbst sagte. Außerdem wußte ich sehr gut, daß der Hochmut, mit dem er über die körperliche Arbeit sprach, weniger auf den Erwägungen bezüglich des heiligen Feuers beruhte, als auf der Angst, daß ich wirklich Arbeiter und der ganzen Stadt zum Spott werden könnte; vor allen Dinge aber hatten schon alle meine Altersgenossen die Universität absolviert und waren auf dem besten Wege, Karriere zu machen; der Sohn des Reichsbankdirektors z. B. besaß schon den Rang eines Kollegienassessors, ich aber, sein einziger Sohn, war noch nichts! Dieses Gespräch fortzusetzen, war zwecklos und unangenehm, aber ich saß noch immer da und machte schwächliche Einwendungen in der Hoffnung, daß er mich vielleicht am Ende doch verstehen würde. Für mich war ja die ganze Frage ganz einfach und sonnenklar: es handelte sich nur noch darum, auf welche Weise ich mein Stück Brot verdienen könnte. Aber mein Vater wollte das Einfache nicht einsehen, sondern sprach in gedrechselten, süßlichen Sätzen von Borodino, vom heiligen Feuer, von meinem Onkel, dem vergessenen Dichter, der einst schlechte, verlogene Gedichte geschrieben, und nannte mich in seiner rohen Art einen Schafskopf und einen stumpfsinnigen Menschen. Und ich sehnte mich so sehr danach, verstanden zu werden! Trotz alledem liebe ich aber meinen Vater und meine Schwester, und die kindliche Gewohnheit, sie in allen Dingen um Erlaubnis zu fragen, ist in mir so tief eingewurzelt, daß ich mich von ihr wohl kaum jemals freimache; ganz gleich, ob ich im Recht oder Unrecht bin, ich fürchte immer, ihnen Kummer zu bereiten, fürchte, daß mein Vater einen roten Hals bekommt oder daß ihn gar der Schlag trifft.
»In einem dumpfen Zimmer zu sitzen,« sagte ich, »Papiere abzuschreiben und mit einer Schreibmaschine zu konkurrieren, ist für einen Menschen in meinem Alter beschämend und beleidigend. Wie kann da überhaupt von einem heiligen Feuer die Rede sein!«
»Es ist immerhin geistige Arbeit,« entgegnete mein Vater. »Aber genug, brechen wir dieses Gespräch ab. Doch für jeden Fall muß ich dich warnen: wenn du deinen Dienst nicht wieder antrittst und deinen verächtlichen Neigungen folgst, so entziehen wir dir, ich und meine Tochter, unsere Liebe. Ich werde dich enterben, das schwöre ich dir bei Gott!«
Ich sagte darauf ganz aufrichtig, nur um die Reinheit der Motive, von denen ich mich mein Leben lang leiten lassen wollte, zu zeigen:
»Diese Frage erscheint mir nicht so wichtig. Ich verzichte auf die Erbschaft schon von vornherein.«
Diese Worte verletzten meinen Vater ganz wider Erwarten äußerst schwer. Er wurde über und über rot.
»Untersteh dich nicht, mit mir so zu sprechen, Dummkopf!« schrie er mit einer dünnen, kreischenden Stimme. »Du Taugenichts!« Und er versetzte mir mit einer geschickten, gewohnten Bewegung schnell hintereinander zwei Ohrfeigen. »Du vergißt dich letztens gar zu oft!«
In meiner Kindheit mußte ich, wenn mich mein Vater schlug, stramm, die Hände an der Hosennaht, stehen und ihm gerade ins Gesicht sehen. Und wie er mich jetzt schlug, fiel ich gleichsam in meine Kinderjahre zurück, und stand stramm und sah ihm in die Augen. Mein Vater war alt und sehr mager, seine Muskeln waren aber wohl dünn und zäh wie Riemen, denn seine Schlägt taten sehr weh.
Ich zog mich ins Vorzimmer zurück, aber hier ergriff er seinen Regenschirm und schlug mich damit einigemal auf Kopf und Schultern; in diesem Augenblick öffnete meine Schwester die Wohnzimmertüre, um zu sehen, woher der Lärm komme; als sie die Szene sah, wandte sie sich sofort mit einem Ausdruck von Mitleid und Schreck wieder fort, ohne auch nur ein Wort für mich einzulegen.
Mein Entschluß, in die Kanzlei nicht zurückzukehren, sondern ein neues Arbeitsleben zu beginnen, stand unwankbar fest. Es blieb mir nur noch übrig, die Art der Arbeit zu wählen, und das erschien mir nicht sonderlich schwer, da ich mich für außerordentlich stark, ausdauernd und jeder Arbeit gewachsen hielt. Mir stand ein eintöniges Arbeitsleben mit Hunger, Armeleutegeruch, Roheit und der ständigen Sorge um das tägliche Brot bevor, Und – wer weiß? – vielleicht werde ich, wenn ich durch die Große Adelsstraße von der Arbeit heimgehe, mehr als einmal den Ingenieur Dolschikow beneiden, der von geistiger Arbeit lebt; aber jetzt freute es mich nur, an alle meine zukünftigen Schwierigkeiten zu denken. Einst hatte ich von einer geistigen Tätigkeit geträumt und mich schon als Lehrer, Arzt oder Dichter gesehen, aber die Träume blieben eben Träume. Der Hunger nach geistigen Genüssen – z. B. nach Theater und Büchern, war in mir bis zur Leidenschaft entwickelt, ob ich aber auch die Fähigkeit besaß, mich auf diesen Gebieten selbst zu betätigen, das weiß ich nicht. Auf dem Gymnasium hatte ich eine unüberwindliche Abneigung gegen Griechisch, so daß ich aus der vierten Klasse austreten mußte. Lange Zeit nahm ich Privatunterricht und bereitete mich für die fünfte Klasse vor; dann diente ich in den verschiedenen Ressorts, wobei ich den größten Teil des Tages nichts zu tun hatte, aber das nannte man geistige Arbeit! Das Studium und der Staatsdienst erforderten weder Geistesanspannung, noch Talente, weder persönliche Fähigkeiten, noch schöpferischen Aufschwung: sie waren rein mechanisch. Solche geistige Arbeit schätze ich aber viel niedriger als die körperliche ein, ich verachte sie und glaube nicht, daß sie ein müßiges, sorgloses Leben auch nur einen Augenblick lang zu rechtfertigen vermag, da sie doch selbst nur Betrug und eine Form von Müßiggang ist. Die wahre geistige Arbeit habe ich wahrscheinlich nie gekannt. Der Abend brach an. Wir wohnten in der Großen Adelsstraße, der Hauptstraße unserer Stadt, auf der in den Abendstunden in Ermangelung eines ordentlichen Stadtgartens unsere vornehme Welt zu promenieren pflegte. Diese schöne Straße ersetzte zum Teil einen Garten, da sie zu beiden Seiten von Pappeln eingefaßt war, die, besonders nach einem Regen, herrlich dufteten, und aus den Gartenzäunen Akazien, Fliederbüsche, Faul- und Apfelbäume hervorlugten. Die Maiendämmerung, das zarte, junge Grün voller Schatten, der Fliederduft, das Summen der Käfer, die Stille, die Wärme – wie neu und ungewöhnlich war das alles, obwohl es sich jedes Jahr wiederholte! Ich stand vor der Gartenpforte, und sah mir die Spaziergänger an. Mit den meisten von ihnen war ich aufgewachsen und hatte als Kind gespielt; jetzt wäre ihnen aber meine Bekanntschaft peinlich gewesen, denn ich war ärmlich und nicht nach der Mode gekleidet, und meine engen Hosen und plumpen Stiefel waren allen zum Spott. Zudem stand ich überhaupt in schlechtem Ruf, da ich keine gesellschaftliche Position besaß und oft in billigen Gasthäusern Billard spiele; außerdem vielleicht auch aus dem Grunde, weil man mich zweimal ohne den geringsten Anlaß meinerseits auf die Gendarmerie vorgeladen hatte.
Im großen Hause gegenüber, beim Ingenieur Dolschikow, spielte man Klavier. Es dunkelte, und am Himmel leuchteten die Sterne auf. Da kommt langsam, in seinem altmodischen Zylinder mit breiter, nach oben gebogener Krempe, nach allen Seiten grüßend, Arm in Arm mit meiner Schwester mein Vater gegangen.
»Sieh einmal!« sagt er zu meiner Schwester und zeigt mit demselben Regenschirm, mit dem er mich vorhin geprügelt, nach oben: »Sieh den Himmel! Die Sterne, selbst die winzigsten unter ihnen sind ganze Welten! Wie nichtig ist doch der Mensch im Vergleich zum Weltall!«
Und das sagte er in einem Ton, als ob es ihm schmeichelhaft und angenehm wäre, so nichtig zu sein. Was war er doch für ein talentloser, unbedeutender Mensch! Leider war er unser einziger Architekt, und aus diesem Grunde ist bei uns in den letzten fünfzehn – zwanzig Jahren kein einziges anständiges Haus erstanden. Wenn man bei ihm einen Plan bestellte, so zeichnete er immer zuerst einen Saal und ein Wohnzimmer; ebenso wie die Institutschülerinnen der guten alten Zeit nur von einer bestimmten Stelle des Zimmers, nämlich vom Ofen zu tanzen verstanden, so vermochte sich die künstlerische Phantasie meines Vaters nur vom Saal und Wohnzimer aus zu entfalten. Daran zeichnete er ein Eßzimmer, ein Kinderzimmer und ein Kabinett und verband alle diese Räume durch Türen, so daß jedes Zimmer zu einem Durchgangszimmer wurde und je zwei oder auch drei Türen zuviel hatte. Seine Phantasie war augenscheinlich verworren und dürftig; als fühlte er, daß irgend etwas fehlte, griff er jedesmal zu allerlei Anbauten, die er einfach aneinanderreihte. Ich sehe auch heute noch die engen Vorzimmer und Korridore, die krummen Treppchen zum Zwischenstock, wo man nur gebückt stehen konnte und wo drei Riesenstufen in der Größe von Pritschen den Fußboden ersetzten. Die Küche befand sich aber unbedingt im Kellergeschoß und hatte eine gewölbte Decke und einen Ziegelfußboden. Die Fassade blickte eigensinnig und langweilig drein und hatte trockene, nichtssagende Linien; das Dach war niedrig und flach, und auf den dicken, gleichsam geschwollenen Schornsteinen saßen unbedingt Drahtkappen mit schwarzen quietschenden Wetterfahnen. Alle diese von meinem Vater erbauten Häuser ähnelten sich und erinnerten mich aus irgendeinem Grunde an seinen Zylinderhut und seinen trockenen und eigensinnigen Nacken. Im Laufe der Zeit gewöhnte man sich in der Stadt an die Geschmacklosigkeit meines Vaters, sie faßte Wurzeln und wurde zu unserm Stil.
Nach dem gleichen Stil gestaltete er auch das Leben meiner Schwester. Es begann damit, daß er sie Kleopatra taufte (mich hatte er aber Missail genannt). Als sie noch ein Kind war, machte er ihr mit seinen Reden über die Sterne, über die alten Weisen und über unsere Ahnen Angst, erklärte ihr lang und breit, was das Leben und was die Pflicht sei; und auch jetzt, da sie bereits sechsundzwanzig Jahre alt war, betrieb er ihre Erziehung auf die gleiche Weise und erlaubte ihr, nur mit ihm allein Arm in Arm zu gehen. Aus irgendeinem Grunde bildete er sich ein, es müsse früher oder später ein anständiger junger Mann kommen, der sie aus Achtung vor den Tugenden ihres Vaters heiraten würde. Sie aber betete den Vater an und glaubte an seinen ungewöhnlichen Geist.
Es war ganz dunkel geworden, und die Straße leerte sich allmählich. Im Hause war das Klavierspiel verstummt. Das Tor wurde weit geöffnet, und über unsere Straße rollte mit gedämpftem Schellengeläute eine Troika. Der Ingenieur fuhr mit seiner Tochter spazieren. Es war Zeit zum Schlafen.
Ich hatte zwar im Hause mein eigenes Zimmer, wohnte aber auf dem Hofe in einer Hütte, die an einen Stall angebaut war. Die Hütte hatte einst zum Aufbewahren von Pferdegeschirr gedient, und in den Wänden steckten große Haken. Jetzt stand sie leer, und mein Vater benutzte sie als Ablage für seine Zeitungen, die er halbjährlich binden ließ und die niemand anrühren durfte. Wenn ich hier wohnte, kam ich meinem Vater und seinen Gästen weniger unter die Augen, und es schien mir, daß, wenn ich nicht in einem richtigen Zimmer wohnte und nicht jeden Tag zu Hause zu Mittag aß, die Worte meines Vaters, daß ich ihm zur Last falle, weniger verletzend seien.
Meine Schwester erwartete mich schon. Sie brachte mir heimlich mein Abendessen: ein kleines Stück kaltes Kalbfleisch und eine Scheibe Brot. Bei uns zu Hause hieß es immer: »Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.« Meine Schwester stand unter dem Drucke solcher Redensarten und dachte nur noch daran, wie sie die Ausgaben vermindern könnte; deshalb aß man bei uns im allgemeinen schlecht. Sie stellte den Teller auf den Tisch, setzte sich auf mein Bett und fing zu weinen an.
»Missail,« sagte sie, »was tust du uns an?«
Sie bedeckte ihr Gesicht nicht, die Tränen fielen ihr auf Brust und Hände, und ihre Züge drückten tiefe Trauer aus. Sie sank auf das Kissen, ließ den Tränen freien Lauf, zitterte am ganzen Leibe und schluchzte.
»Du hast schon wieder deine Stellung verloren,« sagte sie. »Wie schrecklich ist das!«
»Aber so höre doch, Schwester, begreife mich ...« fing ich an. Ihre Tränen brachten mich zur Verzweiflung.
Wie zum Trotz war das Petroleum in meinem Lämpchen ausgebrannt; es qualmte und wollte verlöschen. Die alten Haken an den Wänden blickten streng drein, und ihre Schatten bewegten sich.
»Erbarme dich unser!« sagte meine Schwester, sich vom Bette erhebend. »Unser Vater ist tief unglücklich, und ich bin krank und fürchte den Verstand zu verlieren. Was wird aus dir?« fragte sie schluchzend, die Hände nach mir ausstreckend. »Ich bitte dich, ich flehe dich im Namen unserer verstorbenen Mutter an: geh wieder in Stellung!«
»Ich kann nicht, Kleopatra!« sagte ich, obwohl ich fühlte, daß nicht mehr viel fehlte, daß ich mich ergebe. »Ich kann nicht!«
»Warum dene nicht?« fuhr meine Schwester fort. »Warum? Nun, wenn du dich mit deinem Chef nicht vertragen kannst, so suche dir eine andere Stellung. Warum sollst du zum Beispiel nicht zur Eisenbahn gehen? Ich habe eben mit Anjuta Blagowo gesprochen; sie behauptet, daß man dich bei der Eisenbahn ganz bestimmt nehmen wird, und verspricht sogar, sich für dich zu verwenden. Um Gottes willen, Missail, überlege es dir! Ich flehe dich an!«
Wir sprachen noch ein Weilchen, und ich gab schließlich nach. Ich sagte ihr, daß der Gedanke an eine Stellung beim Eisenbahnbau mir noch gar nicht gekommen und daß ich nicht abgeneigt sei, die Sache zu probieren.
Sie lächelte freudig unter Tränen und drückte mir die Hand. Sie weinte fort und konnte sich lange nicht beruhigen. Ich aber ging in die Küche nach Petroleum.
II
Inhaltsverzeichnis
Unter den Veranstaltern von Liebhaberaufführungen, Konzerten und lebenden Bildern zu wohltätigen Zwecken spielten in unserer Stadt die Aschogins, die im eigenen Hause auf der Großen Adelstraße wohnten, die erste Rolle; sie gaben jedesmal ihre Räume her und übernahmen alle Scherereien und Auslagen. Diese reiche Gutsbesitzersfamilie besaß im Landkreise ein Gut von dreitausend Deßjatinen mit einem herrlichen Herrenhause, liebte aber das Landleben nicht und wohnte im Winter wie im Sommer in der Stadt. Die Familie bestand aus der Mutter, einer groß gewachsenen, hageren, vornehmen Dame, die die Haare kurz geschoren trug und sich nach englischer Mode kleidete, und aus drei Töchtern, die man niemals bei ihren Namen nannte, sondern einfach mit die Aelteste, die Mittlere, die Jüngste bezeichnete. Alle drei Töchter hatten ein spitzes Kinn, waren unschön und kurzsichtig, hielten sich gebückt, kleideten sich wie die Mutter und lispelten höchst unangenehm. Trotzdem nahmen sie unbedingt an jeder Vorstellung teil und betätigten sich immer zu wohltätigen Zwecken; entweder spielten sie, rezitierten oder sangen. Sie waren sehr ernst und lächelten niemals; selbst in Possen mit Gesang spielten sie ohne den leisesten Humor, mit einem so geschäftsmäßigen Ausdruck, als wenn sie Buchhaltung trieben.
Ich liebte unsere Aufführungen und ganz besonders die häufigen, etwas unordentlichen, geräuschvollen Proben, nach denen man immer ein Abendbrot bekam. An der Auswahl der Stücke und der Verteilung der Rollen beteiligte ich mich nicht. Ich betätigte mich nur hinter den Kulissen. Ich malte die Dekorationen, schrieb die Rollen ab, soufflierte, schminkte die Darsteller und sorgte für solche Effekte wie Donner, Nachtigallenschlag usw. Da ich weder eine gesellschaftliche Position noch anständige Kleider besaß, hielt ich mich bei den Proben abseits, im Schatten der Kulissen und schwieg.
Die Dekorationen malte ich bei den Aschogins auf dem Hofe oder im Stall. Mir half dabei der Maler oder »Unternehmer für Malerarbeiten«, wie er sich nannte, Andrej Iwanow. Es war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, groß, sehr mager und blaß; er hatte eine eingefallene Brust, eingedrückte Schläfen und blaue Ringe um die Augen und sah sogar etwas unheimlich aus. Er litt an irgendeiner auszehrenden Krankheit, und jeden Herbst und Frühling hieß es von ihm, daß er sterbe. Aber er stand immer wieder auf und sagte dann verwundert: »Ich bin nun wieder nicht gestorben!«
In der Stadt nannte man ihn »Rettich« und behauptete, daß das sein richtiger Name sei. Er liebte das Theater ebenso wie ich, und sobald er hörte, daß man wieder eine Liebhaberaufführung plane, ließ er alle seine Arbeiten liegen und ging zu den Aschogins, um Dekorationen zu malen.
Am Tage nach der Aussprache mit meiner Schwester arbeitete ich vom frühen Morgen an bei den Aschogins. Die Probe war auf sieben Uhr abends angesetzt, und eine Stunde vor Beginn hatten sich schon alle Liebhaber im Saale versammelt. Die Aelteste, die Mittlere und die Jüngste gingen auf und ab und lasen ihre Rollen. Rettich lehnte schon in seinem langen rotbraunen Mantel mit einem Tuch um den Hals an der Wand und blickte mit andächtigen Augen auf die Bühne. Frau Aschogina-Mutter ging bald auf den einen, bald auf den anderen Gast zu und sagte einem jeden etwas Angenehmes. Sie hatte die Manier, einen jeden scharf ins Gesicht zu blicken und so leise zu sprechen, als wären es lauter Geheimnisse.
»Es muß doch recht schwer sein, Dekorationen zu malen,« sagte sie leise zu mir. »Als Sie eintraten, sprach ich gerade mit Madame Muffke von den Vorurteilen. Mein Gott, ich habe mein ganzes Leben lang gegen die Vorurteile gekämpft! Um die Dienstboten von der Grundlosigkeit des Aberglaubens zu überzeugen, pflege ich stets drei Lichter anzuzünden und alles Wichtige am Dreizehnten zu beginnen.«
Nun kam die Tochter des Ingenieurs Dolschikow, eine üppige, schöne Blondine, die, wie man sich erzählte, lauter Pariser Sachen trug. Sie spielte nicht mit, aber bei allen Proben stand stets ein Stuhl für sie auf der Bühne bereit, und man begann mit der Vorstellung nicht eher, als bis sie, strahlend und alle durch ihre Toiletten in Verwunderung versetzend, in der ersten Reihe erschien. Als Großstädterin hatte sie das Privilegium, während der Proben Bemerkungen zu machen, und sie machte sie mit einem freundlichen, herablassenden Lächeln, dem man ansehen konnte, daß sie unsere Aufführungen als ein Kinderspiel betrachten, Man erzählte sich, sie hätte am Petersburger Konservatorium Gesang studiert und wäre sogar einen ganzen Winter lang in einer Operntruppe aufgetreten. Sie gefiel mir außerordentlich, und ich pflegte sie bei den Proben und Aufführungen nicht aus den Augen zu lassen.
Ich hatte schon das Heft in die Hand genommen, um mit dem Soufflieren zu beginnen, als plötzlich meine Schwester erschien. Ohne Mantel und Hut abzulegen, ging sie auf mich zu und sagte:
»Ich bitte dich, komm mit!«
Ich folgte ihr. Hinter der Bühne stand in der Türe Anjuta Blagowo, gleichfalls in Hut, mit einem dunklen Schleier vor dem Gesicht. Sie war die Tochter des Vizepräsidenten des Kreisgerichts, der schon sehr lange, fast seit der Gründung des Gerichtshofes in unserer Stadt amtierte. Da sie groß und schön gewachsen war, wirkte sie obligatorisch an den lebenden Bildern mit, und wenn sie irgendeine Fee oder Ruhmesgöttin darstellte, glühte ihr Gesicht vor Scham; aber in den Stücken spielte sie nicht mit und kam zu den Proben immer nur im Vorbeigehen, wenn sie jemand sprechen mußte. Auch jetzt war sie offenbar nur auf dem Sprunge hier.
»Mein Vater hat von Ihnen erzählt,« sagte sie trocken, ohne mich anzusehen und errötete. »Dolschikow hat eine Stelle für Sie bei der Bahn in Aussicht gestellt. Gehen Sie morgen zu ihm hin, er wird zu Hause sein.«
Ich verbeugte mich und dankte für die Bemühungen.
»Das können Sie übrigens lassen,« sagte sie, auf mein Soufflierheft zeigend.
Dann gingen sie und meine Schwester auf die Frau Aschogina zu und tuschelten eine Weile mit ihr, zu mir herüberblickend. Sie schienen etwas zu beraten.
»In der Tat,« sagte Frau Aschogina leise, an mich herantretend und mir gerade ins Gesicht blickend: »in der Tat, wenn Sie das von ernsthafter Beschäftigung ablenkt,« sie nahm mir das Heft aus der Hand, »so können Sie das jemand anders übergeben. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, lieber Freund, gehen Sie mit Gott.«
Ich verabschiedete mich von ihr und ging verlegen hinaus. Auf der Treppe sah ich auch meine Schwester und Anjuta Blagowo weggehen. Sie sprachen eifrig über etwas, wahrscheinlich über meinen Eintritt in den Eisenbahndienst, und hatten es sehr eilig. Meine Schwester war bisher noch niemals bei einer Probe gewesen; daher hatte sie wohl jetzt Gewissensbisse und fürchtete, der Vater könnte erfahren, daß sie ohne seine Erlaubnis bei den Aschogins gewesen war.
Ich ging zu Dolschikow am nächsten Tag, bald nach zwölf. Ein Diener führte mich in ein sehr schönes Zimmer, das dem Ingenieur als Empfangszimmer und zugleich als Arbeitszimmer diente. Hier war alles weich, elegant und kam einem Menschen wie mir, der so etwas noch nie gesehen hatte, sogar seltsam vor. Lauter teure Teppiche, riesengroße Sessel, Bronzen, Bilder in Gold- und Plüschrahmen; an den Wänden Photographien, die sehr schöne Frauen mit klugen Gesichtern in ungezwungenen Posen darstellten; eine Tür führte aus dem Empfangszimmer auf die Veranda und in den Garten, und ich sah Fliederbüsche, einen gedeckten Tisch mit vielen Flaschen und einem Rosenstrauß; alles duftete nach Frühling, nach teuren Zigarren, alles atmete Glück und alles schien sagen zu wollen: siehst du, dieser Mensch hat sein Leben lang gearbeitet und schließlich alles Glück erreicht, das auf dieser Welt möglich ist. Am Schreibtische saß die Tochter des Ingenieurs und las in einer Zeitung.
»Sie kommen zu meinem Vater?« fragte sie. »Er nimmt gerade eine Dusche, gleich wird er kommen. Bitte, setzen Sie sich.«
Ich setzte mich.
»Sie wohnen, glaube ich, uns gegenüber?« fragte sie wieder nach einer Pause.
»Jawohl.«
»Vor Langweile schaue ich oft zum Fenster hinaus. Sie müssen es entschuldigen,« fuhr sie fort, in die Zeitung blickend, »ich sehe oft Sie und Ihre Schwester. Sie hat einen so gutmütigen und besorgten Gesichtsausdruck.«
Nun kam Dolschikow herein. Er trocknete sich mit einem Handtuch den Hals ab.
»Papa, es ist Herr Polosnjew,« sagte die Tochter.
»Ja, ja, Blagowo hat mir schon von Ihnen erzählt,« wandte er sich lebhaft an mich, ohne mir die Hand zu reichen. »Aber, hören Sie einmal, was soll ich für Sie tun? Was habe ich für Stellen zu vergeben? Ihr seid doch wirklich merkwürdige Menschen!« fuhr er sehr laut fort, in einem Tone, als ob er mir eine Rüge erteilte. »Täglich kommen an die zwanzig Menschen zu mir, die sich einbilden, daß ich hier ein Ministerium habe! Ich habe ja nur die Bauarbeiten unter mir, meine Herren, und kann nur Schwerarbeiter brauchen: Mechaniker, Schlosser, Erdarbeiter, Tischler, Brunnengräber. Ihr alle versteht aber nur in den Schreibstuben zu hocken. Ihr seid alle nichts als Schreiber!«
Er atmete dasselbe Glück wie seine Teppiche und Sessel. Voll, gesund, rotbackig, mit breiter Brust, frisch gewaschen, in farbigem Kattunhemd und Pluderhose, sah er wie ein Spielzeug, wie ein Kutscher aus Porzellan aus. Er hatte ein rundes, lockiges Bärtchen ohne ein einziges graues Haar, eine Adlernase und dunkle, klare, unschuldige Augen.
»Was verstehen Sie zu tun?« fuhr er fort. »Gar nichts verstehen Sie! Ich bin Ingenieur und gut versorgt, aber bevor ich diese Eisenbahn bekam, mußte ich lange schuften. Ich bin als Maschinist auf der Lokomotive herumgefahren und habe ganze zwei Jahre als einfacher Wagenschmierer in Belgien gearbeitet. Urteilen Sie nun selbst, mein Bester, was für eine Arbeit soll ich Ihnen anbieten?«
»Gewiß, das stimmt ...« stotterte ich in höchster Aufregung. Der Blick seiner klaren, unschuldigen Augen irritierte mich.
»Verstehen Sie wenigstens mit einem Telegraphenapparat umzugehen?« fragte er nach einiger Überlegung.
»Ja, ich habe schon den Telegraphen bedient.«
»Hm ... Nun, wir wollen sehen. Gehen Sie vorläufig nach Dubetschnja. Ich habe dort schon einen sitzen, aber der ist ein ganz unmöglicher Kerl.«
»Worin wird meine Tätigkeit bestehen?« fragte ich.
»Das wird sich schon zeigen. Gehen Sie nur hin, ich werde das Nötige anordnen. Aber um das eine muß ich Sie bitten: daß Sie mir nicht trinken und mich mit keinen Bittschriften behelligen. Sonst jage ich Sie gleich hinaus.«
Er ließ mich stehen und nickte mir nicht einmal mit dem Kopf. Ich verbeugte mich vor ihm und seiner Tochter, die in der Zeitung las, und ging. Es war mir so traurig zumute, und ich hatte so wenig Lust, die Stadt zu verlassen. Ich liebte meine Vaterstadt. Sie schien mir so hübsch und heimlich. Ich liebte dieses Grün, die stillen sonnigen Morgenstunden, das Läuten unserer Kirchenglocken; aber die Menschen, mit denen ich in dieser Stadt zusammenwohnte, langweilten mich und waren mir fremd, zuweilen sogar widerlich. Ich liebte sie nicht und verstand sie auch nicht.
Ich konnte nicht verstehen, wozu und wovon alle diese fünfundzwanzigtausend Menschen existierten. Ich wußte, daß die Stadt Kimry von Stiefeln lebte, daß Tula Samowars und Gewehre produzierte, daß Odessa eine Hafenstadt war, was aber unsere Stadt darstellte und was sie leistete, das war mir unbekannt. Die Große Adelsstraße und noch zwei andere bessere Straßen lebten von Zinsen und von den Gehältern, die der Staat den Beamten zahlte; wovon aber die übrigen acht Straßen lebten, die parallel zueinander drei Werst weit liefen und hinter dem Hügel verschwanden, das war für mich immer ein unlösbares Rätsel.
Und wie diese Menschen lebten, das war die reinste Schande! Es gab weder einen Stadtgarten, noch ein Theater, noch ein anständiges Orchester; die Stadt- und die Klubbibliothek wurden ausschließlich von halbwüchsigen Jungen besucht, und die Zeitschriften und neuen Bücher lagen monatelang unaufgeschnitten herum; selbst die reichen und gebildeten Menschen schliefen in schwülen, engen Räumen auf Holzbetten mit Ungeziefer, hielten ihre Kinder in scheußlichen, schmutzigen Löchern, die sie Kinderzimmer nannten, und die Dienstboten, selbst die alten und geachteten, mußten in der Küche auf dem Fußboden schlafen und sich mit elenden Lumpen zudecken. An Fleischtagen roch es in allen Häusern nach Kohlsuppe, und an Fasttagen – nach Stör und Sonnenblumenöl. Man aß schlecht zubereitete Speisen und trank ungesundes Wasser. Im Rathause, beim Gouverneur, beim Bischof, in allen Häusern sprach man jahrelang davon, daß wir in unserer Stadt kein billiges gutes Trinkwasser haben und daß man beim Staate eine Anleihe von zweihunderttausend Rubel machen sollte, um eine Wasserleitung zu bauen; auch die sehr reichen Leute, von denen es in unserer Stadt an die drei Dutzend gab, und die manchmal ganze Güter am Kartentisch verspielten, tranken das schlechte Wasser und sprachen ihr Leben lang mit großem Eifer von der Anleihe. Ich konnte das nicht verstehen: mir schien es viel einfacher, die zweihunderttausend Rubel aus eigener Tasche zu zahlen.
Ich kannte in unserer Stadt keinen einzigen ehrlichen Menschen. Mein Vater nahm Bestechungsgelder an und bildete sich ein, daß man sie ihm aus Achtung für seine seelischen Eigenschaften schenke; die Gymnasiasten mußten, um alljährlich versetzt zu werden, zu ihren Lehrern in Pension gehen, wofür sich diese ordentlich bezahlen ließen; die Frau des Stadtkommandanten ließ sich zur Zeit der Einberufungen von den Rekruten bestechen und sogar mit Alkohol traktieren, und einmal passierte es, daß sie in der Kirche beim Gottesdienst unmöglich von den Knien aufstehen konnte, da sie betrunken war; auch die Ärzte mußten bei den Einberufungen geschmiert werden, und der Bezirksarzt und der Veterinär hatten alle Fleischläden mit einer Steuer belegt; an der Kreisschule konnte man Atteste kaufen, die die Berechtigung zum Freiwilligendienst gaben; die Pröpste nahmen von den ihnen unterstellten Geistlichen und Kirchenvorstehern Geldgeschenke an; in allen Ämtern rief man jedem Besucher nach: »Es ist üblich, sich zu bedanken!«, und der Besucher kehrte um, um dreißig oder vierzig Kopeken zu geben. Diejenigen aber, die keine Bestechungsgelder annahmen, wie die Gerichtsbeamten, waren hochmütig, reichten bei der Begrüßung nur zwei Finger, zeichneten sich durch die Kälte und Beschränktheit ihrer Urteile aus, waren dem Kartenspiel und dem Trunke ergeben, heirateten reich und wirkten auf ihre Umgebung zweifellos schädlich und demoralisierend. Nur die jungen Mädchen atmeten Reinheit; die meisten von ihnen hatten hohe Bestrebungen und ehrliche, keusche Seelen; aber sie verstanden das Leben nicht und glaubten, daß die Bestechungsgelder in Anerkennung der seelischen Eigenschaften gegeben werden. Wenn sie aber heirateten, alterten sie früh, versumpften schnell und versanken hoffnungslos im Schlamme der trivialen, kleinbürgerlichen Existenz.
III
Inhaltsverzeichnis
In unserer Gegend wurde eine Eisenbahn gebaut. An den Abenden vor den Feiertagen zogen Banden von zerlumpten Kerlen durch die Stadt, die man »Eisenbahner« nannte und vor denen man sich fürchtete. Gar oft sah ich, wie man so einen Kerl mit blutendem Gesicht, ohne Mütze zur Polizei führte, während hinter ihm als corpus delicti ein Samowar oder frischgewaschene, noch neue Wäsche getragen wurde. Die »Eisenbahner« drängten sich meistens bei den Schenken und auf den Märkten herum. Sie aßen und tranken, schimpften unflätig und begleiteten jede Dirne mit gellendem Pfeifen. Zur Unterhaltung dieser immer hungrigen Lumpen pflegten unsere Ladenbesitzer Katzen und Hunde mit Schnaps betrunken zu machen oder einem Hunde eine leere Petroleumkanne an den Schwanz zu binden; dann fingen sie zu pfeifen an, und der Hund raste, vor Entsetzen heulend, durch die Straße, während die Kanne dröhnte. Dem Hunde schien es, daß er von einem Ungeheuer verfolgt werde, er lief weit vor die Stadt ins freie Feld hinaus, bis ihn die Kräfte verließen; es gab in unserer Stadt mehrere Hunde, die immer zitterten und die Schweife eingezogen hielten; von ihnen sagte man, daß sie dieses Spiel nicht hatten ertragen können und verrückt geworden seien.
Der Bahnhof wurde fünf Werst von der Stadt erbaut. Man erzählte sich, daß die Ingenieure fünfzigtausend Rubel dafür gefordert hätten, daß der Bahnhof näher bei der Stadt läge; die Stadtverwaltung hätte dafür aber nur vierzigtausend geben wollen; wegen der zehntausend Rubel hätte sich das Geschäft zerschlagen; die Stadtverwaltung bereute es nun schwer, da sie bis zum Bahnhof eine Chaussee anlegen mußte, die viel teurer zu stehen kam. Auf der ganzen Strecke lagen schon die Schwellen und die Schienen und verkehrten Dienstzüge, die das Baumaterial beförderten; es fehlten nur noch die Brücken, die Dolschikow zu bauen hatte, und auch einige Stationsgebäude waren noch nicht ganz fertig.
Dubetschnja – so hieß unsere erste Station – lag siebzehn Werst von der Stadt entfernt. Ich ging zu Fuß. Die Saaten leuchteten grün in der Morgensonne. Die Gegend war flach und freundlich, und in der Ferne hoben sich klar der Bahnhof, die Hügel und entfernte Gutsgebäude ab ... Wie schön war es hier in Gottes freier Natur! Und wie gern wollte ich diese Freiheit genießen, wenigstens diesen einen Morgen lang, und nicht daran denken müssen, was in der Stadt vorging, nicht an meine Schwierigkeiten und an den Hunger, der mich quälte, denken müssen! Nichts hinderte mich am Lebensgenuß so sehr wie dieses nagende Hungergefühl, wenn meine besten Gedanken sich sonderbar mit den Vorstellungen von Buchweizengrütze, Koteletts und Bratfischen verquickten. Da stehe ich allein im Felde, blicke auf eine Lerche, die in der Luft unbeweglich zu schweben scheint und wie in einem hysterischen Anfall schmettert, und denke mir dabei: »Wie gut wäre es jetzt, ein Stück Butterbrot zu essen!« Oder ich setze mich am Straßenrande nieder, schließe die Augen, um auszuruhen und diesen herrlichen Frühlingsgeräuschen zu lauschen, und plötzlich muß ich an den Geruch gebratener Kartoffeln denken. Obwohl ich groß gewachsen und kräftig gebaut bin, bekam ich im allgemeinen wenig zu essen, und daher war der Hunger meine wesentlichste Empfindung im Laufe des Tages; darum verstand ich vielleicht auch so gut, weshalb so viele Menschen nur des Brotes wegen arbeiten und nur vom Essen sprachen.
In Dubetschnja arbeitete man gerade am Verputz der Innenwände des Stationsgebäudes und baute eine hölzernen Oberstock am Wasserturm. Es war heiß, es roch nach Kalk, und die Arbeiter trieben sich träge zwischen den Haufen von Schutt und Spänen herum; der Weichensteller schlief vor seinem Häuschen, und die Sonne brannte ihm gerade ins Gesicht. Kein einziger Baum war zu sehen. Leise summten die Telegraphendrähte, auf denen hie und da Habichte ausruhten. Ich drückte mich zwischen dem Schutt umher, wußte nicht, was anzufangen und dachte an die Antwort des Ingenieurs auf meine Frage, was ich hier zu tun haben würde: »Das wird sich schon zeigen.« Was konnte sich aber in dieser Wüste zeigen? Die Maurer sprachen von irgendeinem Polier und von einem gewissen Fedot Wassiljew; ich verstand es nicht, und meiner bemächtigte sich allmählich ein Unlustgefühl, – ein körperliches Unlustgefühl, bei dem man seine Arme und Beine und seinen ganzen großen Körper fühlt und nicht weiß, was mit ihnen anzufangen.
Nachdem ich mindestens zwei Stunden so herumgebummelt, bemerkte ich eine Reihe von Telegraphenstangen, die rechts von der Strecke abbogen und vor einer weißen Mauer aufhörten; die Arbeiter sagten mir, daß dort die Baukanzlei sei, und nun begriff ich endlich, daß ich mich dorthin zu wenden hatte.
Es war ein sehr altes, verwahrlostes Gutshaus. Die Mauer aus weißem porösem Stein war verwittert und stellenweise eingefallen. Der Seitenflügel, dessen blinde Wand nach dem Felde lag, hatte ein rostiges Eisendach, auf dem hie und da einige frisch geflickte Stellen glänzten. Durch das Tor sah ich einen sehr geräumigen Hof, der mit wildem Steppengras bewachsen war, und ein altes Herrenhaus mit Jalousien an den Fenstern und einem hohen, vor Rost ganz roten Dach. Rechts und links standen zwei vollkommen gleiche Seitenflügel; die Fenster des einen waren mit Brettern vernagelt, vor dem andern aber, dessen Fenster offen standen, war Wäsche zum Trocknen aufgehängt und weideten Kälber. Der letzte Telegraphenpfahl stand auf dem Hofe, und der Draht ging in eines der Fenster des Flügels, der mit seiner blinden Wand nach dem Felde lag. Die Türe war offen, und ich trat ein. Am Tisch mit dem Telegraphenapparat saß ein Herr mit dunklem Lockenkopf, mit einer Leinenjacke bekleidet; er blickte mich erst streng und mürrisch an, lächelte aber dann gleich und sagte:
»Guten Tag, kleiner Nutzen!«
Es war Iwan Tscheprakow, mein ehemaliger Schulkollege, den man aus der zweiten Klasse wegen Rauchens relegiert hatte. Wir pflegten einst zusammen zur Herbstzeit Stieglitze, Zeisige und Kernbeißer zu fangen und am frühen Morgen, wenn die Eltern noch schliefen, auf dem Markte zu verkaufen. Wir lauerten auch den Staren auf, schossen sie mit seinem Schrot an und sammelten dann die verwundeten. Die einen starben bei uns in schrecklichen Qualen (ich erinnere mich auch heute noch, wie sie nachts in ihrem Käfig stöhnten), die anderen aber, die wieder gesund wurden, verkauften wir und schworen dabei, daß es lauter Männchen seien. Einmal war mir auf dem Markte nur ein einziger Star übriggeblieben, den ich lange nicht anbringen konnte und schließlich für eine Kopeke verkaufte, »Es ist ja immerhin ein kleiner Nutzen!« sagte ich damals zum Trost, die Kopeke in die Tasche steckend, und von nun an hieß ich bei den Gassenjungen und Gymnasiasten »kleiner Nutzen«. Es kam auch jetzt noch vor, daß Gassenjungen und Händler mich damit neckten, obgleich wohl niemand mehr den Ursprung dieses Spitznamens kannte.
Tscheprakow war schwächlich von Statur, engbrüstig und langbeinig, und hielt sich krumm. Seine Halsbinde war wie ein Strick verknotet, eine Weste hatte er überhaupt nicht an, und seine Stiefel hatten schiefe Absätze und waren noch schlechter als die meinigen. Er zwinkerte immer mit den Augen und hatte einen so ungestümen Ausdruck, als wollte er immer etwas packen.
»Wart einmal,« sage er jeden Augenblick sehr geschäftig. »Hör einmal ... Ja, was wollte ich eben sagen? ...«
Wir kamen ins Gespräch. Ich erfuhr von ihm, daß das Gut, auf dem ich mich jetzt befand, noch vor kurzem den Tscheprakows gehört hatte und erst im vergangenen Herbst in den Besitz Dolschikows übergegangen war, der es für vernünftiger hielt, sein Geld in Immobilien als in Papieren anzulegen, und in unserer Gegend bereits drei ansehnliche Güter mit Uebernahme der Schuldenlast gekauft hatte; Tscheprakows Mutter hatte sich beim Verkauf dieses Gutes das Recht ausbedungen, in einem der Seitenflügel noch zwei Jahre wohnen zu bleiben, und obendrein auch eine Anstellung für ihren Sohn an der Baukanzlei erwirkt.
»Warum soll er auch keine Güter kaufen!« sagte Tscheprakow vom Ingenieur. »Was er von den Lieferanten allein schindet! Von allen schindet er!«
Dann forderte er mich auf, mit ihm zu Mittag zu essen. Er hatte in aller Eile beschlossen, daß ich mit ihm im Seitenflügel wohnen und mich bei seiner Mutter beköstigen werde.
»Sie ist zwar ein Geizhals,« sagte er, »wird dir aber nicht allzu viel berechnen.«
In den kleinen Zimmern, die seine Mutter bewohnte, war es sehr eng; überall, selbst im Flur und Vorzimmer standen die Möbel herum, die man nach dem Verkauf des Gutes aus dem großen Hause herübergeschafft hatte; es waren lauter altertümliche Mahagonimöbel. Frau Tscheprakowa, eine volle, alte Dame mit chinesischen Schlitzaugen, saß in einem schweren Sessel am Fenster und strickte. Sie empfing mich höchst zeremoniell.
»Mama, das ist Herr Polosnjew,« stellte mich Tscheprakow vor. »Er tritt hier in Stellung.«
»Sind Sie adlig?« fragte sie mich mit seltsam unangenehmer Stimme, die so klang, als ob in ihrem Halse Fett kochte.
»Ja,« antwortete ich.
»Nehmen Sie Platz.«
Das Mittagessen war schlecht. Es gab eine Pastete mit bitterem Quark, eine Milchsuppe und sonst nichts. Jelena Nikiforowna, die Dame des Hauses, blinzelte mir die ganze Zeit bald mit dem einen, bald mit dem andern Auge zu. Sie sprach und aß, aber in ihrem ganzen Wesen war etwas Totes, und ich glaubte sogar Leichengeruch zu spüren. Das Leben glimmte in ihr ebenso schwach wie das Bewußtsein, daß sie eine Gutsbesitzerin, die einst Leibeigene besessen hatte, und Generalewitwe sei, die die Dienstboten Exzellenz zu titulieren haben; wenn diese kümmerlichen Reste ihres einstigen Lebens in ihr wieder aufleuchteten, pflegte sie ihrem Sohn zu sagen:
»Jean, du hältst das Messer nicht so, wie, es sich gehört!«
Oder sie wandte sich, schwer keuchend, an mich, mit der Geziertheit einer Dame, die ihren Gast unterhalten will:
»Wissen Sie, wir haben unser Gut verkauft. Es tut uns natürlich furchtbar leid, denn wir sind an diese Gegend gewöhnt, aber Dolschikow hat versprochen, Jean zum Stationschef von Dubetschnja zu machen. So werden wir von hier nicht fortziehen müssen, sondern auf der Station wohnen, und das ist genau so wie auf dem Gute. Der Ingenieur ist so gut! Finden Sie nicht auch, daß er ein schöner Mann ist?«
Die Tscheprakows lebten vor nicht langer Zeit als reiche Leute, aber nach dem Tode des Generals hatte sich alles verändert. Jelena Nikiforowna zankte sich und prozessierte mit den Nachbarn, kürzte den Angestellten und Arbeitern die Löhne und hatte immer Angst vor Dieben und Räubern; nach kaum zehn Jahren war Dubetschnja nicht mehr wiederzuerkennen.
Hinter dem großen Hause lag ein alter Garten, in dem Gras und Gesträuch verwilderten. Ich betrat die schöne und noch gar nicht baufällige Terrasse und blickte durch die Glastür ins Innere des Hauses hinein. Ich sah ein Zimmer mit Parkettfußboden, wohl einen Salon mit einem alten Klavier und Stichen in breiten Mahagonirahmen an den Wänden; sonst war nichts drin. Von den früheren Blumenanlagen waren nur Päonien und Mohn übriggeblieben, die aus dem Grase ihre weißen und grellroten Köpfe hoben. Längs der Wege wuchsen, einander drängend, junge Ahornbäume und Ulmen, die von den Kühen ordentlich angenagt waren. Das Dickicht schien undurchdringlich; so war es aber nur in der Nähe des Hauses, wo noch Pappeln, Fichten und Linden, die wohl ebenso alt wie das Haus waren, standen. Aber weiter hinaus war der Garten schon zu einer Weide ausgerodet; hier war es nicht mehr so schwül, hier bekam man nicht fortwährend Spinngewebe in den Mund und in die Augen, hier wehte ein erfrischender Wind. Und noch weiter vom Hause weg war es schon sehr geräumiger; hier standen ganz frei Kirschen-, Pflaumen- und Apfelbäume, von Stützen und Brand entstellt, und so große Birnbäume, daß man gar nicht glauben wollte, daß es Birnbäume seien. Dieser Teil des Gartens war an Obsthändlerinnen aus der Stadt verpachtet, und ein halbverrückter Bauer, der in einer Hütte wohnte, bewachte ihn vor den Staren und Dieben.
Der Garten ging dann allmählich in eine richtige Wiese über und stieg zum Flüßchen herab, das mit grünem Schilf und Weidengebüsch umwachsen war; neben dem Mühlendamme lag ein tiefer, fischreicher Teich. Die mit Stroh gedeckte Mühle rauschte wütend, und die Frösche quakten wie wahnsinnig. Auf dem glatten Wasserspiegel zogen Kreise, wenn ein Fisch die Stengel der Wasserlilien streifte. Jenseits des Flüßchens lag das Dorf Dubetschnja. Der stille blaue Teich lockte zu sich und verhieß Kühle und Ruhe. Und jetzt gehörte das alles – der Teich, die Mühle und die schönen Ufer dem Ingenieur!
Nun begann mein neuer Dienst. Ich empfing Telegramme und gab sie weiter, setzte allerlei Berichte auf und schrieb die Bestellzettel, Klagen und Rechnungen ins reine, die uns die kaum des Schreibens kundigen Poliere und Meister schickten. Den größten Teil des Tages tat ich aber nichts und ging, in Erwartung von Telegrammen, im Zimmer auf und ab; oder ich ließ einen Jungen als Aufpasser zurück und spazierte im Garten, bis der Junge mir meldete, daß der Apparat klopft. Zu Mittag aß ich bei der Frau Tscheprakow. Fleisch gab es sehr selten; meistens bekamen wir Milchspeisen und an Mittwochen und Freitagen – Fastenspeisen; an diesen Tagen standen rosa Teller auf dem Tisch, die man »Fastenteller« nannte. Frau Tscheprakowa hatte die angenehme Angewohnheit, mir immer zuzublinzeln, und in ihrer Gegenwart fühlte ich mich recht unbehaglich.
Da es nicht einmal für einen Menschen genug Arbeit gab, so tat Tscheprakow gar nichts, sondern schlief meistens oder ging mit der Flinte an den Teich, Wildenten zu schießen. An Abenden betrank er sich im Dorfe oder auf der Station, betrachtete sich dann vor dem Schlafengehen in einem kleinen Spiegel und rief sich selbst zu:
»Guten Abend, Iwan Tscheprakow!«
Wenn er betrunken war, sah er sehr blaß aus, rieb sich immer die Hände und wieherte wie ein Pferd. Manchmal zog er sich auch ganz nackt aus und lief in diesem Zustand im Felde herum. Er aß auch Fliegen und behauptete, daß sie säuerlich schmeckten.
IV
Inhaltsverzeichnis
Eines Nachmittags kam er zu mir außer Atem gelaufen sagte:
»Komm, deine Schwester ist da.«
Ich ging hinaus. Vor dem großen Hause hielt tatsächlich eine Stadtdroschke. Meine Schwester war mit Anjuta Blagowo und einem Herrn in Militäruniform gekommen. Als ich näher kam, erkannte ich ihn: es war Anjutas Bruder, der Militärarzt.
»Wir sind zu Ihnen zu einem Picknick gekommen,« sagte er: »Ist es Ihnen recht?«
Meine Schwester und Anjuta wollten mich wohl fragen, wie es mir hier ginge, aber beide schwiegen und sahen mich nur an. Auch ich schwieg. Sie wußten, daß es mir hier nicht gefiel; meiner Schwester traten Tränen in die Augen, und Anjuta Blagowo wurde rot. Wir gingen in den Garten. Der Militärarzt schritt voran und rief begeistert:
»Das nenn' ich eine Luft! Heilige Mutter Gottes, ist das eine Luft!«
Er sah noch ganz wie ein Student aus. Er sprach und bewegte sich wie ein Student, und auch seine grauen Augen blickten lebhaft, einfach und offen wie bei einem guten Studenten. An der Seite seiner stattlichen und schönen Schwester erschien er schmächtig und klein; sein Bärtchen war dünn, ebenso seine nicht unangenehme Tenorstimme. Er diente bei irgendeinem Regiment und war auf Urlaub zu den Seinen gekommen. Im Herbst wollte er nach Petersburg gehen, um dort das Doktorexamen zu machen. Er hatte schon Familie – eine Frau und drei Kinder; er hatte früh, im vierten Semester, geheiratet, und in der Stadt erzählte man sich, daß es eine unglückliche Ehe sei und daß er von seiner Frau getrennt lebe.
»Wie spät ist es jetzt?« fragte meine Schwester unruhig »Wir wollen früh heimkehren, Papa erlaubte mir nur bis sechs Uhr hier zu bleiben.«
»Ach, Ihr Papa!« seufzte der Doktor.
Ich bereitete den Samowar. Auf einem Teppich vor der Terrasse des großen Hauses tranken wir Tee, der Doktor schlürfte ihn kniend aus einer Untertasse und behauptete, er fühle sich selig. Tscheprakow holte dann den Schlüssel, sperrte die Glastür auf, und wir traten alle ins Haus. Hier war es halbdunkel und geheimnisvoll, es roch nach Pilzen, und unsere Schritte hallten, als wenn sich unter dem Fußboden ein Keller befände. Der Doktor berührte stehend die Tasten des Klaviers, und dieses antwortete mit einem schwachen, zittrigen, heiseren, aber doch harmonischen Akkord; er versuchte seine Stimme und begann ein Lied, die Stirne runzelnd und geärgert mit dem Fuße stampfend, wenn irgendeine Taste versagte. Meine Schwester hatte es nicht mehr so eilig, nach Hause zurückzukehren, sondern ging erregt im Zimmer auf und ab und sprach:
»Mir ist so lustig zumute! So furchtbar lustig!«
In ihrer Stimme klang Erstaunen, als ob es ihr selbst ganz unwahrscheinlich schiene, daß sie einmal lustig sein, könnte. Zum erstenmal in ihrem Leben sah ich sie so lustig. Sie sah sogar auf einmal hübscher aus. Ihr Profil war nicht schön, Nase und Mund standen hervor und hatten den Ausdruck, als ob sie vor sich bliese, sie hatte aber wunderschöne dunkle Augen, einen blassen, sehr zarten Teint und einen rührenden Ausdruck von Güte und Trauer; wenn sie sprach, schien sie recht anmutig und sogar hübsch. Wir beide, sie und ich, waren unserer Mutter nachgeraten und waren breitschultrig, kräftig und ausdauernd; aber ihre Blässe war krankhaft, sie hustete oft, und in ihren Augen beobachtete ich manchmal den Ausdruck, den die Menschen haben, die ernsthaft krank sind, es aber aus irgendeinem Grunde verheimlichen. In ihrer plötzlichen Lustigkeit lag etwas Kindliches und Naives; es war, als ob die Lustigkeit, die man in uns in unserer Kindheit durch strenge Erziehung unterdrückt hatte, jetzt in ihrer Seele erwacht und mit Gewalt zum Ausbruch gekommen wäre.
Als aber der Abend anbrach und der Wagen vorfuhr, wurde sie wieder schweigsam, klappte zusammen und setzte sich in die Droschke mit einer Miene, als ob es eine Anklagebank wäre.
Als sie alle weg waren, wurde es gleich wieder still ... Mir fiel es auf, daß Anjuta Blagowo die ganze Zeit kein einziges Wort zu mir gesagt hatte.
– Ein merkwürdiges Mädchen! – dachte ich mir: – Ein merkwürdiges Mädchen!
In den Petrifasten bekamen wir tagtäglich Fastenspeisen zu essen. Der ewige Müßiggang und die Unbestimmtheit meiner Lage bedrückten mich schwer, und ich trieb mich unzufrieden mit mir selbst, faul und hungrig auf dem Gute herum und wartete nur auf eine passende Stimmung, um von hier fortzugehen.
Eines Abends, als bei uns im Seitenflügel Rettich saß, erschien plötzlich Dolschikow, braungebrannt und über und über mit Staub bedeckt. Er hatte drei Tage auf der Strecke verbracht und war nach Dubetschnja auf einer Lokomotive und von der Station zu uns zu Fuß gekommen. In Erwartung seiner Equipage, die ihn hier abholen sollte, machte er mit seinem Verwalter eine Runde durch seinen Besitz, erteilte mit lauter Stimme Befehle, saß dann eine ganze Stunde bei uns in der Kanzlei und schrieb Briefe; für ihn liefen in einem fort Telegramme ein, die er sofort selbst beantwortete. Wir drei standen vor ihm schweigend und stramm da.
»Diese Unordnung!« rief er angeekelt, in die Tagesberichte hineinschauend. »In vierzehn Tagen kommt die Kanzlei ins Stationsgebäude hinüber, und dann weiß ich wirklich nicht, was ich mit euch anfangen soll, meine Herren!«
»Ich gebe mir die größte Mühe, Euer Hochwohlgeboren,« sagte Tscheprakow.
»Ich sehe ja, wie ihr euch Mühe gebt. Ihr versteht nur, die Gehälter einzustecken,« fuhr der Ingenieur fort, mit einem Blick auf mich. »Ihr hofft immer auf Protektion, um möglichst schnell und leicht faire la carrière. Ich gebe aber auf Protektion gar nichts. Für mich hat sich niemand bemüht. Bevor ich diese Eisenbahn bekam, fuhr ich lange Zeit auf der Lokomotive herum und arbeitete in Belgien als einfacher Wagenschmierer. Und was machst du hier, Pantelej?« wandte er sich an Rettich. »Du trinkst wohl mit ihnen?«
Er hatte die Angewohnheit, alle einfachen Leute »Pantelej« zu nennen; solche aber wie uns, mich und Tscheprakow, verachtete er und titulierte uns hinter dem Rücken mit Sauser, Vieh und Gesindel. Gegen die kleinen Angestellten war er überhaupt grausam: er zog ihnen vom Gehalt Strafgelder ab und jagte sie ohne viele Worte aus dem Dienst.
Endlich kam seine Equipage. Beim Abschied versprach er, uns alle in vierzehn Tagen zu entlassen, nannte seinen Verwalter einen Schafskopf, setzte sich recht bequem in die Polster und fuhr in die Stadt.
»Andrej Iwanowitsch,« sagte ich zu Rettich, »nehmen Sie mich zu sich als Arbeiter.«
»Nun, von mir aus!«
Und wir gingen zusammen in die Stadt. Als die Station und das Gut weit hinter uns lagen, fragte ich ihn:
»Andrej Iwanowitsch, warum waren Sie eigentlich nach Dubetschnja gekommen?«
»Erstens, weil meine Leute hier auf der Strecke arbeiten, und zweitens mußte ich der Generalin die Zinsen zahlen. Vergangenes Jahr habe ich von ihr fünfzig Rubel geliehen und zahle ihr jetzt einen Rubel monatlich ab.«
Der Malermeister blieb stehen und nahm mich am Rockknopf.
»Missail Alexejewitsch, mein Engel,« fuhr er fort, »ich bin der Ansicht, daß jeder einfache Mann oder vornehme Herr, der auch die geringsten Zinsen nimmt, ein Verbrecher ist. In einem solchen Menschen kann die Wahrheit nicht wohnen.«
Der magere, blasse, unheimliche Rettich schloß die Augen, schüttelte den Kopf und sagte im Tone eines Philosophen:
»Läuse fressen das Gras, der Rost – das Eisen, und die Lüge – die Seele. Herr, sei uns Sündern gnädig!«
V
Inhaltsverzeichnis
Rettich war unpraktisch und verstand nicht zu rechnen; nahm viel mehr Arbeit, als er bewältigen konnte, bei der Abrechnung verlor er stets die Fassung und hatte daher fast immer Schaden. Er malte, setzte Scheiben ein, tapezierte und übernahm sogar Dachdeckerarbeiten, und ich kann mich noch erinnern, wie er manchmal wegen irgendeines ganz unbedeutenden Auftrages drei Tage lang auf der Suche nach Dachdeckern herumlief. Er war ein vorzüglicher Meister, verdiente zuweilen zehn Rubel am Tage, und wenn er nicht den Ehrgeiz hätte, unbedingt als Erster zu gelten und »Unternehmer« zu sein, so hätte er wahrscheinlich Geld gespart.
Er selbst arbeitete in Akkord und zahlte davon mir und den anderen Arbeitern siebzig Kopeken bis einen Rubel täglich. Solange es heiß und trocken war, machten wir allerlei Außenarbeiten und strichen hauptsächlich die Dächer. Ich war diese Arbeit nicht gewohnt, und meine Füße glühten, als ob ich auf einer heißen Herdplatte ginge; zog ich aber Filzstiefel an, so war es meinen Füßen wieder zu schwül. Das war aber nur in der ersten Zeit so; als ich mich gewöhnte, ging es wie geschmiert. Ich lebte jetzt unter Menschen, für die die Arbeit obligatorisch und unvermeidlich war und die wie die Lastpferde arbeiteten, oft ohne die sittliche Bedeutung der Arbeit einzusehen und selbst ohne das Wort »Arbeit« in ihren Gesprächen zu gebrauchen; in ihrer Nähe fühlte ich mich gleichfalls als ein Lastpferd, überzeugte mich immer mehr von der Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit dessen, was ich tat, und das erleichterte mir das Leben und befreite mich von allen Zweifeln.
In der ersten Zeit interessierte mich alles, alles war mir neu, und ich fühlte mich wie neugeboren. Ich konnte auf der Erde schlafen, konnte barfuß gehen, was übrigens sehr angenehm ist; konnte, ohne jemand zu belästigen, in einem Haufen gemeinen Volkes stehen, und wenn auf der Straße ein Droschkenpferd fiel, kam ich gelaufen und half es aufheben, ohne Angst, meine Kleider zu beschmutzen. Vor allen Dingen lebte ich aber auf eigene Kosten und fiel niemand zur Last!
Das Anstreichen der Dächer, insbesondere wenn wir auch Firnis und Farbe beistellten, war ein recht einträgliches Geschäft, und selbst so gute Meister wie Rettich verachteten diese grobe und langweilige Arbeit nicht. In kurzer Hose, mit lila Beinen stolzierte er wie ein Storch auf dem Dache herum, und oft hörte ich ihn bei der Arbeit schwer seufzen und sagen:
»Wehe, wehe uns Sündern!«
Auf dem Dache spazierte er ebenso frei herum wie auf dem Fußboden. Obwohl er kränklich und blaß wie eine Leiche war, zeichnete er sich durch ungewöhnlicht Gewandtheit aus; wie die jüngsten Arbeiter malte er die Kirchenkuppeln ohne jedes Gerüst, nur mit Hilfe einer Leiter und eines Strickes, und es war ein wenig unheimlich, wenn er, in der Höhe über der Erde stehend, sich in seiner ganzen Länge ausstreckte und, man wußte nicht, zu wem, sagte:
»Die Läuse fressen das Gras, der Rost – das Eisen, und die Lüge – die Seele!«
Oder wenn er laut auf seine eigenen Gedanken antwortete:
»Alles ist möglich! Alles ist möglich!«
Wenn ich von der Arbeit heimging, riefen mir alle die Ladengehilfen, Lehrjungen und ihre Herren, die vor den Türen saßen, allerlei spöttische und boshafte Bemerkungen nach; in der ersten Zeit regte mich das auf und erschien mir ungeheuerlich.
»Kleiner Nutzen!« klang es von allen Seiten. »Pinsel! Ocker!«
Niemand behandelte mich aber so grausam wie gerade diejenigen, die erst vor kurzem einfache Arbeiter gewesen waren und sich ihr Brot durch schwere Arbeit verdient hatten. Als ich einmal auf dem Markte an einer Eisenhandlung vorbeiging, schüttete man auf mich wie zufällig einen Kübel Wasser aus; ein anderes Mal warf man nach mir mit einem Stock. Und einmal versperrte mir ein alter Fischhändler den Weg und sagte mit böser Stimme:
»Nicht du tust mir leid, Dummkopf: dein Vater tut mir leid!«
Meine Bekannten konnten aber bei der Begegnung mit mir ihre Verlegenheit kaum bemeistern. Die einen sahen mich als einen Sonderling und Hanswurst an, die anderen bemitleideten mich, die dritten aber wußten nicht, wie sie sich zu mir stellen sollten, und ich konnte sie nicht recht verstehen. Eines Tages begegnete ich in einer der Quergassen, in der Nähe unserer Großen Adelsstraße, Anjuta Blagowo. Ich ging zur Arbeit und trug zwei lange Pinsel und einen Eimer mit Farbe. Als Anjuta mich erkannte, bekam sie einen roten Kopf.
»Ich bitte Sie, mich auf der Straße nicht zu grüßen ...« sagte sie nervös, unfreundlich, mit bebender Stimme, ohne mir die Hand zu reichen, und in ihren Augen blinkten plötzlich Tränen. »Wenn Sie das alles für notwendig halten, so bleiben Sie meinetwegen dabei ... aber ich bitte Sie, begegnen Sie mir nicht!«
Ich wohnte nicht mehr in der Großen Adelsstraße, sondern in der Vorstadt Makaricha, bei meiner ehemaligen Kinderfrau Karpowna, einer gutmütigen, doch melancholischen Alten, die überall Unheil witterte, alle Träume fürchtete und selbst in den Bienen und Wespen, die manchmal in ihr Zimmer hineinflogen, üble Vorbedeutungen sah. Auch das, daß ich Arbeiter geworden war, verhieß ihrer Ansicht nach nichts Gutes.
»Verloren ist dein Kopf!« pflegte sie mit traurigem Kopfschütteln zu sagen: »Verloren ist er!«
Bei ihr wohnte ihr Pflegesohn, der Fleischer Prokofij, ein riesengroßer, plumper, rothaariger Geselle mit struppigem Schnurrbart. Wenn er mir im Hausflur begegnete, machte er mir stumm und ehrerbietig Platz; wenn er aber betrunken war, so salutierte er mir mit allen fünf Fingern. Wenn er beim Abendbrot saß, hörte ich durch den Bretterverschlag, wie er nach jedem Glase Schnaps seufzte und sich räusperte.
»Mama!« rief er mit dumpfer Stimme.
»Was ist denn?« antwortete Karpowna, die in ihren Pflegesohn verliebt war. »Was ist denn, Söhnchen?«
»Ich will Ihnen eine Gefälligkeit erweisen, Mama. In diesem irdischen Jammertal werde ich Sie bis ins hohe Alter ernähren, und wenn Sie sterben, werde ich Sie auf meine Kosten beerdigen«. Was ich versprochen habe, das halte ich auch.«
Ich stand jeden Morgen vor Sonnenaufgang auf und ging immer früh zu Bett. Wir Maler aßen sehr viel, schliefen gut, hatten aber nachts immer Herzklopfen. Mit meinen Kollegen zankte ich mich niemals. Flüche und Verwünschungen wie z. B. »Die Augen sollen dir zerspringen!« oder: »Daß dich die Cholera!« verstummten zwar für keinen Augenblick, aber wir lebten doch in gutem Einvernehmen. Die anderen Gesellen hielten mich für einen Sektierer und machten ihre gutmütigen Witze darüber; sie sagten, daß selbst mein leiblicher Vater sich von mir losgesagt hätte, gestanden aber gleich darauf, daß sie selbst fast niemals in die Kirche gingen und daß viele von ihnen seit zehn Jahren nicht mehr in der Beichte gewesen waren; dieses Verhalten rechtfertigten sie damit, daß der Maler unter den Menschen dasselbe sei, was eine Dohle unter den Vögeln.
Die Gesellen achteten mich und behandelten mich mit Ehrfurcht; anscheinend gefiel es ihnen, daß ich weder trank noch rauchte und ein stilles, ordentliches Leben führte. Es berührte sie nur unangenehm, daß ich mich nicht am Stehlen von Firnis beteiligte und auch nicht am Trinkgelderpressen von den Kunden. Das Stehlen von Firnis und Farbe war bei den Malern ein alter Brauch, und selbst ein so anständiger Mensch wie Rettich brachte von der Arbeit immer etwas Firnis und Bleiweiß mit. Um Trinkgeld bettelten aber sogar ehrwürdige alte Männer, die in der Vorstadt Makaricha eigene Häuser besaßen. Es war beschämend zu sehen, wie die Arbeiter irgendeiner Null zum Beginn oder zum Abschluß der Arbeit gratulierten und wie devot sie sich für ein Trinkgeld von zehn Kopeken bedankten.
Den Kunden gegenüber benahmen sie sich wie listige Höflinge, und ich mußte jeden Tag an den Shakespeareschen Polonius denken.
»Es wird wohl regnen,« sagte der Kunde, auf den Himmel blickend.
»Es wird ganz gewiß regnen!« bestätigten die Maler.
»Es sind übrigens keine Regenwolken. Vielleicht wird es auch nicht regnen.«
»Es wird nicht regnen, Euer Wohlgeboren. Ganz gewiß nicht.«
Hinter dem Rücken behandelten sie die Kunden im allgemeinen ironisch, und wenn sie z. B. einen Herrn mit einer Zeitung auf dem Balkon sitzen sahen, spotteten sie:
»Eine Zeitung liest er, aber zu fressen hat er nichts!«