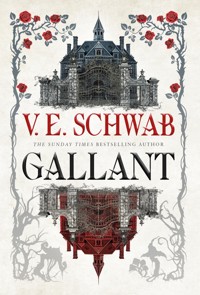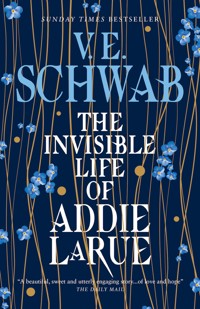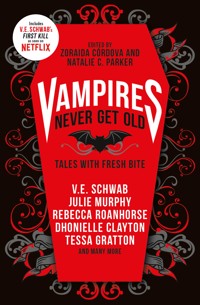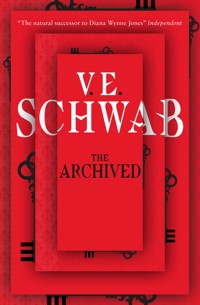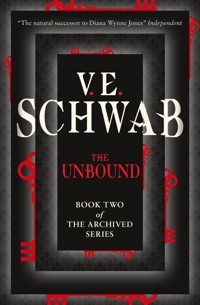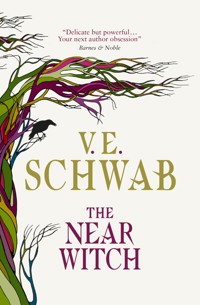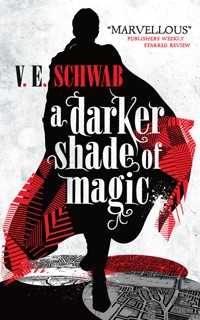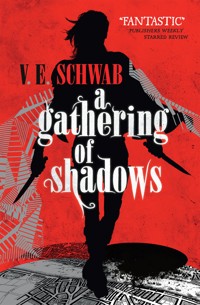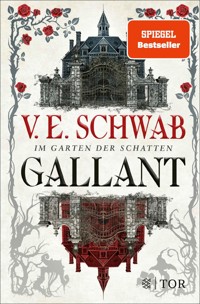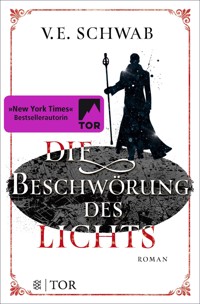
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Weltenwanderer
- Sprache: Deutsch
Magie, Intrigen, Täuschung, Abenteuer – und Piraten. »Die Beschwörung des Lichts« von V.E. Schwab ist das große Finale der Weltenwanderer-Trilogie um die vier unterschiedlichen Versionen von London. »Wie tötet man einen Gott?« Diese Frage stellen sich Lila und Kell, als die Dunkelheit ihre Heimat, das Rote London, erfasst. Osaron, die finsterste Ausgeburt des Schwarzen London, hat in kurzer Zeit die Macht in der Stadt an sich gerissen. Und er möchte vor allem eins: verehrt werden. Selbst die stärksten Magier des Reiches kommen nicht gegen ihn an, also schmieden Kell und Lila einen verzweifelten Plan. Zusammen mit dem von seiner Familie verstoßenen Piraten Emery Alucard und dem zwielichtigen Antari Holland machen sie sich auf die Suche nach einem magischen Artefakt, das selbst Osaron in die Schranken weisen kann. »›Die Beschwörung des Lichts‹ ist pure Magie und der krönende Abschluss einer großartigen Serie. Die Weltenwanderer-Trilogie ein Wendepunkt in der Fantasy-Literatur, die das Genre durch ihre Originalität und meisterhafte Sprache neu belebt hat. Sie wird unseren Blick auf die phantastische Literatur auf Jahre hinaus prägen – Schwabs Bücher sind Kult und jetzt schon Klassiker des Genres.« Barnes & Nobles Sci-Fi and Fantasy Blog Die Weltenwanderer-Trilogie: Band 1: Vier Farben der Magie Band 2: Die Verzauberung der Schatten Band 3: Die Beschwörung des Lichts
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
V. E. Schwab
Die Beschwörung des Lichts
Roman
Über dieses Buch
Magie, Intrigen, Täuschung, Abenteuer – und Piraten. »Die Beschwörung des Lichts« von V. E. Schwab ist das große Finale der Weltenwanderer-Trilogie um die vier unterschiedlichen Versionen von London.
»Wie tötet man einen Gott?« Diese Frage stellen sich Lila und Kell, als die Dunkelheit ihre Heimat, das Rote London, erfasst. Osaron, die finsterste Ausgeburt des Schwarzen London, hat in kurzer Zeit die Macht in der Stadt an sich gerissen. Und er möchte vor allem eins: verehrt werden. Selbst die stärksten Magier des Reiches kommen nicht gegen ihn an, also schmieden Kell und Lila einen verzweifelten Plan. Zusammen mit dem von seiner Familie verstoßenen Piraten Emery Alucard und dem zwielichtigen Antari Holland machen sie sich auf die Suche nach einem magischen Artefakt, das selbst Osaron in die Schranken weisen kann.
Die Weltenwanderer-Trilogie:
Band 1: »Vier Farben der Magie«
Band 2: »Die Verzauberung der Schatten«
Band 3: »Die Beschwörung des Lichts«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Victoria (V. E.) Schwab ist 1987 als Kind einer englischen Mutter und eines amerikanischen Vaters zur Welt gekommen und seitdem von unstillbarer Wanderlust getrieben. Wenn sie nicht gerade durch die Straßen von Paris streunt oder auf irgendeinen Hügel in England klettert, sitzt sie im hintersten Winkel eines Cafés und spinnt an ihren Geschichten. Die drei Bücher der Weltenwanderer-Trilogie um die Antari Kell und Lila Bard wurden zu internationalen Bestsellern.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »A Conjuring of Light« bei Tor Books, New York. Copyright © Victoria Schwab 2017
Published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc. Armonk, U.S.A.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung mehrerer Bilder von Shutterstock/100ker/Naeblys/Algol/Stawek
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490170-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Eins Eine Welt in Trümmern
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Zwei Eine Stadt im Schatten
I
II
III
IV
V
VI
VII
Drei Kampf oder Untergang
I
II
III
IV
V
VI
Vier Zu den Waffen!
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Fünf Asche und Verderben
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Sechs Die Hinrichtung
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Sieben Aufbruch ins Ungewisse
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Acht Unbekannte Gewässer
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Neun Späte Rache
I
II
III
IV
V
VI
VII
Zehn Der Bindering
I
II
III
IV
V
VI
VII
Elf Blut, Stahl und Tod
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Zwölf Verrat
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Dreizehn In den Fußstapfen des Königs
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Vierzehn Die Antari
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Fünfzehn Anoshe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Für all jene, die den Weg nach Hause gefunden haben.
Reine Magie hat kein Selbst. Sie ist einfach. Eine Kraft der Natur, das Blut unserer Welt, das Mark unserer Knochen. Wir verleihen ihr Form, aber wir dürfen ihr nie – niemals – eine Seele geben.
Thieren Serense, Hohepriester des Londoner Heiligtums
EinsEine Welt in Trümmern
I
Delilah Bard – Diebin von Kindesbeinen an, seit kurzem Magierin und hoffentlich bald Piratin – rannte, so schnell sie nur konnte.
Halte durch, Kell, dachte sie, während sie durch die Straßen des Roten Londons sprintete, in der Hand eine weiße Scherbe, die einst zur Statue von Astrid Dane gehört hatte, bevor sie in tausend Stücke zersprungen war. Der Stein erinnerte Lila an ein früheres Leben, als das Wissen um Magie und um die vier Welten noch neu für sie gewesen war; als sie gerade erst von einer Macht erfahren hatte, die andere unterwerfen, binden und in Stein verwandeln konnte.
Hinter ihr, im Herzen der Stadt, explodierten Feuerwerke, begleitet von ausgelassenem Jubel und Musik – das Rote London feierte den Abschluss des Essen Tasch, des großen magischen Turniers. Und niemand ahnte etwas von den grauenhaften Geschehnissen, die sich im Roten Palast abspielten – davon, dass Rhy Maresh, der Prinz von Arnes, im Sterben lag; und somit, in einer anderen Welt, auch sein Bruder Kell.
Kell! Der Name des Antari hallte in ihr wider, wie ein drängender Befehl, eine flehentliche Bitte.
Als Lila die Straße erreichte, nach der sie gesucht hatte, kam sie aus vollem Lauf zum Stehen, zückte ein Messer und zog sich die Klinge über die Handfläche. Keuchend presste sie die blutende Hand zusammen mit der weißen Steinscherbe an die nächstbeste Wand.
Lila hatte die Grenze zwischen den Welten bereits zweimal überquert – aber nie allein. Sie war stets in Begleitung Kells und mit Hilfe seiner Magie gereist.
Doch zum Zaudern fehlte die Zeit. Höchste Eile war geboten.
Heftig um Atem ringend und mit hämmerndem Herzen schluckte Lila schwer, dann sprach sie die magische Formel so beherzt sie nur konnte – jene Worte, die Blutmagiern wie Holland oder Kell vorbehalten waren.
»As Travars.«
Magie vibrierte durch ihren Arm und ihre Brust, die Mauer vor ihr erbebte, dann ging ein Ruck durch die Welt, während der Sog der Schwerkraft sie erfasste.
Lila hatte gedacht, das Reisen zwischen den Welten sei eine einfache Sache.
Entweder man überlebte oder man starb.
Sie hatte sich gründlich getäuscht.
II
Im Weißen London drohte Holland zu ertrinken.
Er kämpfte sich zurück an die Oberfläche seines Bewusstseins, nur um von einem eisenharten Willen zurück in den dunklen Strudel gezogen zu werden. Der Antari wehrte sich mit jeder Faser seines Seins, gierig nach Luft schnappend, während seine Kräfte mit jeder verzweifelten Bewegung weiter schwanden. Dieses unerbittliche Ringen war schlimmer, als zu sterben, denn es gab keine Aussicht auf ein Ende, eine Erlösung durch den Tod.
Osaron hatte ihm alles genommen – Licht, Luft und seine Magie. Nun war da nichts als Dunkelheit, die ihn umdrängte, und irgendwo, in unendlicher Ferne, eine Stimme – Kells Stimme –, die seinen Namen rief.
Holland verlor erneut den Halt und glitt zurück in den Abgrund.
Er hatte doch nur die Magie wiedererwecken, seine Welt vor einem langsamen, erbarmungslosen Tod bewahren wollen. Es war Hollands sehnlichster Wunsch gewesen, seine Welt zu neuem Leben erblühen zu sehen.
Er kannte die Legenden, die Träume von einem Magier, mächtig genug, dieses Wunder zu vollbringen. Und solange er denken konnte, hatte er sich nichts sehnsüchtiger gewünscht, als selbst dieser mächtige Magier zu sein.
Schon als Kind hatte er an den Ufern der Sijlt gestanden, Steine über ihre gefrorene Oberfläche springen lassen und sich vorgestellt, eines Tages das Eis zum Schmelzen zu bringen. Und als junger Mann hatte er im Herzen des Silberwaldes um die Kraft gebetet, seine Heimat schützen zu können. Nie aber hatte er davon geträumt, König zu sein, obwohl in den Legenden stets ein Magier den Thron bestieg. Er wollte die Weiße Welt nicht beherrschen – er wollte sie nur retten.
In jener ersten Nacht, als man ihn blutend und halb bewusstlos in die Gemächer des soeben gekrönten Königs gezerrt hatte, hatte dieser ihn hochmütig genannt. »Du bist hochmütig und stolz«, tadelte ihn Athos Dane, während er das Seelensiegel in Hollands Haut einbrannte. »Das wird sich noch ändern.«
Und der Weiße Herrscher hielt Wort. Auf dem Foltergerüst brach er Hollands Willen Knochen für Knochen, Tag um Tag, Befehl um Befehl. Bis der jeden Gedanken an die Rettung seiner Welt aufgab und nur noch das Ende der Qualen herbeisehnte.
Holland wusste, dass er sich in Feigheit flüchtete, aber das war viel einfacher, als die Hoffnung wachzuhalten.
Und in jenem Moment vor über vier Monaten, als er zugelassen hatte, dass der verwöhnte arnesische Prinz Kell ihm einen Metallpfosten in die Brust rammte, hatte er nichts als reine Erleichterung verspürt.
Endlich war sein Leiden vorbei.
Doch er hatte sich getäuscht – denn einen Antari zu töten war alles andere als einfach.
Als Holland erwachte, lag er in einem verwüsteten Garten in der toten Hauptstadt einer erstarrten Welt. Als Erstes durchfuhr ihn entsetzlicher Schmerz, dann ein Gefühl von Freiheit. Er war Athos Dane entkommen und hatte überlebt – wenn auch in einem schwerverwundeten Körper, in einer versiegelten Welt, der Willkür des Schwarzen Königs ausgeliefert. Doch diesmal hatte er eine Wahl.
Er stand, dem Tode nah, vor dem Thron aus Onyx und schloss einen Pakt mit dem steinernen König: seine Freiheit – seinen Körper und seine Seele – im Gegenzug für die Errettung der Weißen Stadt. Und so war mit der Macht des Schattenkönigs die Magie endlich in seine Welt zurückgekehrt. Diese war in frischen Farben erblüht, und in Hollands Volk war neue Hoffnung aufgekeimt.
Er hatte alles getan, was in seinen Kräften stand, alles gegeben, um seine Welt vor neuem Leid zu bewahren.
Osaron aber war unersättlich.
Der Schattenkönig wurde von Tag zu Tag stärker und dürstete nach dem Chaos der reinen Magie.
Und Holland verlor allmählich die Herrschaft über das Ungeheuer, das von ihm Besitz ergriffen hatte.
Und so spielte er seine allerletzte Karte aus: Er bot Osaron den Körper eines anderen als Gefäß an.
»Nun gut …«, antwortete der Dämon. »Doch sollte dein Versuch fehlschlagen, bist du endgültig mein.«
Holland stimmte dem Handel zu. Denn er hätte alles getan, um seine Stadt vor dem Verderben zu retten.
Aber Kell, der verwöhnte, unreife, starrköpfige Antari, weigerte sich, obwohl die Halsfessel seine Magie lähmte und ihm entsetzliche Qualen zufügte.
Der Schattenkönig hatte mit Hollands Lippen gelächelt. Der Weiße Antari wehrte sich mit aller Kraft, doch da der Pakt nun mal geschlossen war, hatte er keine Chance. Osarons Wille brandete in ihm auf und drängte ihn hinab in die dunklen Abgründe seiner selbst.
Und nun war er in seinem eigenen Körper gefangen, gebunden durch einen Handel, dazu verurteilt, hilflos dem Treiben eines Dämons zuzusehen. Und langsam, aber sicher zu vergehen.
»Holland!«
Kells Stimme brach, während er seinen geschundenen Körper gegen die Fesseln stemmte, so wie damals Holland, als der Weiße König ihn erstmals an das Foltergerüst gebunden hatte. Die Fesseln an Händen und Füßen raubten Kell den Großteil seiner Kräfte; das Halseisen schnitt ihn völlig von seiner Magie ab. Doch in seinen Augen stand immer noch Trotz.
»Holland, du Mistkerl, wehr dich endlich!«
Und Holland versuchte, gegen Osarons Willen anzukämpfen. Sein Körper gehörte ihm jedoch nicht mehr; und sein zutiefst erschöpfter Geist sank tiefer und immer tiefer …
Gib auf, raunte der Schattenkönig.
»Zeig mir, dass du kein Schwächling bist!«, konnte er Kells Stimme hören. »Dass dein Wille dir gehört!«
Hör auf dich zu wehren.
»Hast du dir den Weg zurück ins Leben erkämpft, um dich nun geschlagen zu geben?«
Ich habe dich besiegt.
»Holland!«
Fast hätten Kells Worte den Weißen Antari zu erneutem Widerstand angestachelt. Aber gegen Osarons gnadenlosen Willen war er machtlos.
Dann hörte Holland sich sprechen – nicht mehr mit seiner Stimme, sondern mit der des Ungeheuers, das von ihm Besitz ergriffen hatte. Und in seiner Hand sah er eine purpurrote Münze. Kell wehrte sich wild fluchend gegen seine Fesseln, bis er keuchend nach Luft rang und ihm das Blut über die Handgelenke strömte.
Doch jede Gegenwehr war vergeblich.
Wieder war Holland in seinem eigenen Körper gefangen. Kells Stimme drang durch das Dunkel zu ihm.
Dein alter Meister ist tot, und nun lässt du einen anderen über dich herrschen!
Hollands Körper bewegte sich, geführt von Osarons Willen, durch die Folterkammer. Dann fiel die Tür hinter ihm ins Schloss; Kells wütendes Rufen und seine Schmerzensschreie drangen nur gedämpft durch das Holz.
Draußen im Gang stand Ojka und schärfte ihre Messer. Als sie aufblickte, konnte Holland die halbmondförmige Narbe auf einer Wange sehen sowie ihre zweifarbigen Augen – ein gelbes und ein tintenschwarzes. Sie war eine Antari, ein Geschöpf von Osarons und Hollands Gnaden, mit dunkler Magie erschaffen.
»Majestät«, sagte sie und richtete sich auf.
Holland versuchte, mit seiner eigenen Stimme zu sprechen – aber es waren Osarons Worte, die aus seinem Mund kamen.
»Bewache die Tür. Lass niemanden hinein.«
Ein Lächeln huschte über Ojkas blutrote Lippen. »Zu Befehl, Majestät.«
Holland hastete durch den Palast und trat hinaus, unter den violetten Himmel, an den Statuen der Danes vorbei, die die Eingangstreppe flankierten, und weiter durch den Burghof, in dem nunmehr Bäume statt Steinfiguren wuchsen.
Was würde ohne Osaron, ohne ihn selbst aus seiner Welt werden?, fragte sich Holland. Würde seine Stadt weiter blühen? Oder zusammenbrechen wie ein Körper, den man des Lebensatems beraubt hatte?
Bitte, dachte er. Diese Welt braucht mich.
»Dein Flehen ist sinnlos«, antwortete Osaron laut. »Sie ist bereits tot. Wir werden eine andere Welt suchen, die unserer Stärke würdig ist.«
Als sie die Burgmauer erreichten, zog Osaron ein Messer aus einer Scheide an seiner Hüfte. Holland spürte nicht, wie die Klinge in sein Fleisch drang. Als der Dämon jedoch Hollands blutverschmierte Hand mit der purpurroten Münze gegen die Mauer drücken wollte, bäumte sich der Geist des Antari ein letztes Mal auf.
Selbst wenn es ihm nicht – noch nicht – möglich war, die Herrschaft über seinen ganzen Körper wiederzuerlangen, konnte er vielleicht einen kleinen Teil davon zurückerobern.
Wie zum Beispiel eine Hand.
Holland ließ jeden Funken Kraft, jedes bisschen Willen, das ihm noch verblieb, in seine fünf Finger fließen. Und tatsächlich verharrten sie kurz vor der Mauer in der Luft.
Blut lief ihm am Handgelenk hinunter. Holland kannte die Formel, die einen Körper zu Eis, Asche oder Stein werden ließ.
Er musste nur die Hand an seine Brust führen.
Musste nur der Magie Form verleihen …
Holland konnte spüren, wie sich Ärger in Osaron breitmachte, als sei Hollands letztes, großes Aufbegehren nur eine kleine Unannehmlichkeit.
Muss das wirklich sein?, raunte der Schattenkönig.
Holland kämpfte weiter und schaffte es tatsächlich, seine Hand einen, ja sogar zwei Zoll in Richtung seiner Brust zu bewegen.
Hör auf, Holland, warnte ihn der Dämon in seinem Kopf.
Mit dem letzten Funken seines Willens zwang der Antari seine Hand noch ein kleines Stück weiter auf sich zu.
Osaron seufzte.
Das hast du dir selbst zuzuschreiben.
Der Wille des Schattenkönigs traf Holland mit voller Wucht. Während er selbst völlig reglos dastand, wurde sein Geist von unerträglichem Schmerz überwältigt; einem Schmerz, der anders war als der, den er im Laufe seines Lebens schon Hunderte Male erfahren hatte; den er zu ignorieren gelernt hatte und vor dem er flüchten konnte. Dieser Schmerz drang vor bis in sein Innerstes, so dass jede Faser seines Körpers brannte und er schrie – bis ihn endlich die Dunkelheit überrollte und mit sich in die Tiefe zog.
Diesmal versuchte Holland nicht, dagegen anzukämpfen.
Sondern ließ sich in den Abgrund sinken.
III
Noch lange nachdem die Tür verriegelt worden war, wehrte Kell sich gegen die eisernen Fesseln; sein verzweifeltes Rufen hallte von den bleichen Steinwänden wider, bis er sich heisergeschrien hatte. Doch niemand kam. Angst durchflutete ihn. Schlimmer noch war aber das Gefühl, dass in seiner Brust etwas aufbrach, sich eine lebenswichtige Verbindung Faden für Faden löste und er einen wichtigen Teil seiner selbst verlor.
Er konnte Rhys Puls kaum mehr spüren.
Hatte jegliches Gefühl verloren – nur der Schmerz in seinen Handgelenken und die entsetzliche, betäubende Kälte blieben. Er wand sich in den Fesseln, doch diese hielten ihn unerbittlich fest. Auf dem Metallrahmen des Foltergerüsts waren Zaubersprüche eingraviert, und die Halsfessel schnitt ihn von dem ab, was ihn eigentlich ausmachte, seiner Magie. Das Eisen tauchte sein Inneres in tiefe Schatten, ließ seine Gedanken erstarren, bis ihn nur noch kaltes Grauen und tiefe Hoffnungslosigkeit erfüllten. Gib auf, flüsterte es in ihm. Du bist ein Nichts, ein Niemand, bist völlig machtlos.
Panik stieg in ihm auf.
Er musste einen Ausweg finden, musste sich von seinen Fesseln und dem Halseisen befreien und dieser Welt entfliehen.
Rhy hatte sich ins eigene Fleisch geritzt, um Kell zur Rückkehr zu bewegen; er aber hatte seinen Bruder, das Königshaus und die Stadt törichterweise erneut verlassen. War einer Unbekannten mit flammend rotem Haar in ihre Welt gefolgt, nur weil diese ihm weisgemacht hatte, er würde dort gebraucht, müsste seine Schuld begleichen.
Kells Herz stockte.
Oder war es das von Rhy? Erneut flammte Panik in Kell auf und vertrieb für einen Augenblick die tödliche Kälte. Er klammerte sich an den Hauch von Wärme, richtete sich auf, biss die Zähne zusammen und zerrte an den Handfesseln, bis er glaubte, die Knochen brechen zu hören. Als sich das Eisen ihm ins Fleisch bohrte, unterdrückte er einen Schrei. Trotz des gleißenden Schmerzes kämpfte er weiter gegen die Fessel, bis seine rechte Hand, blutüberströmt und fast bis zum Knochen aufgescheuert, endlich freikam.
Keuchend ließ Kell sich zurücksinken und versuchte sich mit seinen kraftlosen Fingern von der Halsfessel zu befreien. Sobald er das Metall berührte, durchfuhr eine nadelfeine Kälte seinen Arm und hinderte ihn am Denken.
»As Steno«, rief er flehend. Breche.
Doch nichts geschah. Die Magie in seinen Adern blieb stumm.
Kell ließ sich schluchzend in den Fesseln zurücksinken. Die Kammer fing an sich zu drehen, sein Blick verschwamm, seine Gedanken wollten ihm entgleiten. Mühsam richtete er sich auf und schluckte schwer. Dann packte er mit der verletzten Hand seinen anderen Unterarm und zog mit aller Kraft.
Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit, bis es ihm endlich gelang, sich zu befreien.
Er machte ein paar stolpernde Schritte nach vorn und schwankte. Die Metallfesseln hatten sich ihm tief, tief in die Handgelenke gegraben, und der helle Marmorboden der Kammer war blutgetränkt.
Ist das deins?, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf.
Und er erinnerte sich daran, wie Rhy damals mit entsetzter Miene die tiefen Schnitte in Kells Unterarmen und das Blut auf seiner eigenen Brust angestarrt hatte. Ist das alles deins?
Blut troff von dem Halseisen, während Kell fieberhaft daran zerrte. Mit kältestarren Fingern versuchte er verzweifelt, die Schließe zu öffnen. Vergeblich. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er rutschte in seinem eigenen Blut aus und fing sich mit verstümmelten Händen auf. Er krümmte sich schreiend zusammen, während er seinem Körper vergebens befahl, sich hochzurappeln.
Er musste aufstehen; musste in die Rote Stadt zurückkehren, um Holland und Osaron, den Schattenkönig, aufzuhalten.
Um seinen geliebten Bruder zu retten.
Er musste einfach.
All das schoss ihm durch den Kopf, und doch lag er reglos auf dem kalten Marmorboden, und sein Blut sammelte sich in einer warmen Lache um ihn.
IV
Der Prinz ließ sich zurück auf das Bett sinken, schweißgebadet und mit dem widerlich metallischen Geschmack von Blut im Mund. Um ihn herum erklang Stimmengewirr, sein Zimmer war von grellem Licht und Schatten durchwoben. Im Geiste stieß er einen gellenden Schrei aus, doch sein Mund war im Schmerz erstarrt; einem Schmerz, den er spürte, obwohl er nicht der seine war.
Kell!
Rhy krümmte sich und hustete Blut und Galle.
Erneut versuchte er sich aufzurichten – er musste endlich aufstehen, seinen Bruder finden –, aber aus der Dunkelheit streckten sich ihm Hände entgegen, drückten ihn mit sanfter Gewalt zurück auf die seidenen Laken. Und schon war der bösartige, schneidende Schmerz wieder da, als häute man ihn bei lebendigem Leibe und risse ihm das Fleisch von den Knochen. Verzweifelt durchforstete er sein Gedächtnis: Kell war verhaftet worden, aber seine Zelle stand leer; dann die Suche im sonnendurchdrungenen Obstgarten; fieberhaftes Rufen nach seinem Bruder; plötzlich, wie aus dem Nichts, ein entsetzlicher Schmerz, der sich ihm – wie in jener Nacht – gleich einem Messer in die Brust bohrte; dann das Gefühl zu ersticken …
Er konnte nicht mehr at…
»Bleib bei mir«, flehte eine Stimme.
»Verlass mich nicht. Bitte bleib bei mir …«
Rhy hatte den Unterschied zwischen Wunsch und Bedürfnis schon früh kennengelernt. Als Sohn und alleiniger Erbe der Maresh, Kronjuwel von Arnes, Zukunft des Reiches, war keins seiner Bedürfnisse je unerfüllt geblieben (wie ihm einst eine Kinderfrau mitgeteilt hatte, die daraufhin sofort aus den königlichen Diensten entlassen worden war). Schöne Kleider, Pferde, Musikinstrumente, Schmuck – jeder Wunsch wurde ihm von den Augen abgelesen.
Aber gab es etwas, das er sich innigst wünschte, das ihm jedoch niemand geben konnte. Etwas, das die meisten einfachen Bürger seines Landes in Hülle und Fülle besaßen, und was für seinen Vater, seine Mutter und Kell so selbstverständlich wie das Atmen war.
Rhy wünschte sich Magie; mit jeder Faser seines Seins.
Sein Vater, der König, war ein begabter Metallmagier, seine Mutter zeigte großes Geschick im Umgang mit Wasser; aber Magie wurde nicht vererbt wie die Haarfarbe oder der Status, sondern sie erwählte sich ihr Gefäß.
Und bereits im Alter von neun Jahren schien es, als besäße Rhy Maresh keinen Funken magischen Talents.
Doch der Prinz weigerte sich zu glauben, dass er leer ausgehen sollte; ganz bestimmt flackerte irgendwo in ihm ein magisches Flämmchen, das nur darauf wartete, durch einen günstigen Windhauch angefacht zu werden. Schließlich war er ein Prinz! Und so machte sich Rhy Maresh daran, die Magie, die zweifellos in ihm schlummerte, eigenhändig zu entflammen.
Folglich fand er sich eines schönen Tages auf dem Steinboden der zugigen alten Bibliothek des Heiligtums wieder. In seiner kunstvoll bestickten Seidenhose, die für das Leben im gut geheizten Palast gedacht war, fror es ihn.
Doch immer wenn Rhy sich über die niedrigen Temperaturen im Heiligtum beschwerte, legte Meister Thieren die Stirn in Falten.
Magie erschafft ihre eigene Wärme, pflegte der greise Hohepriester dann zu sagen. Schön und gut, wenn man sich auf diese Kunst verstand, was auf Rhy leider nicht zutraf.
Jedenfalls noch nicht.
Dieses Mal aber hatte Rhy sich nicht beschwert, hatte sich dem Hohepriester nicht einmal bemerkbar gemacht.
Der junge Prinz kniete in einer Nische ganz hinten in der Bibliothek, hinter einer Statue und einem langen Holztisch verborgen, und hatte ein Pergament vor sich auf dem Boden ausgebreitet.
Rhy war mit der Fingerfertigkeit eines Taschendiebs geboren worden, wobei er als Thronfolger natürlich nie von diesem Talent Gebrauch machen musste. Alle Welt las ihm jeden seiner Wünsche von den Augen ab, bot ihm eilfertig einen Mantel an, wenn ihn fröstelte, oder brachte ihm ein Stück Zuckerwerk aus der Hofküche, wenn ihn danach verlangte.
Doch um diese Pergamentrolle hatte Rhy den Hohepriester nicht gebeten, sondern sie von dessen Schreibtisch stibitzt, wie auch ein Dutzend anderer, die alle mit einem dünnen weißen Band verschnürt waren – als Zeichen, dass sie die Zaubersprüche eines Priesters enthielten. Aber zu Rhys Verdruss handelte es sich nur um simple Formeln für den Alltagsgebrauch.
Eine zum Frischhalten von Speisen, eine zum Schutz der königlichen Obstbäume vor Frost, eine für ewiges Feuer.
An jedem dieser Zaubersprüche versuchte sich Rhy, um endlich den passenden ausfindig zu machen, der seine schlummernde Magie zum Leben erwecken würde.
Ein Windstoß fuhr durch die Bibliothek, als der Prinz eine Handvoll roter Lin-Münzen aus seiner Tasche zog und das Pergament damit beschwerte. Darauf hatte der Hohepriester mit ruhiger Hand eine Art Karte gezeichnet. Sie besaß keinerlei Ähnlichkeit mit der im Kabinett seines Vaters, auf der das gesamte Reich Arnes eingezeichnet war. Nein, es handelte sich um ein magisches Diagramm, die Darstellung eines Zauberspruchs.
Ganz oben standen drei Worte in der gemeinen Sprache.
Is Anos Vol, las Rhy. Die ewige Flamme.
Darunter befanden sich zwei konzentrische Kreise, die durch zarte Linien miteinander verbunden und mit zahlreichen winzigen Buchstaben in der von den Londoner Flücheschmieden bevorzugten Kurzschrift übersät waren. Angestrengt versuchte Rhy die Worte zu entziffern. Er besaß ein natürliches Talent für Sprachen und beherrschte die geschmeidige Melodie des Faroanischen, den abgehackten Rhythmus der veskanischen Silben oder den Singsang der Grenzdialekte von Arnes geradezu meisterhaft. Aber die Worte auf dem Pergament schienen vor seinen Augen zu tanzen und zu verschwimmen.
Er kaute an seiner Unterlippe – eine schlechte Angewohnheit, die ihm seine Mutter vergebens abzugewöhnen versuchte, da sie einem Prinzen nicht zu Gesicht stand –, dann legte er beide Hände auf die Schriftrolle, wobei seine Fingerspitzen den äußeren der beiden Kreise berührten, und las die magische Formel laut vor.
Die Augen fest auf das Pergament gerichtet, sprach er Silbe für Silbe, die ihm jedoch nur unbeholfen und gebrochen über die Lippen kamen. Das Blut pochte ihm in den Ohren. Rhy ließ sich nicht beirren und versuchte, sich den Zauber durch die Kraft seines Willens zu unterwerfen; und als er sich dem Ende näherte, spürte er ein heißes Kribbeln in den Handflächen, das sich bis in die Fingerspitzen ausbreitete, und dann …
Nichts, kein Funken, nicht die kleinste Flamme.
Rhy wiederholte den Zauber wieder und immer wieder; aber das Kribbeln in seinen Händen verebbte, verwandelte sich in ein gewöhnliches Taubheitsgefühl. Niedergeschlagen verstummte er und ließ sich auf den kalten Steinboden zurücksinken. »Sankt«, murmelte er, obwohl er wusste, dass es sich für einen Prinzen nicht ziemte zu fluchen – schon gar nicht hier, im Londoner Heiligtum.
»Was tust du denn da?«
Rhy blickte auf. Sein Bruder stand in der Nischenöffnung. Um die schmalen Schultern trug er einen roten Mantel; und obwohl er noch nicht einmal elf Jahre alt war, hatte sein Gesicht den ernsthaften Ausdruck eines Erwachsenen, einschließlich der tiefen Falte zwischen den Brauen. Noch im morgendlichen Dämmerlicht glänzte sein rotes Haar; der Ausdruck seiner zweifarbigen Augen – eines blauen und eines tintenschwarzen – ließ alle den Blick abwenden. Rhy hatte das noch nie nachvollziehen können; er achtete deshalb besonders darauf, seinem Bruder stets ins Gesicht zu sehen, um ihm zu beweisen, dass dieses Auge ihm nichts ausmachte.
Nach einem Blick auf Rhys gerötete Wangen und das Pergament kniete Kell dem Prinzen gegenüber nieder, wobei sich sein Mantel fächerförmig um ihn breitete.
»Woher hast du das?«, fragte Kell mit einem Hauch von Unmut in der Stimme.
»Von Thieren«, antwortete Rhy. Auf Kells skeptischen Blick hin verbesserte er sich: »Aus seinem Arbeitszimmer.«
Der Antari überflog den Zauberspruch und runzelte die Stirn. »Eine ewige Flamme?«
Rhy nahm gedankenverloren einen der Lin, die das Pergament beschwerten, und zuckte mit den Achseln. »Das war das Erste, was mir in die Finger kam.« Es sollte klingen, als wäre ihm der Zauber völlig egal; doch es schnürte ihm die Kehle zu, und Tränen brannten ihm in den Augen. »Ist auch egal«, murmelte er und ließ die Münze über den Boden springen, als handle es sich um einen Kieselstein auf der Isle. »Ich bekomm’s ja doch nicht hin.«
Kell verlagerte sein Gewicht und las mit leisen Lippenbewegungen die Schrift des Priesters. Er hielt die Handflächen über das Pergament, als schütze er eine unsichtbare Flamme, und sprach die magische Formel. Während die Worte hart wie Stein über Rhys Lippen gepoltert waren, klangen sie aus Kells Mund melodisch und weich, fast wie ein Gedicht. Sofort erwärmte sich die Luft, Dampf stieg von den handgeschriebenen Zeilen auf, als die Tinte zu einem Tropfen Öl zusammenfloss und sich entzündete.
Und schon schwebte eine weißlodernde Flamme zwischen den Händen des Antari.
Bei Kell sah das so einfach aus! Rhy spürte, wie heißer Ärger in ihm aufstieg, um sofort wieder zu verebben. Schließlich war es nicht Kells Schuld, dass er selbst keinerlei magische Begabung besaß. Rhy wollte aufstehen, aber sein Bruder hielt ihn am Ärmel fest, nahm seine geöffneten Hände und führte sie an die Flamme heran, bis Kells Magie sie beide umhüllte. Rhys Handflächen begannen von der Hitze zu kribbeln, und in ihm kämpfte die Freude mit der Enttäuschung darüber, dass die Magie nicht von ihm stammte.
»Das ist ungerecht«, murmelte er. »Ich bin der Kronprinz von Arnes und noch nicht einmal in der Lage, eine verflixte Kerze anzuzünden.«
Kell biss sich auf die Lippe – er wurde von seiner Ziehmutter nie dafür getadelt –, dann sagte er: »Es gibt verschiedene Arten von Macht.«
»Ich wäre lieber ein richtiger Magier als ein König«, gab Rhy mürrisch zurück.
Kell betrachtete die kleine weiße Flamme, die zwischen ihnen schwebte. »Die Macht eines Königs ist doch auch eine Art von Magie. Während ein Magier die Elemente beherrscht, herrscht ein König über ein ganzes Reich.«
»Aber nur, wenn er stark genug ist.«
Jetzt sah Kell ihn an. »Du wirst ein guter König sein, wenn du dich bis dahin nicht selbst ins Grab gebracht hast.«
Rhy atmete hörbar aus und brachte das Flämmchen zum Flackern. »Woher willst du das wissen?«
Kell lächelte. Das geschah so selten, dass Rhy den Moment nur zu gerne festgehalten hätte. Schließlich war er der Einzige, der dem Antari ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnte, worauf er sehr stolz war. Aber als dieser antwortete: »Magie, wie denn sonst«, hätte Rhy ihm am liebsten einen Kinnhaken verpasst.
»Idiot«, murmelte er und versuchte, sich dem Griff seines Bruders zu entziehen. Doch Kell hielt ihn fest.
»Bleib hier.«
»Lass mich los«, forderte Rhy zunächst noch unbekümmert. Als die Flamme jedoch heiß zwischen seinen Händen aufloderte, wiederholte er in ernstem Ton: »Lass mich los! Du tust mir weh!«
Hitze umzüngelte seine Finger, weißglühender Schmerz schoss ihm an Händen und Armen empor.
»Hör auf!«, flehte er. »Bitte, Kell, hör auf!« Als der Prinz den Blick von der grellen Flamme zum Gesicht seines Bruders hob, sah er nur einen dunklen Abgrund. Rhy keuchte und versuchte sich dem Griff zu entziehen. Aber statt Kell saß ihm nun ein Wesen aus Stein gegenüber, dessen starre Hände seine Arme wie Fesseln umschlossen.
Das kann nicht wahr sein, dachte Rhy. Bestimmt ist das nur ein böser Traum! Doch die Hitze des Feuers und der Druck um seine Handgelenke wurden mit jedem Herzschlag und Atemzug schlimmer.
Die Flamme vor ihm wurde ganz lang und dünn wie eine Klinge aus Licht, die zur Decke emporragte; dann richtete sie sich mit entsetzlicher Langsamkeit auf Rhy. Der Prinz wehrte sich schreiend, versuchte zu entkommen – aber vergeblich. Schon bohrte sich ihm das Flammenmesser tief in die Brust.
Schmerz durchschoss ihn.
Mach, dass es aufhört!
Das heiße Stechen durchfuhr seinen Brustkorb, drang gleißend in jede Faser seines Körpers, ließ sein Herz in Flammen stehen. Als Rhy zu schreien versuchte, hustete er Rauch. Seine Brust war eine einzige lodernde Wunde.
Kells Stimme drang nicht aus dem Mund des steinernen Wesens an sein Ohr, sondern aus weiter Ferne, wurde immer schwächer. Verlass mich nicht.
Es tat so weh, so schrecklich weh!
Hör auf!
Rhy verbrannte von innen heraus.
Bitte!
Er starb.
Bleib!
Starb ein zweites Mal.
Aus dem Dunkel schälten sich unvermittelt die bunten Streifen breiter Deckenbehänge, dann erblickte er durch den Tränenschleier ein vertrautes Gesicht neben sich, mit sturmblauen Augen, die ihn angstvoll musterten.
»Luc?«, flüsterte Rhy heiser.
»Ich bin da«, antwortete Alucard. »Ich bin bei dir. Verlass mich nicht.«
Der Prinz versuchte zu sprechen, aber sein Herz hämmerte so heftig, als wollte es den Brustkorb sprengen.
Dann schlug es mit doppelter Kraft, nur um anschließend ganz auszusetzen.
»Hat man Kell gefunden?«, ertönte eine Stimme.
»Lasst mich allein«, befahl eine andere.
»Verlasst alle den Raum, und zwar sofort!«
Wieder wurde Rhy schwarz vor Augen.
Der Raum begann zu schwanken, die Stimmen wurden dumpf. Der weißglühende Schmerz verwandelte sich in entsetzliche Kälte, doch sein Körper bäumte sich dagegen auf, kämpfte gegen das unausweichliche Ende an …
Nein!, flehte er, während er schon spürte, wie ein Strang des Siegels nach dem anderen zerriss, bis ihn nichts mehr mit dem Leben verband.
Dann verschwand auch Alucards Gesicht und mit ihm das ganze Zimmer.
Dunkelheit umschlang den Prinzen mit gierigen Armen und zog ihn mit sich in die Tiefe.
V
Niemals zuvor hatte Alucard Emery sich so hilflos gefühlt.
Erst vor wenigen Stunden hatte er das Essen Tasch gewonnen und war zum besten Magier der drei Reiche gekürt worden. Doch jetzt, während er am Bett des Prinzen saß, fühlte er sich ohnmächtig, wusste nicht, wie er ihm helfen, ihn retten könnte.
Alucard musste zusehen, wie Rhy sich mit leichenblassem Gesicht auf dem zerwühlten Bett krümmte und vor Schmerzen schrie, in den Fängen einer unsichtbaren Macht, gegen die nicht einmal Alucard ankam. Dabei wäre er bis ans Ende der Welt gegangen, um den Prinzen zu retten. Aber das, was Rhy unaufhaltsam tötete, befand sich außerhalb seiner Reichweite.
»Was geschieht mit ihm?«, hatte er wieder und immer wieder gefragt. »Was kann ich tun?«
Da niemand ihm antwortete, musste er sich aus dem Flehen der Königin, den Befehlen des Königs, Lilas eindringlichen Worten und dem fernen Rufen der Soldaten, die überall nach dem Antari suchten, selbst die Antwort zusammenreimen.
Alucard beugte sich vor und nahm die Hand des Prinzen fest in die seine, während die magische Aura, die Rhy umgab, immer durchscheinender wurde und sich aufzulösen drohte.
Wo die Augen anderer nur Licht, Schatten und Farben sehen konnten, war Alucard Emery Zeit seines Lebens fähig, das Wirken der Magie, die Muster, die sie in der Luft wob, zu erkennen; nicht nur die Aura eines Zaubers, den Nachhall eines Fluchs, sondern auch die Farben der wahren Magie, die in den Adern anderer Menschen floss. Alle konnten den roten Schimmer der Isle sehen, doch für Alucard war die ganze Welt in ein prächtiges Farbenspiel getaucht. Die natürlichen Quellen der Magie leuchteten in tiefstem Rot; Elementarmagier wurden von einer grünblauen Aura umhüllt; Flüche färbten die Luft in düsterem Violett; starke Zauber glühten golden. Und die Blutmagie der Antari? Sie erstrahlte in einem dunklen, aber schillernden Licht, als wären sämtliche Farben, natürliche wie unnatürliche, miteinander verschmolzen und umspönnen ihre Körper mit zarten, seidenschimmernden Fäden.
Nun musste Alucard mitansehen, wie die magische Aura des Prinzen, der noch immer zusammengekrümmt dalag, zerfaserte und zu ersterben drohte.
Dieser Anblick war nach wie vor befremdlich, denn das bisschen Magie, das Rhy besaß, hatte früher in einem dunklen Grün geleuchtet. Aber bei ihrem ersten Wiedersehen nach drei Jahren, die der Kapitän auf hoher See verbracht hatte, war ihm die Veränderung sofort aufgefallen. Nicht nur der kantigere Unterkiefer, die breiteren Schultern oder die ungewohnten Schatten unter den Augen. Nein, die Aura, die Rhy umgab, hatte sich verändert. Magie war etwas Lebendiges, ewig in Bewegung Begriffenes, das dem Auf und Ab im Dasein ihres Trägers folgte. Diese neue Magie aber umschloss den Körper des Prinzen wie ein starrer Kokon, fest gesponnen aus tausend Fäden.
Die allesamt schillerten wie Öl auf einer Pfütze, wie geschmolzenes Metall in der Sonne.
Als er wenige Tage zuvor im Zimmer des Prinzen dessen Schulter entblößt hatte, um sie zu küssen, hatte er sehen können, wo die silbrig schimmernden Fäden mit der verschlungenen Narbe über Rhys Herzen verschmolzen. Alucard brauchte nicht nach dem Urheber dieses Zaubers zu fragen – es konnte niemand anders als Kell sein, der königliche Antari. Aber der Kapitän wusste nicht, wie dieser das zuwege gebracht hatte. Normalerweise konnte Alucard jeden Zauber verstehen, indem er sein Webmuster nachvollzog. Doch das, was er hier sah, besaß keinen Anfang und kein Ende – die Fäden von Kells Magie drangen tief in Rhys Herz, wo sie sich seinem Blick entzogen.
Und dieser starre, widerständige Zauber schien sich jetzt aufzulösen.
Ein Faden nach dem anderen zerriss wie unter einem unsichtbaren Gewicht, und Mal für Mal keuchte der halb bewusstlose Prinz auf. Jede Faser des Bandes, das …
Aber natürlich!, dachte Alucard plötzlich. Das ist weit mehr als ein einfacher Zauber, sondern eine Verbindung – mit Kell!
Der Kapitän wusste nicht, warum Rhys Leben und das des Antari aneinandergeschmiedet waren, wollte auch gar nicht darüber nachdenken. Aber während er die Narbe auf Rhys bebender Brust betrachtete, breit wie eine Dolchklinge, überkam ihn die Erkenntnis und mit ihr eine Woge von Übelkeit und Hilflosigkeit. Nun, da das Band zu zerreißen drohte, tat Alucard das Einzige, was ihm blieb.
Mit der Hand des Prinzen in der seinen versuchte er, die ersterbende Aura des Prinzen zu heilen, als könnte das sturmblaue Leuchten seiner Magie sich mit dem Schillern derjenigen Kells verbinden und ihr neues Leben einhauchen. Alucard betete zu jeder ihm bekannten Macht, jedem Heiligen, Priester und Gesegneten, ob er nun an sie glaubte oder nicht, ihm Stärke zu schenken. Und als keine Antwort kam, wandte er sich an Rhy. Er flehte ihn nicht an, durchzuhalten und stark zu sein. Sondern er sprach von ihrer beider gemeinsamen Vergangenheit.
»Kannst du dich noch an die Nacht erinnern, bevor ich damals gegangen bin?« Alucard bemühte sich, die Angst in seiner Stimme zu unterdrücken. »Bis heute hast du meine Frage nicht beantwortet.«
Alucard schloss die Lider, um die Erinnerung heraufzubeschwören und Rhys Qual nicht mehr mitansehen zu müssen.
Damals war Sommer, und sie lagen im Bett, die warmen Körper ineinander verschlungen. Alucard streichelte Rhys makellose Haut, und als dieser sich im Bewusstsein seiner Schönheit räkelte, flüsterte er: »Ich werde dich noch lieben, wenn du eines Tages alt und runzlig bist.«
»Ich werde nie alt sein«, antwortete der Prinz mit der Selbstgewissheit der Jungen, Gesunden und zutiefst Naiven.
»Du willst wohl jung sterben?«, hatte Alucard gespottet, woraufhin Rhy elegant mit den Achseln gezuckt hatte. »Oder ewig leben.«
»Ach wirklich?«
Der Prinz strich sich eine dunkle Locke aus dem Gesicht. »Sterben ist so schrecklich banal.«
»Und darf ich fragen«, meinte Alucard und stützte sich auf einen Ellbogen, »wie du das anstellen willst?«
Anstatt zu antworten, zog Rhy ihn an sich und beendete die Unterhaltung mit einem Kuss.
Und nun lag er bebend auf seinem Bett und seufzte mit zusammengebissenen Zähnen. Die schweißnassen, schwarzen Locken klebten ihm an der Stirn. Die Königin rief nach einem Tuch, nach dem Hohepriester, nach Kell. Alucard umklammerte die Hand des Geliebten.
»Es tut mir leid, dass ich dich verlassen habe. So schrecklich leid! Aber jetzt bin ich hier, jetzt darfst du nicht mehr sterben!«, flüsterte er mit brechender Stimme. »Das wäre unfassbar unhöflich von dir, nachdem ich so weit gereist bin, nur um dich zu sehen.«
Alucard spürte, wie der Griff des Prinzen fester wurde, als ein Krampf seinen Körper schüttelte. Dann hob und senkte sich seine Brust in einem letzten, qualvollen Seufzer.
Und er lag still.
Einen Moment lang war Alucard erleichtert, dass Rhy nun endlich schlief. Alles schien, für diesen einen, kurzen Augenblick, in Ordnung zu sein …
Bis die Illusion zerbrach.
Irgendjemand schrie entsetzt auf. Die Priester drängten zum Bett; die Soldaten versuchten, Alucard vom Bett wegzuzerren.
Alucard starrte fassungslos auf den Prinzen hinunter.
Dann entglitt Rhys Hand der seinen und fiel zurück auf das Bett.
Die letzten Silberfäden des Siegels lösten sich und glitten von der Brust des Prinzen wie seidene Laken im Sommer.
Dann hörte Alucard sich schreien.
Und versank im Dunkel des Vergessens.
VI
Einen grauenvollen Augenblick lang gab es Lila Bard nicht mehr.
Ihr Körper löste sich in unzählige Fäden auf, die sich unendlich dehnten, zu zerreißen drohten, während sie aus der Roten Welt, aus ihrem Leben, ins Nichts trat. Dann taumelte sie ebenso plötzlich nach vorn, auf eine Straße hinaus.
Ihr entrang sich ein kurzer Schrei, als sie mit bebenden Gliedern und dröhnendem Kopf auf dem Pflaster landete.
Der Boden unter ihr – dass es überhaupt einen Boden gab, war ein gutes Zeichen! – fühlte sich rau und kalt an. In der Luft lag Schweigen; das Krachen des Feuerwerks und die Musik waren verstummt. Lila rappelte sich hoch und wischte das Blut ab, das ihr von Fingern und Nase troff. Als sie ihr Messer zog und an die eiskalte Mauer zurückwich, fielen rote Tropfen zu Boden. Sie erinnerte sich an ihren letzten Besuch in der Weißen Stadt, an die hungrigen Augen der nach Magie gierenden Männer und Frauen.
Dann erregte ein fröhlicher Farbschein ihre Aufmerksamkeit, und sie hob den Blick.
Der Himmel über ihr erstrahlte im Pink, Violett und Rotgold eines Sonnenuntergangs. Dabei war das Weiße London, das sie kannte, grau und farblos! Eine Schrecksekunde lang fürchtete Lila, sie könnte in einer anderen Stadt und einer anderen Welt gelandet sein, die noch weiter von ihrem Zuhause – falls sie überhaupt noch so etwas besaß – entfernt lag.
Aber nein; Lila erkannte die Straße, auf der sie stand, und die spitzen Türme der königlichen Burg, die vor der untergehenden Sonne gen Himmel ragten. Sie war in der Weißen Stadt, auch wenn sie kaum mehr wiederzuerkennen war. Erst vor vier Monaten hatte sie gemeinsam mit Kell die Dane-Zwillinge besiegt, die grausamen Herrscher einer Welt aus Eis, Asche und kaltem weißen Stein. Und jetzt … jetzt spazierte ein Mann an ihr vorbei, dessen Gesicht nicht etwa das starre Grinsen eines Hungerleiders zeigte, sondern das zufriedene Lächeln derer, die über Magie in Hülle und Fülle verfügten.
Irgendetwas stimmte hier nicht!
Im Laufe der letzten vier Monate hatte Lila gelernt, wenn auch nicht den Zweck, so doch die Präsenz von Magie zu erspüren. Und obwohl sie nicht Alucards Fähigkeit besaß, ihre Farben zu sehen, konnte sie sie jetzt bei jedem Atemzug schmecken: Schwer und beinahe ekelerregend süß lag sie in der Abendluft.
Was zum Teufel war hier los?
Und wo steckte Kell?
Da Lila wusste, wo sie sich befand, folgte sie der hohen Mauer um eine Ecke, bis sie vor dem Burgtor stand. Die schmiedeeisernen, von Efeu umrankten Flügel standen weit offen. Lila blieb wie angewurzelt stehen. Statt der steinernen Statuen wuchsen im Innenhof echte Bäume gen Himmel; und die Eingangsstufen zur Festung wurden von Soldaten in schimmernden Rüstungen flankiert, die einen überaus lebendigen Eindruck machten.
Irgendwo da drinnen musste Kell sein. Zwischen ihr und dem Antari gab es eine fadenzarte, dabei merkwürdig starke Verbindung. Lila wusste nicht genau, was sie da aneinanderschmiedete – war es Magie? oder etwas ganz anderes? –, aber es zog sie wie ein mächtiger Magnet in Richtung Schloss. Sie versuchte, nicht an das zu denken, was vor ihr lag, daran, wie weit sie gehen, wie viele Gegner sie besiegen musste, bis sie ihn endlich fand.
Gab es nicht einen Blutzauber, um jemanden zu finden?
Lila versuchte fieberhaft, sich an die magische Formel zu erinnern. As Travars öffnete eine Pforte zwischen zwei Welten, As Tascen eine Tür zwischen zwei Orten derselben Welt. Doch womit ließ sich eine Person aufspüren?
Zu blöd, dass sie Kell nie nach der Formel gefragt hatte. Der Antari hatte ihr erzählt, wie er vor vielen Jahren Rhy gefunden hatte, der entführt worden war. Wie war ihm das gelungen? Hatte er nicht einen Gegenstand benutzt, den Rhy selbst angefertigt hatte? Richtig, ein kleines Holzpferd! Dann fiel ihr das Taschentuch ein – ihr Taschentuch –, mit dessen Hilfe Kell sie in ihrer Dachkammer im Steinwurf gefunden hatte. Aber sie trug nichts dergleichen bei sich, keine Münze und auch keinen anderen Gegenstand.
Lila unterdrückte ihre wachsende Panik.
Auch wenn ihre Taschen leer waren – bestimmt bewahrten nicht nur Gegenstände die Aura eines Menschen; da waren auch noch Worte und … Erinnerungen.
Und davon hatte Lila jede Menge.
Sie legte ihre blutige Hand auf das Burgtor und spürte, wie die eisige Kälte des Metalls in die oberflächliche Wunde drang, während sie fest die Augen schloss und das Bild Kells heraufbeschwor. Sie dachte an die Nacht ihrer ersten Begegnung, als sie ihn in einer dunklen Gasse bestohlen hatte und er kurz darauf durch die Wand in ihr Zimmer spaziert war; daran, wie sie diesen Wildfremden an ihr Bett gefesselt und kurz danach erstmals Magie in den Händen gehalten hatte; entsann sich des Versprechens von Freiheit und der Angst, Kell könnte sie in ihrer Welt zurücklassen. Aber der Antari hatte sie mitgenommen, in die Rote Stadt, wo sie sich gemeinsam vor Holland verborgen, den verschlagenen Hehler Fletcher überlistet und schließlich gegen den falschen Prinzen Rhy gekämpft hatten. Das Chaos im Roten Palast, die anschließende Schlacht im Weißen London, Kells geschundener Körper im Krös Mekt, eng an den ihren geschmiegt; ihre Lebenswege, die sich trennten und wieder vereinten. Verwegene Maskenspiele und eine erneute Umarmung; seine heiße Hand auf ihrer Hüfte beim Tanz, seine brennenden Lippen auf den ihren und ihre eng aneinandergepressten Leiber auf der Veranda des Soner Rast; die schreckliche Hitze und dann, viel zu schnell, die Kälte danach; ihr Zusammenbruch in der Arena, und Kells Zorn, den er ihr wie eine Waffe entgegenschleuderte, bevor er ihr den Rücken zukehrte, bevor sie ihn gehen ließ.
Jetzt aber holte sie ihn sich zurück.
Lila biss die Zähne zusammen und wappnete sich gegen den Schmerz, der sie erwartete.
Sie hielt die Bruchstücke ihrer Erinnerung fest wie Kleinode, presste sie zusammen mit ihren Händen auf die Mauer und sprach die Blutformel: »As Tascen Kell.«
Der Stein erbebte, die Welt wich zurück, als Lila von der Straße in einen mit weißem Marmor verkleideten Korridor der Weißen Burg trat.
Fackeln brannten in Halterungen entlang der Wände, in der Ferne hallten Schritte. Lila gönnte sich einen winzigen Augenblick der Genugtuung, ja der Erleichterung, bis sie merkte, dass Kell nirgends zu sehen war. Ihr dröhnte der Kopf, und ein Fluch lag ihr auf den Lippen, als hinter einer Tür zu ihrer Linken ein erstickter Schrei erklang.
Das Blut gefror ihr in den Adern.
Das musste Kell sein! Sobald sich ihre Finger um den Türgriff schlossen, hörte sie das leise Pfeifen von Metall in der Luft. Hastig wich sie zur Seite, und dort, wo sie eben noch gestanden hatte, bohrte sich ein Messer in das Holz. Vom Griff der Klinge zog sich eine schwarze Schnur durch die Luft. Lila drehte sich um und sah, dass die Schnur zu einer Frau in einem schneeweißen Umhang führte. Über die Wange der Unbekannten zog sich eine Narbe. Viel ungewöhnlicher war jedoch ihr magisches Auge, dessen Schwärze sich wie vergossenes Wachs über eine Wange hinunter bis zum Hals sowie die Stirn hinauf erstreckte. Ihr Haar leuchtete röter als Kells Mantel, röter noch als die Isle und schien sie wie eine Flamme zu umlodern, mit einer Intensität, die zu grell war für die Weiße Welt – zumindest in ihrer früheren Form. Wieder spürte Lila, dass hier irgendetwas nicht stimmte, etwas Tiefgreifenderes als die leuchtenden Farben und das magische Auge der Unbekannten.
Die Frau erinnerte Lila nicht an Kell und auch nicht an Holland, sondern an den schwarzen Stein, den Vitari – dessen merkwürdige Anziehungskraft und geheimnisvolles Vibrieren.
Eine rasche Bewegung des Handgelenks – und schon hielt die Fremde ein zweites Messer in ihrer Linken, das am anderen Ende der schwarzen Schnur befestigt war. Ein kurzer Ruck, und die erste Klinge löste sich aus dem Türblatt und wirbelte, anmutig wie ein Vogel, zurück in ihre rechte Hand.
Nicht übel, dachte Lila. Sie fragte: »Und wer zum Teufel seid Ihr?«
»Ich bin eine Botin«, erwiderte die Frau, auch wenn Lila ihr die Assassinin an der Nasenspitze ansah. »Und Ihr?«
Lila zückte zwei ihrer Messer. »Ich bin eine Diebin.«
»Ich darf Euch nicht einlassen.«
Lila stellte sich mit dem Rücken gegen die Tür und spürte hinter sich den verebbenden Puls von Kells Magie. Halte durch, dachte sie verzweifelt. Sie sagte: »Ihr könnt ja versuchen, mich aufzuhalten.«
»Wie heißt Ihr?«, fragte die Fremde.
»Was geht Euch das an?«, gab Lila zurück.
Die Frau in Weiß antwortete mit einem verschlagenen Grinsen: »Mein König wird wissen wollen, wen ich …«
Noch bevor sie den Satz vollenden konnte, ließ Lila eines ihrer Messer durch die Luft schnellen; und als die Fremde abwehrend eine Hand hob, stieß Lila mit dem zweiten Dolch zu. Doch schon kam eine Klinge auf sie zugeschwirrt und zwang sie, zur Seite zu hechten. Sie wirbelte sogleich um die eigene Achse, bereit zum Gegenangriff, aber wieder schwirrte eine Klinge mit tödlicher Präzision auf sie zu. Die Schnur, die die Messer miteinander verband, war elastisch, und die Frau beherrschte ihre Klingen wie Jinnar den Wind, Alucard das Wasser oder Kisimyr Vasrin das Element Erde. Von ihrem Willen getrieben, bewegten sich die Messer ebenso kraftvoll wie elegant. Und zu allem Überfluss kämpfte die rothaarige Unbekannte mit der atemberaubenden Grazie einer Tänzerin.
Einer Tänzerin mit zwei äußerst scharfen Klingen.
Lila duckte sich, als das erste Messer ganz knapp an ihrem Gesicht vorbeizischte. Mehrere Strähnen ihres dunklen Haars segelten zu Boden. Schneller und immer schneller kamen aus ständig neuen Richtungen die silberglänzenden Klingen auf sie zugeschnellt, so dass sie größte Mühe hatte, ihnen auszuweichen.
Lila hatte schon so manchen Kampf mit dem Messer ausgefochten, hatte die meisten sogar selbst angezettelt. Sie verstand sich bestens darauf, die Schwachstellen ihres Gegners auszumachen und unter seiner Deckung hindurchzuschlüpfen, ihn durch Finten so lange zu reizen, bis sich ihr die Möglichkeit zum Stoß bot. Dieser Kampf gehorchte jedoch ganz anderen Regeln.
Wie sollte sie eine Gegnerin besiegen, deren Messer wie Vögel durch die Luft schwirrten?
Nicht anders als jeden anderen auch, sagte sie sich: Mit Schnelligkeit und allen schmutzigen Tricks. Schließlich ging es nicht darum, eine gute Figur zu machen, sondern nur darum, am Leben zu bleiben.
Die Klingen der Unbekannten stießen zu wie Giftschlangen, plötzlich und todbringend. Ihre Art des Kampfes barg jedoch einen entscheidenden Nachteil: Eine einmal geworfene Klinge musste auf ihrem Kurs bleiben, während ein mit der Hand geführtes Messer jederzeit unvermittelt zustechen konnte.
Lila täuschte eine Bewegung nach rechts an. Sobald eine Klinge auf sie zuschnellte, sprang sie jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Und als die zweite geflogen kam, duckte Lila sich, so dass beide Klingen fehlgehen mussten.
»Jetzt hab ich dich«, knurrte sie und hechtete auf die Frau zu. Aber zu ihrem großen Entsetzen änderten die Messer plötzlich doch ihre Flugrichtung, weshalb sie sich nur durch einen hektischen Sprung zur Seite retten konnte. Die Klingen schlugen Funken auf dem Marmorboden, wo Lila noch vor einer Sekunde gekauert hatte.
Aber natürlich, das rothaarige Biest war bestimmt eine Metallmagierin!
Blut lief an Lilas Arm hinab, tropfte ihr von den Fingern. Da war sie nicht schnell genug gewesen.
Wieder eine rasche Bewegung des Handgelenks, und schon surrten die Klingen zurück in die Hände der Frau.
»Namen sind wichtig«, sagte sie, während sie die Schnur aufwickelte. »Ich heiße Ojka, und mein König hat mir befohlen, niemanden einzulassen.«
Durch die Tür drang ein frustrierter Schrei Kells, gefolgt von schmerzerfülltem Stöhnen.
»Mein Name ist Lila Bard«, antwortete sie und zückte ihr Lieblingsmesser, »und was dein König sagt, ist mir egal.«
Ein Lächeln glitt über Ojkas Gesicht, dann ging sie zum Angriff über.
Diesmal zielte Lila nicht auf den Körper der Frau, auch nicht auf die Klinge, die auf sie herabfuhr, sondern auf die straff gespannte Schnur. Schon berührte ihr Messer die schwarzen Fasern und …
Ojka war jedoch unglaublich flink. Bevor Lila den elastischen Faden durchtrennen konnte, schnellte er wieder zurück in die Hände der rothaarigen Kämpferin.
»Nein«, knurrte Lila und packte die Schnur mit bloßer Hand. Überraschung blitzte in Ojkas Augen auf, und Lila stieß einen leisen Jubelruf aus. In diesem Moment durchfuhr ein scharfer Schmerz ihr Bein. Eine dritte – kurze und höllisch scharfe – Klinge hatte sich ihr in die Wade gebohrt.
Lila keuchte und geriet ins Taumeln. Blut spritzte auf den bleichen Steinboden, als sie das Messer aus ihrem Fleisch zog und sich wieder aufrichtete.
Hinter der Tür schrie Kell in höchster Pein.
In der Nachbarwelt rang Rhy mit dem Tod.
Lila hatte keine Zeit für solche Spielchen.
Sie zog ihre Klingen übereinander, so dass Funken sprühten und Flammen an den Schneiden entlangzügelten. Die Luft im Korridor flirrte vor Hitze, und als Ojka wieder ein Messer auf sie zuschwirren ließ, setzte Lila die schwarze Schnur in Brand. Die Flamme fraß sich an den Fasern entlang, und Ojka wich zurück. Noch bevor das Feuer ihre Hand erreichte, zerriss die Schnur, und das Messer klirrte nutzlos zu Boden. Die todbringende Tänzerin war aus dem Rhythmus geraten. Mit zornsprühenden Augen sprang Ojka mit nurmehr einer Klinge bewaffnet auf Lila zu.
Noch immer bewegte sich die rothaarige Kämpferin mit der entsetzlichen Eleganz eines Raubtiers. Als Lila einem Messerhieb durch einen Sprung nach hinten auswich, fiel sie rückwärts über einen kniehohen Stuhl. Die Flammen in ihren Händen verloschen. Und noch bevor sie den Boden berührte, hatte sich das rothaarige Biest schon auf sie geworfen und zielte mit dem Messer auf ihre Brust.
Lila riss die Arme hoch, um den Stoß abzuwehren. Metall traf klirrend auf Metall, als die Hefte der beiden Messer sich ineinander verhakten. Ein böses Lächeln kräuselte Ojkas Lippen, während der Stahl ihrer Waffe plötzlich länger wurde und sich in einen schmalen, spitzen Dorn verwandelte, der sich auf Lilas rechtes Auge zubewegte …
Lilas Kopf wurde von dem Stoß seitwärts gedreht; Glas knirschte, und ein scharfes Klirren drohte ihr den Schädel zu sprengen. Dann rutschte die Klinge an ihrem Glasauge ab und hinterließ einen tiefen Kratzer im Marmorboden des Korridors. Ein Blutstropfen lief wie eine purpurne Träne an Lilas Wange hinunter, wo das Messer ihr die Haut aufgeritzt hatte.
Sie blinzelte wütend.
Das Miststück hatte versucht, ihr ein Auge auszustechen.
Und hatte zum Glück das falsche erwischt.
Ojka starrte in momentaner Verwirrung auf Lila hinunter.
Dieser eine Augenblick reichte Lila. Sie zeichnete mit ihrer Klinge, die sie noch immer vor sich erhoben hielt, eine blutrote Linie auf den Hals ihrer Gegnerin.
Ojkas Mund schnappte auf und zu, wie ein groteskes Spiegelbild der klaffenden Öffnung, aus der das Blut sprudelte. Sie glitt neben Lila zu Boden, die Finger auf die Wunde gepresst; aber diese war tödlich.
Die Metallmagierin zuckte noch ein letztes Mal und lag still. Lila schob sich rückwärts aus der stetig größer werdenden Blutlache; ihre verwundete Wade brannte, und ihr Schädel dröhnte.
Mit einer Hand vor dem zerstörten Auge rappelte sie sich auf. Dann zog sie ihr anderes Messer aus einem Fackelhalter heraus und stolperte, eine Blutspur hinterlassend, zur Tür. Von der anderen Seite war kein Laut mehr zu hören. Sie drückte die Klinke, aber der Weg war ihr versperrt.
Bestimmt gab es einen Zauber, um Schlösser zu öffnen; da Lila ihn nicht kannte und sie zu erschöpft war, um zu elementarer Magie zu greifen, trat sie stattdessen mit letzter Kraft die Tür ein.
VII
Kell starrte an die Decke empor. Die Welt war unendlich fern und schien ihm mit jedem Atemzug weiter zu entgleiten.
Plötzlich riss ihn eine Stimme – Lilas Stimme! – wie ein Rettungsanker zurück an die Oberfläche seines Seins.
Er keuchte und versuchte sich aufzusetzen; vergeblich. Schmerz durchfuhr ihn, als es ihm endlich gelang, sich hinzuknien. Wie aus weiter Ferne hörte er Holz unter Stiefeltritten zersplittern und ein Schloss zerbersten. Als die Tür schließlich aufschwang, stand er schwankend auf beiden Beinen, und da sah er sie, einen scharfen Schatten im Gegenlicht. Doch schon vernebelte sich sein Blick erneut, und sie schien wie ein Geist auf ihn zuzugleiten.
Kell machte einen unsicheren Schritt nach vorn, woraufhin er in der Blutlache auf dem Boden ausrutschte. Schreck und Schmerz ließen ihm kurz die Sinne schwinden. Er spürte, wie die Beine unter ihm nachgaben, dann umfingen warme Arme seine Taille.
»Keine Sorge, ich hab dich«, keuchte Lila und ließ sich mit ihm zu Boden sinken. Kells Kopf sackte an ihre Schulter, und er stammelte mit heiserer Stimme irgendetwas in ihren Mantel. Als sie ihn nicht verstand, griffen seine blutverschmierten, verstümmelten Hände kraftlos nach dem Halseisen.
»Nimm’s mir … ab«, würgte Kell hervor.
Lilas Blick – was war nur mit ihren Augen los? – glitt zu der Fessel, dann packte sie mit beiden Händen zu. Sie fauchte, als ihre Finger das Metall umschlossen, ließ aber nicht los, sondern tastete mit schmerzverzerrtem Gesicht, bis sie die Schließe in Kells Nacken fand. Sobald sie sich öffnete, schleuderte sie das Eisen beiseite.
Sofort flutete Luft in Kells Lungen, Hitze durchfloss seinen Körper. Einen Augenblick lang vibrierte jede seiner Nervenzellen – erst vor Schmerz, dann aufgrund der Magie, die ihn wie ein elektrischer Schlag durchfuhr. Er keuchte und krümmte sich. Tränen rannen über seine Wangen, während die Luft um ihn herum flimmerte, als würde sie gleich in Flammen stehen. Auch Lila sprang erschrocken zurück, während Kells Macht sich Bahn brach und Tropfen für Tropfen, Funken für Funken, in seine Adern zurückkehrte.
Doch etwas fehlte.
Nein, dachte Kell. Bitte nicht! Rhys Puls, der in ihm geschlagen hatte, war verstummt. Kell blickte auf seine verstümmelten Hände hinunter, von denen das Blut und mit ihm seine Magie troff. Aber das war ihm völlig egal. Hastig riss er sich das Hemd auf. Die silbernen Linien des Seelensiegels waren noch immer zu sehen, in seiner Brust war jedoch nur noch ein Herzschlag zu hören; nur noch der seine …
»Rhy«, schluchzte er flehend. »Ich kann ihn nicht mehr … Er ist …«
Lila packte ihn an der Schulter. »Schau mich an«, befahl sie. »Dein Bruder war noch am Leben, als ich gegangen bin. Gib nicht so schnell auf!« Doch ihre Worte klangen hohl, und statt Hoffnung vibrierte ein Echo von Kells Angst in ihnen. »Außerdem«, fügte sie hinzu, »kannst du hier überhaupt nichts für ihn tun.«
Ihr Blick glitt durch das Zimmer, über das Metallgerüst hinweg, die blutverschmierten Handfesseln, den mit Folterwerkzeugen übersäten Tisch, das Halseisen auf dem Boden, bis er wieder an Kell hängen blieb. Irgendetwas stimmte tatsächlich nicht mit ihren Augen! Während das eine unverändert braun schimmerte, war das andere von sternförmigen Rissen durchzogen.
»Dein Auge …«, setzte Kell an. Lila winkte ab.
»Nicht jetzt«, sagte sie ungeduldig und stand auf. »Los, lass uns abhauen.«
Aber Kell wusste, dass er in diesem Zustand nirgendwo hingehen konnte. Seine Handgelenke waren zersplittert, Blut strömte aus seinen offenen Wunden. Jedes Mal, wenn er sich bewegte, wurde ihm schwindlig; und als Lila ihm aufhelfen wollte, geriet er ins Taumeln und sank wieder auf dem Boden zusammen. Er keuchte verärgert.
»Das ist ja nicht zum Mitansehen.« Lila presste die Hand auf eine blutende Wunde an ihrem Knöchel. »Halt still, ich flicke dich wieder zusammen.«
Kell sah sie mit großen Augen an. »Warte«, sagte er und zuckte vor ihrer Berührung zurück.
Lilas Lippen kräuselten sich. »Du traust mir wohl nicht.«
»Stimmt.«
»Dein Pech«, meinte sie und legte ihm ihre blutverschmierte Hand auf die Schulter. »Wie war die Formel nochmal?«
Der Raum begann zu schwanken, als er den Kopf schüttelte. »Lila, ich glaube nicht, dass …«
»Kell, wie lautet die verfluchte Formel?«
Kell schluckte, dann antwortete er mit bebender Stimme: »Hasari. As Hasari.«
»Na, dann mal los«, sagte Lila und verstärkte ihren Griff. »Bist du bereit?« Bevor er etwas erwidern konnte, rief sie: »As Hasari.«
Nichts passierte.
Kells Lider zuckten vor Erleichterung, Erschöpfung und Schmerz.
Lila runzelte die Stirn. »Hab ich was fal…«
In diesem Moment gab es einen grellen Lichtblitz, und die Kraft der Magie schleuderte Kell und Lila in verschiedene Richtungen, wie von einem Sturm entwurzelte Bäume.
Kell landete mit dem Rücken auf dem Boden, und Lila prallte gegen eine Wand.
Der Antari schnappte nach Luft. Von der Wucht des Aufschlags war er so betäubt, dass er einen Augenblick lang nicht wusste, ob der Zauber gewirkt hatte. Doch dann bewegte er die Finger und spürte, wie seine zersplitterten Knochen heilten, seine geschundene Haut sich glättete und die Luft wieder in seine Lungen strömte. Als er sich aufsetzte, hämmerte ihm der Puls in den Ohren; doch ihm war nicht mehr schwindlig, das Blut kreiste wieder in seinen Adern. Die gähnende Leere war verschwunden, sein Körper geheilt.
Lila war an der Wand zusammengesackt und rieb sich leise stöhnend den Hinterkopf.
»Verflixte Magie«, murmelte sie, während Kell neben ihr niederkniete. Als sie ihn mit heilen Gliedern vor sich sah, grinste sie ihn triumphierend an.
»Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich …«