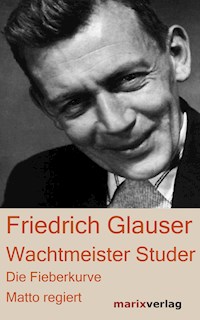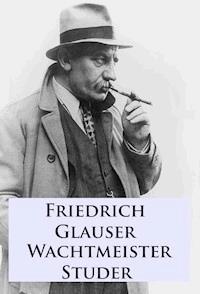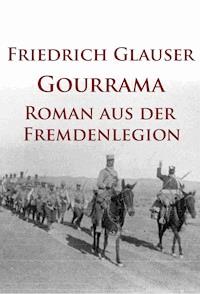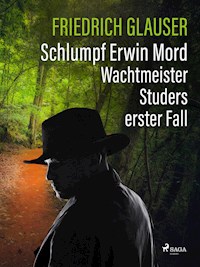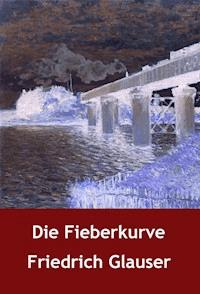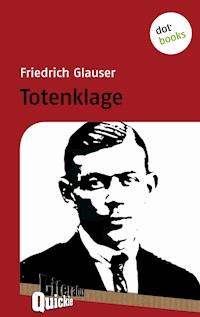Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In 'Die Besten Glauser-Krimis' präsentiert Friedrich Glauser eine Sammlung seiner faszinierendsten Kriminalgeschichten, die den Leser mit ihren ausgefeilten Plots und tiefgründigen Charakteren in den Bann ziehen. Glauser, bekannt für seinen unverwechselbaren Schreibstil, der zwischen düsterer Atmosphäre und subtilem Humor changiert, schafft es, Spannung und Psychologie gekonnt miteinander zu verbinden. Die Kriminalgeschichten bieten einen Einblick in die düstere Welt der Ermittler und Verbrecher, wobei Glauser subtile soziale und politische Kommentare einfließen lässt. Friedrich Glauser, ein Schweizer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der selbst Erfahrungen mit psychischen Problemen und Sucht hatte, bringt in seinen Werken eine einzigartige Perspektive ein. Durch seine persönlichen Erfahrungen konnte er glaubwürdige und vielschichtige Charaktere erschaffen, die den Leser auf eine fesselnde Reise durch die Abgründe der menschlichen Natur mitnehmen. Glausers Krimis sind nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine introspektive Auseinandersetzung mit dem menschlichen Zustand. 'Die Besten Glauser-Krimis' ist ein Muss für Liebhaber des Kriminalgenres, die nach anspruchsvollen Geschichten suchen, die sie gleichzeitig fesseln und zum Nachdenken anregen. Von der ersten Seite an wird der Leser in Glausers Welt gezogen, die voller Geheimnisse, Wendungen und unerwarteter Enthüllungen steckt, und wird bis zum Schluss in Atem gehalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Besten Glauser-Krimis
Der alte Zauberer
Von der Bahnstation bis zur Abzweigung, die nach Waiblikon führte, war die Strasse noch asphaltiert, und Wachtmeister Studer fluchte nicht allzusehr, obwohl es vom Himmel schüttete und ein durchaus unangenehmer Herbstwind pfiff. Ausser dem Wetter störte den Wachtmeister einzig die »Rösti«, die seine Frau ihm am Morgen vorgesetzt hatte. Denn auf die »Rösti« am Morgen hielt er, der Wachtmeister Studer. Sein Vater, der im Emmental Bauer gewesen war, hatte sie am Morgen gegessen, sein Grossvater auch; warum sollte er eine Ausnahme machen? Aber dass man alt wurde, war eben eine Tatsache, die Verdauung funktionierte nicht mehr wie früher, man bekam Sodbrennen von der »Rösti«. Studer schob dies auf das schlechte Fett, das seine Frau wohl der Sparsamkeit wegen gebraucht hatte. Irgend so ein modernes Geschlarpf war wohl das Fett. Er trappte mit den dicken Sohlen durch die Pfützen, zog den Gummimantel enger an den Bauch. Nicht einmal rauchen konnte man bei diesem Wetter.
Da war die Abzweigung, sie war gerade breit genug, dass ein Güllenwagen durchfahren konnte, rechts ging es steil bergab in ein Bachbett, links stieg ein triefender Wald in die Höhe. Der Wachtmeister dachte an Dinge, an die man eben so denkt, wenn es schüttet und wenn man friert: an einen Jassabend, an seine Amtsstube, an seinen Sohn, der als Setzer bald ausgelernt hatte. Studer hatte ein dickes, rotes Gesicht, das jetzt ein wenig bläulich angelaufen war, und einen vertrauenerweckenden Schnurrbart. Zwischen den vom Rauchen braungewordenen Schneidezähnen spuckte er kunstgerecht, wie ein Achtjähriger, in weitem geradem Strahl, und der Regen war machtlos gegen diese Kunst, und der Wind auch: Das freute Studer. Dass ihm hingegen der Regen die Ärmel herab in die Taschen lief, das ärgerte ihn wieder, so dass er nicht recht wusste, welches Gesicht er schneiden sollte. Es war überhaupt schwer, bei diesem Wetter seinen eigenen Willen durchzusetzen, besonders was das Gesichterschneiden betraf, denn der Regen fuhr ihm manchmal mit seinen nassen Fingern in die Augen, und die breite Krempe des Hutes war ein ungenügender Schutz gegen derartig böswillige Attacken.
Die Strasse wurde steil, Studer fluchte ein wenig, schüttelte den Kopf, dass die Tropfen von seinem Hutrand tangential abflogen. Es war ja schliesslich, dachte er, nicht die Schuld des kantonalen Polizeidirektors, dass er hier in der Nässe herumvagieren musste. Sonst gab man ja dort oben auf anonyme Briefe nicht viel, aber hier schien der Fall doch etwas anders zu liegen, und das Ganze war eine etwas kohlige Geschichte. Wo man da anpacken sollte, war nicht ganz klar, entweder war das Ganze ein Versuch, die Behörde zu blamieren, und da musste man doppelt vorsichtig sein, oder es war etwas ganz Grosses dahinter, ein Sensationsprozess vielleicht, und dann kamen die Reporter von den ausländischen Zeitungen, und man bekam ein wenig internationalen Ruhm weg. Das war nicht zu verachten. Mein Gott, man hatte es ja nicht nötig, man war ja sonst schon in den Fachkreisen bekannt, in Wien besonders, in Paris auch; es hatten sich da ein- oder zweimal ziemlich schwierige Internationale (halb Spione, halb Einbrecher) in der Schweiz wie in einer Mausefalle gefangen. Das sollte doch genügen, besonders wenn die Pensionierung in erreichbarer Nähe stand – noch fünf Jahre ... fünf Jahre wird man doch noch aushalten? Aber – seinen Namen zu lesen, im »Journal« zum Beispiel, mit schmeichelhaften Beiwörtern, das war nicht zu verachten. Etwa so: »Le distingué inspecteur de la sûreté Studer, dont le talent remarquable est bien connu dans les milieux policiers ...« und vielleicht noch seine Photographie dazu. Ja, die Franzosen hatten es los, in der Schweizer Presse war man sparsamer mit lobenden Beiwörtern.
Da kam rechts vom Wege ein Heuschober in Sicht. Ein wenig unterstehen kann man, dachte Studer und fühlte dabei nach seiner Brusttasche. Gut, dass ihm die Frau noch Kognak gerüstet hatte, der würde jetzt gerade lau sein von der Körperwärme, und in der zerfliessenden Sintflut ringsum wäre eine Stärkung doch nicht zu verachten. Studer ging in den Heuschober, das Heu war trocken, er nahm einen Büschel, wischte sich die nassen Schuhe ab, trocknete die Hände an einem sauberen Taschentuch und zog den Brief aus der Tasche, der den Polizeidirektor so aufgeregt hatte. Es stand wenig darin:
»Der Bauer Berthold Leuenberger in Waiblikon begräbt seine vierte Frau. Er ist sechzig Jahre alt, die drei letzten Frauen sind innerhalb von drei Jahren gestorben. Es waren immer junge. Er sagt, das Wasser bei ihm auf dem Hof ist schlecht. Viele meinen etwas anderes. Wann wird das Gericht endlich einschreiten? Wenn das Wasser schlecht ist auf seinem Hof, warum ist er nie krank geworden, noch sein Vieh, Knecht und Gesinde? Jetzt gehet er wieder um, der Bauer, wie ein brüllender Löwe, und suchet, wen er verzehren könne. Aber Gottes Gericht ist über ihm, wenn ihn das Gericht der Menschen vergisst.«
Die Schrift war verstellt, das Papier grob, längliche Rechtecke überspannten es wie ein feines Netz. Nach dem Schluss des Briefes musste ihn ein »Stündeler« geschrieben haben, ein Bibelkundiger. In drei Jahren drei Frauen, das war merkwürdig. Aber die Totenscheine mussten doch in Ordnung sein, Studer hatte mit dem Polizeidirektor im Telephonbuch nachgesehen und den Namen eines Arztes gefunden, der als gewissenhaft bekannt war. Dieser Arzt war früher am Spital gewesen, die Polizei hatte bei Unfällen viel mit ihm zu tun gehabt, der Mann war untadelig. Aber man weiss ja, wie es in einer Landpraxis zugeht, man hat nicht viel Zeit, wenn man weit herum Besuche machen muss... und irren ist ja bekanntlich menschlich.
Studer stapfte weiter, ganz wenig hellte sich das Wetter auf, das heisst der Regen hörte auf zu fliessen, dafür senkte sich ein dicker, weisser Nebel über das Land. So dicht war dieser Nebel, dass Studer die Häuser zuerst gar nicht erblickte, aus denen der Weiler Waiblikon bestand. Ein Junge mit halblangen Hosen, die bis zur Mitte der nackten Waden reichten, die Füsse in Holzschuhen, stapfte an ihm vorbei. »Wo ist die Wirtschaft?« fragte Studer. Der Junge glotzte zuerst, dann deutete er mit einer schmutzigen Knabenhand geradeaus und wies nach links, hob dann fünf gespreizte Finger. »Bist du stumm?« Der Junge nickte – also das fünfte Haus links, dachte Studer und stapfte weiter. Das Gastzimmer, das an den kleinen Laden stiess, war klein, nieder und finster. Es musste doch bald Mittag sein. Studer zog den triefenden Mantel aus, zog die Weste straff über seinen Bauch, zog noch den Rock aus, dessen Ärmelenden durchweicht waren, und setzte sich. Dann zog er die Uhr aus der Tasche, eine flache, goldene Uhr, die er an seinem zwanzigjährigen Dienstjubiläum geschenkt erhalten hatte; sie zeigte zehn Uhr. Es war früh. Er hatte Zeit. Lange blieb die Stube leer, kein Mensch zeigte sich, es herrschte in ihr jener ein wenig ekelerregende Geruch (auf nüchternen Magen ist er noch schwerer zu ertragen) von abgestandenem Bier und kaltem Pfeifenrauch. Endlich erschien ein gähnendes Mädchen, das unwillig die Absätze seiner Finken auf dem Boden nachschleifte. Studer bestellte einen Dreier Roten und eine Portion Hammen. Das Fleisch war gut, er bestrich es dick mit Senf, auch der Wein war nicht schlecht. Die Stube war gut geheizt, die nasse Luft von draussen vermochte nicht durch die Doppelfenster zu dringen. Dem Kommissar wurde wohl, seine Augen bekamen einen trockenen und klaren Glanz, und er überlegte, wie er sich am besten an das Mädchen heranmachen könne. Diese Serviertochter musste einmal in der Stadt gedient haben, sie hatte verraufte Dauerwellen und trug ein kunstseidenes, schon ein wenig brüchiges Kleid. Studer hätte es als einen psychologischen Fehler empfunden, eine Dorfmaid zu einer »Consommation«, wie sie in Genf sagten, einzuladen, hier konnte man es riskieren. Das Mädchen bügelte in der Nähe des grossen steinernen Ofens, der von der Küche her geheizt wurde, gestärkte Schürzen. Studer klopfte auf den Tisch. Er war der biedere alte Handlungsreisende, der sich gern eine kleine Zerstreuung gönnt, obwohl die Zerstreuung hier etwas Überwindung kostete. Als das Mädchen mürrisch näher kam, fragte er verlockend, ob sie nicht auch etwas nehmen wolle, es sei so kalt draussen. Das Mädchen schwärmte für Wermut, es holte die staubige Flasche vom Wandbord, sagte: »Excusez« und »wenn's erlaubt ist« und drängte seine Magerkeit ziemlich dicht an den Wachtmeister. Und das Gespräch entspann sich. Studer liess sich Zeit (man muss sich immer Zeit lassen); er reise in Düngemitteln, besonders Thomasschlacke sei jetzt sehr preiswert zu kaufen, ein ausgezeichnetes Phosphordüngemittel, aber er wolle zuerst ein wenig Bescheid wissen über die Leute in der Gegend, sein Auto habe er am Bahnhof gelassen, denn der Weg sei doch gar zu schlecht. Und er plätscherte und plätscherte, und das Mädchen langweilte sich und gähnte. Das war das Richtige, wenn sie gähnte, so ehrlich gähnte, dann glaubte sie ihm seine Geschichte. Und vorsichtig begann er, von den Bauern der Gegend zu reden und zu fragen, wer wohl den grössten Hof habe und welche die besten Abnehmer seien, aber er wolle nur von solchen wissen, die Geld hätten im Haus. Und man habe ihm besonders den Berthold Leuenberger gerühmt, der habe so einen grossen Hof, aber grosse Höfe seien meist verschuldet – ob man etwa bei diesem anklopfen könne? Und was das für ein schönes Kleid sei, das die Jungfer da anhabe, man sehe doch gleich, dass sie nicht von hier stamme, und gute Manieren habe sie, nur wie sie das Glas halte. Das kam alles in einem leise einschläfernden Redestrom, besonders die Komplimente, denn Studer hatte bemerkt, wie ein leises Erschrecken durch den mageren Körper neben ihm ging, als er den Namen Leuenberger nannte. Er säbelte an seinem Schinken herum. Ja, also, dieser Leuenberger, ob es sich wohl empfehle, ihn zuerst zu besuchen? Komme er öfters in die Wirtschaft? In die bleichen Augen des Mädchens neben ihm kam ein seltsames Flimmern. Der Leuenberger habe den Leichenschmaus gestern bei ihnen gehabt.
»Leichenschmaus?« fragte der Wachtmeister, wer denn da gestorben sei.
»Seine Frau.«
Dann sei es wohl nicht günstig, ihn heute zu besuchen. Das Mädchen stiess ein pfeifendes Lachen aus, leerte das Glas, fragte zutraulich, ob es ihr erlaubt sei, noch eins zu trinken; der Wachtmeister nickte, das kam sicher gut, wenn diese Trucke halb betrunken war.
Und bohrte weiter. Also, der Leuenberger habe den Leichenschmaus hier gehabt, wie alt er denn sei, ob er wohl wieder heiraten wolle? Das Mädchen zierte sich. Oh, es werde sich schon eine finden, die nicht alles glaube, eine Couragierte. Es stellte sich heraus, dass der Leuenberger schon zu Lebzeiten seiner Frau oft in der Gaststube seine Abende verbracht hatte, und dass eine Frau noch glücklich bei ihm werden könne. Was ist das für ein Mensch, dachte der Wachtmeister, dieser Bauer, hat nicht genug an vier Frauen, die er unter den Boden gebracht hat, nein, er schafft auf Vorrat, während die letzte noch am Leben ist, sorgt er schon für die folgende. Fast wäre ihm die Frage herausgefahren, ob sie denn nicht Angst hätte, über den Frauen des Leuenberger walte doch kein guter Stern, aber er schluckte die Bemerkung noch rechtzeitig hinunter, untersuchte aufmerksam das Deckblatt seines Stumpens (er hasste es, diese Rauchware am falschen Ende anzuzünden) und schwieg. Denn jetzt war Schweigen am Platz. Der Redestrom rann von selbst, wie aus einem angestochenen Fass, der Wermut hatte seine Wirkung getan. Nur nicht unterbrechen. Er erinnerte sich dunkel, dass ihm ein alter Untersuchungsrichter zu Beginn seiner Laufbahn diesen Rat gegeben hatte: sich unbemerkbar zu machen, wenn der andere einmal loslegt. Aber den Rat brauchte er nicht mehr, er wusste, bei Zeugenverhören, bei fälligen Geständnissen war Schweigen ein so starkes Druckmittel, dass die mittelalterlichen Foltermethoden dagegen zu einem einfachen Kinderschreck zusammenschrumpften.
Und er erfuhr genug, der Wachtmeister, er erfuhr genug, um sich ein ziemlich gelungenes Bild von diesem Leuenberger zu machen. Das Mädchen schilderte ihn ganz gut, als einen grossen, mageren Mann, mit noch dunkelbraunen Haaren trotz seinem Alter. Glattrasiert. Mit seiner ersten Frau hatte er vierzig Jahre zusammengelebt. Das Ehepaar hatte keine Kinder gehabt. Dann war die Frau an einer Lungenentzündung gestorben, vor zehn Jahren. Sie war fromm gewesen, den Bauer aber hatte man nie in der Kirche gesehen, auch nicht in der »Stunde«. Nach dem Tode der Frau war er allein geblieben und hatte den Hof bewirtschaftet mit einer Magd und drei Knechten. Übrigens habe er einen schlechten Ruf, als stehe er mit dem Teufel im Bunde. Das Mädchen lachte und liess Goldplomben sehen; sie glaubte nicht daran, aber Tatsache sei, der Leuenberger habe viel Zulauf, von weit herum kämen Leute, um ihn zu befragen, wenn Krankheit im Stall sei, auch bei Menschen, wenn der Doktor nicht mehr zu helfen wisse. Er stünde sonst gut mit dem Doktor, der Leuenberger, sagte das Mädchen; bei den Krankheiten seiner Frauen habe er immer den Arzt beigezogen, den Doktor Pfister, der sei jedesmal ein-, zweimal hier heraufgekommen, der Leuenberger habe ihn gerufen, aber der Arzt habe nichts Rechtes finden können. Darmkatarrh, bei allen dreien, einmal habe er sogar an Typhus geglaubt, bei der zweiten Frau, aber er habe es dann doch nicht kontrollieren können, denn da sei die Frau schon gestorben gewesen. Ja, der Leuenberger sei arg verhasst, besonders bei den Frommen, und von diesen gehe die Sage aus, er stünde mit dem Teufel im Bunde; als ob es so etwas gebe, einen Teufel. Das Mädchen stiess wieder ihr pfeifendes Lachen aus, sie sei aufgeklärt, sagte sie; bevor sie in dies Kaff gekommen sei, habe sie eine gute Stelle gehabt in der Stadt, und jetzt müsse sie hier unter dem Mond leben, bei den »Ruechen«. Aber der Leuenberger, das sei so der Beste hier herum, immer manierlich, immer »Fräulein Rosa« sagte er, und einmal habe er sogar gefragt, ob sie nicht seine Frau sein wolle, wenn er wieder Witwer sei. Warum nicht? Sie glaube doch nicht alles, was die andern da erzählen, und Angst habe sie keine. Als Frau vom Leuenberger hätte sie dann keine Sorgen mehr, es ginge ihr gut, und der Leuenberger habe ihr versprochen, sie dürfe nach Bern fahren, wann sie wolle, er habe schon lange daran gedacht, sich ein Auto anzuschaffen. Und wenn sie dann so ihre ehemaligen Freundinnen besuchen könne und triumphieren über sie, da nehme sie es noch gern mit dem Teufel auf. Aber jetzt müsse sie in der Küche helfen, es wundere sie überhaupt, dass die Wirtin noch nicht gekommen sei, sie zu holen, sie müsse das Mittagessen kochen, ob der Herr auch hier essen wolle? Ja, sagte Studer, gegen halb eins werde er zum Essen kommen, er wolle jetzt zuerst ein wenig bei den Leuten anklopfen, wegen den Düngemitteln.
Der Mantel war trocken, draussen bemühte sich eine schwindsüchtige Sonne, den milchigen Nebel zu trinken, es gelang ihr schlecht, es war zuviel da; sie gab es auf, von der Anstrengung war sie ein wenig rot geworden. Wachtmeister Studer schritt durch die wenigen Häuser, die rechts und links von der Dorfstrasse lagen, er trat hier ein, trat dort ein, zeigte eine biedere Miene und pries Thomasmehl an. Manchmal, wenn die Frau allein daheim war und der Mann fort, im Wald beim Holzen, wurde er in die Küche gebeten, es war nicht schwer, die Frau auf das gewünschte Thema zu bringen. Aber aus allen Gesprächen, die Studer an diesem Morgen führte, konnte er nur zwei ganz unwägbare Gefühle herausdestillieren: die Furcht, die alle Frauen vor dem Leuenberger hatten, und die Überzeugung, dass der Leuenberger drei Frauen umgebracht hatte. Der anonyme Brief war somit erklärt, aber einen Menschen auf Gerüchte hin zu verhaften, das ging nicht. Studer wurde unsicher. Weibergetratsch, dachte er und sah seinen schönen Sensationsprozess zerfliessen, wie den Nebel vor ihm, der gerade jetzt zwei glänzendrote, zierliche Bäumchen freigab. Sie glühten in der Sonne wie flüssiges Erz, und durch eine sonderbare Gedankenverbindung musste Studer an die Hölle denken, so, wie er sie sich als kleiner Bube vorgestellt hatte.
Sie hatten ihm genug vom Teufel vorgeschwatzt, die Weiber, den ganzen Morgen lang. Schon als Bub sei der Leuenberger ein gar merkwürdiger gewesen und habe mehr gesehen als andere Leute. Eine uralte Grossmutter hatte sich erinnert, dass der Berthel, damals erst elfjährig, am Tag der zehntausend Ritter gegen Abend atemlos heimgekommen war, auf der Schwelle sei er zusammengebrochen, und in der Nacht habe er dann gefiebert. Im Fieber habe er immer von einem schwarzen Mann erzählt, der sei auf einem schwarzen Ross über den Galgenhubel geritten. Und der Ritter, der Mann auf dem Ross, der habe keinen Kopf gehabt, aber er habe dem Jungen immer mit der Hand gewinkt. Seit diesem Tage sei der Leuenberger verändert gewesen. Er habe immer viel gelesen, die dicken Bücher, die sein Vater gehabt habe, sein Vater sei auch ein Kluger gewesen, der habe das Vieh besprechen können, und der Grossvater Leuenberger auch. Sie seien vor Generationen hier eingewandert, die Leuenberger, niemand habe gewusst, woher sie gekommen seien.
Kein Sektionsprotokoll, keine richtiggehende Anzeige. Studer nannte sich einen Idioten. Er hätte doch wenigstens, bevor er hier heraufkam, sich an den Arzt wenden können, der die Frauen behandelt hatte, und diesen fragen, ob ihm nichts aufgefallen sei. Es war dem Wachtmeister ungemütlich zumute, er fröstelte (ob er sich wohl diesen Morgen bei dem Sauwetter erkältet hatte?), fühlte sich hin und her gerissen: Sollte er einfach ins Wirtshaus zurückgehen, dort zu Mittag essen und dann sang- und klanglos wieder nach Bern zurückkehren? Aber es hielt ihn etwas zurück. Man blamiert sich nicht gern, wenn man einmal so lange Dienst getan hat. Und sollte er vor diesem Leuenberger einfach ausreissen? Ganz dunkel, und ohne dass er es hätte formulieren können, kam ihm die Überzeugung, dass das Frösteln einfach ein Zeichen der Angst sei. Was Erkältung! Er hatte schon oft, in noch ärgerem Wetter, stundenlang auf der Strasse irgendeinem aufpassen müssen. Furcht vor dem Leuenberger! Er stampfte wütend vorwärts, aber so blindlings, dass die Sohle in eine Wasserlache klatschte und das Wasser an seinen Hosen in die Höhe spritzte. Den Leuenberger wollte er doch noch sehen. Was Teufelsvisionen, das war Mittelalter, und jetzt gehörte es ins Gebiet der Irrenärzte und der psychiatrischen Gutachten. Den Leuenberger wollte er noch kennenlernen!
Da war sein Hof. Studer stellte fest, dass er geträumt haben müsse, denn die roten Bäumchen waren jetzt gerade neben ihm, also war er kaum zehn Schritte vorwärts gekommen. Er nahm einen Anlauf, die nassen Hosen scheuerten an seinem Knie. Rechts von ihm breitete sich ein riesiger Obstgarten aus, alte Bäume, stellte Studer fest, aber vor noch nicht langer Zeit frisch gepfropft. Und dieser Obstgarten liess eine dunkle Erinnerung in ihm auftauchen. Obstbäume – Schädlinge – Schädlingsbekämpfung.
Was brauchte man zur Schädlingsbekämpfung? Arsenite? ... Vor der Tür des Hauses blieb Studer einen Augenblick stehen. Ein Giftprozess, bei dem er Zeuge gewesen war, ging ihm durch den Kopf. Was waren doch die Symptome von Arsenvergiftung? Durchfall? Ja, was hatte nur der Experte gesagt? Es sei manchmal schwer, eine Arsenikvergiftung festzustellen; die Ähnlichkeit mit anderen Darmkrankheiten sei gross. Nur die chemische Analyse der inneren Organe könne Sicherheit geben. War da der Angriffspunkt? Aber warum hatte dieser Leuenberger (wenn er ein Giftmörder war, und das war doch nicht bewiesen), warum hatte er dann seine Frauen ermordet? Es waren doch alle arme Meitschi gewesen, hatten sie ihm erzählt. Er hatte doch nichts davon. Warum? Er stiess die Tür auf, der Wachtmeister Studer, legte sein Gesicht in biedere Falten und trat in die Küche. Sie war leer. Im Zimmer nebenan hustete jemand, Studer tappte laut auf den Fliesen, nebenan stand jemand auf, die Verbindungstür wurde aufgerissen, in ihr stand ein grosser, alter Mann und blickte auf den Eindringling.
»Was wollt Ihr?« fragte der alte Mann. Studer war in seiner Rolle, er redete ölig von Thomasschlacke und Düngemitteln, und ob er den Bauern vor sich habe. Und während er redete, hatte er Mühe, dem andern in die Augen zu sehen. Es war schwierig, sehr schwierig, die Lider nicht niederklappen zu lassen, dem Blick des andern standzuhalten. Eine alte Redensart ging dem Wachtmeister durch den Kopf: »Der kann auch mehr als Brot essen.« Und während Studer weiterplauderte, kroch ihm eine feuchte Angst den Rücken hinauf, nistete sich im Nacken ein, füllte den Kopf aus, brachte ihn fast zum Platzen, die Augen tränten, er musste den Blick niederschlagen, und dann schwieg Studer.
Der andere wartete, wartete eine geraume Weile. Dann kam von der Tür eine merkwürdig durchdringende Stimme, einen Ton hatte diese Stimme, der Erschütterungen im Körper auslöste, nicht unangenehme, so wie ein leichter elektrischer Strom. »Tretet näher«, sagte die Stimme. »Ihr seid willkommen. Habt kein freundliches Wetter gehabt, um auf den Berg zu kommen.« Pause. »Und zu mir zu kommen, um Eure Düngemittel anzupreisen. Es wird wohl nicht so sehr pressieren. Ihr bleibet zum Essen bei mir, hab' gern einen Gast von Zeit zu Zeit, man hört etwas von der Welt, und gerade jetzt seid Ihr willkommen, jetzt wo ich im Leid bin.«
Wachtmeister Studers Verstand hatte plötzlich jegliches exakte Arbeiten vergessen. Ich mache mich lächerlich, dachte er, während er seinen rundlichen Körper an dem sehnigen des andern vorbeidrückte. Ein helles, warmes Zimmer, die Sonne spritzte viel flüssiges Gelb durch die kleinen Scheiben der Fenster. Es ging wirr zu im Kopf des Wachtmeisters, so einen habe ich noch nicht getroffen, so einen habe ich noch nicht getroffen, dachte er ununterbrochen und fühlte sich als blutiger Anfänger, ohne Überlegenheit, winzig klein, wie ein Büblein in der Schule vor dem Lehrer. Der macht mit mir, was er will, dachte er noch. Studer, Studer, sagte er zu sich selbst, wärst du ins Wirtshaus gegangen, hättest dort gegessen und wärst dann heimgefahren. Studer, was ist mit dir los! Du hast doch schon andere Leute gebodigt, wirst du Angst haben vor so einem Bauer? Du wirst alt, Studer, lass dich pensionieren.
Der Leuenberger war gemütlich; er schien sich glänzend zu unterhalten bei diesem stummen Spiel. »Natürlich«, dachte Studer, »der ist nicht auf meinen vorgeschützten Beruf hereingefallen. Der hat mich gleich erkannt als der, der ich bin. Und so sicher ist er... eine unerschütterliche Sicherheit.« Der alte Leuenberger benahm sich untadlig, machte nicht zuviel Worte, nötigte den Gast auf die Bank am Fenster, setzte sich ihm gegenüber, schwieg. Schwieg lange.
Studer nahm einen Anlauf. »Ihr seid also im Leid?« fragte er, so harmlos als möglich, und auf einen kurzen Augenblick hob er die Augen. Unerträglich, was dieser alte Bauer für einen Blick hatte. Es sah aus, als seien seine Augen aus einem matten Stein, nur dort, wo die Pupillen sassen, drangen zwei spitze Strahlen hervor, anders konnte man das wohl nicht nennen, die trieben einem das Wasser in die Augen. Und Studer klappte wieder mit den Lidern.
»Ja«, sagte Leuenberger, »meine Frau ist gestern begraben worden. Sie ist zu Verwandten gefahren, hat wohl etwas Unrechtes gegessen, sterbend haben sie mir die Leute ins Haus gebracht. Der Doktor hat sie kurz vorher gesehen, kurz vor ihrem Tode. Ein Darmfieber. Ja.« Und Leuenberger schwieg wieder. Er hatte die Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet, langfingrige Hände, stellte Studer fest, mit gekrümmten Nägeln daran, gelblichen Nägeln, gewölbt.
In der Küche lief jemand herum. »Rösi«, rief Leuenberger, ganz sanft, es klang wie das Mauzen eines Katers; ein junges Mädchen erschien. »Lauf in die Wirtschaft und sag dort, sie sollen nicht auf den Herrn warten, der Herr isst hier.« Schweigend ging das Mädchen. Auch sie hatte den Blick nicht gehoben.
»Also«, sagte Leuenberger und blickte auf die alte Tischplatte, »Ihr wollt mir Kunstdünger verkaufen ... oder?« Wenn er die Augen gesenkt hielt, war sicher nichts Besonderes an diesem Bauer, er war ein alter Bauer, wie andere auch, mit einem runden, samtenen Käppchen auf dem Kopf, das mit bunten Seidenblumen bestickt war. »Welche von seinen Frauen hat ihm jetzt das Käppchen gestickt?« dachte der Wachtmeister, und zugleich sollte er antworten, und wieder war dies unangenehme Gefühl im Nacken da, am ehesten erinnerte es noch, dies Gefühl, an den Eindruck, den man in einer Schlägerei hat: Man hat sich nach vorn zu wehren, und plötzlich bekommt man die Warnung, so als ob man Augen hinten im Kopf hätte, hinter dir steht einer mit aufgezogenem Gummiknüppel ... und jetzt schlägt er. Furchtsam sah sich der Wachtmeister um. Hinter ihm war ein unschuldiges, niederes Fenster, niemand blickte durch die Scheiben, vor ihm sass ein alter Mann mit gefalteten Händen. Von nirgends her drohte Gefahr. Und doch war es unheimlich in diesem sauberen Bauernzimmer – und ganz schnell schickte der Wachtmeister einen Blick ringsum. Ein alter Schrank, in einer Ecke der breite Ofensitz, ein Bord an der Wand, alte Bücher darauf. Studers Blick blieb an den Büchern haften. Leuenberger sah auf, folgte der Richtung, nickte, sagte, als müsse er eine Frage beantworten: »Alte Bücher, ja, vom Urgrossätti, Bücher, die man nicht mehr findet, mit handschriftlichen Bemerkungen. Ich zeig' sie nur nicht gern.« Und wieder das Schweigen. Draussen, in der Küche, das scheue Klappern von Holzböden, das Mädchen musste zurück sein. Pfannen rasselten. Wasser lief. Ein Hahn krähte vor dem Fenster. »Und nicht einmal ein Sektionsprotokoll«, dachte der Wachtmeister, »wie kann man an diesen Menschen herankommen, das Spiel beginnen.« Es kam ihm ein dummer Vergleich in den Sinn, aber er wurde ihn nicht los: Wie beim Jassen, musste er denken, der Gegner hat die Hände voll Trümpfe, er trumpft, trumpft, er hofft, den Match zu machen, nur eine falsche Karte hat er, und beim vorletzten Stich hat man noch zwei Asse in der Hand, welches soll man verwerfen? Verwirft man das falsche, ist man der Lackierte. Auch hier: Der andere hatte alle Trümpfe, aber eine falsche Karte hatte er, das Gefühl hatte Studer deutlich, und er musste verwerfen, verwerfen. Wenn er nicht die richtige Karte behielt, dann war alles verspielt, sein ganzes Leben war nichts wert, hier war ein Kampf, auf seinem Boden eigentlich, er war doch auch ein Bauernsohn! Gott, die Internationalen! So klug waren sie nicht, und die grossen Kanonen kamen ja nie in die Schweiz. Aber dieser Bauer, dieser Leuenberger, der reizte ihn, dem musste er es zeigen. Und dabei hatte das Spiel doch kaum begonnen, und wo war der Einsatz? Diesmal war es nicht ein halber Liter Fendant, es ging um mehr. Ganz geistesabwesend zog Studer sein Taschentuch aus der Tasche und wischte sich die Stirn. Er schwitzte.
Dieses Schweigen in dem kleinen Zimmer! Es war nicht zum Aushalten. Und dann wurde es auch noch dunkel draussen, der Nebel hatte sich wohl wieder eingefunden, nein, es regnete, ganz leise plätscherte es gegen die Scheiben. Ihm gegenüber der sanfte alte Mann mit dem Samtkäppli und den gestickten Blumen. Und da spielte der Bauer den ersten Trumpf aus:
»Ihr habt Euch gar viel um mich interessiert, Herr«, sagte er, mit einer so stillen, unbeteiligten Stimme, und ganz ruhig blieb er dabei, einen Moment nur blitzten die Strahlen aus den versteinten Augen. »Was meint Ihr?« fragte Studer unbedacht und hätte das Wort so gerne wieder eingefangen, er hätte schweigen sollen, Schweigen war das Beste, was hatte der alte Untersuchungsrichter gesagt? Und er seufzte, denn er dachte: »Untersuchungsrichter haben gut reden, die sitzen in ihrem Büro, wir haben die Vorarbeiten getan, sie thronen hoch oben, sie haben Autorität. Ich möcht' einen Untersuchungsrichter an meiner Stelle sehen.« Aber der andere schien das Spiel auch zu kennen, denn auf die Frage des Wachtmeisters schwieg auch er und blickte nur still und ruhig auf seine gefalteten Hände. Dann sagte der Leuenberger mit seiner tönenden Stimme: »Ja, drei Frauen hab' ich verloren in den letzten Jahren, es muss ein Fluch sein auf meinem Hof«, und schielte lauernd zu seinem Gast, wie das Wort »Fluch« wirken werde. Aber nun hatte der Wachtmeister etwas gelernt, das Taschentuch behielt er zwar in Händen, aber er verschränkte die Finger darüber und nickte scheinheilig.
Das Mädchen brachte das Essen, es war Speck, Sauerkraut, Erdäpfel. Die Männer assen schweigend. In der Küche trampten die Knechte, der Wachtmeister hörte, wie sie absassen, hörte das Klappern der Löffel in den Tellern, spitzte die Ohren, ob er nicht ein Wort erhaschen könne, durch die angelehnte Tür. Die Knechte assen schweigend, Stühlerücken, sie klapperten hinaus, das Mädchen kam ins Zimmer, räumte den Tisch ab, stellte eine Flasche »Brönnts« auf den Tisch, zwei Gläser, verliess wieder das Zimmer. Das waren keine Schnapsgläser, das waren Weingläser. Der Leuenberger füllte die Gläser, trank das seine mit einem Ruck leer, der Wachtmeister folgte dem Beispiel, er hätte am liebsten einen langen Fluch hinausgeschmettert, aber mitten drin wäre ihm der Atem ausgegangen. Das war ja Salpetersäure! Der Leuenberger verzog keinen Muskel im starren Gesicht. »Ein gutes Schnäpslein«, sagte er, und es schien dem Wachtmeister, als grinse er auf den Stockzähnen. Und dann spielte er den zweiten Trumpf aus: »Was hat sich die Polizei in Bern um meine Angelegenheiten zu kümmern, dass sie einen Wachtmeister zu mir heraufschickt? Hab' ich etwas verbrochen?« War es der Schnaps, der zu wirken begann, war es der offenkundige Hohn, plötzlich war Studer ganz klar »im Grind«, wie er sagte. Die Ängstlichkeit war plötzlich fort, er fühlte plötzlich ganz deutlich, der da gegenüber ist reif, jetzt ihm nur Zeit lassen, jetzt mit ihm saufen den ganzen Nachmittag lang. Noch einmal verwirrten sich seine Gedanken, ganz kurz, er dachte an seine Gesundheit: Bei deinem Herzen, dachte er, kann es dich einen Schlag kosten. In Gottes Namen, dachte er weiter, die Kinder sind fast erwachsen, die Alte hat die Pension, war wieder klar, zog das Schnupftuch, tat verlegen, schneuzte sich, bevor er antwortete, und liess seine Antwort ganz kläglich klingen: »Oh, gegen Euch hat man apartig nichts, aber es sind natürlich immer böse Mäuler um den Weg, und wir haben da einen Brief empfangen, der ...« Er zögerte scheinbar, dann zog er den Brief aus der Tasche und legte ihn vor den Bauer hin.
Jetzt zog der Bauer das Schnupftuch, hielt es einen Augenblick wie zögernd in der Hand, dann kam die Brille zum Vorschein, er putzte die Gläser, mitten in diesem Geschäft störte ihn der Wachtmeister: »Rauchet Ihr?« und hielt ihm eine längliche Tasche voll brandschwarzer Toscani hin. Leuenberger sagte: »Ich danke auch ...«, wählte eine, legte sie neben sich, putzte die Brille fertig, setzte sie umständlich auf; da hatte Studer schon ein Streichholz angebrannt, bot dem Bauern Feuer, das Zündholz verbrannte dem Wachtmeister schon die Finger, er hielt aus (dunkel fühlte er, hier kam es auf solche Kleinigkeiten an, auf Unbeteiligttun, auch wenn man sich die Finger verbrennt), endlich brannte die Zigarre, Leuenberger spie sittsam Rauchschwaden aus, wie eine wohlerzogene Lokomotive, goss die Gläser voll, schluckte die Salpetersäure und beobachtete dabei den Wachtmeister. »Un homme averti en vaut deux«, dachte Studer und ärgerte sich, dass ihm heute soviel Welsches im Kopf herumspukte. Aber er trank das Zeug gelassen aus, schnalzte dann sogar mit der Zunge, und jetzt war er es, der sagte: »Ein gutes Schnäpslein.« Der Leuenberger beugte sich über den Brief. Er studierte ihn lange und aufmerksam, schob ihn dann zurück. »Ja«, sagte er, »es gibt böse Leute auf dieser Welt.« Wieder das Schweigen. Der Regen pritschelte an die Scheiben, es war ein schmutziges Dämmerlicht im Zimmer. Die Männer rauchten. Wenn nur nicht diese Stille über dem Hof gewesen wäre. Studer fühlte, wie ihn die Gefahr wieder im Rücken bedrohte, darum sagte er, und es klang mehr wie eine nebensächliche Feststellung: »Den Frauen wird's nicht wohl sein in der nassen Erde auf dem Friedhof, bei dem Wetter.«
»Was gehen mich die Frauen an, mein Grossätti hat sechse begraben.«
»Die richtige Blaubartfamilie«, sagte der Wachtmeister, und kaum waren die Worte heraus, hätte er sich mit den Fäusten an den Kopf kläpfen können. Solche Dummheiten zu sagen. Aber die Antwort war scheinbar doch richtig gewesen, denn der andere bekam einen sonderbaren Tick in die Mundwinkel, man konnte es gerade noch sehen, die Mundwinkel zitterten. Jetzt nahm Studer die Flasche vom Tisch und goss die Gläser voll, es war gegen die Etikette, er wusste es, aber jetzt scherte er sich den Teufel um die Etikette, er musste den andern teig machen, teig wie eine Birne, die man in der Hand zerquetscht. »Zum Wohl«, sagte er, der Bauer zögerte, dann trank er, und wieder war es Studer, der sich zu bemerken erlaubte: »Ein gutes Schnäpschen.«
Da stand der Leuenberger auf, drehte das Licht an. Fast hätte der Wachtmeister durch die Zähne gepfiffen, die Augen des andern waren gar nicht mehr steinern, sie schwammen, die Augen, sie waren feucht! Dass er jetzt das Schweigen bewahrte, rechnete sich der Wachtmeister später hoch an, obwohl ... Der Leuenberger setzte sich nicht wieder, mit einer merkwürdig brüchigen Stimme sagte er, er habe draussen noch einen besonders guten Tropfen, ob er den noch holen dürfe? Sonderbar untertänig fragte er dies. Der Wachtmeister nickte. Er tat gut gelaunt, obwohl es ihm plötzlich kotzübel wurde und schwarz vor den Augen. Er biss die Zähne zusammen, schneuzte sich, dass ihm schier der Kopf platzte, »nur jetzt nicht abgehen«, dachte er, »sonst hat das Ganze keinen Sinn gehabt, aufpassen jetzt!« Er schrie es sich innerlich zu. Und es half. Der Leuenberger ging hinaus, er blieb lange fort, der Wachtmeister wäre gern hinausgegangen, um sich zu erleichtern, er hielt aus, wie ein Soldat auf verlorenem Posten.
Endlich kam der Bauer wieder ins Zimmer. Er hielt eine kleine Flasche in der Hand, sie war verstaubt. Aber sie war schon entkorkt; der Bauer hielt sogar noch den Pfropfenzieher mit dem Korken daran in der Hand. War es dieser Umstand, der dem Wachtmeister verdächtig vorkam? Er hätte es später nicht sagen können. Aber der Leuenberger machte eine zweite Dummheit, er sagte nämlich: »Ich hab' genug getrunken, probiert ihn allein, Herr.« Jetzt hat er die Farbe verraten, die Farbe der falschen Karte, fast hätte es der Wachtmeister hinausgebrüllt, aber so nahm er nur dem andern die Flasche aus der Hand und den Pfropfenzieher, drehte sorgfältig und langsam den Korken ab, verschloss die Flasche, steckte sie in die Tasche, in dieselbe Tasche, in der er die Toscani trug, und sagte mit ganz neutraler Stimme (jetzt war er wieder der Fahnder-Wachtmeister Studer von Bern, eine Amtsperson): »Die Flasche will ich lieber dem Gerichtschemiker mitbringen.« Einen Augenblick stand der Leuenberger noch kerzengerade, dann hockte er ab, stützte den Kopf auf eine Faust und stierte auf den Tisch.
»Es war doch nur wegen dem Fliegen können«, sagte er, wie aus einem Traum heraus.
Der Wachtmeister schwieg. Wollte der da Komödie spielen? Der sollte jetzt ausspucken, und wenn auch keine Zeugen für das Geständnis da waren, jetzt konnte man doch die Exhumation beantragen, jetzt hatte er, der Wachtmeister Studer, doch das richtige As behalten – aber um Gottes willen kein Wort reden! Ein wenig Mitleid hatte er mit dem Mann, vielleicht war er doch ein wenig verrückt gewesen? Aber gerade in das Mitleid hinein stachen ihm wieder die seidengestickten Blümlein auf des Bauern Samtkappe in die Augen. Die Finger, die das gestickt hatten, die waren verfault, die hatten sich vielleicht im Todeskampf gebogen, und niemand hatte ihnen geholfen, den Fingern. Er war wohl auch beschwipst, der Wachtmeister, dass ihm solche Gedanken kamen. Jetzt sprach der andere wieder: »Ja, wegen dem Fliegen. Der Grossätti hat es doch in seinem Buch geschrieben gehabt, nach der siebenten toten Ehefrau da bekommt man die Gewalt, da kann man fliegen. Ihm ist's fast gelungen, aber die siebente hat ihn überlebt. Sonst... sonst hätte er fliegen können.«
»Aber Mensch«, brüllte ihn der Wachtmeister an (er brüllte wirklich, so etwas Verrücktes, und der viele Schnaps den ganzen Nachmittag). »Aber Mensch, und die Alpenflüge? Auf jedem Flugplatz kannst du doch fliegen.«
Da blickte ihn der Leuenberger unendlich überlegen an, seine Augen versteinten wieder, das alte Leuchten durchstach die Pupillen, und ganz leise, mit seiner alten, tönenden Stimme sagte er: »Und die Unsterblichkeit? Kann ich die mir auch auf dem Flugplatz kaufen? Es heisst: Und wirst fliegen können bis ans Ende der Tage der Welt, und nichts wird dir verborgen sein.« Er sprang auf, holte eins der alten Bücher vom Wandbord, schlug es auf. Mühsam entzifferte der Wachtmeister die altertümliche Handschrift. Ja, da stand es. »Bis ans Ende der Tage.«
Er nahm das Buch unter den Arm. »Komm jetzt mit, Leuenberger«, sagte er sanft. »Das andere wird sich finden.«
Sie zogen den Berg hinab, durch das stille Dorf. Der Leuenberger wehrte sich nicht. Im kleinen Städtchen lieferte ihn der Wachtmeister ins Bezirksgefängnis ein, nach einer telephonischen Unterredung mit Bern.
Aber der Wachtmeister Studer kam um seinen wohlverdienten internationalen Ruhm, das »Journal« brachte weder sein Bild noch eines jener schmeichelhaften Beiwörter, die von den Franzosen so gut beherrscht werden; denn der Leuenberger erhängte sich in der gleichen Nacht in seiner Zelle. Und niemand weiss, ob seine Seele nicht doch das Fliegen gelernt hat.
Der Hund
Ich weiss ja nicht, wo Sie arbeiten und was Sie für Ansichten haben, junger Mann ... – Ja, ein kleines Helles, Jungfer ... – Aber gerade heute ist es mir so recht einsam zumute. Witze haben wir uns genug erzählt, all die letzten Abende, und der Dritte, der sonst mit uns einen Zuger gemacht hat, ist heute auch nicht da. Soll ich Ihnen einmal eine ernste Geschichte erzählen? Natürlich, Sie glauben, dass wir Reisende es immer leicht haben, aber einmal bin ich durch Zufall in eine komplizierte Affäre hineingerissen worden, und das war unangenehm. Denn so etwas stört bei der Arbeit, Und wenn wir nicht immer auf dem Sprung sind und die Kunden bearbeiten, dann kommt ein Jüngerer und stösst uns beiseite.
Nein, Komplikationen liegen mir gar nicht. Ich bin dick und gemütlich, das kann ich sagen, habe auch nie jemandem etwas zuleide getan. Aber die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, hat mich doch eine ganze Zeitlang aus dem Gleichgewicht gebracht, und ich frage mich noch heute, ob ich da nicht etwas hätte verhindern können. Auf alle Fälle hat sie mich vom Heiraten endgültig kuriert ... Und auch von den möblierten Zimmern. Dinge können einem da passieren! ...
Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass ich für eine Zigarettenfabrik reise, für eine bekannte Marke, aber die Direktoren wollen eben auch auf ihre Rechnung kommen. Nun, ich habe es mir vielleicht ein wenig zu wohl sein lassen in Zürich, war nicht genug hinter den Kunden her, ein paar haben reklamiert, der Reisende sei nicht zur rechten Zeit vorbeigekommen, ihr Vorrat sei aufgebraucht. Mehr ist nicht nötig gewesen. Der Direktor hat mir die Kutteln geputzt und mir einen andern Rayon gegeben. Irgend so ein kleines Kaff, von dem aus ich die Krämer der Umgebung hätte besuchen sollen. Froh war ich, dass er mich nicht entlassen hat, aber ich verstehe das Geschäft, es war also mehr eine Art Strafversetzung; denn ich bin schon Jahre und Jahre in der Branche und sonst ganz brauchbar. Es war ein wüstes kleines Dorf, in das ich gekommen bin. Es ging auf den Abend zu, und ich war müde; denn ich bin den ganzen Tag mit dem Töff herumgefahren. Zuerst bin ich in eine Wirtschaft gegangen, habe etwas gegessen und so nebenbei den Wirt gefragt, wo hier ein möbliertes Zimmer frei sei. »Gehen Sie zum Notar Schneider«, hat er gesagt, »der sucht schon lange einen Mieter. Aber es sind ungemütliche Leute. Irgend etwas stimmt nicht bei ihnen. Man weiss nicht was. Eine Garage haben sie auch, wo Sie Ihr Motorrad einstellen können, und die Emma, das ist die Stieftochter vom Notar, ist ein flottes Meitschi. Man mag sie gern hier.«
Ich fuhr also zum Notar. Eine Jungfer machte mir auf. Ein währschaftes Meitschi, mit einem Gesicht ... Und die Augen!... Ich muss an ein junges Pferd denken. Sie trägt einen unordentlichen Haarknoten im Nacken ... Sie hat mir gleich gefallen. Dann hat sie mir das Zimmer gezeigt. Es war ganz anständig, mit Diwan und einem grossen Schrank. Fünfzig Franken im Monat ... Und das Frühstück könne ich auch haben, wenn ich wolle ... Ich war sehr höflich.
»Frühstück nehme ich schon gern«, sag' ich, »aber ich muss etwas essen, was vorhält, weil ich bis Mittag zu tun habe und das Töffahren hungrig macht. Speck und Eier möcht' ich. Über den Preis werden wir uns schon einigen«, meine ich. Dann zahl' ich die fünfzig Franken, das Meitschi gibt mir den Hausschlüssel und sagt noch, ich solle doch leise machen, wenn ich spät heimkomme; denn die Mutter sei herzkrank und erschrecke leicht, wenn man die Türen zuschlage. Ich antworte: Sie brauche keine Angst zu haben, wir schweren, dicken Männer seien manchmal viel leiser als die jungen, mageren Fisel, die so ungeschickt sind, dass sie an keinem Stuhl vorbeikönnen, ohne ihn umzuschmeissen. Da hat sie lachen müssen, die Emma. Schöne Zähne hat sie gehabt, wissen Sie: so breite ... Vielleicht war das ein Grund mehr, dass sie wie eine junge Stute ausgesehen hat – und ich habe Pferde gern.
Beim Wirt habe ich noch einen Zweier getrunken, Zeitungen gelesen (es war grad niemand da, der einen Jass hat klopfen wollen), und ich hab' angefangen, mich mit meiner Strafversetzung auszusöhnen. Das Haus, in dem ich wohnen sollte, hat mir zwar nicht so recht gefallen, es sah aus, wie eben ein verschuldetes Haus aussieht. Und die Luft drin hat mir doch ein wenig den Atem verschlagen, wie ich die Stiegen hinauf bin. Aber ich hab' mir gedacht, das ist nur Einbildung. Man muss sich wieder an die Atmosphäre der Dorfhäuser gewöhnen, wenn man aus der Stadt kommt. Da gibt's nichts anderes.
Um zehn Uhr bin ich heimgegangen. Mein Töff hatte ich in die Garage gestellt, ich hab' die Haustür leise aufgesperrt, und da seh' ich die ganze Familie unter einer Petroleumlampe um einen runden Tisch im Zimmer sitzen. Die Türe zum Gang ist weit offen, die Emma liest in einem Buch, der Notar, ein dürrer, alter Mann mit einer unregelmässigen Glatze, die aussieht, als hätten ihm die Ratten hier und dort ein Büschel Haare herausgenagt, tut nichts; er hockt nur da und starrt auf seine Nägel. Ein wenig im Schatten, zwischen der Jungfer und dem Alten, sitzt ein gebücktes Weiblein, mit gebleichten Haaren. Die hält ein Strickzeug in der Hand, und die Nadeln bewegen sich so langsam, dass es aussieht wie eine Zeitlupenaufnahme im Kino. Die drei haben mich nicht kommen hören. Ich mache die Türe leise zu, aber wie ich weitergehe, knarren meine Stiefel. Sie können es mir glauben oder nicht: Ich kann Schuhe kaufen, wo ich will, immer knarren die Sohlen. Schon als ich klein war, ist es so gewesen, es ist eine Art Fluch, der über meinem Leben liegt, diese knarrenden Schuhe; aber daran kann man eben nichts ändern.
Der Notar schaut auf, die Emma kommt auf mich zu, nimmt mich an der Hand und zieht mich ins Zimmer. Dann stellt sie mich vor. Der Alte knurrt mich an, die Mutter reicht mir zwei Finger. Und dann kann ich wieder gehen. Die Emma lächelt mir nach. Herzlich war die Begrüssung nicht.