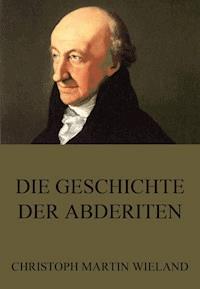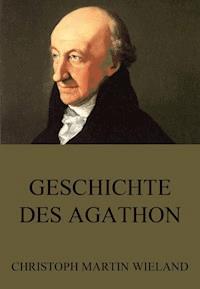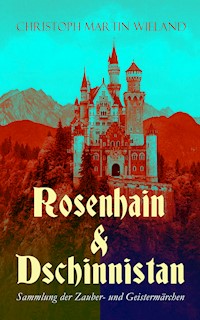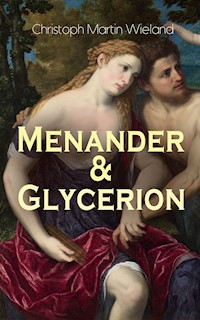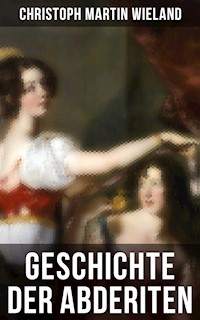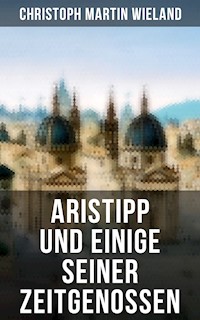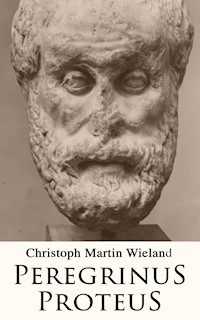1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Christoph Martin Wielands Werk 'Die Beyträge zur geheimen Geschichte der Menschheit' ist eine faszinierende Sammlung von Geschichten und Gedanken, die den Leser in die Welt der Geheimnisse und Mysterien der Menschheit eintauchen lässt. Mit einem ausgeprägten literarischen Stil, der von Wielands genauer Beobachtungsgabe und seinem tiefen Verständnis für die menschliche Natur geprägt ist, präsentiert das Buch Geschichten, die sowohl unterhaltsam als auch tiefgründig sind. Diese Erzählungen entführen den Leser in eine Welt voller Intrigen, Verschwörungen und dunkler Geheimnisse, die die verborgenen Seiten der Geschichte beleuchten. Wielands Werk kann als wichtiger Beitrag zur Literatur des 18. Jahrhunderts angesehen werden, da es Themen behandelt, die auch heute noch von großer Bedeutung sind. Christoph Martin Wieland, ein bedeutender deutscher Schriftsteller der Aufklärung, war bekannt für seine vielseitigen literarischen Werke und seinen scharfen Verstand. Als aufgeklärter Gelehrter hat Wieland sich intensiv mit den philosophischen und ethischen Fragen seiner Zeit auseinandergesetzt, was sich auch in seinen Schriften widerspiegelt. 'Die Beyträge zur geheimen Geschichte der Menschheit' spiegelt Wielands Interesse an geheimnisvollen und unerforschten Bereichen der Menschheitsgeschichte wider und zeigt seine Fähigkeit, komplexe Themen auf fesselnde und informative Weise zu präsentieren. Für Leser, die sich für historische und philosophische Themen interessieren und gleichzeitig auf der Suche nach einer fesselnden Lektüre sind, ist Wielands Werk ein absolutes Muss. Mit seinen packenden Geschichten und seiner detaillierten Analyse der menschlichen Natur bietet 'Die Beyträge zur geheimen Geschichte der Menschheit' eine einzigartige Perspektive auf die verborgenen Geheimnisse und Abgründe der Menschheit, die den Leser zum Nachdenken anregen und fesseln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die Beyträge zur geheimen Geschichte der Menschheit
Inhaltsverzeichnis
Koxkox und Kikequetzel
Eine mexikanische Geschichte
Ein Beytrag zur Naturgeschichte des sittlichen Menschen
1.
Vor undenklichen Jahren kam, nach einer alten Mexikanischen Sage, ein großer Komet, auf seiner Reise um die Sonne – man weiß nicht aus welcher Veranlassung – dem Planeten, welchen unsre Vorfahren bewohnten, so nahe, daß beide Sterne, nach menschlicher Weise zu reden, handgemein mit einander werden mußten.
Das Gefecht war eines der hartnäckigsten, welche seit langer Zeit in den Gefilden des Äthers vorgefallen waren. Die besondern Umstände davon sind, aus Mangel beglaubter Zeugnisse, unbekannt. Alles, was wir davon sagen können, ist: daß, nachdem der Mond seiner Schwester Erde zu Hülfe gekommen, de Komet sich endlich genöthiget fand, mit Zurücklassung des größten Theils von seinem Schweife, die Flucht zu ergreifen, und, es sey nicht aus Feigheit oder Scham über seine mißlungene Unternehmung, sich im leeren Raume so weit zu verlaufen, daß er, nach der Meinung der besten Sinesischen Sternseher, bis auf den heutigen Tag den Rückweg noch nicht hat finden können.
Wie wichtig der Verlust seines Schweifs für ihn gewesen sey, können wir nicht bestimmen. Aber so viel ist gewiß, daß die Erde wenig Ursache hatte, sich dieses erfochtenen Siegeszeichens zu erfreuen. Denn unglücklicher Weise, befanden sich in diesem Schweife (welcher nach der mäßigsten Berechnung eine Million dreymahl hundert vier und vierzig tausend fünf hundert sechs und sechzig Mexikanische Meilen lang, und verhältnismäßig breit und dick war) obenhin gerechnet wenigstens tausend Millionen Tonnen Wassers, welches in erschrecklichen Güssen auf die arme Erde herunter stürzte, und in wenigen Stunden eine solche Überschwemmung verursachte, daß alle Menschen und Thiere des ganzen mittlern Theils der Halbkugel, von Luisiana und Kalifornien an bis zu der Erdenge Panama, dadurch zu Grunde gingen; wenige einzelne ausgenommen, die so unglücklich waren, in den Klüften der höchsten Gebirge einem feuchten Tode zu entrinnen, um aus Mangel an Lebensmitteln von einem trocknen aber unendliche Mahl grausamer aufgerieben zu werden.
Hüet und seines gleichen würden kein Bedenken tragen, uns zu versichern, daß diese alte Mexikanische Sage nichts anders als eine durch die Länge der Zeit abgenutzte, und (nach Gewohnheit der blinden Heiden) mit Fabeln wieder unterlegte und ausgeflickte Nachricht von der Mosaischen allgemeinen Sündflut sey.
Ich bin nicht belesen genug, um mit einem so belesenen Manne wie Hüet zu haberechten. Es kann seyn! – Aber da es eben so möglich ist, daß diese Mexikanische Überschwemmung nur partikular gewesen und später erfolgt ich als jene; und da, aus Mangel zuverlässiger kronologischer Nachrichten, sich in dieser Sache nichts bestimmen läßt: so – überlasse ich diese Frage unberührt einem jeden, der sich ihrer annehmen will, – um zu derjenigen interessanten Begebenheit fortzueilen, welche der Leser, wofern er über diesem Anfang noch nicht eingeschlafen ist, im zweyten Kapitel dieses rhapsodischen Werkes, mit allen Grazien der Neuheit, deren eine so alte Geschichte nur immer fähig ist, beschrieben finden wird.
2.
Ein junger Mensch – der jedoch alt genug war, um zu wissen daß man ihn Koxkox zu nennen pflegte, ehe dieses entsetzliche Schicksal sein Vaterland befiel, – hatte das Glück, der allgemeinen Zerstörung zu entrinnen, und das Unglück, allem Ansehen nach das einige menschliche Wesen zu seyn, dem dieses Glück zu Theil geworden war.
Koxkox glaubte sich zu erinnern, daß der Frühling, welcher, so bald als das Gewässer von den höher liegenden Orten abgeflossen war, wieder aufzublühen anfing, wenigstens der zehente sey, den er erlebt hätte; – ein Umstand, der zur Ehre seines Verstandes wenigstens so viel beweist, daß er drey und ein Drittel Mahl besser zählen konnte, als die armen Einwohner von Neuholland, welche es bis auf diesen Tag noch nicht weiter als bis zur Pythagoreischen Drey haben bringen können; – wenn wir so gut seyn wollen, es den Reisebeschreibern zu glauben. – Und in der That wär' es, das wenigste zu sagen, sehr unfreundlich, wenn wir Leuten, welche sich so vielen Gefahren und Beschwerden unterzogen haben, um uns andern glebae addictis – Wunderdinge nach Hause zu bringen, eine so wenig kostende Kleinigkeit, als ein Bißchen Glauben ist, versagen wollten.
In der Folge der besagten Rechnung also, mochte Koxkox, wofern er sich anders nicht überzählt hatte, – welches größern Kronologen als er begegnet ist, und noch täglich begegnet – ungefähr vierzehn bis funfzehn Jahre als seyn; vorausgesetzt, daß er sich wenigstens bis auf sein fünftes Jahr habe zurück erinnern können, welches von einem Jüngling von erträglicher Fähigkeit nicht zu viel gefordert scheint.
Man weiß nicht wie es zugegangen, daß er während der Überschwemmung und eine geraume Zeit hernach sich bey Leben erhalten konnte. Was seyn soll, muß sich schicken, sagten unsre Alten, – die mit ihren Sprichwörtern gemeiniglich mehr sagten, als manche Leute zu verstehen fähig sind. – Im Nothfall sehe ich nicht, warum wir nicht unendliche Mahl befugter seyn sollten, ihn durch ein Wunder zu retten, als die Kronikenschreiber des achten und etlicher folgender Jahrhunderte es waren, Wunder auf einander zu häufen, wo man nicht begreifen kann, wozu sie dienen sollen; – denn die Rettung eines Menschen in einem Falle wie dieser scheint doch wohl ein dignus vindice nodus zu seyn.
Wofern aber der eine oder andere von unsern Lesern kein Liebhaber dieser Art von Entwicklung – welche, genau zu reden, in der That keine Entwicklung ist – seyn sollte: so däucht uns, könnte man sich billig daran begnügen lassen, daß Koxkox, besage seiner ganzen Geschichte, da war. Denn war er da, so ist die Möglichkeit seines Daseyns außer allem Zweifel; wie jedermann zugeben wird, der seinen Aristoteles oder Baumeister nicht ganz vergessen hat.
3.
Das Land, worauf sich Koxkox befand, war durch die besagte Überschwemmung zu einer Insel geworden. Nach einiger Zeit hatte die Erde wieder angefangen, eine lachende Gestalt zu gewinnen; junge Haine kränzten wieder die Stirne der Berge, und diese Haine wimmelten in kurzer Zeit wieder von Papagayen und Kolobri's; die Fluren, die Thäler waren voll Blumen und fruchttragender Gewächse; – kurz, da er nun immer weniger Schwierigkeiten fand sich fortzubringen, würde sich sein Herz der Freude wieder haben öffnen können: wenn die Einsamkeit, welche keinem Menschen gut ist, für einen Menschen von sechzehn oder siebzehn Jahren nicht beynahe eben so entsetzlich wäre, als für den einsiedlerischen Talapoin – welcher, um desto ruhiger der Betrachtung des geheimnißvollen Nichts (des Ursprungs und Abgrunds aller Dinge, nach Fohi's Grundsätzen) obzuliegen, sich dreyßig ganzer Jahre aus aller männlichen und weiblichen Gesellschaft verbannt hatte – der beleidigende Anblick eines nymfenähnlichen Mädchens, das sich in seine Wildniß verirrt hätte.
Die Einsamkeit – ich meine hier eine solche, welche nicht von unserm Willen abhängt, und in einer gänzlichen Beraubung aller menschlichen Gesellschaft besteht – muß für Menschen, die an die Vortheile und Annehmlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens gewöhnt sind, ein unerträgliches Übel seyn. Freylich nicht für alle in gleichem Grade. – Der Dichter, der Platonist, der schwärmerische Liebhaber, es sey nun daß er in eine materielle oder unsichtbare Schönheit verliebt ist, kurz die Penserosi aller Gattungen und Arten, entreißen sich oft freywillig dem Getümmel der Städte, fliehen aufs Land, in einsame Schatten, in wilde Gegenden, wo überhangende Felsen, finstre Wälder, fern her schallende Wasserfälle, die süße Schwermuth unterhalten, welche das Element einer begeisterten Einbildung ist. Solche Leute würden sichs, wenigstens eine Zeit lang, auf einer einsamen Insel gefallen lassen können. Wenn sie anfingen das Leere ihres Zustandes zu fühlen, wie viele Hülfsmittel würde ihnen ihre Einbildungskraft darbieten! Sie würden Berge und Haine und Thäler mit eingebildeten Wesen ausfüllen; sie würden mit den Nymfen der Bäche, mit den Dryaden der Bäume Liebesverhältnisse unterhalten; und wenn auch dieses Mittel nicht immer hinlänglich wäre, die Forderung der Natur und des Herzens zu befriedigen, so würde es doch schon genug seyn, um sie zuweilen einzuschläfern und durch angenehme Träume zu täuschen; – und alle Bonzen und Bonzinnen auf beiden Seiten des Ganges wissen, »daß angenehme Träume sehr viel sind, wenn man nichts substanzielleres haben kann.«
Aber der arme Koxkox hatte keinen Begriff von diesen Mitteln sich die Einsamkeit zu versüßen. Das Volk, welches in den Gewässern des Kometenschweifes ersäuft worden war, hatte sich noch in den ersten Anfangsgründen des geselligen Standes befunden. Zufrieden mit den freywilligen Geschenken der Natur hatten sie noch wenig Gelegenheit gehabt, ihre Fähigkeit zur Kunst zu entwickeln. Ihre Einbildungskraft schlummerte noch, und ihre Sprache war nur sehr wenig reicher und wohlklingender als die Sprache der wilden Truthühner, womit ihre Wälder angefüllt waren. Die Erziehung, welche Koxkox unter einem solchen Völkchen genossen hatte, konnte ihm also wenig oder gar nichts helfen, die Beschwerlichkeiten des verlassenen Zustandes, worin er sich befand, zu erleichtern. Hingegen ersetzte sie ihm auf einer andern Seite wieder, was auf dieser abging; sie verhinderte ihn das Elend seines Zustandes zu fühlen.
4.
Indessen erinnerte er sich doch ganz lebhaft, daß er in seinem vorigen Zustande unter andern Kindern gewesen war, daß sie mit einander gespielt hatten, und daß unter diesen Spielen ein Tag nach dem andern wie ein Augenblick vorbey geschlüpft war. Er merkte, daß ihm jetzt die Tage länger vorkamen; öfters so lange, daß es nicht auszustehen gewesen wäre, wenn er sich nicht damit geholfen hätte, sich in irgend ein dickes Gebüsche hinzulegen, und den ganzen langen Tag so gut hinweg zu schlafen, als ob es nur eine einzelne Stunde gewesen wäre. Lebhafte Träume versetzten ihn dann in die Tage seiner Kindheit; er jagte sich mit seinen Gespielen durch Gebüsche herum, sie plätscherten mit einander in kühlen Bächen, oder kletterten an jungen Palmbäumen hinauf. Keichend erwachte er darüber, und wurde nun so traurig über seine Einsamkeit, daß er sich wieder hinlegte zu träumen. Aber weder Schlaf noch Traum war so gefällig wieder zu kommen. In dem schwermüthigen staunenden Zustande, worein ihn diese Lage setzte, blieb ihm nichts anders übrig, als mit sich selbst zu reden, – welches sich gemeiniglich damit endigte, daß er unwillig darüber wurde, keine Antwort zu bekommen, – oder mit etlichen Papagayen zu spielen, aus welchen er sich, in Ermanglung einer bessern, eine Art von Gesellschaft gemacht hatte.
Die Papagayen hatte die schönsten Federn von der Welt, – aber eine so dumme, gleichgültige, gedankenlose Miene, so wenig Fähigkeit zu ergetzen oder sich ergetzen zu lassen, daß sogar Koxkox bey aller seiner eigenen Einfalt verlegen war, was er mit ihnen anfangen sollte.
Ein einziger aschgrauer, den er Anfangs wegen seiner unscheinbaren Gestalt wenig geachtet hatte, entdeckte ihm endlich ein Talent, welches ihm eine Art von Zeitvertreib gab, ohne daß er sogleich merkte, wie viel Vortheil er davon ziehen könnte. Der graue Papagay gab allerley Töne von sich, welche einige Ähnlichkeit mit gewissen Worten hatten, die er aus den Selbstgesprächen des Koxkox aufgefangen haben mochte. Koxkox merkte dieß kaum, so machte er sich schon ein sehr angelegenes Geschäft daraus, der Sprachmeister seines Papagayen zu werden; welcher bey seiner Lernbegierde und Fähigkeit, die ganze Kunst seines Lehrers ziemlich bald erschöpfte.
Unvermerkt sprach der Papagay so gut Mexikanisch als Koxkox selbst. Wahr ists, ein strenger Dialektiker würde oft sehr viel gegen seine Wortverbindungen einzuwenden gehabt haben. Hingegen gelangen ihm auch nicht selten die witzigsten Einfälle; und wenn er zuweilen baren Unsinn sagte, so kam es bloß daher, weil er keine Begriffe, sondern bloße Wörter zusammen stellte; – ein Zufall, wovon, wie man glaubt, die weisesten Männer, ja sogar ganze ehrwürdige Versammlungen von weisen Männern, nicht allezeit frey gewesen sind.
Koxkox und sein Papagay waren nunmehr im Stande Gespräche mit einander zu führen, die zum wenigsten so witzig und interessant waren, als es die Unterhaltung in den meisten heutigen Gesellschaften ist, wo derjenige sehr wenig Lebensart verrathen würde, welcher mehr Zusammenhang und Sinn darein bringen wollte, als in der Unterhaltung mit einem Papagay ordentlicher Weise zu herrschen pflegt.
Tlantlaquakapatli, ein angesehener mexikanischer Filosof, trägt kein Bedenken, den Anfang des gesellschaftlichen Lebens unter seiner Nazion von dieser Vertraulichkeit Koxkoxens mit seinem Papagay abzuleiten.
Die Dichter des Landes gingen noch weiter. Sie versicherten, – mit einer Freyheit, deren sich diese Zunft bey allen Völkern des Erdbodens zu allen Zeiten mit sehr wenig Mäßigung bedient hat, – »daß irgend eine mitleidige Gottheit sich den Zustand des einsamen Koxkox zu Herzen gehen lassen, und den oft besagten Papagay in das schönste Mädchen, das jemahls von der Sonne beschienen worden sey, verwandelt habe.« Und damit die Weiber (sagen sie) ein immer währendes Merkmahl ihres Ursprungs an sich trügen, habe dieser Gott dem neuen Mädchen und allen seinen Töchtern die Schwatzhaftigkeit gelassen, welche ihm in seinem Papagayenstand eigen gewesen.
Wenn man (sagt der vorbenannte Filosof) dieses Mährchen behandelt, wie alle Mährchen, welche von Anbeginn der Welt bis auf diesen Tag in Prosa, oder in Versen, oder in beiden zugleich erzählt worden sind, ohne Ausnahme behandelt werden sollten, – d. i. wenn man (durch eine so leichte Operazion, daß eine jede Amme Verstand genug dazu hat) das Wunderbare darin vom Natürlichen scheidet; so wird man finden: »daß gerade so viel Wahres daran ist, als am Boden sitzen bleibt, nachdem das Wunderbare in Rauch aufgegangen ist.« Nemlich – –
5.
Koxkox gerieth einst, indem er mit seinem Papagay auf der Hand spazieren ging, in eine Gegend, wohin er noch nie gekommen war, – und da fand er unter einem Rosenstrauche – ein Mädchen schlafen, von dessen Anblick er auf der Stelle so entzückt wurde, daß er eine gute Weile nicht im Stande gewesen wäre, zu sagen ob er wache oder träume.
Den Rosenstrauch ausgenommen, – denn ich sehe nicht, warum es nicht eben so wohl ein Balsamstrauch oder ein Rosinenstrauch oder ein Kokospflaumstrauch hätte gewesen seyn mögen – scheint in dieser Geschichte, wenigstens bis hierher, nichts zu seyn, was der Wahrheit der Natur nicht vollkommen gemäß wäre.
Die Entzückung des armen Koxkox endigte sich mit einem Schauer, der alle seine Glieder durchfuhr, und auf welchen eben so schnell ein Strom von geistigem Feuer folgte, der aus seinem Herzen sich in einem Augenblick durch sein ganzes Wesen ergoß, und jedes unsichtbare Fäserchen davon elektrisch machte. Das Mädchen däuchte ihm das lieblichste unter allen Dingen, die jemahls bei Tageslicht oder Mondschein vor seine Augen gekommen waren.
Die ernsthaften Leute, welche ihm dieses übel nehmen, sollten (wie Tlantlaquakapatli sagt) bedenken, daß er seit mehr als sechs und dreyßig Monden nichts als Papagayen, Truthühner, Schlangen, Affen und Ameisenbären gesehen hatte.
Diese Entschuldigung (wofern es einer Entschuldigung bedurfte) scheint sehr gründlich zu seyn. Gleichwohl aber erklären wir hiermit und kraft dieses, daß wir, aus billiger Rücksicht auf unsre schönen Leserinnen, an derselben keinen Antheil nehmen.
6.
Es mag nun aus Vorurtheil, oder aus Aberglauben, oder aus wirklicher Überzeugung daß es so und nicht anders gewesen, hergekommen seyn, – so viel ist gewiß: daß die Mexikanischen Tiziane, wenn sie die Göttin der Schönheit, oder prosaischer zu reden, eine vollkommene Schöne mahlen wollten, sich dazu durch die Idee der schönen Kikequetzel (so nennen sie die Nymfe, von welcher hier die Rede ist) zu begeistern pflegten.
Sie war, sagen sie, gerade und lang wie ein Palmbaum, und frisch und saftvoll wie seine Frucht. Ihre Gestalt war nach den feinsten Verhältnissen gebildet; vom Wirbel ihres Hauptes bis zu den Knöcheln ihrer schönen Füße war nichts eckiges zu sehen noch zu fühlen. Rabenschwarze Haare flossen ihr in natürlichen Locken um den erhabenen Busen. Sie hatte große schwarze Augen, eine kleine Stirne, hochrothe etwas aufgeworfene Lippen, eine Gesichtsfarbe, die ins Jonquille fiel, eine flache aufgestülpte Nase – mit Einem Worte, niemahls (sagen sie) hat die Natur etwas vollkommneres hervorgebracht.
Ein junger Sineser rümpfte die Nase bei diesem Gemählde. – Eine Schöne, rief er, mit großen Augen! mit einer kleinen Stirne! mit aufgestülpten Nüstern! – Ha! ha! ha!
Sie mag, beym Goldkäfer! so übel nicht gewesen seyn, schnatterte ein Hottentott – und, beym Goldkäfer! wenn sie zu ihren großen Augen und dicken Lippen noch kurze dicke Beine und nicht so langes Haar gehabt hätte, ich bin euch nicht gut dafür, daß ich mich nicht selbst in sie verliebt haben könnte.
Der Grieche – Aber, ach! es giebt keine Griechen mehr, welche wissen was die Gnidische Venus war!
Wir wollen nicht streiten, lieben Leute! – Der Himmel weiß, was für Drachen es in andern Planeten giebt, die sich selbst für schön, und alle unsre Liebesgöttinnen und Grazien für – Drachen halten!
Genug, die Nymfe Kikequetzel machte auf Koxkoxen denselben Eindruck, welche Juno mit Hülfe des Gürtels der Venus auf den Vater der Götter, und die schöne Fryne ohne Gürtel auf hundert tausend tapfre Griechen mit Einem Mahle machte; – und darum allein ist es zu thun.
Übrigens hätte ich wohl selbst wünschen mögen, daß die schöne Kikequetzel einen andern Namen geführt hätte. Unsre höchst verfeinerten Ohren sind durch die musikalischen Nahmen unsrer Cefisen und Cidalisen, Adelaiden und Zoraiden, Nadinen und Aminen, Belinden und Rosalinden, so verwöhnt, daß wir uns keine liebenswürdige Person ohne einen schönen Nahmen denken können. Es ist ein bloßes Vorurtheil. Aber was für eine Wirkung würde Kikequetzel in einer Tragödie oder in einem Heldengedicht, oder nur in einer kleinen Novelle thun? – Koxkox und Kikequetzel! – Wehe dem Dichter, der den Einfall hätte, diese Nahmen über das mühevolle Werk seiner Nachtwachen zu setzen! Alle Grazien und Liebesgötter könnten ihn nicht gegen das Lächerliche und Indecente in dem Nahmen Kikequetzel schützen. – Ich wiederhohle es, ich hätte ihr einen andern wünschen mögen; – und in der That, warum hätte sie nicht eben so gut Zilia oder Alzire heißen können?
Ein bloßer Zufall war Schuld daran. Als sie mit Koxkox bekannt wurde, hatte sie noch gar keinen Nahmen, und sie lebten eine geraume Zeit mit einander, ohne daß es ihm einfiel ihr einen zu geben.
Die Wahrheit von der Sache ist: Kikequetzel (welches in Koxkoxens Sprache ungefähr so viel als Freude des Lebens bedeutet) war der Nahme, den er ehmahls seinem grauen Papagay gegeben hatte. Einige Sommer nach dem Tage, da er das Mädchen unter dem besagten Rosenstrauche gefunden hatte, befiel den armen Kikequetzel das Unglück, von einer Schlange gegessen zu werden. Koxkox war etliche Tage untröstbar über diesen Verlust. Endlich fiel ihm, um das Andenken seines geliebten Papagayen zu erhalten, nichts bessers ein, als seinen Nahmen auf dasjenige überzutragen, was ihm das liebste in der Welt war: und so hieß das Mädchen Kikequetzel; – und so hat schon tausendmahl ein eben so zufälliger Umstand Dinge von unendliche Mahl größerer Wichtigkeit entschieden.
Der Umstand ist an sich so gering, daß wir ihn nicht berührt hätten, wenn er nicht dem Herzen des guten Koxkox Ehre machte.
7.
Sich hinsetzen und aussinnen, wie dem jungen Mexikaner, in dem Augenblicke, worin wir ihn zu Anfang des vorher gehenden Kapitels verlassen haben, zu Muthe gewesen seyn müsse, ist wahrlich keine so leichte Sache, als sich diejenigen vielleicht einbilden, die es nicht versucht haben.
Es ist noch lange nicht damit ausgerichtet, daß man sich etwa frage: Wie würde mir an einem solchen Platze gewesen seyn? – Nichts betrügt mehr als diese Operazion; ob wir gleich gestehen müssen, daß sie, mit gehöriger Vorsichtigkeit und zu rechter Zeit gemacht, allen Arten von Dichtern und Schauspielern – auf allen Arten von Schaubühnen gute Dienste thun kann.
Hundert verschiedene Personen würden an Koxkoxens Platze auf hunderterley verschiedene Weise empfunden und gehandelt haben. Zum Beyspiel:
Ein Mahler würde mit dem kältesten Blut einen haarscharfen Umriß von der schlafenden Mexikanerin genommen haben.
Ein inquisitiver Reisender hätte die ganze Scene in sein Tagebuch abgezeichnet, – wenn er hätte zeichnen können; wo nicht, so hätte er wenigstens eine so genaue Beschreibung davon gemacht, als ihm seine Eilfertigkeit verstattet hätte.
Ein Alterthumsforscher würde alle alte Dichter und Prosaschreiber, Münzen, Aufschriften und geschnittene Steine in seinem Kopfe gemustert haben, um etwas darunter zu suchen, wodurch er diese Begebenheit erläutern könne.
Ein Poet hätte sich gegen über gesetzt, und indessen, bis sie erwacht wäre, ein Liedchen, oder wenigstens ein kleines Madrigal gedichtet.
Ein Platonischer Filosof hätte untersucht, wie viel ihr noch fehle, um dem Ideal eines schlafenden Mädchens gleich zu kommen?
Ein Pythagoräer, – was ihre Seele in diesem Augenblicke für Visionen habe?
Ein Hedoniker, – ob und wie es thunlich seyn möchte, ihren Schlummer durch eine angenehme Überraschung zu unterbrechen?
Ein Faun würde bey der Ausführung angefangen haben, ohne zu untersuchen.
Ein Stoiker hätte sich selbst bewiesen, daß er keine Begierden habe, weil – der Weise keine Begierden hat.
Ein ächter Epikuräer hätt' es, nach einer kurzen Überlegung, nicht der Mühe werth gefunden, die Sache in längere Überlegung zu nehmen.
Ein Skeptiker hätte die Gründe für so lange gegen die Gründe gegen abgewogen, bis sie erwacht wäre.
Ein Sklavenhändler hätte sie taxiert, und, nach Berechnung der Unkosten und des Profits, auf Mittel gedacht sie sicher nach Jamaika zu bringen.
Ein Missionar hätte sich in die Verfassung gesetzt, sie, so bald sie erwachen würde, auf der Stelle zu bekehren.
Robert von Arbrissel würde sich so nahe als möglich zu ihr hingelegt und sie so lange unverwandt betrachtet haben, bis er, dem Satan zu Trotz, gefühlt hätte, daß sie ihm nicht mehr Emozion mache als ein Flaschenkürbiß.
Sankt Hilarion wäre seines Weges fortgegangen und hätte sie gar nicht angesehen.
Und so weiter – – –
Aber Koxkox – was Koxkox empfand und dachte, das verdient ein besonderes Kapitel.
8.
Koxkox war, nach der gelehrten Zeitrechnung des Filosofen Tlantlaquakapatli, – gegen welche sich vielleicht Einwendungen machen ließen, ohne daß den Wissenschaften ein merklicher Nutzen aus der ganzen Erörterung zugehen würde – Koxkox, sage ich, war in dem wichtigen Augenblicke, wovon die Rede ist, achtzehn Jahre, drey Monate, und einige Tage, Stunden, Minuten und Sekunden alt.
Er war fünf Fuß und einen halben Palm hoch, stark von Gliedmaßen, und von einer so guten Leibesbeschaffenheit, daß er niemahls in seinem Leben weder Husten, noch Schnupfen, noch Magendrücken, noch irgend eine andre Unpäßlichkeit gehabt hatte; – welchen Umstand der weise und vorsichtige Kornaro, in seinem bekannten Buche von den Mitteln alt zu werden, seiner Mäßigkeit und einfältigen Lebensart zuschreibt.
Die Absonderung seiner Säfte ging also vortrefflich von Statten, und die flüssigen Theile befanden sich bey ihm mit den festen in diesem glücklichen Gleichmaße, welches, nach dem göttlichen Hippokrates, die Bedingung einer vollkommenen Gesundheit ist.
Alle seine Sinne und sinnlichen Werkzeuge befanden sich in derjenigen Verfassung, welche – in allen Handbüchern der Wolfischen Metafysik – zum Empfinden erfordert wird. Die Kanäle seiner Lebensgeister waren nirgends verstopft, und die Fortpflanzung der äußern Eindrücke in den Sitz der Seele, (welche, im Vorbeygehen zu sagen, ihm so bekannt war als irgend einem Psychologen unserer Zeit) nebst der Absendung der Volizionen und Nolizionen aus dem Kabinet der Seele in die äußersten Fäserchen derjenigen Werkzeuge, welche bey Ausführung derselben unmittelbar interessiert waren, ging mit der größten Leichtigkeit und Behendigkeit von Statten.
Er hatte ungefähr vor zwey Stunden eine starke Mahlzeit von Früchten und geröstetem Maiz gethan, und ungefähr drey Nößel von einem Trank aus Wasser, Kakaomehl und Honig zu sich genommen, von welchen beiden Ingredienzien das erste bekannter Maßen sehr nährend, und das andre, nach Boerhaave und allen die Er abgeschrieben hat und die Ihn abgeschrieben haben, ein vortreffliches Konfortativ ist, dessen Koxkox weniger als irgend einer von unsern angeblichen Mädchenfressern nöthig gehabt zu haben scheint.
Es war ungefähr um vier Uhr Nachmittags, in dem Monat, worin ein allgemeiner Geist der Liebe die ganze Natur neu belebt, alle Pflanzen blühen, tausend Arten von bunten Fliegen und Schmetterlingen, aus ihren selbst gesponnen Gräbern aufgestanden, ihre feuchten Flügel in der Sonne versuchen, und zehen tausend vielfarbige Wizizilis auf jungen Zweigen aus ihrem langen Winterschlummer erwachen, um unter Rosen und Orangenblüthen zu schwärmen, und ihr wollüstiges Leben, welches mit der Blumenzeit anfängt, zugleich mit ihr zu beschließen.
Es ist sehr zu bedauern, daß Tlantlaquakapatli, aus Mangel eines Reaumürschen oder irgend eines andern Thermometers, nicht im Stande war, den Grad der Wärme zu bestimmen, auf welchem sich damahls die Luft befand.
Es war ein schöner, warmer Tag, sagt er, die Luft rein, und der oberste Theil derselben lasurblau; und es wehte ein angenehmer Wind von Nord-West-West, welcher die Sonnenhitze so gut mäßigte, daß das Roth auf Koxkoxens Wangen, etliche Augenblicke zuvor eh' er das schlafende Mädchen erblickte, nicht höher war, als es auf den innersten Blättern einer neu aufgehenden Rose zu seyn pflegt.
Unser Filosof – welcher glaubt, daß alle diese Umstände bey Berechnung der Ursachen und Wirkungen der menschlichen Leidenschaften mit in Rechnung gebracht werden müssen – ist eben so genau in Angebung aller der kleinen Bestimmungen, unter welchen die schöne Kikequetzel dem jungen Mexikaner in die Augen stach.
Seiner Beschreibung nach, war sie gerade so gekleidet, wie die Grazien der Griechen oder die Töchter der Karaiben auf den Antillen, das ist in derjenigen Kleidung, wegen welcher der ältere Plinius – vermuthlich in einem Anstoß von schlimmer Laune – mit der Natur einen Zank anfängt, der uns (alles wohl überlegt) der unbilligste unter allen scheint, welche jemahls ein mißmüthiger Filosof mit ihr angefangen hat.1
Sie lag auf einem grünen Rasen, dessen dichtes blumenvolles Gras sie (wie Homer von seiner bekannten Göttergruppe auf dem Ida sagt) sanft empor zu heben schien. Ihr Haupt ruhte auf einem Haufen der schönsten Blumen, welche sie vermuthlich selbst (es wäre denn, daß man glauben wollte, daß Zefyr oder irgend ein andrer Sylfe ihr diese Galanterie gemacht habe) zu diesem Gebrauch zusammen getragen hatte. Ihr rechter Arm – dessen schöne Form unser Filosof nicht unbemerkt läßt – verbarg einen Theil ihres Gesichts, und bekam durch die Verkürzung, und den sanften Druck, den er von seiner Lage litt, einen Reitz, der – wie alle Grazien – sich besser fühlen als zeichnen, und besser zeichnen als beschreiben läßt. – Das leichte Gesträuch, welches eine Art von Sonnenschirm um sie zog, warf kleine bewegliche Schatten auf sie hin, welche die pittoreske Schönheit des Gemähldes – denn noch war es nichts mehr für unsern Mann – erheben halfen.
9.
Tlantlaquakapatli untersteht sich aus verschiedenen Ursachen nicht, zu bestimmen, wie schön das Mädchen gewesen sey; – denn
Erstlich, (sagt er) fehlen mir dazu die nöthigen Originalgemählde, Zeichnungen, Abdrücke, u. s. w.
Zweytens, haben wir kein allgemein angenommenes Maß der Schönheit, und
Drittens, ist auch keines möglich, – bis alle Menschen, an allen Orten und zu allen Zeiten, aus einerley Augen sehen, und den Eindruck mit einerley Gehirn auffassen werden; – und das, spricht er, hoffe ich nicht zu erleben.
Indessen getraut er sich so viel zu behaupten, daß sie, so wie sie gewesen, dem ehrlichen Koxkox das schönste und lieblichste Ding in der ganzen Natur geschienen habe; – und wir zweifeln, ob es möglich sey ihm das Gegentheil zu beweisen.
Die Wahrheit zu sagen, bey einem Dinge, welches das einzige in seiner Art ist, hat weder Vergleichung noch Übertreibung Statt. Koxkox konnte keine Idee von etwas besserm haben als er vor sich sah. Seine Einbildungskraft hatte gar nichts bey der Sache zu thun; seine Sinne und sein Herz thaten alles. Kikequetzel hätte so schön seyn mögen als Kleopatra, Poppäa, Roxelane oder Frau von Montespan, oder, wenn ihr lieber wollt, so schön als Oriane, Magellone, Frau Kondüramur, und die Prinzessin Dulcinea selbst, ohne daß sie ihm um ein Haar schöner vorgekommen wäre, oder um den hundertsten Theil des Drucks eines Blutkügelchens mehr Eindruck auf ihn gemacht hätte, als so wie sie vor ihm lag.
»Das ist wunderlich.« – Es ist nicht anders, mein Herr.
Unser Autor – dessen verloren gegangene Schriften der geneigte Leser um so mehr mit mir bedauern wird, als uns diese Probe von seinem Beobachtungsgeiste keine schlechte Meinung giebt – geht noch weiter, indem er sich sogar getraut, die eigensten Empfindungen von Augenblick zu Augenblick zu bestimmen, welche Koxkox, einem so unverhofften Gegenstand gegen über, habe erfahren müssen.
Beym ersten Anblick, spricht er, schauerte der Jüngling, in einer Art von angenehmem Schrecken, zwey und einen halben Schritt zurück.
Im Zweiten Momente guckte er, mit aller Begierde eines Menschen der sich betrogen zu haben fürchtet, wieder nach ihr hin. Der Durchmesser seines Augapfels wurde eine halbe Linie größer; er hielt die linke Hand etwas eingebogen vor seine Stirne, so daß der Daumen an den linken Schlaf zu liegen kam, und schlich sich allgemach mit zurück gehaltenem Athem näher, um sie desto besser betrachten zu können.
Im Dritten Momente glaubte er einen kleinen Unterschied zwischen ihrer Figur und der seinigen wahrzunehmen, und eine Bestürzung von der angenehmsten Art, welche ihn bey dieser Entdeckung befiel, nahm
Im Vierten, und
Fünften dergestalt zu, daß er im
Sechsten eine Art von Beklemmung ums Herz fühlte, welche sich ungefähr im
Neunten oder Zehenten mit der oben besagten Ergießung des subtilen elektrischen Feuers aus seinem Herzen durch alle Adern, Kanäle und Fasern seines ganzen Wesens endigte.
Dieser letzte Augenblick ist, nach der Meinung unsers Autors, der angenehmste in dem ganzen Leben eines Menschen; und dasjenige, was er darüber filosofiert, scheint uns nicht unwürdig zu seyn, in einem kleinen Auszug zu einem eigenen Kapitel gemacht zu werden.
10.
Die ganze Natur, spricht er, zeugt von der Güte und Weisheit ihres Urhebers.
Aber in der ganzen Natur überzeugt mich, – Tlantlaquakapatli, Mixquitlipikotsohoitl's Sohn, nichts vollkommner und inniger von dieser größten und besten aller Wahrheiten, als die Beobachtung der besondern Aufmerksamkeit, welche dieser unsichtbare Geist der Natur darauf gewandt hat, – den höchsten Grad des Vergnügens, dessen der Mensch fähig ist, mit denjenigen Empfindungen unauflöslich zu verbinden, welche den großen Endzweck seines Daseyns unmittelbar befördern.
Glaub' ich, am Ende einer feurigern Bestrebung meines Geistes durch die krummen Irrgänge der Einbildung, eine schon lange vor mir fliehende Wahrheit erhascht zu haben;
Oder, unterhalt' ich mich, einsam und in mich selbst gesammelt, mit dem Anschauen eines tugendhaften Karakters; – ich seh' ihn in Handlung gesetzt, in Versuchungen verwickelt, mit Schwierigkeiten umringt; – ich zittre für ihn; – und nun, in dem großen Augenblicke der Entscheidung, seh' ich ihn seiner würdig handeln, und meine schüchterne Hoffnung durch die schönste der Thaten überraschen;
Oder, mein besseres Selbst hat in diesem Augenblick einen Sieg über das unedlere erhalten; – ich habe eine eigennützige Bewegung unterdrückt, welche mich verhindern wollte etwas Gutes zu thun, da ich einen Wink dazu bekam; – oder eine übelthätige, welche mich aufwiegelte eine Beleidigung zu rächen, weil ich es, ohne Besorgniß mir selbst dadurch zu schaden, hätte thun können;
Oder, ich habe dem süßen Zug der Menschlichkeit gefolget, und mit sanfter mitleidiger Hand die Thränen des Unglücklichen abgewischt, die Freude ins bleiche Gesicht des Bekümmerten zurück gerufen:
In allen diesen, und in allen ähnlichen Fällen, fühle ich, in dem entscheidenden Augenblicke, diese göttliche Flamme sich mit einer unaussprechlichen geistigen Wollust durch mein ganzes Wesen ergießen, und den sittlichen Menschen mit dem animalischen wie in Eins zusammen schmelzen; – und ich sag' und schwöre, daß keine andre Wollust so süß, so befriedigend, und – wenn ihr mir diesen Ausdruck gestatten wollt – so vergötternd ist als diese.
Ich habe, fährt er fort, auch unter Rosen gelegen, o Montezuma! Ich habe mich auch in den Düften des Rosenstrauchs, im säuerlichsüßen Nektar des Palmbaums, und in den süßen Küssen des Mädchens berauscht. – Hab' ich nicht den Becher der Freude rein ausgetrunken, und den letzten Tropfen von meinem Nagel abgesogen? – Aber, ich behaupte dir und schwöre, daß die Wollust eine gute That zu thun – die größte aller Wollüste ist!
Sanft ruhe deine Asche, weiser und empfindungsvoller Tlantlaquakapatli! und Friede sey mit deinem Schatten, wo er auch irren mag! Wenn schon dein Nahme in keinem Gelehrtenregister prangt, und kein hohlaugiger Kommentator, in eine Wolke von Lampendampf (das Sinnbild seiner viel wissenden Dummheit) eingehüllt, polyglottische Noten mit schwerer Arbeit zu deinen Werken zusammen getragen hat; so soll dennoch – oder mein weissagender Genius müßte mich gänzlich betrügen – dein Gedächtniß noch dauern, wenn ich lange, wie du selbst, Staub bin, und von dem Menschenfreunde gesegnet werden, dessen klopfendes Herz dir die große Wahrheit beschwören hilft: daß die Wollust eine gute That zu thun die größte aller Wollüste ist.