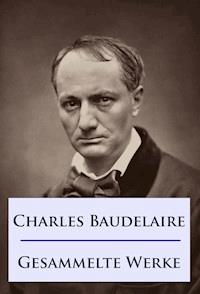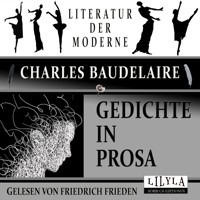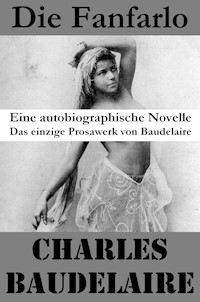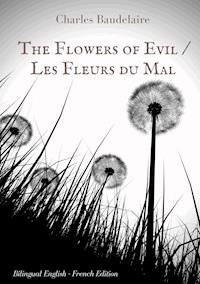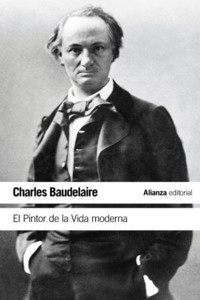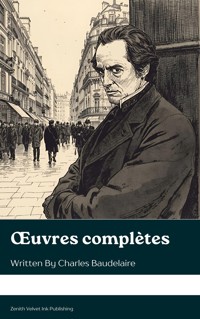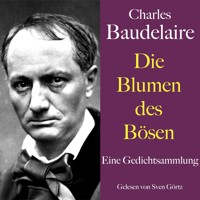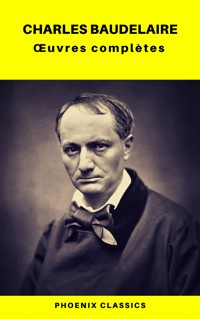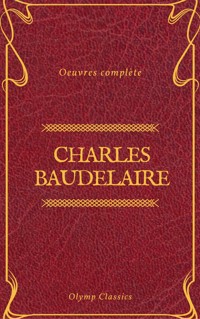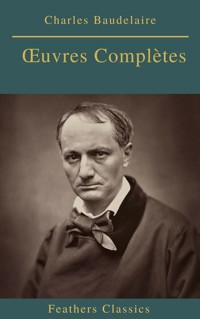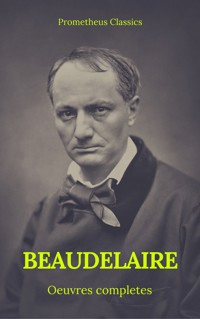Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Les Fleurs du Mal / Die Blumen des Bösen) ist ein Gedichtband Charles Baudelaires, der von 1857 bis 1868 in drei Fassungen wachsenden Umfangs und unterschiedlicher Anordnung herausgegeben worden ist. Die Erstausgabe führte zu einem gerichtlichen Verfahren: Baudelaire wurde wegen Verletzung der öffentlichen Moral verurteilt und die weitere Veröffentlichung von sechs als anstößig bezeichneten Gedichten verboten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Blumen des Bösen
Charles Baudelaire
Inhalt 1
Wenn nach des Himmels mächtigen Gesetzen
Der Dichter kommt in diese müde Welt,
Schreit seine Mutter auf, und voll Entsetzen
Flucht sie dem Gott, den Mitleid selbst befällt.
»Warum gebar ich nicht ein Nest voll Schlangen,
Statt diesem Spottgebild verwünschter Art!
Verflucht die Nacht, in der mein Bauch empfangen,
Da flüchtiger Lust so bittre Strafe ward!
Was wähltest du mich aus von allen Frauen,
Dem blöden Mann zur ekelvollen Wut,
Was werf' ich nicht die Missgeburt voll Grauen
Gleich einem Liebesbrief in Feuersglut!
Doch ich will deinem Hasse nicht erliegen,
Ich wälz' ihn auf das Werkzeug deines Grolls
Und will den missgeratnen Baum so biegen,
Dass keine Frucht entspringt dem faulen Holz.«
So presst sie geifernd ihren Grimm zusammen,
Nichts ahnend von des Himmels Schluss und Rat,
Und schürt sich in Gehenna selbst die Flammen
Für ihre mütterliche Freveltat.
Indessen zieht ein Engel seine Kreise,
Und der Enterbte blüht im Sonnenschein,
Und zu Ambrosia wird ihm jede Speise
Und jeder Trank zu goldnem Nektarwein.
Zum Spiel taugt Wind ihm, Wolken und Gestirne,
Berauscht von Liedern zieht er durch sein Reich,
Und traurig senkt der Engel seine Stirne,
Sieht er ihn sorglos, heitern Vögeln gleich.
Denn alle, die er liebt, voll Scheu ihn messen;
Weil seine Sanftmut ihren Groll entfacht,
Versuchen sie ihm Klagen zu erpressen,
Erproben sie an ihm der Roheit Macht.
Sie mischen eklen Staub in seine Speisen,
Beschmutzen jedes Ding, dem er sich naht.
Was er berührt, sie heuchelnd von sich weisen,
Und schreien »wehe«, kreuzt er ihren Pfad.
Auf öffentlichem Markt, wie eine Dirne,
Höhnt laut sein Weib: »Da mir sein Beten gilt,
So will ich auch vom Sockel bis zur Stirne
Vergoldet sein gleich einem Götzenbild.
Berauschen will ich mich an Weihrauch und Essenzen,
An Wein und Huldigung mich trinken satt,
Und da er göttergleich mich will bekränzen,
Werd ich beherrschen ihn an Gottes Statt!
Und will die Posse mir nicht mehr gefallen,
Pack' ich ihn mit der schwachen, starken Hand,
Mit meinen Nägeln wie Harpyenkrallen
Zerfleisch ich ihn, bis ich sein Herze fand.
Gleich einem jungen Vogel fühl' ichs zittern,
Zuckend und rot wird's meiner Hände Raub,
Und um mein Lieblingstier damit zu füttern,
Werf ich es voll Verachtung in den Staub!«
Zum Himmel, zu dem ewigen Strahlensitze
Hebt fromm der Dichter seine Hände auf,
Und seines lichten Geistes weite Blitze
Verhüllen ihm des Volks blindwütigen Häuf:
»Dank, dir, o Gott, der uns das Leid liess werden,
Das uns erlöst aus tiefer Sündennacht,
Das reine Elixier, das schon auf Erden
Die Starken deiner Wonnen würdig macht!
Dem Dichter wahrst du deiner Sitze besten
Inmitten seliger Legionen Schar,
Ich weiss, du lädst ihn zu den ewigen Festen
Der Herrlichkeit und Tugend immerdar.
Ich weiss, nicht Welt noch Hölle macht zum Hohne
Den einzigen Adel, den der Schmerz verleiht.
Ich weiss, auf meinem Haupt die Wunderkrone
Muss leuchten über Welt und Ewigkeit.
Ich weiss, dass Schätze, die versunken schliefen,
Dass Gold und Edelstein aus finstrem Schacht,
Dass Perlen, die du hebst aus Meerestiefen,
Nicht würdig sind für dieser Krone Pracht.
Denn sie ward aus dem reinsten Licht gesponnen,
Das der Urflamme heiliger Herd besass,
Des Menschen Blick, die leuchtendste der Sonnen
Erlischt vor ihrem Glanz wie mattes Glas.
Der Albatros
Oft kommt es vor, dass, um sich zu vergnügen,
Das Schiffsvolk einen Albatros ergreift,
Den grossen Vogel, der in lässigen Flügen
Dem Schiffe folgt, das durch die Wogen streift.
Doch, – kaum gefangen in des Fahrzeugs Engen
Der stolze König in der Lüfte Reich,
Lässt traurig seine mächtigen Flügel hängen,
Die, ungeschickten, langen Rudern gleich,
Nun matt und jämmerlich am Boden schleifen.
Wie ist der stolze Vogel nun so zahm!
Sie necken ihn mit ihren Tabakspfeifen,
Verspotten seinen Gang, der schwach und lahm.
Der Dichter gleicht dem Wolkenfürsten droben,
Er lacht des Schützen hoch im Sturmeswehn ;
Doch unten in des Volkes frechem Toben
Verhindern mächt'ge Flügel ihn am Gehn.
Erhebung
Hoch über stillen Wäldern, blauen Meeren,
Hoch über eisiger Gletscher Einsamkeit
Und über Wolkenflügen weltenweit,
Jenseits der sternbeglänzten ewigen Sphären
Dort regst du dich, mein Geist, so frei und jung!
Wie kühne Schwimmer durch die Wellen gleiten,
So ziehst du durch die unermessnen Weiten
Voll grosser, männlicher Begeisterung.
Flieh' aus der Erde giftigtrübem Schlamme,
Steig' auf zum Äther, Seele, werde rein!
Und trink wie einen starken Götterwein
Der lichten Räume himmlischklare Flamme.
Weit hinter dir lass Kummer, Schuld und Streit,
Die dumpf und lastend dich zur Erde zwingen,
Beglückt, wer sich erhebt auf leichten Schwingen
Zu leuchtender Gefilde Heiterkeit!
Wessen Gedanken gleich der Lerche steigen
Des Morgens frohbeschwingt zum Firmament,
Wer überm Leben schwebt und mühlos kennt
Der Blumen Sprache und der Dinge Schweigen!
Zusammenklang
Im Tempel der Natur, in Säulengängen,
Durch die oft Worte hallen, fremd, verwirrt,
Der Mensch durch einen Wald von Zeichen irrt,
Die mit vertrauten Blicken ihn bedrängen.
Wie weite Echo fern zusammenklingen
Zu einem einzgen feierlichen Schall,
Tief wie die Nacht, die Klarheit und das All,
So Düfte, Farben, Klänge sich verschlingen.
Denn es gibt Düfte, frisch wie Kinderwangen,
Süss wie Oboen, grün wie junges Laub,
Verderbte Düfte, üppige, voll Prangen,
Wie Weihrauch, Ambra, die zu uns im Staub
Den Atemzug des Unbegrenzten bringen
Und unsrer Seelen höchste Wonnen singen.
Den Entschwundenen
Den entschwundenen, nackten Zeiten bin ich so hold,
Da Phöbus die Säulen umwob mit lauterem Gold,
Da Mann und Weib ohne Lüge und schamhaftes Bangen
In heiter beweglichem Spiel durch das Leben gegangen,
Und – vom zärtlichen Licht umspielt und umflossen –
Ihrer edlen Leiber kraftvolle Schönheit genossen.
Als Cybele fruchtbar, verschwenderisch fast
Ihre Kinder nicht fühlte als drückende Last
Und wie eine Wölfin mit mütterlich drängenden Lüsten
Die ganze Erde getränkt an den schwellenden Brüsten,
Als der Mensch geschmeidig, voll siegreicher Pracht
Mit stolzem Recht sich zum König der Erde gemacht,
Und die edlen Früchte ohne Flecken und Schaden
Mit frischem und saftigem Fleisch zum Bisse geladen.
Will in unseren Tagen ein Dichter bewundernd schauen
Ursprüngliche Schönheit, da wo Männer und Frauen
In Nacktheit sich zeigen, da fühlt er die Freude entfliehen,
Da fühlt er den eisigen Frost seine Seele durchziehen
Vor dem düsteren Bild dieser Hässlichkeit,
Vor der Missgeburt, die nach Kleidern schreit!
O armselig Zerrbild, für Masken geschaffen!
Ihr mageren Rümpfe, ihr feisten, ihr schlaffen,
Die der Nützlichkeit Gott unerbittlich und fest
Schon als Kinder in eherne Windeln gepresst!
Ihr Frau'n, die ihr bleich seid wie wächserne Kerzen,
Die Wollust nagt euch am Leib und am Herzen,
Jungfraun, durch ererbte Sünden entweiht,
Ihr schleppt schon der Mutterschaft Hässlichkeit!
Wohl ist uns, die wir zum Untergang neigen,
andere Schönheit, den Eilten verschlossen, zu eigen,
Gesichter, drin glühendes Leiden brennt,
Darin man die Schönheit des Siechtums erkennt;
Diese Gabe jedoch, aus der Muse zögernden Händen
Soll uns, des Untergangs Kindern, die Blicke nicht blenden.
Wir huldigen tief und voll Leidenschaft
Der heiligen Jugend, der Jugend voll Klarheit und Kraft.
Deren Auge strahlend und klar wie die fliessende Quelle,
Die überall Leben spendet und sorglose Helle,
Die in des Himmels Leuchten, der Vögel Gesang,
Die Duft ist und Wärme und Farbe und Klang.
Die Leuchttürme
Rubens, der Trägheit Garten, des Vergessens Bronnen,
Ein Lager blüh'nden Fleisches, der Liebe leer,
Doch so von Leben und von Glut durchronnen
Wie von der Luft das All, das Meer vom Meer.
Leonard da Vinci Spiegel tief und dunkel,
Wo Engel lächeln süss und rätselschwer
Aus Fichtenschatten, grünem Eisgefunkel
Von ihrer Heimat Gletschergipfeln her.
Rembrandt, das Haus der Traurigen und Kranken,
Von einem hohen Kruzifix erhellt,
Gebete, Seufzer überm Unrat schwanken,
Ein kalter Schimmer jäh ins Dunkel fällt.
Buonarroti, fern, wo Riesenschatten schweben,
Wo Herkules mit Christus sich verband,
Gespenster steil aus ihrer Gruft sich heben,
Mit starrem Finger fetzend ihr Gewand.
Der in des Pöbels Wut, des Fauns Erfrechen,
Der Schönheit fand selbst in der Schurken Reich,
Puget, du grosses Herz voll Stolz und Schwächen,
Der Sklaven König, kummervoll und bleich.
Watteau, ein Fest, wo Herzen leuchtend irren,
Den Schmetterlingen gleich, ein Faschingsball,
Lieblicher Zierat, Glanz und Lichter schwirren
Und Tollheit wirbelnd durch den Karneval.
Goya, ein Nachtmahr, ferner wirrer Schrecken,
Leichengeruch vom Hexensabbat weht,
Wo, lüsterner Dämonen Gier zu wecken,
Die nackte Kinderschar sich biegt und dreht.
Und Delacroix, Blutsee, wo Geister hausen.
Im Schatten tief, der Himmel schwer wie Blei,
Wo durch die trübe Luft Fanfaren brausen
Seltsamen Klangs, wie ein erstickter Schrei.
Dies alles, Fluch und Lästerung und Sünden,
Verzückungsschrei, Gebet und Todesschmerz
Ist Widerhall aus tausend dunklen Gründen,
Berauschend Gift für unser sterblich Herz.
Ein Schrei ist's, der da gellt in tausend Stürmen,
Die Losung, die von tausend Lippen schallt,
Leuchtfeuer, das da flammt von tausend Türmen,
Des Jägers Ruf, der durch die Wildnis hallt.
Ein Zeichen, Gott, das wir dir bringen wollen,
Vor deinen Herrlichkeiten zu bestehn,
Glühende Tränen, die durchs Weltall rollen
Und an der Ewigkeiten Rand vergehn.
Die kranke Muse
Du arme Muse, was ist dir geschehn?
Im hohlen Blick les' ich die nächtgen Qualen,
Und muss den Wahnsinn und den Schreck, den fahlen
Im stummen, angstgequälten Antlitz sehn.
Gossen sie Lieb' und Furcht aus ihren Schalen,
Die grünen Zwerge und die rosigen Feen?
Hat dich der Alb gepackt mit eisigem Wehn
Und dich erstickt in wilden Zauber quälen?
Ich wollt', dein Atem wäre stets voll Kraft,
Dass er nur starker Dinge Abbild schafft!
Des Blutes Rauschen rhythmischer Gesang,
Wie er in jenen alten Zeiten klang,
Als Phöbus und der grosse Pan regierten,
Des Liedes Vater und der Gott der Hirten.
Die käufliche Muse
O meine Muse, der Paläste Kind!
Wirst du, wenn erst der Winter hetzt die Raben,
Für deinen nackten Fuss ein Feuer haben
In trüber Schneenacht und bei eisigem Wind?
Willst du die marmorkalten Schultern laben
Am nächtigen Strahl, der durch die Läden rinnt?
Willst du, wenn leer dir Tasch' und Gaumen sind,
Verborgnes Gold aus blauen Höhlen graben ?
Allabendlich wird dich der Hunger zwingen,
Chorkindern gleich beim Weihrauchfass zu singen
Den Lobgesang, der deinen Schmerz verhöhnt,
Seiltänzern gleich wirst du zur Schau dich stellen.
Indes dein Lachen, darin Schreie gellen,
Des rohen Haufens Gier und Lüsten frönt.
Der schlechte Mönch
Aus alter Klöster hohem Wandgemälde
Schaut oft der heiligen Wahrheit Angesicht,
Den Brüdern, die der fromme Eifer quälte,
Ein wenig Wärme spendend, Trost und Licht.
Zur Zeit, da Christi Saat geblüht, erwählte
Manch edler Mönch, von dem man heut kaum spricht,
Das Leichenfeld zur Werkstatt und erzählte
In Bildern uns vom Tode stark und schlicht.
Mein Herz gleicht einer finstern Klosterzelle,
Seit Ewigkeiten tritt mein Fuss die Schwelle, –
Mit nichts hab' ich die kahle Wand geschmückt.
Ich träger Mönch, wann werd' ich endlich geben
Aus jenem öden Schauspiel, meinem Leben,
Was meine Hand erschuf, mein Aug' beglückt?
Der Feind
Mein Kinderland war voll Gewittertagen,
Nur selten hat die Sonne mich gestreift,
Und so viel Bluten hat der Blitz zerschlagen,
Dass wenig Früchte nur mein Garten reift.
Nun kommt der Herbst, – ich muss zur Harke greifen,
Die Erde sammeln, die verwüstet schlief,
In die der Regen Risse grub und Streifen
Und manche Holde wie ein Grab so tief.
Doch ob den Blumen, die erhofft mein Träumen,
In dieses wild zerwühlten Ackers Räumen
Die Wundernahrung wird voll Glut und Kraft?
O Schmerz! die Zeit trinkt unsren Lebenssaft,
Der dunkle Feind, der uns am Herzen zehrt
Und sich von unsrem Blute stärkt und mehrt!
Der Unstern
So schwere Lasten zu heben,
Bedarf es des Sisyphus Mut,
Und hätten wir Kraft auch und Glut,
Lang ist die Kunst, flüchtig das Leben.
Fern ruhmreicher Sarkophage,
An des Friedhofs verlassenem Hang,
Wie verdeckter Trommel Gesang
Schlägt mein Herz nun die trauernde Klage.
Manches Kleinod von leuchtender Glut
In finstrer Verborgenheit ruht,
Wohin Sonde und Senkblei nicht gleiten.
Manche Blume der edelsten Art
Strömt Duft wie Geheimnis so zart
In der Wildnis verlorene Weiten.
Das frühere Leben
Ich wohnte lang in weiter Hallen Schweigen,
Die abends in der Meeressonne Glut
Sich stolz erheben und zur blauen Flut
Sich gleich basaltnen Grotten niederneigen.
Das Meer, darauf des Himmels Abbild ruht,
Tönt feierlich beim Auf- und Niedersteigen,
Und der Akkorde übermächt'ger Reigen
Strömt in den Abend voller Gold und Blut.
Dort lebt' ich lang in dämmerstillem Lächeln,
Voll Wollust atmend Glanz und blaue Luft;
Die nackten Sklaven, ganz getaucht in Duft,
Sie mussten mir die müde Stirne fächeln,
Von einer einzigen Sorge nur beschwert,
Das Leid zu finden, das mein Herz verzehrt.
Zigeuner auf der Fahrt
Zum Aufbruch muss der Stamm der Zaubrer rüsten,
Glutäugig Volk. – Es schleppt der Weiber Schar
Bücklings die Kinder, reicht dem Säugling dar
Den stets bereiten Schatz aus braunen Brüsten.
Zu Fuss die Männer, deren Waffen flimmern,
Die Karren rollen langsam nebenher;
Und Aller Augen wandern sehnsuchtsschwer
Zum Himmel, wo die fernen Träume schimmern.
Sie ziehn vorbei, – und im Versteck die Grille
Singt doppeltlaut ihr Lied durch Morgenstille;
Die Erde, die sie liebt, vermehrt ihr Grün,
Lässt Felsen sprudeln, lässt die Wüste blühn
Für sie, die in der Zukunft dunkles Brauen
Wie in vertraute lichte Lande schauen.
Der Mensch und das Meer
Du freier Mensch, du liebst das Meer voll Kraft,
Dein Spiegel ist's. In seiner Wellen Mauer,
Die hoch sich türmt, wogt deiner Seele Schauer,
In dir und ihm der gleiche Abgrund klafft.
Du liebst es, zu versinken in dein Bild,
Mit Aug' und Armen willst du es umfassen,
Der eignen Seele Sturm verrinnen lassen
In seinem Klageschrei, unzähmbar wild.
Ihr beide seid von heimlich finstrer Art.
Wer taucht, o Mensch, in deine letzten Tiefen,
Wer kennt die Perlen, die verborgen schliefen,
Die Schätze, die das neidische Meer bewahrt?
Und doch bekämpft ihr euch ohn' Unterlass
Jahrtausende in mitleidlosem Streiten,
Denn ihr liebt Blut und Tod und Grausamkeiten,
O wilde Ringer, ewiger Bruderhass!
Don Juan in der Unterwelt
Als Don Juan, den schwarzen Fluss erreichend,
Den Fährmann zahlte und bestieg das Schiff,
Ein finstrer Bettler, Antisthenes gleichend,
Mit starkem Rächerarm zum Ruder griff.
Laut stöhnend warfen sich die Frau'n zur Erde,
Mit schlaffen Brüsten und zerfetztem Kleid,
Wie Brüllen einer aufgescheuchten Herde
Klang ihr Geschrei, gedehnt, voll dumpfem Leid.
Sganarell heischte Lohn, sein Lachen schwirrte.
Indes Don Louis, die Greisenhand gereckt,
Der Totenschar, die an den Ufern irrte,
Den Sohn wies, der sein Haupt mit Schmach bedeckt.
Nah ihrem Gatten, fröstelnd, sass Elvire,
In ihrer Trauer aller Anmut bar,
Fleht' um das letzte Lächeln letzter Schwüre,
So süss und falsch wie jenes erste war. –
Ein grosser fremder Mann, in Stahl die Glieder,
Lenkte das Steuer, steinernen Gesichts.
Der bleiche Held beugte aufs Schwert sich nieder,
Betrachtete die Flut und weiter nichts.
An Theodor von Banville
Du hast die Muse so beim Haar ergriffen.
So herrisch sie besiegt voll schöner Lässigkeit,
Dass du ein Held erschienst, ein Bravo, der im Streit
Sein Lieb erdolcht, die Waffe blankgeschliffen.
Dein Blick war feurig und voll junger Kraft,
Und Kühnheit zeigtest du und Stolz und Stärke
Im künstlerischen Wunderbau der Werke,
Aus denen atmet künftige Meisterschaft.
Uns Dichtern starrt das Blut im Glück, im Leid.
War's Zufall, dass man des Kentauren Kleid,
Das Blut und Mark gerinnen liess in Qualen,
Im scharfen Gift getränkt zu dreien Malen,