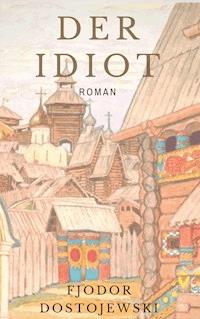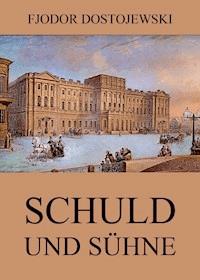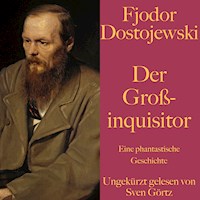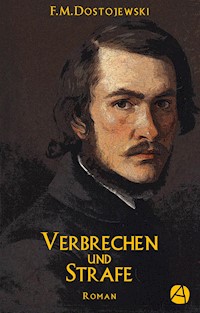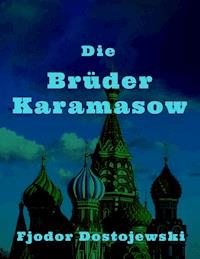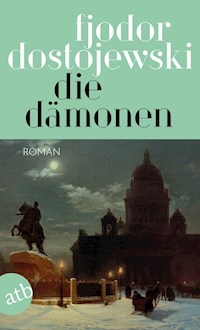
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Intrigen und Irrsinn.
Die Generalswitwe Warwara Petrowna und der ehemalige Hauslehrer Stepan Trofimowitsch haben sich in einiger Entfernung von St. Petersburg zur Ruhe gesetzt. Unerwartet tauchen ihre inzwischen erwachsenen Söhne auf und kehren das Unterste zuoberst. Ein »revolutionäres Komitee« soll sämtliche Autoritäten stürzen. Dämonen gleich, überzieht es die Stadt mit einem Spinnennetz von Intrigen und aufrührerischen Ideen, bis alles außer Kontrolle gerät. Ein Roman über das Russland des 19. Jahrhunderts, in dem der bröckelnde Zarismus mit neuen zerstörerischen Kräften zusammenprallt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1347
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Intrigen und Irrsinn.
Die Generalswitwe Warwara Petrowna und der ehemalige Hauslehrer Stepan Trofimowitsch haben sich in einiger Entfernung von St. Petersburg zur Ruhe gesetzt. Unerwartet tauchen ihre inzwischen erwachsenen Söhne auf und kehren das Unterste zuoberst. Ein »revolutionäres Komitee« soll sämtliche Autoritäten stürzen. Dämonen gleich, überzieht es die Stadt mit einem Spinnennetz von Intrigen und aufrührerischen Ideen, bis alles außer Kontrolle gerät. Ein Roman über das Russland des 19. Jahrhunderts, in dem der bröckelnde Zarismus mit neuen zerstörerischen Kräften zusammenprallt.
»Dostojewski ist ein Ozean bei hohem Seegang, unzuverlässigen Winden und abrupt wechselnder Temperatur.« FAZ
Über Fjodor Dostojewski
Fjodor Dostojewski (1821–1881) wurde in Moskau als Sohn eines Militärarztes und einer Kaufmannstochter geboren. Er studierte an der Petersburger Ingenieurschule und widmete sich seit 1845 ganz dem Schreiben. 1849 wurde er als Mitglied eines frühsozialistischen Zirkels verhaftet und zum Tode verurteilt. Unmittelbar vor der Erschießung wandelte man das Urteil in vier Jahre Zwangsarbeit mit anschließendem Militärdienst als Gemeiner in Sibirien um. 1859 kehrte Dostojewski nach Petersburg zurück, wo er sich als Schriftsteller und verstärkt auch als Publizist neu positionierte.
Wichtigste Werke: »Arme Leute« (1845), »Der Doppelgänger« (1846), »Erniedrigte und Beleidigte« (1861), »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1862), »Schuld und Sühne« (1866), »Der Spieler« (1866), »Der Idiot« (1868), »Die Dämonen« (1872), »Der Jüngling« (1875), »Die Brüder Karamasow« (1880).
Michael Wegner (geboren 1930 in Kaunas, Litauen), war bis 1991 Professor für russische Literaturgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er ist der Herausgeber der Gogol-Ausgabe und der renommierten Dostojewski-Ausgabe des Aufbau-Verlags und Autor von Veröffentlichungen zur Geschichte und Theorie des Romans und zu deutsch-russischen Kulturbeziehungen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Fjodor Dostojewski
Die Dämonen
Roman in drei Teilen
Aus dem Russischen von Günter Dalitz
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Erstes Kapitel: Anstelle eines Vorworts: Einige Details aus der Biographie des hochgeschätzten Stepan Trofimowitsch Werchowenski
Zweites Kapitel: Prinz Heinrich • Eine Brautwerbung
Drittes Kapitel: Fremde Sünden
Viertes Kapitel: Die Hinkende
Fünftes Kapitel: Die kluge Schlange
Zweiter Teil
Erstes Kapitel: Nacht
Zweites Kapitel: Nacht (Fortsetzung)
Drittes Kapitel: Das Duell
Viertes Kapitel: Alle sind voller Erwartung
Fünftes Kapitel: Vor dem großen Fest
Sechstes Kapitel: Pjotr Stepanowitsch in Schwierigkeiten
Siebentes Kapitel: Bei den Unseren
Achtes Kapitel: Iwan Zarewitscb, der Kronprinz
Neuntes Kapitel: Stepan Trofimowitsch wurden beschlagnahmt
Zehntes Kapitel: Flibustier • Ein verhängnisvoller Vormittag
Dritter Teil
Erstes Kapitel: Das Fest • Erster Teil
Zweites Kapitel: Des Festes Ende
Drittes Kapitel: Das Ende einer Liebesgeschichte
Viertes Kapitel: Letzter Entschluß
Fünftes Kapitel: Eine Frau aus der Ferne
Sechstes Kapitel: Eine arbeitsreiche Nacht
Siebentes Kapitel: Stepan Trofimowitscb zum letztenmal auf Wanderschaft
Achtes Kapitel: Schluß
Anhang
Neuntes Kapitel: Bei Tichon
Zu diesem Band
Anmerkungen
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Wir entfernen uns vom Ziele!
Blind macht mich der Schnee und dumm!
Glaub’s, der Teufel ist im Spiele,
Führt im Kreis uns ringsherum.
Schar auf Scharen schwirren, schweben;
Welch Gesang tönt kläglich jetzt?
Hält ein Hexlein Hochzeit eben?
Wird ein Kobold beigesetzt?
A. Puschkin
Es war aber daselbst eine große Herde Säue auf der Weide auf dem Berge. Und sie baten ihn, daß er ihnen erlaubte, in sie zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Teufel aus von dem Menschen und fuhren in die Säue; und die Herde stürzte sich von dem Abhange in den See und ersoff. Da aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündigten’s in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen die Bewohner hinaus, zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesu und fanden den Menschen, von welchem die Teufel ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündigten’s ihnen, wie der Besessene war gesund geworden.
Lukas 8, 32–36
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Erstes Kapitel: Anstelle eines Vorworts: Einige Details aus der Biographie des hochgeschätzten Stepan Trofimowitsch Werchowenski
Zweites Kapitel: Prinz Heinrich • Eine Brautwerbung
Drittes Kapitel: Fremde Sünden
Viertes Kapitel: Die Hinkende
Fünftes Kapitel: Die kluge Schlange
Zweiter Teil
Erstes Kapitel: Nacht
Zweites Kapitel: Nacht (Fortsetzung)
Drittes Kapitel: Das Duell
Viertes Kapitel: Alle sind voller Erwartung
Fünftes Kapitel: Vor dem großen Fest
Sechstes Kapitel: Pjotr Stepanowitsch in Schwierigkeiten
Siebentes Kapitel: Bei den Unseren
Achtes Kapitel: Iwan Zarewitscb, der Kronprinz
Neuntes Kapitel: Stepan Trofimowitsch wurden beschlagnahmt
Zehntes Kapitel: Flibustier • Ein verhängnisvoller Vormittag
Dritter Teil
Erstes Kapitel: Das Fest • Erster Teil
Zweites Kapitel: Des Festes Ende
Drittes Kapitel: Das Ende einer Liebesgeschichte
Viertes Kapitel: Letzter Entschluß
Fünftes Kapitel: Eine Frau aus der Ferne
Sechstes Kapitel: Eine arbeitsreiche Nacht
Siebentes Kapitel: Stepan Trofimowitscb zum letztenmal auf Wanderschaft
Achtes Kapitel: Schluß
Anhang
Neuntes Kapitel: Bei Tichon
Zu diesem Band
Anmerkungen
Impressum
Erster Teil
Erstes Kapitel Anstelle eines Vorworts: Einige Details aus der Biographie des hochgeschätzten Stepan Trofimowitsch Werchowenski
1
Wenn ich jetzt darangehe, die höchst merkwürdigen Ereignisse zu schildern, welche sich unlängst in unserer bis dahin durch nichts hervorgetretenen Stadt zugetragen haben, muß ich, weil ich es nicht besser verstehe, ein wenig ausholen und mit einigen biographischen Details über den talentvollen und hochgeschätzten Stepan Trofimowitsch Werchowenski beginnen. Diese Details sollen lediglich als Einleitung zu der hiermit vorgelegten Chronik dienen, während die eigentliche Geschichte, die ich schildern will, erst später kommt.
Ich sage es frei heraus: Stepan Trofimowitsch spielte in unserer Mitte immer eine gewissermaßen besondere und, sozusagen, demokratische Rolle, und er liebte diese Rolle bis zur Leidenschaft – so sehr, daß er ohne sie wohl gar nicht hätte leben können. Nicht daß ich ihn einem Schauspieler gleichstellen möchte: da sei Gott vor, um so mehr, als auch ich ihn sehr verehre. Nein, alles mochte nur eine Sache der Gewöhnung sein oder, besser ausgedrückt, des permanenten und edlen, seit Kindesbeinen aufgetretenen Hanges, der Wohlbehagen bereitenden Sehnsucht nach einer schönen demokratischen Attitüde zu huldigen. Er liebte beispielsweise über alle Maßen die Rolle des »Verfolgten« und sozusagen »Verbannten«. Diese beiden Wörtchen besitzen eine Art klassischen Glanz, der ihn ein für allemal in seinen Bann zog, ihn dann allmählich im Laufe so vieler Jahre in der eigenen Achtung steigen ließ und schließlich auf einen dem Ehrgeiz schmeichelnden, alles überragenden Marmorsockel hob. In einem satirischen englischen Roman aus dem vorigen Jahrhundert war es einem gewissen Gulliver durch seinen Aufenthalt im Lande der Liliputaner, wo die Menschen nur eine Größe von zwei Zoll erreichten, so sehr zur Gewohnheit geworden, sich inmitten anderer als Riese zu fühlen, daß er auch auf den Straßen Londons den Passanten und Equipagen zurief, sie möchten ihm ausweichen und aufpassen, daß er sie nicht etwa zertrete, sah er sich doch noch immer als Riese und die anderen als Zwerge. Dafür wurde er verspottet und beschimpft, und ruppige Kutscher schlugen sogar mit der Peitsche nach dem Riesen; aber war das wohl recht? Was vermag Gewohnheit nicht alles! Gewohnheit hatte aus Stepan Trofimowitsch nahezu einen zweiten Gulliver gemacht, nur einen noch unschuldigeren und harmloseren, wenn man so sagen darf, denn er war ein in jeder Hinsicht vortrefflicher Mensch.
Ich meine sogar: Wenn man ihn gegen Ende auch überall vergessen hatte, so kann wirklich nicht behauptet werden, er sei vorher schon völlig unbekannt gewesen. Unstreitig gehörte er vorübergehend zur ruhmvollen Elite namhafter Vertreter der vorigen Generation, und eine Zeitlang – freilich war es nur eine winzige Frist – wurde sein Name damals von vielen Voreiligen nahezu in einer Reihe mit dem Namen Tschaadajews, Belinskis, Granowskis und des gerade erst im Ausland debütierenden Herzens genannt. Stepan Trofimowitschs Wirken endete jedoch fast im gleichen Augenblick, da es begann – sozusagen im »Wirbelsturm zusammentreffender Umstände«. Und was stellte sich dann heraus? Weder von einem »Wirbelsturm« noch auch nur von »Umständen« konnte die Rede sein, zumindest nicht in seinem Falle. Erst jetzt, vor wenigen Tagen, erfuhr ich zu meinem größten Erstaunen, aber dafür aus absolut zuverlässiger Quelle, daß Stepan Trofimowitsch keineswegs als Verbannter in unserer Mitte und unserem Gouvernement gelebt hat, wie wir damals gemeinhin glaubten, ja daß er niemals auch nur unter Aufsicht stand. Wie lebhaft muß also seine Einbildungskraft gewesen sein! Er hat völlig im Ernst sein Leben lang geglaubt, in einigen Bereichen sei man vor ihm ständig auf der Hut, alle seine Schritte würden ununterbrochen beobachtet und registriert und jeder unserer drei Gouverneure, die einander in den letzten zwanzig Jahren ablösten, habe bei Amtsantritt bereits eine ganz bestimmte, besorgniserregende Vorstellung von ihm mitgebracht, die von oben und vor allem bei der Amtsübergabe suggeriert worden sei. Hätte damals jemand den redlichen Stepan Trofimowitsch mit unwiderlegbaren Argumenten davon überzeugen wollen, er habe nicht das geringste zu befürchten, er hätte ihn zutiefst beleidigt. Dabei war Stepan Trofimowitsch ein durchaus gescheiter und begabter Mensch, sogar – sozusagen – ein Mann der Wissenschaft, obgleich er freilich in der Wissenschaft … nun ja, in der Wissenschaft hat er wohl nicht allzuviel geleistet, genau besehen – gar nichts. Doch unter den Männern der Wissenschaft soll das bei uns in Rußland ja gang und gäbe sein.
Nach seiner Rückkehr aus dem Ausland brillierte er kurz vor Ende der vierziger Jahre mit Vorlesungen an der Universität. Es kam allerdings nur zu einigen wenigen Vorlesungen, wenn ich nicht irre, über die Araber; dann schrieb er noch eine glänzende Dissertation über den anfänglichen politischen und hanseatischen Aufstieg der deutschen Stadt Hanau in der Epoche zwischen 1413 und 1428 und gleichzeitig über die besonderen und ungeklärten Ursachen, warum es zu keinerlei Aufstieg kam. Die Dissertation teilte geschickte und schmerzhafte Hiebe gegen die damaligen Slawophilen aus und verschaffte ihm unter diesen mit einem Schlag zahlreiche erbitterte Feinde. Danach – übrigens schon nach Verlust des Lehrstuhls – veröffentlichte er noch (sozusagen als Rache und um zu zeigen, wen man in ihm verloren hatte) in einer fortschrittlichen Monatszeitschrift, die Dickens-Übersetzungen abdruckte und George Sand propagierte, den Anfang einer tiefschürfenden Untersuchung – ich glaube, über die Ursachen des außergewöhnlichen Sittenadels irgendwelcher Ritter irgendeiner Epoche oder etwas in dieser Art. Zumindest wurden darin höchst erhabene und ungewöhnlich edle Gedanken entwickelt. Später behauptete man, die Fortsetzung dieser Untersuchung sei von heute auf morgen untersagt worden und die fortschrittliche Zeitschrift habe für den Abdruck der ersten Hälfte sogar büßen müssen. Das erschien durchaus möglich, denn was ist damals nicht alles geschehen? In diesem Falle freilich ist höchstwahrscheinlich gar nichts geschehen und war der Autor einfach zu träge, seine Untersuchung zu Ende zu führen. Zum Abbruch seiner Vorlesungen über die Araber wiederum kam es, weil irgendwie von irgendwem (sicher von einem seiner rückschrittlichen Feinde) ein an irgend jemanden gerichteter Brief mit der Darlegung irgendwelcher »Umstände« abgefangen wurde, worauf jemand irgendwelche Erklärungen von ihm verlangte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, jedenfalls wurde noch behauptet, in Petersburg sei man zum gleichen Zeitpunkt einer mächtigen, naturwidrigen und staatsfeindlichen Vereinigung auf die Spur gekommen, die mit ihren etwa dreizehn Mitgliedern um ein Haar einen Umsturz bewirkt hätte. Diese Leute sollen gar eine Übersetzung Fouriers geplant haben. Ausgerechnet zu dieser Zeit wurde in Moskau auch ein Poem Stepan Trofimowitschs beschlagnahmt, das er schon sechs Jahre zuvor in Berlin – noch in frühester Jugend – geschrieben hatte und das in Abschriften zwischen zwei Literaturliebhabern und einem Studenten kursierte. Dies Poem liegt jetzt auch in meinem Schreibtisch; es ist erst vergangenes Jahr in meinen Besitz gelangt, in eigenhändiger, kurz zuvor von Stepan Trofimowitsch selbst besorgter Abschrift, mit Widmung versehen und in prächtiges Saffianleder gebunden. Das Poem ist übrigens nicht ohne Poesie und auch nicht ohne einiges Talent geschrieben; es wirkt etwas seltsam, aber damals (richtiger gesagt, in den dreißiger Jahren) schrieb man häufig in dieser Art. Den Inhalt wiederzugeben fällt mir allerdings schwer, denn ehrlich gesagt, ich habe nichts davon begriffen. Es handelt sich um eine Art Allegorie in lyrisch-dramatischer Form und erinnert an den zweiten Teil des »Faust«. Das Ganze beginnt mit einem Frauenchor, danach kommt ein Männerchor, darauf ein Chor irgendwelcher Geister und am Ende ein Chor der Seelen, die noch nicht gelebt haben, aber schrecklich gern leben möchten. Alle diese Chöre singen von etwas höchst Vagem, meist von irgend jemandes Fluch, aber mit einem Anklang erhabensten Humors. Doch plötzlich wechselt die Szene, und es beginnt eine »Feier des Lebens«, auf der sogar Insekten singen, dann gibt eine Schildkröte sakramentale lateinische Wörter von sich, und wenn ich mich recht erinnere, singt sogar ein Mineral, also ein nun wirklich völlig unbelebter Gegenstand. Überhaupt wird von allen pausenlos gesungen, und wenn sie einmal sprechen, dann schelten sie auf seltsam unbestimmte Weise, aber wiederum mit einem Unterton erhabenster Bedeutsamkeit. Schließlich wechselt der Handlungsort erneut, wird zur wüsten Gegend, und durch Felsenschluchten wandert ein zivilisierter junger Mann, pflückt und lutscht irgendwelche Kräuter und erwidert auf die Frage einer Fee, wozu er diese Kräuter lutsche, er spüre in sich überströmendes Leben, suche Vergessenheit und finde sie im Safte dieser Kräuter; sein sehnlichster Wunsch aber sei – so schnell wie möglich den Verstand zu verlieren (ein, möglicherweise, überflüssiger Wunsch). Danach kommt auf einmal ein unbeschreiblich schöner Jüngling auf einem Rappen geritten, gefolgt von einer Unzahl aller möglichen Völker. Der Jüngling verkörpert den Tod, und alle Völker dürsten nach ihm. Schließlich, schon in der allerletzten Szene, sieht man plötzlich den Turm von Babel, athletische Gestalten bauen ihn doch noch zu Ende, singen dabei ein Lied von neuer Hoffnung, und als sie bereits ganz oben angelangt sind, ergreift der Beherrscher des, na, sagen wir mal: des Olymps in komischer Manier die Flucht, während die Menschheit, nicht faul, seinen Platz einnimmt und schnurstracks ein neues Leben mit einem neuen Verständnis der Dinge beginnt. Dieses Poem also sei, fand man damals, gefährlich. Voriges Jahr schlug ich Stepan Trofimowitsch vor, er solle es drucken lassen, in unserer Zeit sei es doch absolut harmlos, er aber wies meinen Vorschlag sichtlich verstimmt zurück. Meine Ansicht von der absoluten Harmlosigkeit mißfiel ihm, und ich führe hierauf sogar eine gewisse Kälte mir gegenüber zurück, die ganze zwei Monate währte. Und was passiert da? Plötzlich, nahezu zur selben Zeit, da ich eine Veröffentlichung bei uns vorgeschlagen hatte, wird unser Poem – drüben abgedruckt, das heißt im Ausland, in einem revolutionären Sammelband, und zwar ohne jedes Wissen Stepan Trofimowitschs. Er war zunächst erschrocken, eilte zum Gouverneur und setzte ein hochsinniges Rechtfertigungsschreiben nach Petersburg auf, las es mir zweimal vor, schickte es aber nicht ab, weil er nicht wußte, an wen er es richten sollte. Um es kurz zu machen, einen ganzen Monat lebte er in heller Aufregung; dabei bin ich gewiß, in den geheimsten Winkeln seines Herzens fühlte er sich höchlichst geschmeichelt. Es fehlte nicht viel, und er hätte mit dem ihm zugesandten Exemplar des Sammelbandes geschlafen, tagsüber jedenfalls versteckte er ihn unter der Matratze und ließ nicht einmal die Wirtschafterin sein Bett richten; obgleich er Tag für Tag von irgendwoher ein Telegramm erwartete, lief er mit stolz erhobenem Haupt umher. Ein Telegramm traf niemals ein. Da schließlich söhnte er sich auch mit mir aus, was wieder von der beispiellosen Güte seines sanften, niemals nachtragenden Herzens zeugt.
2
Ich behaupte ja nicht, er sei völlig unbehelligt geblieben; nur bin ich heute restlos überzeugt, er hätte sich mit seinen Arabern weiter befassen können, soviel er wollte, sofern er nur die erforderlichen Erklärungen lieferte. Aber er hatte eben seinen Ehrgeiz, und als ob es ihn besonders pressierte, entschied er sich, ein für allemal zu glauben, seine Karriere sei vom »Wirbelsturm der Umstände« für immer zerstört. Sagt man freilich die ganze Wahrheit, dann bildete den eigentlichen Grund für seinen Karrierewechsel das schon früher einmal gemachte und später erneuerte verfänglich-verlockende Anerbieten der Generalleutnantsgattin Warwara Petrowna Stawrogina, einer Frau von beträchtlichem Reichtum, er möge die Erziehung und gesamte geistige Entwicklung ihres einzigen Sohnes übernehmen – als leitender Pädagoge und Freund; von der glänzenden Vergütung ganz zu schweigen. Dieses Anerbieten war ihm zunächst in Berlin gemacht worden, just als er zum erstenmal Witwer wurde. Seine erste Frau war ein leichtfertiges junges Ding aus unserem Gouvernement gewesen, das er in seiner frühesten, noch unvernünftigen Jugend ehelichte; mit dieser übrigens recht attraktiven Person mußte er wohl allerhand durchmachen, weil es ihm an Mitteln zu ihrem Unterhalt fehlte und darüber hinaus auch aus anderen, zum Teil schon heiklen Ursachen. Nachdem sie die letzten drei Jahre getrennt von ihm gelebt hatte, segnete sie in Paris das Zeitliche und hinterließ ihm einen fünfjährigen Sohn, die »Frucht der ersten glücklichen, noch ungetrübten Liebe«, wie mir Stepan Trofimowitsch einmal in einem Augenblick der Unbeherrschtheit voll Trauer eingestand. Der Sprößling war gleich nach seiner Geburt nach Rußland geschickt worden, wo ihn entfernte Tanten weitab von aller Zivilisation aufzogen. Stepan Trofimowitsch lehnte damals Warwara Petrownas Angebot ab und heiratete sehr bald wieder, in weniger denn Jahresfrist, diesmal eine wortkarge Berlinerin, ohne, und dies ist das Auffallende daran, daß hierzu besondere Notwendigkeit bestanden hätte. Allerdings gab es noch andere Gründe für die Ablehnung der Erzieherstelle: verleitet von dem weithin ertönenden Ruhm eines unvergeßlichen Professors, drängte es nun auch ihn, den Lehrstuhl einzunehmen, auf den er sich so lange vorbereitet, um die eigenen Adlerflügel zu erproben. Danach freilich, nun schon mit versengten Flügeln, erinnerte er sich nur zu natürlich des Anerbietens, das ihn in seinem Entschluß auch früher schon wankend gemacht hatte. Der plötzliche Tod seiner zweiten Frau, die nicht einmal ein Jahr an seiner Seite lebte, brachte die Sache endgültig ins Rollen. Direkt gesagt: Den Ausschlag gab die glühende Anteilnahme und edle, sozusagen klassische Freundschaft Warwara Petrownas, wenn man eine Freundschaft überhaupt so bezeichnen kann. Er stürzte in die Arme dieser Freundschaft, und die Angelegenheit wurde für reichlich zwanzig Jahre festgemacht. Ich gebrauchte soeben den Ausdruck »stürzte in die Arme«, aber Gott behüte jedermann vor unangemessenen und müßigen Gedanken; diese Arme sind einzig und allein im allersittlichsten Sinne zu verstehen. Die Beziehung, die diese zwei so bemerkenswerten Charaktere für alle Zeiten verband, war von zartester und delikatester Art.
Zur Annahme der Erzieherstelle kam es auch noch deswegen, weil das kleine Gütchen, das Stepan Trofimowitsch nach dem Tode seiner ersten Frau zufiel – fürwahr ein sehr kleines Gütchen –, unmittelbar an das in Stadtnähe gelegene Stawroginsche Gut Skworeschniki grenzte, eines der prächtigsten Güter unseres Gouvernements. Abgesehen davon konnte er sich ja jederzeit in der Stille seines Arbeitszimmers, unbeschwert von drückenden Universitätsverpflichtungen, der Wissenschaft widmen und die vaterländische Literatur durch tiefschürfende Untersuchungen bereichern. Die wissenschaftlichen Untersuchungen blieben zwar aus; dafür aber bot sich Stepan Trofimowitsch die Möglichkeit, sein ganzes restliches Leben, mehr als zwanzig Jahre, gleichsam als leibhaftiger Vorwurf vor seinem Vaterland zu stehen, wie es ein volksverbundener Dichter einmal gesagt hat:
Als ein leibhaftiger Vorwurf
Standst du vor deinem Vaterland,
Ein liberaler Idealist.
Nur kam es der Person, von welcher unser Volksdichter sprach, möglicherweise zu, ihr ganzes Leben in dieser Stellung zu verharren, sofern es ihr gefiel, obgleich das ja ziemlich langweilig ist. Stepan Trofimowitsch hingegen war, ehrlich gesagt, bloß Epigone im Vergleich zu solchen Leuten, zudem wurde er des Stehens allmählich müde und lag lieber so oft wie möglich auf der faulen Haut. Indes faule Haut hin, faule Haut her, leibhaftiger Vorwurf blieb er auch im Liegen – soweit muß man ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, um so mehr, als dies fürs Gouvernement allemal ausreichte. Der geneigte Leser hätte ihn nur bei uns im Klub sehen sollen, wenn er sich an den Kartentisch setzte. Sein ganzes Wesen schien zu sagen: Spielkarten! Ich spiele mit euch russischen Whist! Ist das mit allem anderen zu vereinbaren? Wer kann das verantworten? Wer hat mein Wirken zunichte gemacht und es in ein unsinniges Kartenspiel verkehrt? Ah, so geh denn zugrunde, Rußland! – und mit hoheitsvoller Gebärde spielte er das rote Trumpf-As vor.
In Wahrheit jedoch spielte er schrecklich gern Karten, weswegen er – und dies besonders in letzter Zeit – häufig unangenehme Auseinandersetzungen mit Warwara Petrowna zu bestehen hatte, um so mehr, als er ständig verlor. Doch davon später. Jetzt will ich nur anmerken, daß er ein Mensch war, der unter Gewissensskrupeln litt (das heißt – manchmal) und sich daher oft grämte. Während der zwanzigjährigen Freundschaft zu Warwara Petrowna fiel er drei- bis viermal jährlich mit schöner Regelmäßigkeit in, wie wir zu sagen pflegten, »demokratische Schwermut« oder, einfacher ausgedrückt, in Hypochondrie, aber der Ausdruck »demokratische Schwermut« gefiel unserer hochverehrten Warwara Petrowna. Später dann verfiel er neben der demokratischen Schwermut auch dem Champagner; allein die zartfühlende Warwara Petrowna suchte ihn ihr Leben lang vor allen gemeinen Neigungen zu bewahren. Und er brauchte auch wirklich ein Kindermädchen, denn bisweilen benahm er sich sehr merkwürdig: mitten in erhabenster Schwermut konnte er plötzlich in vulgärstes Gelächter ausbrechen. Es gab Augenblicke, da er sich sogar über seine eigene Person im humorigen Sinne äußerte. Nichts aber fürchtete Warwara Petrowna mehr als humorigen Sinn. Sie war eine Frau der Klassik, eine Mäzenatin, die sich in ihren Handlungen allein von erhabensten Erwägungen leiten ließ. Geradezu totalitär war der zwanzigjährige Einfluß dieser hochsinnigen Dame auf ihren armen Freund. Ihr müßte an sich ein besonderes Kapitel gewidmet werden, und dies will ich nun auch tun.
3
Es gibt schon eigentümliche Freundschaften: da möchten zwei Freunde einander aus Groll am liebsten fressen, verbringen in dieser Gesinnung ein ganzes Leben miteinander, trennen aber können sie sich nicht. Denn der das Freundschaftsband doch einmal launisch-unbeherrscht Zerreißende würde als erster von Krankheit befallen, stürbe möglicherweise sogar, wenn ein solcher Fall einträte. Ich weiß positiv, Stepan Trofimowitsch ist mehrfach, bisweilen gleich nach vertraulichsten Herzensergüssen unter vier Augen mit Warwara Petrowna, sobald diese den Raum verließ, vom Sofa aufgesprungen und hat mit den Fäusten gegen die Wand gehämmert.
Und dies geschah keineswegs etwa nur allegorisch, einmal schlug er sogar den Putz von der Mauer. Vielleicht fragt hier jemand, wie ich von einer so subtilen Einzelheit Kenntnis erhalten konnte? Und wenn ich nun Augenzeuge war? Wenn sich nun Stepan Trofimowitsch an meiner Schulter ausgeweint und mir seinen tiefsten Kummer in grellen Farben geschildert hat? (Und was hat er dabei nicht alles erzählt!) Aber man höre und staune, was sich nahezu immer wieder nach solchen Tränenszenen abspielte: Schon am nächsten Tag war er bereit, sich wegen seiner Undankbarkeit freiwillig ans Kreuz schlagen zu lassen; eilig schickte er nach mir oder kam selber, einzig um mir zu verkünden, Warwara Petrowna sei »ein Engel an Ehrenhaftigkeit und Zartgefühl, er aber das absolute Gegenteil«. Er kam damit nicht nur zu mir, sondern schrieb wiederholt ihr selbst all dies in ausdrucksvollsten Briefen und legte dann mit vollständiger Unterschrift das Geständnis ab, er habe beispielsweise erst am Vortage einem völlig Unbeteiligten erzählt, sie halte ihn aus purer Eitelkeit bei sich, neide ihm seine Gelehrsamkeit und seine Talente; sie hasse ihn und scheue sich nur, ihren Haß offen zu zeigen, aus Furcht, er könne sie verlassen und damit ihrem Ruf in literarischen Kreisen Abbruch tun; er verachte sich deswegen und sei entschlossen, eines gewaltsamen Todes zu sterben, harre nur noch ihres letzten Worts, das alles entscheiden würde, und so weiter und so fort in diesem Tone. Man kann sich nun wohl vorstellen, welchen Grad von Hysterie die psychischen Ausbrüche dieses harmlosesten aller fünfzigjährigen Säuglinge bisweilen erreichten! Ich selbst mußte einmal einen solchen Brief lesen, nach einem Streit zwischen den beiden, der einen lächerlichen Anlaß hatte, aber mit aller Gehässigkeit ausgetragen wurde. Ich erschrak zutiefst und flehte ihn an, den Brief nicht abzuschicken.
»Das kann ich nicht … die Ehrlichkeit gebietet es … mein Pflichtgefühl … ich sterbe, wenn ich ihr nicht alles, alles bekenne!« entgegnete er wie vom Fieber geschüttelt und schickte den Brief trotzdem ab.
Darin eben bestand der Unterschied zwischen den beiden: Warwara Petrowna hätte einen solchen Brief nie und nimmer abgesandt. Er schrieb allerdings wahnsinnig gern, er schrieb ihr Briefe, obwohl beide doch im gleichen Hause wohnten, und wenn er seine hysterischen Anfälle hatte, auch zweimal am Tag. Ich weiß zuverlässig, daß sie diese Briefe jedesmal mit größter Aufmerksamkeit las, selbst wenn es zwei am Tage waren, und sie dann, abgezeichnet und geordnet, in einem besonderen Kästchen aufbewahrte; außerdem bewahrte sie alle in ihrem Herzen. Hinterher ließ sie ihren Freund einen ganzen Tag ohne Antwort schmoren und trat ihm mit der unschuldigsten Miene der Welt entgegen, als sei rein gar nichts gewesen. Schritt um Schritt machte sie ihn so kirre, daß er sich schon nicht traute, an das Geschehene zu erinnern, und eine Zeitlang nur ihren Blick suchte. Dabei war sie es, die nichts vergaß, während ihm dies manchmal allzu schnell widerfuhr und er, durch ihre Gelassenheit ermutigt, nicht selten schon am gleichen Tag wieder lachte und sich, wenn seine Freunde kamen, beim Champagner wie ein Schuljunge aufführte. Mit welch giftigen Blicken muß sie ihn in solchen Momenten bedacht haben, aber er bemerkte nicht das geringste! Höchstens, daß ihm nach einer Woche, einem Monat oder gar erst nach einem halben Jahr bei irgendeiner besonderen Gelegenheit unwillkürlich eine bestimmte Formulierung aus einem solchen Brief und darauf auch der ganze Brief mit allen dazugehörigen Umständen wieder einfiel, er dann vor Scham vergehen wollte und einige Male solche Pein litt, daß er seine Cholerine-Anfälle bekam. Diese sonderbaren, cholerine-artigen Anfälle bildeten zuweilen den trivialen Abschluß seiner Nervenerschütterungen und stellten eine in ihrer Art recht interessante Eigentümlichkeit seiner Konstitution dar.
Warwara Petrowna hat gewiß, und zwar sehr oft, Haß für ihn empfunden; eines aber sollte er bis zum Schluß nie bemerken: daß er für sie schließlich zu einem Sohn geworden war, zu ihrem Geschöpf, ja man könnte sagen, zu ihrer Erfindung, zu Fleisch von ihrem Fleisch, und daß es keineswegs nur aus bloßem »Neid auf seine Talente« geschah, wenn sie ihn hielt und für seinen Unterhalt aufkam. Wie sehr also muß sie sich von solchen Unterstellungen verletzt gefühlt haben! In ihrem Inneren verborgen, brannte so etwas wie unerträgliche Liebe zu ihm, überdeckt von nie endendem Haß, von Eifersucht und Verachtung. Sie behütete ihn vor jedem Stäubchen, bemutterte ihn zweiundzwanzig Jahre, und sie hätte fürsorglich ganze Nächte durchwacht, wäre es um seinen Ruf als Dichter, als Gelehrter, als Demokrat gegangen. Er war ein Produkt ihrer Einbildungskraft, und sie selbst war die erste, die an dieses Produkt ihrer Einbildung glaubte. Er verkörperte für sie eine Art Traum … Dafür freilich verlangte sie wirklich viel von ihm, manchmal auch sklavische Unterwerfung. Und nachtragend war sie – einfach unvorstellbar. Da muß ich übrigens zwei Begebenheiten erzählen.
4
Einmal, noch während der ersten Gerüchte von der Bauernbefreiung, als ganz Rußland aufjauchzte und sich zu völliger Neugeburt rüstete, empfing Warwara Petrowna den Besuch eines durchreisenden Barons aus Petersburg, eines Mannes mit höchsten Verbindungen, der einen ziemlich einflußreichen Posten bekleidete. Warwara Petrowna legte außerordentlichen Wert auf solche Besuche, weil ihre Verbindungen zu den höchsten Kreisen nach dem Tode ihres Gatten immer loser geworden und schließlich völlig abgebrochen waren. Der Baron saß eine Stunde bei ihr zum Tee. Niemand sonst war zugegen, nur Stepan Trofimowitsch, den Warwara Petrowna bitten ließ, um Staat mit ihm zu machen. Der Baron hatte schon früher einiges über ihn gehört oder gab dies zumindest vor, richtete beim Tee das Wort aber nur selten an ihn. Natürlich bestand keine Gefahr, daß sich Stepan Trofimowitsch blamieren würde, und er besaß zudem auch glänzende Manieren. Zwar stammte er, wie es hieß, aus niederen Kreisen, doch das Schicksal hatte es gewollt, daß er von frühester Jugend in einem vornehmen Moskauer Hause aufwuchs und folglich eine anständige Erziehung genoß; Französisch sprach er wie ein Pariser. Der Baron mußte also auf den ersten Blick begreifen, mit was für Leuten sich Warwara Petrowna umgab, und sei es auch in der Zurückgezogenheit einer Gouvernementsstadt. Allein es sollte anders kommen. Als der Baron in aller Bestimmtheit erklärte, die damals gerade umlaufenden ersten Gerüchte von einer großen Reform seien absolut zutreffend, konnte Stepan Trofimowitsch auf einmal nicht an sich halten, rief hurra! und machte mit der Hand sogar eine Geste, die Entzücken ausdrücken sollte. Es war dies kein lauter Ausruf, und er klang sogar elegant; möglicherweise hatte Stepan Trofimowitsch sein Entzücken sogar mit Vorbedacht geäußert und die Geste speziell eine halbe Stunde zuvor am Spiegel einstudiert; irgend etwas aber muß ihm dabei danebengelungen sein, jedenfalls erlaubte sich der Baron die Andeutung eines Lächelns, obgleich er mit ausgesuchter Höflichkeit auf der Stelle eine Bemerkung über die allgemeine und gebührende Rührung aller russischen Herzen ob des großen Ereignisses einzuflechten wußte. Bald danach fuhr er ab und versäumte beim Abschied nicht, auch Stepan Trofimowitsch zwei Finger darzubieten. Wieder im Salon, verharrte Warwara Petrowna zunächst etwa drei Minuten in Schweigen, während sie auf dem Tisch etwas zu suchen schien; dann indes wandte sie sich plötzlich Stepan Trofimowitsch zu und zischte bleich und mit funkelnden Augen: »Das werde ich Ihnen nie vergessen!«
Anderntags begegnete sie ihrem Freund, als sei nichts vorgefallen; an das Geschehene rührte sie nie mit einem einzigen Wort. Jedoch dreizehn Jahre später, in einem tragischen Augenblick, erinnerte und rügte sie sein Verhalten und erbleichte dabei ebenso wie dreizehn Jahre zuvor, als sie ihn das erste Mal gerügt. Zweimal nur in ihrem ganzen Leben hat sie zu ihm gesagt: »Das werde ich Ihnen nie vergessen!« Die Geschichte mit dem Baron war schon der zweite Fall; aber auch der erste ist so bezeichnend und hatte wohl für Stepan Trofimowitschs Leben so viel zu bedeuten, daß ich auch ihn noch erwähnen will.
Es war im Jahre 1855, im Frühjahr, im Monat Mai, und in Skworeschniki hatte man gerade erst die Nachricht vom Tode Generalleutnant Stawrogins erhalten, der, ein unbesonnener alter Mann, auf einer Eilfahrt zur Krim, wohin man ihn zur kämpfenden Armee beordert hatte, einer Magenverstimmung erlegen war. Warwara Petrowna, seine nunmehrige Witwe, legte Volltrauer an, obgleich sie nicht allzuviel Kummer empfinden konnte, hatte sie doch die letzten vier Jahre wegen Unverträglichkeit der Charaktere von ihrem Manne völlig getrennt gelebt und ihm eine Pension gezahlt. (Der Generalleutnant selbst besaß nur hundertfünfzig Seelen und sein Gehalt, wenn man von seinem vornehmen Stand und seinen Verbindungen absieht; das gesamte große Vermögen hingegen und Skworeschniki gehörten Warwara Petrowna, der einzigen Tochter eines schwerreichen Steuerpächters.) Nichtsdestoweniger war sie über die unerwartete Nachricht erschüttert und zog sich vollständig von der Welt zurück. Natürlich ohne sich auch nur einen Augenblick von Stepan Trofimowitsch zu trennen.
Der Mai strahlte in voller Pracht; die Abende waren wundervoll. Die Faulbaumblüte begann. Die beiden trafen sich Abend für Abend im Garten und saßen bis zur Nacht in einer Laube, um einander ihre Gedanken und Gefühle anzuvertrauen. Es waren Augenblicke voll Poesie. Warwara Petrowna sprach unter dem Eindruck der schicksalhaften Änderung ihrer Lebensumstände mehr als sonst. Sie schmiegte sich gleichsam an das Herz ihres Seelenfreundes, und dies währte mehrere Abende. Da durchfuhr Stepan Trofimowitsch ein merkwürdiger Gedanke: Macht sich die untröstliche Witwe in bezug auf mich etwa Hoffnungen und erwartet am Ende des Trauerjahres einen Heiratsantrag? – Ein zynischer Gedanke; aber sublime seelische Organisation fördert ja bisweilen geradezu die Neigung zu zynischem Denken, allein schon wegen der Mannigfaltigkeit unserer menschlichen Entwicklung. Er bedachte die Sache gründlicher und fand, vieles spräche dafür. Er erwog: Ihr Vermögen ist riesig, ja, aber … Warwara Petrowna glich fürwahr nicht in jeder Hinsicht einer Schönheit: Sie war eine hochgewachsene, gelbhäutige, knochige Frauensperson mit überlangem Gesicht, das ihr etwas Pferdeartiges verlieh. Immer mehr schwankte Stepan Trofimowitsch, wurde von Zweifeln gepeinigt und brach ein- oder zweimal ob seiner Unentschlossenheit gar in Tränen aus (er weinte ziemlich oft). An den Abenden indes, will sagen, in der Laube, nahm sein Gesicht nunmehr unwillkürlich einen launischen, spöttischen, kokettierenden, dabei aber auch hochmütigen Ausdruck an. So etwas geschieht gleichsam unabsichtlich, wider Willen, ja, je edler ein Mensch ist, um so auffälliger tritt es zutage. Gott allein weiß, was man dazu sagen soll, aber höchstwahrscheinlich hat sich in Warwara Petrownas Herz überhaupt nichts geregt, was Stepan Trofimowitschs Argwohn völlig gerechtfertigt hätte. Und niemals auch würde sie den Namen Stawrogin gegen den seinen eingetauscht haben, mochte er auch noch so berühmt sein. Möglicherweise war ihrerseits alles nur weibliches Spiel, Folge eines unbewußten weiblichen Bedürfnisses, wie es bei Frauen in mancherlei Ausnahmesituationen nur zu natürlich erscheint. Allein verbürgen kann ich mich nicht; unerforschlich bleibt die Tiefe des weiblichen Herzens bis auf den heutigen Tag! Doch weiter.
Sie muß die seltsame Miene ihres Freundes wohl bald richtig gedeutet haben; sie war feinfühlig und alles andere als blind, er wiederum gelegentlich gar zu naiv. Indes die Abende verliefen wie immer, die Gespräche waren unverändert poetisch und interessant. Einmal nun hatten sie sich bei Einbruch der Dunkelheit freundschaftlich gute Nacht gewünscht und an der Tür des Sommerhäuschens, das Stepan Trofimowitsch bewohnte, einander innigst die Hände gedrückt. Jeden Sommer nämlich übersiedelte er aus dem riesigen Herrenhaus von Skworeschniki in dieses schon fast im Park gelegene Häuschen. Kaum in sein Zimmer getreten, griff er, in beunruhigende Gedanken vertieft, nach einer Zigarre, blieb, ohne sie anzuzünden, müde und reglos am weit geöffneten Fenster stehen, betrachtete die federleichten weißen Wölkchen, die den hellen Mond umschwebten – da ließ ihn ein leises Rascheln zusammenfahren, und er sah sich um. Vor ihm stand erneut Warwara Petrowna, die er doch vor kaum vier Minuten verlassen hatte. Ihr gelbes Gesicht zeigte einen nahezu bläulichen Schimmer, die Lippen waren fest zusammengepreßt, und die Mundwinkel zuckten. Volle zehn Sekunden sah sie ihn schweigend mit hartem, unerbittlichem Blick an und stieß plötzlich flüsternd aus: »Niemals werde ich Ihnen das vergessen!«
Als mir Stepan Trofimowitsch, erst zwanzig Jahre danach, diese traurige Begebenheit im Flüsterton berichtete, vorsorglich hinter verschlossener Tür, schwor er Stein und Bein, er sei damals vor Schreck so starr gewesen, daß er weder sah noch hörte, wie Warwara Petrowna verschwand. Da sie ihm gegenüber später nie eine Andeutung über den Vorfall machte und alles weiterlief, als sei nichts geschehen, neigte er sein Leben lang zu der Ansicht, alles wäre nur eine krankheitsbedingte Halluzination gewesen, um so mehr, als er noch in der gleichen Nacht tatsächlich für ganze zwei Wochen erkrankte, was übrigens auch das Ende der Laubengespräche bedeutete.
Ungeachtet dieses Wunschtraums von einer Halluzination verbrachte er sein ganzes Leben Tag für Tag gleichsam in Erwartung einer Fortsetzung und sozusagen befreienden Klärung dieses Vorfalls. Er glaubte nicht, daß die Sache damit abgetan sei! Wenn dem aber so war, dann muß er seine erhabene Freundin manchmal recht seltsam angeschaut haben.
5
Sogar einen Anzug hatte sie für ihn entworfen, den er denn auch sein Leben lang trug. Es war ein eleganter Anzug und mit eigener Note: ein langschößiger Rock, zugeknöpft fast bis zum Halse, aber brillant sitzend; ein weicher Hut (im Sommer ein Strohhut) mit breiter Krempe; das Halstuch weiß, aus Batist und mit herabhängenden Enden; ein Spazierstock mit Silberkrücke und zu alledem die Haare schulterlang. Er war dunkelblond, und sein Haar wurde erst in letzter Zeit ein wenig grau. Schnurr- und Kinnbart rasierte er. In seiner Jugend soll er auffallend schön gewesen sein. Ich meine indes, auch im Alter wirkte er ungewöhnlich imposant. Und was heißt schon Alter, wenn einer erst dreiundfünfzig ist? Doch einer gewissen demokratischen Mode folgend, tat er nichts dazu, jünger zu erscheinen, sondern kokettierte geradezu noch mit seinen soliden Jahren und erinnerte in seinem Anzug, mit seiner hohen, hageren Gestalt und dem schulterlangen Haar etwa an einen Patriarchen oder, noch zutreffender, an das Porträt des Dichters Kukolnik, wie es in den dreißiger Jahren als Lithographie irgendeinem Buch beigefügt war, besonders, wenn er sommers im Park saß, auf der Bank unterm blühenden Fliederstrauch, mit beiden Händen auf seinen Spazierstock gestützt, ein aufgeschlagenes Buch neben sich und in dichterisches Sinnen über den Sonnenuntergang versunken. Was übrigens Bücher anlangt, so hielt er sich gegen Ende von ihnen fern. Allerdings erst ganz gegen Ende. Zeitungen und Zeitschriften, die Warwara Petrowna in Mengen abonnierte, las er ständig. Für die Erfolge der russischen Literatur zeigte er ebenfalls beständiges Interesse, ohne dabei allerdings im geringsten seine eigene Würde preiszugeben. Eine Zeitlang begeisterte er sich für das Studium unserer modernen hohen Innen- und Außenpolitik, verlor indes bald das Interesse daran und gab dies Unterfangen auf. Es kam auch vor, daß er einen Band Tocqueville mit in den Park nahm, in der Tasche aber einen Paul de Kock versteckt hatte. Doch das sind natürlich Belanglosigkeiten.
In Klammern eine Bemerkung zu dem Porträt Kukolniks: erstmals war dieses Bildchen Warwara Petrowna in die Hände geraten, als sie sich, noch ein kleines Mädchen, in einem Moskauer Adelspensionat befand. Sofort verliebte sie sich in das Porträt, wie es ja aller Pensionatsmädchen Brauch ist, sich in alles mögliche zu verlieben, dabei auch in ihre Lehrer, vorzugsweise in den Schönschreib- und den Zeichenlehrer. Doch von Interesse sind hier nicht die Eigenheiten des kleinen Mädchens, sondern der Umstand, daß Warwara Petrowna dieses Bildchen noch mit fünfzig unter ihren intimsten Schätzen aufbewahrte, so daß der Anzug, den sie für Stepan Trofimowitsch entwarf, möglicherweise nur aus diesem Grunde ein wenig dem auf dem Bildchen glich. Aber auch das will natürlich nicht viel besagen.
In den ersten Jahren, oder genauer, in der ersten Hälfte seines Weilens im Hause Warwara Petrownas trug sich Stepan Trofimowitsch noch immer mit dem Plan zu einem bedeutenden Werk und traf tagtäglich ernsthafte Anstalten, es zu schreiben. In der zweiten Hälfte indes muß sein Hirn wie leergeblasen gewesen sein. Immer häufiger erklärte er uns: »Da glaubt man mit der Arbeit anfangen zu können, das Material beisammen zu haben, doch man kommt nicht voran. Es will einfach nicht gehen!« und ließ trübsinnig den Kopf hängen. Zweifellos mußte gerade dies ihm als Märtyrer der Wissenschaft in unseren Augen noch mehr Größe verleihen; er selbst freilich wollte etwas anderes. »Vergessen hat man mich, niemand braucht mich!« entrang es sich ihm mehr als einmal. Diese zunehmende Hypochondrie ergriff besonders Ende der fünfziger Jahre von ihm Besitz. Warwara Petrowna erkannte schließlich, wie ernst es war. Auch vermochte sie nicht den Gedanken zu ertragen, ihr Freund sei vergessen und werde nicht gebraucht. Um ihn zu zerstreuen und gleichzeitig seinen Ruhm aufzufrischen, nahm sie ihn mit nach Moskau, wo sie einige exklusive Bekanntschaften in literarischen und gelehrten Kreisen besaß; doch auch Moskau erwies sich als unzureichend.
Damals war eine besondere Zeit; etwas Neues kam auf, das der früheren Geruhsamkeit arg wenig glich, etwas höchst Seltsames, das man jedoch überall spürte, selbst in Skworeschniki. Man vernahm die verschiedensten Gerüchte. Die Tatsachen als solche waren mehr oder weniger bekannt, doch unübersehbar tauchten neben den Tatsachen auch bestimmte begleitende Ideen auf, und zwar in beängstigender Menge. Und gerade das bereitete Unbehagen: Es war schlechterdings unmöglich, sich darauf einzustellen und genau zu erfahren, was diese Ideen denn besagten. Warwara Petrowna, ihrem weiblichen Naturell folgend, wollte in ihnen um jeden Preis ein Geheimnis argwöhnen. Sie griff schon selbst zu Zeitungen und Zeitschriften, zu verbotenen Büchern aus dem Ausland und sogar zu den damals aufkommenden Proklamationen (all das wurde ihr ins Haus geliefert); doch ihr schwindelte davon nur der Kopf. Sie versuchte es mit Briefen: die Antworten gingen sehr spärlich ein und klangen mit fortschreitender Zeit immer unverständlicher. Stepan Trofimowitsch wurde feierlich aufgefordert, ihr »alle diese Ideen« ein für allemal zu erläutern; doch seine Erläuterungen stellten sie absolut nicht zufrieden. Stepan Trofimowitschs Ansichten über die allgemeine Entwicklung zeichneten sich durch äußersten Hochmut aus; alles lief bei ihm darauf hinaus, daß er selbst vergessen sei und von niemandem gebraucht würde. Endlich tat man auch seiner einmal Erwähnung, zunächst in ausländischen Publikationen, als eines verbannten Märtyrers, gleich darauf in Petersburg, wo er als ehemaliger Stern einer bekannten Gruppierung bezeichnet wurde; aus irgendeinem Grunde verglich man ihn sogar mit Radistschew. Dann schrieb jemand, er sei schon gestorben, und stellte einen Nachruf in Aussicht. Stepan Trofimowitsch war blitzschnell wieder lebendig und gab sich ein ausgesprochen würdevolles Air. Aller Hochmut in der Beurteilung seiner Zeitgenossen war mit einem Schlage verflogen, und in seinem Inneren entbrannte ein Wunsch: sich der gesellschaftlichen Entwicklung anzuschließen und seine Kräfte zu beweisen. Warwara Petrowna hegte erneut unbegrenztes Vertrauen und entfaltete schreckliche Geschäftigkeit. Es wurde beschlossen, ohne den geringsten Aufschub nach Petersburg zu fahren, alles konkret in Erfahrung zu bringen, sich persönlichen Einblick zu verschaffen und sich, wenn möglich, dem neuen Wirkungsfeld voll und ganz zu verschreiben. Unter anderem erklärte sich Warwara Petrowna bereit, eine eigene Zeitschrift zu gründen und dieser von nun an ihr ganzes Leben zu weihen. Als Stepan Trofimowitsch sah, wie weit die Sache gediehen war, wurde er noch schlimmer vom Hochmutsteufel geplagt und legte Warwara Petrowna gegenüber schon während der Reise ein nahezu gönnerhaftes Gebaren an den Tag, was diese flugs in ihrem Herzen verwahrte. Für sie gab es übrigens noch einen zweiten sehr wichtigen Grund zur Reise, nämlich die Wiederaufnahme höchster Verbindungen. Sie mußte sich der Gesellschaft nach Möglichkeit in Erinnerung bringen oder es zumindest versuchen. Offizieller Anlaß für die Reise war jedoch ein Wiedersehen mit ihrem einzigen Sohn, der damals gerade an einem Petersburger Lyzeum seine Abschlußprüfungen machte.
6
Sie fuhren nach Petersburg und verbrachten dort nahezu die ganze Wintersaison. Zu den großen Fasten indes platzte das Ganze wie eine schillernde Seifenblase. Die schönen Träume zerstoben, und alle Wirrsal hatte sich nicht etwa geklärt, sondern nur noch verschlimmert. Zum ersten waren die höchsten Verbindungen nahezu überhaupt nicht oder doch nur in mikroskopischster Form und unter erniedrigenden Anstrengungen zustande gekommen. Die gekränkte Warwara Petrowna stürzte sich nun mit aller Ausschließlichkeit auf die »neuen Ideen« und eröffnete in ihrer Wohnung literarische Abende. Sie lud Literaten ein, und man führte ihr solche unverweilt in Menge zu. Danach kamen sie schon von selber, ohne Einladung; einer brachte den anderen mit. Noch nie hatte sie solche Literaten gesehen. Sie waren eitel bis zur Unerträglichkeit, dies aber ganz unverhüllt, als entledigten sie sich damit einer Pflicht. Manche (wenn auch bei weitem nicht alle) kamen gar betrunken, schienen hierin jedoch einen besonderen, erst gestern entdeckten Schick zu sehen. Alle waren auf irgend etwas geradezu komisch stolz. Auf aller Mienen stand geschrieben, sie seien soeben auf ein ungemein wichtiges Geheimnis gestoßen. Sie beschimpften einander und rechneten sich dies zur Ehre an. Ziemlich schwierig war zu erfahren, was sie denn geschrieben hätten; doch es waren Kritiker unter ihnen, Romanschriftsteller, Theaterschriftsteller, Satiriker und Ankläger. Stepan Trofimowitsch konnte sogar in ihren allerhöchsten Kreis eindringen, von dem aus die Bewegung geleitet wurde. Die Leitenden lebten in unvorstellbarer Höhe, doch sie nahmen ihn freundlich auf, obzwar natürlich keiner von ihnen etwas über ihn wußte oder von ihm gehört hatte, außer daß er »eine Idee repräsentierte«. Er ging bei ihnen so geschickt zu Werke, daß er auch sie, ihrer olympischen Unnahbarkeit zum Trotz, ein- oder zweimal in Warwara Petrownas Salon zu locken wußte. Sie nun waren sehr ernst und sehr höflich; benahmen sich gut; wurden von den übrigen anscheinend gefürchtet; allein ganz offensichtlich hatten sie keine Zeit. Auch zwei oder drei frühere literarische Berühmtheiten ließen sich einmal sehen, die damals zufällig in Petersburg weilten und mit denen Warwara Petrowna seit langem exquisiteste Beziehungen unterhielt. Aber zu ihrem Erstaunen verhielten sich diese echten und über jeden Zweifel erhabenen Berühmtheiten mucksmäuschenstill, ja einige von ihnen biederten sich bei diesem ganzen neuen Pack schlicht und einfach an und redeten ihm beschämend nach dem Munde. Zunächst hatte Stepan Trofimowitsch Glück; er kam diesen Leuten gerade gelegen, und sie präsentierten ihn auf öffentlichen literarischen Veranstaltungen. Als er neben anderen das erste Mal bei einer öffentlichen literarischen Lesung die Bühne betrat, um aus seinen Werken vorzutragen, brandete enthusiastischer, fünf Minuten lang nicht verstummen wollender Beifall auf. Er hat sich hieran noch neun Jahre danach mit Tränen erinnert – freilich wohl eher auf Grund seiner künstlerischen Natur denn aus Dankbarkeit. »Ich schwöre Ihnen und halte jede Wette«, sagte er zu mir (aber nur zu mir und unter dem Siegel der Verschwiegenheit), »keiner unter all diesen Zuhörern hatte auch nur die leiseste Ahnung, wer ich bin!« Ein bemerkenswertes Eingeständnis: demnach muß er doch einen scharfen Verstand besessen haben, wenn er damals, auf der Bühne, trotz des Erfolgsrausches seine Lage so klar erkannte; und wiederum kann er keinen scharfen Verstand besessen haben, wenn er sich noch neun Jahre später nicht ohne ein Gefühl der Kränkung daran erinnern konnte. Man ließ ihn zwei oder drei Proteste mit unterschreiben (wogegen, wußte er nicht); er unterschrieb. Warwara Petrowna ließ man gleichfalls ihre Unterschrift unter irgendeine »schändliche Handlungsweise« setzen, und auch sie unterschrieb. Übrigens besuchten die meisten dieser neuen Leute zwar Warwara Petrownas Abende, hielten sich aber aus irgendeinem Grunde für verpflichtet, verachtungsvoll und mit unverhohlenem Spott auf sie herabzublicken. Stepan Trofimowitsch hat später, in Augenblicken der Bitterkeit, mir gegenüber durchblicken lassen, seit damals eben sei sie neidisch auf ihn gewesen. Natürlich sah sie ein, daß sie mit solchen Leuten nicht verkehren dürfte, empfing sie aber trotzdem geradezu gierig, mit aller hysterischen weiblichen Ungeduld, und schien dabei vor allem immer auf etwas zu warten. An den Abenden sprach sie wenig, obwohl sie durchaus hätte sprechen können; sie hörte lieber zu. Man redete von Abschaffung der Zensur und des Buchstabens Jer, von der Einführung lateinischer Buchstaben anstelle der russischen, von jemandem, der am Vortage in Verbannung geschickt worden war, über einen Skandal in der Passage, über den Nutzen einer Aufsplitterung Rußlands nach Völkerschaften bei loser föderativer Bindung, über eine Abschaffung von Heer und Flotte, die Wiederherstellung Polens bis zum Dnepr, über Bauernreform und Proklamationen, die Abschaffung des Erbrechts, der Familie, der Kinder und Geistlichen, über Frauenrechte, über Krajewskis Haus, das keiner dem Herrn Krajewski je verzeihen konnte, und dergleichen mehr. Erklärlicherweise gab es in diesem Sammelsurium von Emporkömmlingen auch viele Spitzbuben, unbestreitbar aber auch viele ehrenhafte, sogar sehr anziehende Persönlichkeiten – trotz einiger doch recht verwunderlicher Varietäten. Die Ehrenhaften waren weit unverständlicher als die Unehrenhaften und Flegel; unklar blieb nur, wer wen beherrschte. Als Warwara Petrowna verkündete, sie gedenke eine Zeitschrift herauszugeben, drängte sich noch mehr Volks in ihren Salon, sofort jedoch hagelte es auch unverhüllte Beschuldigungen, sie sei eine Kapitalistin und beute menschliche Arbeit aus. Die Vorwürfe wurden ebenso unverfroren wie unerwartet erhoben. Ein steinalter General, Iwan Iwanowitsch Drosdow, ehemaliger Freund und Kriegskamerad des seligen Generals Stawrogin, ein uns allen hier wohlbekannter und (freilich auf seine Art) höchst ehrenwerter, extrem widerborstiger und reizbarer Mann, der immer schrecklich viel aß und entsetzliche Angst vor Atheismus hatte, bekam auf einem Abend bei Warwara Petrowna Streit mit einem berühmten jungen Mann. Der fackelte nicht lange und schleuderte ihm ins Gesicht: »Sie müssen ein General sein, wenn Sie so daherreden«, als wollte er sagen, ein schlimmeres Schimpfwort als General könne er nicht finden. Iwan Iwanowitsch brauste zornig auf: »Ja, Verehrtester, ich bin General, und zwar Generalleutnant, und ich habe meinem Zaren gedient, wogegen du, Verehrtester, ein Rotzjunge bist und ein Atheist dazu!« Die Folge war ein alle Grenzen des Anstandes übersteigender Skandal. Am nächsten Tag wurde der Zwischenfall in der Presse breitgetreten, und es kam zu einer Unterschriftensammlung gegen die »schändliche Handlungsweise« Warwara Petrownas, die nicht bereit gewesen war, dem General auf der Stelle die Tür zu weisen. In einer Illustrierten erschien eine Karikatur, in der Warwara Petrowna, der General und Stepan Trofimowitsch, aufs hämischste zusammen abkonterfeit, als drei rückschrittsbesessene Freunde dargestellt waren; der Karikatur waren auch Verse beigefügt, die ein volkstümlicher Dichter einzig für diesen Zweck verfaßt hatte. Ich darf von mir aus anmerken, daß tatsächlich viele Personen im Generalsrang die komische Angewohnheit haben, zu erklären: »Ich habe meinem Zaren gedient …«, als ob sie nicht denselben Zaren hätten wie wir einfachen Untertanen, sondern einen besonderen, der nur ihnen gehört.
Ein weiteres Verbleiben in Petersburg war nun natürlich unmöglich, um so mehr, als auch Stepan Trofimowitsch ein endgültiges Fiasko erlitt. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen und verkündete nunmehr die Rechte der Kunst, worauf man ihn nur noch lauter verlachte. Bei seinem letzten Vortrag gedachte er, durch forensische Eloquenz Wirkung zu erzielen, meinte er doch, auf diese Weise die Herzen rühren und auf Ehrerbietung gegenüber einem »Verbannten« rechnen zu können. Widerspruchslos erklärte er sich damit einverstanden, »Vaterland« sei ein unnützes und lächerliches Wort; auch dem Gedanken von der Schädlichkeit aller Religion pflichtete er bei, erklärte dafür aber laut und bestimmt, ein Puschkin sei noch immer mehr wert als ein Paar gute Stiefel, sogar viel mehr wert. Er wurde erbarmungslos ausgepfiffen und brach auf der Stelle, in aller Öffentlichkeit und ohne die Bühne zu verlassen, in Tränen aus. Von Warwara Petrowna wurde er, mehr tot als lebendig, nach Hause gebracht. »On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!« stammelte er immer wieder fassungslos vor sich hin. Sie pflegte ihn die ganze Nacht, gab ihm Kirschlorbeertropfen und wiederholte ihm bis zum Morgengrauen: »Sie sind noch wer; Sie werden’s denen noch zeigen; man wird Sie noch zu schätzen wissen … andernorts.«
Am nächsten Tag erschienen in aller Frühe bei Warwara Petrowna fünf Literaten, von denen sie drei überhaupt nicht kannte und noch nie gesehen hatte. Strenger Miene verkündeten sie ihr, sie hätten die Zeitschriftenangelegenheit geprüft und überbrächten den diesbezüglichen Entscheid. Warwara Petrowna hatte nie und nimmer jemanden beauftragt, irgend etwas wegen ihrer Zeitschrift zu prüfen und zu entscheiden. Der Entscheid lautete, sie habe die Zeitschrift sofort nach der Gründung mit allem Kapital ihnen zu übergeben, und zwar auf der Rechtsgrundlage einer freien Assoziation; sie selbst solle sich nach Skworeschniki begeben und ja nicht vergessen, Stepan Trofimowitsch mitzunehmen, der »schon zu alt sei«. Rücksichtsvollerweise erklärten sie sich bereit, ihr das Eigentumsrecht zuzuerkennen und jährlich ein Sechstel des Reingewinns zu überweisen. Am rührendsten war, daß wahrscheinlich vier von diesen fünf keinerlei gewinnsüchtige Absichten verfolgten, sondern ausschließlich im Namen der »gemeinsamen Sache« handelten.
»Wie betäubt sind wir abgereist«, erzählte Stepan Trofimowitsch später. »Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen und habe, dessen erinnere ich mich, zum Rattern des Eisenbahnwagens nur immer wieder gestammelt:
Zeitschrift WEK und Lew Kambek,
Lew Kambek und Zeitschrift WEK …
und wer weiß was sonst noch in dieser Art, bis Moskau. Erst in Moskau bin ich wieder zu mir gekommen – als ob mich dort etwas anderes erwartet hätte! O meine Freunde!« wandte er sich bisweilen wie in höherer Eingebung an uns. »Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Trauer und Bitterkeit die Seele eines Menschen befällt, wenn eine große Idee, die er lange Zeit heilig gehütet, von Unfähigen aufgegriffen und zu ebensolchen Dummköpfen wie sie selbst auf die Gasse gezerrt wird und sie ihm dann plötzlich auf dem Trödelmarkt begegnet, nicht wiederzuerkennen, beschmutzt, läppisch und schief dargeboten, ohne Proportion, ohne Harmonie, ein Spielzeug für törichte Kinder! Nein! Zu unserer Zeit war es anders, und nicht dies ist es, was wir erstrebten. Nein, nein, durchaus nicht dieses. Alles ist mir hier fremd … Unsere Zeit wird wiederkehren und alles Schwankende, diese ganze Gegenwart wieder in sichere Bahnen lenken. Was würde sonst wohl geschehen? …«
7
Gleich nach der Rückkehr aus Petersburg schickte Warwara Petrowna ihren Freund ins Ausland: »zur Erholung«; und es mußte wohl auch sein, daß sie sich für eine Weile trennten, das spürte sie. Stepan Trofimowitsch machte sich himmelhoch jauchzend auf die Reise. »Dort werde ich zu einem neuen Menschen!« rief er aus. »Dort kann ich mich endlich der Wissenschaft weihen!« Doch schon in den ersten Briefen aus Berlin stimmte er wieder sein altes Lied an. »Mein Herz ist gebrochen«, schrieb er an Warwara Petrowna. »Ich kann nicht vergessen! Hier in Berlin erinnert mich alles an alte, vergangene Zeiten, an erste Freuden und erstes Leid. Wo ist sie, die eine? Wo die andere? Wo sind sie, die beiden Engel, deren ich nie wert gewesen? Wo ist mein Sohn, mein geliebter Sohn? Wo schließlich bin ich, ich selbst, mein früheres Ich, hart wie Stahl und unerschütterlich wie ein Fels, während jetzt ein hergelaufener Andrejeff, un orthodoxer Narr mit Bart, peut briser mon existence en deux« und so weiter und so weiter. Was Stepan Trofimowitschs Sohn anlangt, so hatte er ihn bis dahin insgesamt nur zweimal zu Gesicht bekommen, das erste Mal, als er geboren wurde, und das zweite Mal erst unlängst in Petersburg, wo sich der junge Mann auf die Universität vorbereitete. Sein ganzes Leben hatte der Junge, wie bereits gesagt, bei Tanten im Gouvernement O. verbracht (auf Kosten Warwara Petrownas), siebenhundert Werst von Skworeschniki entfernt. Was andererseits den erwähnten Andrejeff, will sagen, Andrejew, anlangt, so war dies schlicht und einfach ein hiesiger Kaufmann und Ladenbesitzer, ein ausgesprochener Sonderling, Archäologe aus Liebhaberei und passionierter Sammler russischer Altertümer, der Stepan Trofimowitsch bisweilen mit seinen Kenntnissen und vor allem mit seiner gesamten Einstellung reizte. Von diesem ehrenhaften Kaufmann mit seinem grauen Vollbart und der großen silbergerahmten Brille hatte Stepan Trofimowitsch noch vierhundert Rubel zu bekommen, den Restbetrag für einige Deßjatinen Wald seines kleinen (gleich neben Skworeschniki gelegenen) Gütchens, die er Andrejew zum Abholzen verkauft hatte. Gewiß war Stepan Trofimowitsch von Warwara Petrowna, als diese ihren Freund nach Berlin schickte, sehr nobel mit Geld versehen worden, doch gerade auf diese vierhundert Rubel hatte er besonders gerechnet – wahrscheinlich für geheime Ausgaben, und er wäre beinahe in Tränen ausgebrochen, als »dieser Andrejeff« ihn bat, einen Monat zu warten, wobei er übrigens ein Recht auf solchen Aufschub besaß, hatte er doch die ersten Raten fast ein halbes Jahr vorfristig auf einmal gezahlt, weil Stepan Trofimowitsch sie damals dringend benötigte. Warwara Petrowna las den ersten Brief begierig von Anfang bis Ende durch, unterstrich mit Bleistift den Ausruf: »Wo sind sie, die beiden Engel?«, vermerkte das Datum und schloß ihn dann in ihre Schatulle. Er meinte natürlich seine beiden verstorbenen Gattinnen. Im zweiten Brief aus Berlin wurde das Lied variiert: »Ich arbeite zwölf Stunden am Tag« (»und wenn es nur elf wären«, murmelte Warwara Petrowna vor sich hin), »wühle in Bibliotheken, kollationiere, exzerpiere, bin ständig auf den Beinen; war bei einigen Professoren. Habe meine Bekanntschaft mit der vortrefflichen Familie Dundassow erneuert. Wie reizend ist Nadeshda Nikolajewna sogar jetzt noch! Sie läßt Sie grüßen. Ihr junger Gemahl und alle drei Neffen sind in Berlin. An den Abenden plaudern wir bis zum Morgengrauen mit jungen Leuten, es sind geradezu attische Abende, das heißt – nur was Geist und Eleganz anlangt; alles in Ehren: viel Musik, spanische Motive, Träume von Menschheitserneuerung, die Idee ewiger Schönheit, die Sixtinische Madonna, Licht mit einigen Sprenkeln von Dunkel, aber selbst die Sonne hat ja ihre Flecke! O teure Freundin, edle, treue Freundin! Ich bin mit dem Herzen bei Ihnen, bin der Ihre, stets der Ihre, en tout pays, und wäre es selbst dans le pays de Makar et de ses veaux, von dem wir, Sie erinnern sich, so oft mit innerem Beben in Petersburg sprachen, vor meiner Abreise. Die Erinnerung entlockt mir ein Lächeln. Kaum hatte ich die Grenze passiert, fühlte ich mich außer Gefahr, ein eigentümliches Gefühl, ganz neu, zum erstenmal nach so vielen Jahren …« und so weiter und so weiter.
»Alles Gerede!« entschied Warwara Petrowna und legte auch diesen Brief zu den anderen. »Bis zum Morgengrauen attische Abende, da kann er ja wohl nicht zwölf Stunden täglich hinter den Büchern sitzen. War er vielleicht betrunken, als er das schrieb? Welche Dreistigkeit von dieser Dundassowa, mich grüßen zu lassen! Ansonsten, soll er sich nur ein wenig amüsieren …«
Die Redewendung »dans le pays de Makar et de ses veaux« bedeutete: »Wohin selbst Makar seine Kälber noch nicht getrieben hat«. Stepan Trofimowitsch übersetzte russische Sprichwörter und altüberlieferte Redewendungen bisweilen mit beabsichtigter Einfalt wortwörtlich ins Französische, obwohl er zweifellos imstande war, sie richtig zu verstehen und besser zu übersetzen; er machte das aus einer Art Snobismus heraus und fand es geistreich.
Doch er amüsierte sich nicht lange, keine vier Monate hielt er es aus, dann eilte er wieder nach Skworeschniki. Seine letzten Briefe bestanden aus lauter Beteuerungen gefühlvollster Liebe zu seiner abwesenden Freundin und waren buchstäblich mit Tränen der Trennung benetzt. Es gibt Naturen, die sich allzusehr ans Haus gewöhnen, wie Zimmerhündchen. Das Wiedersehen der beiden gestaltete sich enthusiastisch. Nach zwei Tagen lief alles wieder seinen alten Gang, und es war sogar noch langweiliger als vorher. »Mein Freund«, bekannte mir Stepan Trofimowitsch nach zwei Wochen unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit, »mein Freund, ich habe eine fürchterliche … Entdeckung gemacht: je suis un ganz gewöhnlicher Gnadenbrotempfänger et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!«
8
Danach trat Stille bei uns ein und währte nahezu diese ganzen neun Jahre. Hysterieausbrüche und Ausweinen an meiner Schulter – sich regelmäßig wiederholende Erscheinungen – konnten unser Wohlbefinden nicht im geringsten beeinträchtigen. Erstaunlich, daß Stepan Trofimowitsch in dieser Zeit nicht dicker wurde. Nur seine Nase färbte sich etwas rot, und er nahm an Sanftmut zu. Mit der Zeit bildete sich um ihn ein fester Kreis von Freunden, der übrigens nie sehr groß war. Warwara Petrowna suchte zwar selten Kontakt zu diesem Kreis, dennoch erkannten wir ihr alle die Rolle unserer Schirmherrin zu. Nach der ihr in Petersburg zuteil gewordenen Lehre ließ sie sich endgültig in unserer Stadt nieder; den Winter verbrachte sie in ihrem Stadthaus, den Sommer dagegen auf ihrem nahe gelegenen Gut. Nie zuvor besaß sie solche Bedeutung und soviel Einfluß in der Öffentlichkeit unseres Gouvernements wie während der letzten sieben Jahre, das heißt bis zur Ernennung unseres jetzigen Gouverneurs. Der frühere Gouverneur, unser unvergessener und weichherziger Iwan Ossipowitsch, war ein naher Verwandter von ihr und hatte einstmals ihre Wohltätigkeit erfahren. Seine Gemahlin zitterte beim bloßen Gedanken, es Warwara Petrowna einmal nicht recht zu machen, und die Ehrerbietung seitens der besseren Gesellschaft erreichte einen solchen Grad, daß sie förmlich an Götzendienst erinnerte. Folglich hatte es auch Stepan Trofimowitsch gut. Er war Mitglied des Klubs, ein würdevoller Verlierer im Spiel und genoß Ansehen, wenngleich viele in ihm nur den »Gelehrten« sahen. Später, als Warwara Petrowna ihm erlaubte, in einem anderen Haus zu wohnen, fühlten wir uns noch ungehemmter. Wir versammelten uns an die zweimal pro Woche; es ging immer lustig zu, besonders wenn er nicht mit Champagner geizte. Wein wurde stets im Laden des uns ja schon bekannten Andrejew geholt. Die Begleichung der Rechnungen nahm Warwara Petrowna alle halben Jahre vor, und dieser Zahltag war fast immer ein Tag von Cholerine-Anfällen.
Eines der ältesten Mitglieder unseres Kreises war Liputin, ein Gouvernementsbeamter, nicht mehr der jüngste, sehr liberal gesonnen und in der Stadt als Atheist verschrien. Er war zum zweitenmal verheiratet, und zwar mit einem jungen, hübschen Ding, das ihm eine schöne Mitgift eingebracht hatte, außerdem besaß er drei fast schon erwachsene Töchter. Seine ganze Familie hielt er in strenger Gottesfurcht und hinter verschlossenen Türen, war maßlos geizig und hatte sich während seiner Dienstjahre ein Häuschen und Kapital zusammengespart. Ein unruhiger Geist und dabei von nur niedrigem Rang, in der Stadt wenig geachtet und in den höheren Kreisen nicht zugelassen. Zu alledem hatte er ein ausgesprochenes Lästermaul, für das er schon mehrmals büßen mußte: einmal hatte ihn ein Offizier schmerzhaft gezüchtigt, ein anderes Mal ein ehrenwerter Familienvater und Gutsbesitzer. Aber wir liebten seinen scharfen Verstand, seine Wißbegier und seine eigentümliche bösartige Lustigkeit. Warwara Petrowna mochte ihn nicht, doch er verstand es immer, sie irgendwie zu hofieren.
Auch einen anderen mochte sie nicht leiden – Schatow, der erst vergangenes Jahr Mitglied unseres Kreises wurde. Schatow studierte früher an der Universität und wurde nach einer Studentenaffäre relegiert; in der Kindheit war er Stepan Trofimowitschs Schüler gewesen, bei seiner Geburt aber Leibeigener Warwara Petrownas, Sohn ihres verstorbenen Kammerdieners Pawel Fjodorow, und er hatte von ihr viele Wohltaten erfahren. Sie mochte ihn nicht wegen seines Stolzes und seiner Undankbarkeit, und sie konnte ihm nie verzeihen, daß er nach dem Ausschluß aus der Universität nicht sofort zu ihr gekommen war; ganz im Gegenteil, einen damals von ihr speziell dieserhalb