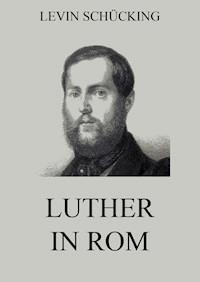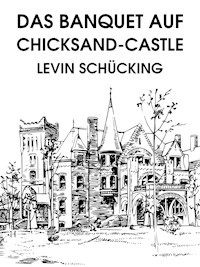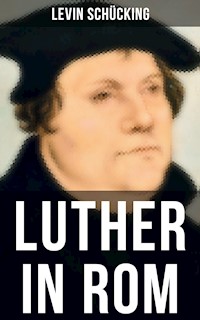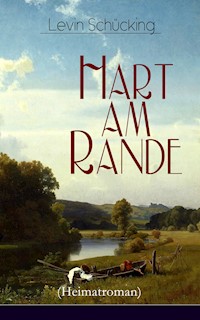Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Die Diamanten der Großmutter' entführt uns Levin Schücking in die Welt des 19. Jahrhunderts, in der die junge Protagonistin auf der Suche nach den verlorenen Diamanten ihrer Großmutter ist. Der Roman zeichnet sich durch seinen beschreibenden Stil und die detaillierte Schilderung der damaligen Gesellschaft aus. Schücking verwebt geschickt Elemente des Familienromans mit einer spannenden Schatzsuche, die den Leser bis zum Schluss fesselt. Als Vertreter der Realistischen Schule zeigt Schücking auch eine kritische Haltung gegenüber den sozialen Missständen seiner Zeit, die in das Werk subtil eingewoben sind. Levin Schücking, als Schriftsteller und Übersetzer bekannt, schöpft aus seinem reichen Erfahrungsschatz und bringt mit 'Die Diamanten der Großmutter' ein Werk hervor, das sowohl Unterhaltung bietet als auch zum Nachdenken anregt. Seine enge Verbundenheit mit der Literatur und die Liebe zum Detail spiegeln sich in jedem Satz wider, und sein feines Gespür für die menschliche Natur zeigt sich in den vielschichtigen Charakteren des Romans. 'Die Diamanten der Großmutter' ist ein lesenswertes Buch für alle, die sich für historische Romane mit einer packenden Handlung und tiefgründigen Botschaft interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Diamanten der Großmutter
Books
Inhaltsverzeichnis
1.
In den letzten Septembertagen des Jahres 1870 saß eine Gesellschaft deutscher Officiere, ein Hauptmann und drei Lieutenants – just so viel, wie zur Führung einer Compagnie genügen, wenn ein intelligenter Vicefeldwebel sie mit seiner Einsicht unterstützt – in dem kleinen, terrassenförmig angelegten Garten eines Restaurants in einem französischen Städtlein, das den Namen Void führt und im obern Maasthal liegt. Die Maas ist hier noch ein sehr bescheidenes Gewässer, sie ist eben aus dem wasserreichen Schooß der Sichelberge entsprungen, um an ihrem linken Ufer das berühmte Vaucouleurs zu bespülen; eine Strecke weiter abwärts schlägt sie nach Nordost einen Bogen, an dessen Ende, am Fuß ansehnlicher Höhen Void liegt, und wendet sich dann wieder dem Norden zu, um zunächst Commercy, die alte Residenz der Herzöge von Lothringen und Bar, zu berühren, dessen schönes Schloß mit seinen Erinnerungen an den guten König Stanislaus, an Voltaire und an die »divine Emilie«, die Marquise du Chatelet, jetzt eine große Caserne ist.
Commercy selbst war damals ein wichtiger Etappenplatz für die deutschen Heere, die auf der großen Straße von Nancy nach Paris zogen – zur Sicherung des Punktes hatte man in das hier sich öffnende Maasthal aufwärts hinein, und zwar in den nächsten bedeutenderen Ort, unser Void, eine Compagnie Truppen gelegt, die aus norddeutscher Landwehr bestanden und die Aufgabe hatten, die Thalstraße zu bewachen und die von Langres her durch das Thal abwärtsführende Eisenbahn im Auge zu halten, nachdem man sie unfahrbar gemacht hatte.
Es war ein ziemlich leichter Dienst, der unsrem kleinen Corps zu Theil geworden; das Einzige, was eine gewisse Wachsamkeit nothwendig machte, war der Umstand, daß sich Haufen Franctireurs in den Vogesen gebildet hatten und von dort oder von der Festung Langres her einen Handstreich wider die große Heerstraße der Deutschen ausführen konnten; aber auch das war in diesem Augenblicke nicht wohl mehr denkbar, weil das vierzehnte Armeecorps unter dem General von Werder sich eben zu seinem Marsch auf Epinal rüstete, um jene Banden zu zerstreuen; seine Vorhut unter dem General Degenfeld war bereits auf dem Marsche, der sie zu dem Gefechte von Raon l’Etape führte – und diese Bewegungen sicherten unser Commando jetzt eben ziemlich vollständig gegen die Gefahren, welche ihnen vom Süden her drohen konnten.
Es war also ein ruhiger Garnisondienst, den sie zu üben hatten – mit Exercitien wurden die biederen Landwehrmänner verschont; wenn die Streifpatrouillen ausgesendet, die regelmäßigen Rapporte nach Commercy abgeschickt, die Posten revidirt waren, so blieb den Officieren nichts übrig, als sich die Zeit zu vertreiben, so gut wie möglich, und als Schauplatz ihrer auf dieses Ziel gerichteten vereinten Thätigkeit hatten sie den hübschen Garten des Restaurants gewählt, der, durch eine sehr hohe Futtermauer von der Hauptstraße des Ortes getrennt, so hoch lag, daß man aus dem Billardsaale in der Beletage des Hauses durch eine Glasthür hineintrat. Alte Kastanienbäume beschatteten ihn; am Ende auf einer Erhöhung lag ein von Reben umsponnener Pavillon, aus dem man eine sehr hübsche Aussicht auf das reizende, offene und fleißig angebaute Thal der Maas, seine Wiesen, Rebenhügel und waldgekrönten Bergzüge hatte.
Die Officiere saßen in dem Pavillon um einen runden Tisch, der mit Flaschen und Gläsern bedeckt war; sie spielten Karten, Whist, aber mit dem Blinden, denn Einer aus der Vierzahl hatte vorhin ermüdet die Karten weggeworfen und war auf die Gartenterrasse hinausgegangen; er stand, mit den Armen sich auf die Mauerbrüstung lehnend und sich über sie beugend, und blickte wie zerstreut und in Gedanken verloren in das Thal hinaus.
Es war ein schlanker junger Mann von etwa dreißig Jahren, mit einem feingeschnittenen aristokratischen Kopfe; er hatte dunkles Haar, große, ein wenig vorliegende blaue Augen, die von breiten Lidern halb verschleiert waren, und einen zwar hoffnungsvollen, aber jetzt noch struppigen, häßlichen Ansatz zu einem Vollbart, ein Product des Feldlebens, das noch zu jung war, um nicht in seinem jetzigen Stadium der Entwickelung seinen Eigenthümer mehr zu entstellen als zu schmücken. Der einsame Stern unter der Regimentsnummer auf seiner Epaulette bezeichnete ihn als den Premierlieutenant bei seiner Truppe.
Max von Daveland, so hieß unser Unterbefehlshaber über die Schaar gesetzter Männer, welche Void occupirt hatte, war stets ein fleißiger und thätiger Mensch gewesen und schon seit ein paar Jahren an angestrengte amtliche Thätigkeit gewöhnt. Der Müßiggang in dem kleinen fremden Garnisonsorte drückte ihn – um eine Beschäftigung für seine Gedanken zu haben, hatte er etwas gethan, wozu er daheim bei seinen Studien und Arbeiten noch nie ernstlich Zeit gefunden – er hatte sich verliebt, aber freilich in mehr als platonischer Weise, in partibus infidelium, würde sein Freund Hartig, der Vicefeldwebel, mit Beziehung auf die Französin gesagt haben; verliebt in eine Fremde, Unbekannte, in einen bloßen Schatten, ein farbloses Bild, aber doch ein Lichtbild – nicht blos in seiner Phantasie war sie das, sondern in Wirklichkeit war ein Lichtbild bisher Alles, was er von der Unbekannten, mit der seine Träume sich beschäftigten, gesehen. Die Officiere hatten eines Tages zum Zeitvertreib bei dem Photographen von Void einen Einbruch gemacht und sich von ihm zu einem Bilde gruppiren lassen, das ihnen zur Erinnerung an die gemeinsam verlebten Tage dienen sollte. Bei dieser Gelegenheit war Max Daveland auf ganz eigenthümliche Weise von einer Photographie betroffen worden, die er im Atelier des Künstlers unter dessen früheren Werken ausgestellt gefunden. Es war ein sogenanntes Cabinetsbild und stellte eine junge Dame von etwa zwanzig Jahren vor, deren von einem höchst anmuthigen Oval umfaßte Züge etwas außerordentlich Klares und Edles in den fest und bestimmt gezeichneten Linien und dabei nichts vom französischen Typus hatten, einen weichen und doch so offenen und freien Ausdruck; etwas von deutscher Gefühlsweise oder Innigkeit blickte unter den breiten halbgeschlossenen Lidern hervor, die an Maxens eigene erinnerten. Als die andern Officiere durch Maxens lange Betrachtung auf das Bild aufmerksam wurden, sagte der Hauptmann Sontheim:
»Das hat etwas von deutscher Race, und ist gewiß eine Elsässerin!«
Und Hartig, der intelligente Vicefeldwebel, fand, daß Daveland nur so lange vor dem Bilde stehe, um daran die Wirkung halbverschleierter Augen, mit der er selber zu kokettiren pflege, zu studiren. Daveland aber hörte nicht auf diesen Scherz des Cameraden, er blickte auch eben nicht mehr auf die Züge, die ihn so lange gefesselt hatten, sondern auf etwas Anderes, den alterthümlich gefaßten Ring an der schmalen Hand, auf welche das junge Mädchen im Bilde ihr Kinn stützte. Die Form dieses Ringes hatte etwas, das ihn an alte heimathliche Geschichten erinnerte, an Ereignisse und Verhältnisse, die vor seiner Geburt lagen, die für ihn schon, Dank einer würdigen und redseligen Tante, zu den Traditionen der Kinderstube gehört … und so kam es, daß ihn der Eindruck, den ihm das Bild gemacht, nicht los ließ – er hatte es mehrmals wiedergesehen, einen Abzug kaufen wollen, aber vom Photographen eine abschlägige Antwort erhalten – das Bild gehörte einem jungen Mädchen aus der Gegend an, der Mann war nicht autorisirt, es in fremde Hände gelangen zu lassen.
Seitdem waren etwa vierzehn Tage vergangen. Es hatte sich bereits über das Lichtbild ein leiser Schatten gelegt, es hatten die ursprünglich so lebendig und so fesselnd vor seinem innern Auge stehenden Züge zu verschwimmen begonnen – die Zeit ist wie eine schwere Ackerwalze, die Alles, was der Tag und der Zufall in uns aufwühlt und emporzieht und an Entschlüssen und Vorsätzen oder Empfindungen aufsprießen läßt, unbarmherzig wieder glatt walzt und in das flache Tageseinerlei einebnet. In diesem Augenblicke war Max Daveland, als er so auf die hohe Terrassenmauer sich lehnte und über sie fort auf die Straße blickte, nicht einmal in Gedanken mehr bei seiner Unbekannten, und so unterbrach ihn auch der Hauptmann nicht, als dieser ihm aus dem Pavillon zurief:
»Der Robber ist zu Ende – willst Du nicht wieder eintreten, Daveland?«
»Ich danke, Sontheim,« antwortete Max mit einem Seufzer – »ich finde dies ewige Whist langweilig …«
»Sie warten wohl auf die hübsche blonde Nicaise, um ihr den Hof zu machen?« rief Hartig herüber.
»Das giebt Ihnen nur die Eifersucht ein, Hartig – ich habe mich mit Ihrer blonden Kellnerin nie anders beschäftigt, als um ihr so viel Deutsch beizubringen, daß sie Ihre falsch accentuirten Liebeserklärungen verstehen kann!«
»Unnütze Mühe,« rief hier ein Anderer der jungen Leute aus, »Hartig’s Gefühle werden ihr immer unverständlich bleiben.«
»Was wollen Sie? dies Frankreich ist ein unverständliches Land!« sagte Hartig, ein mitten in seinen Probejahren der friedlichen Kathederthätigkeit entrissener Schulamtscandidat, »ich habe im Examen für französische Sprache die Note ›gut‹ bekommen – und muß nun erleben, daß dies Volk hier nicht sieben Silben von dem, was ich sage, versteht, so wenig wie ich von ihrem Kauderwelsch!«
»Bei der blonden Nicaise bleibt Ihnen ja die Sprache der Augen und der Mimik,« entgegnete Hauptmann Sontheim, »oder haben Sie dafür im Examen auch ›gut‹ bekommen?«
»Wahrscheinlich, denn Nicaise lacht darüber erst recht!« rief der Secondelieutenant Merwig.
»Da Sie also bei Nicaise kein Glück haben, Hartig,« fuhr Daveland fort, »sollten Sie sich als deutscher Jüngling von der prosaischen Gegenwart mit ihren spröden Kellnerinnen ab- und der romantischen Vergangenheit zuwenden. Ist Ihnen noch nicht eingefallen, daß es im Schiller heißt: ›Er steht nicht eine Tagereise weit von Vaucouleurs …‹ Wir stehen nicht eine Vierteltagereise weit von Vaucouleurs! Machen Sie einen Ausflug mit mir nach Domremi?«
»Ach – der Vorschlag wäre nicht übel; aber Domremi liegt noch weit hinter Vaucouleurs und der Hauptmann Sontheim wird uns dazu keinen Urlaub geben!«
»Um das Haus der Jungfrau von Orleans zu sehen?« fiel der Hauptmann ein. »Welche Idee! Glauben Sie denn an die alten Geschichten, Daveland?«
»Ich glaube an Schiller.«
»An Schiller – nun ja. Ich glaube an Goethe, der irgendwo ganz gelassen sagt: ›Die Ereignisse verlieren durch die Länge der Zeit an Glaubwürdigkeit.‹ Vortrefflich das! Da haben Sie den ganzen Strauß, Bauer, Renan und so weiter auf den kürzesten und naivsten Ausdruck gebracht! Auf die ›Pucelle‹ wird es nicht minder anwendbar sein. Wenn aber Ihre romantischen Gefühle und der großen Seelen innewohnende Drang zu bewundern Sie durchaus hintreiben … nun, meinethalb, doch müssen wir erst wissen, wie weit es denn bis dahin von Void aus ist. Hoffentlich, Hartig, haben Sie nicht auch in der Geographie ›gut‹ bekommen und wissen uns zu sagen …«
Der Hauptmann Sontheim wurde hier in seiner Rede unterbrochen durch das laute Gerassel eines sich in der tiefen Gasse unter ihnen rasch heranbewegenden Wagens – es war ein leichter offener Jagdwagen mit eleganter Bespannung; ein junger Mann in grauem Staubkittel saß auf einem erhöhten Sitz auf der vorderen Bank und lenkte die Pferde, zwei schöne kräftige Füchse; ein älterer Herr und eine junge Dame nahmen die zweite Bank ein.
Daveland beugte sich, die Ellenbogen aufstemmend, über seine Mauerbrüstung vor; er faßte das auffallend hübsche Gesicht der jungen Dame in’s Auge und wechselte plötzlich heftig die Farbe; er verschlang diese feinen leicht gerötheten Züge, die sich ihm – sie hatte den geöffneten braunen Sonnenschirm über ihre Schalter zurückgelegt – mit dem Ausdruck einer offenen kindlichen Neugier zugewendet hatten; ein kleiner blauer Hut mit gelben Blumen bedeckte ihren hellbraunen Scheitel, die Bänder flatterten auf ein Kleid von gelber ungebleichter Seide – es war in der That ein Gesicht ganz von so auffallender Anmuth, von solchem Zauber, wie es vor Daveland’s Phantasie gestanden, denn unverkennbar war sie es, die Unbekannte, das Original des Lichtbildes! – In ihren Augen, wie sie sie zu Daveland aufgeschlagen lag für diesen nun vollends etwas, das wieder an Schiller erinnerte, an den »heiligen Götterstrahl, der trifft und zündet …« So rasselte der Wagen heran, und war schon fast gerade unter dem Standpunkte des jungen Mannes angekommen, als diesem plötzlich der Anblick, in den er sich versenkte, vergällt, der mächtig wirkende Zauber auf eine höchst unerwartete und schmerzliche Weise unterbrochen wurde. Der Herr auf dem Vordersitze hatte eben seine lange Kutscherpeitsche nur leicht auf die Kruppe seiner Pferde gelegt und hob sie nun mit einer raschen und kräftigen Schwenkung wieder in die Höhe – aber so unglücklich oder ungeschickt, daß sie Daveland in’s linke Auge fuhr.
Mit einem leisen unwillkürlichen Ausruf des Schmerzes schlug dieser die Hand vor’s Auge. – Der Hauptmann Sontheim, der sich aus dem Pavillon durch ein offenstehendes Fenster vorgebeugt hatte, um nach dem Wagen zu schauen, war Zeuge des Zufalls geworden und rief im selben Augenblick laut dem Wagen alle französische Flüche nach, deren er habhaft war – die anderen jungen Männer eilten hinaus, um nach Daveland’s Verletzung zu sehen, während Sontheim seine geballte Faust dem Wagen nachstreckte.
Ein paar Leute von der Compagnie kamen die Straße herauf; sie bemerkten die drohenden Gesten ihres Officiers und wandten sich, wie um ihn aufzuhalten, dem Wagen zu. Der Mann auf dem Führersitze peitschte auf die Pferde, aber der ältere Herr hinter ihm war ihm schon in die Arme gefallen; die junge Dame war aufgestanden und sah rückwärts nach der Terrasse, lebhaft redend; sie mußte das, was vorgegangen, sogleich bemerkt haben.
»Ist Ihr Auge verletzt, ist es schlimm?« rief Sontheim herbeispringend aus, während der Philologe schon in’s Haus eilte, um kaltes Wasser herbeizuholen.
»Ich weiß nicht,« versetzte Daveland, »ob das Auge verletzt ist – ich denke nicht, es wird nichts auf sich haben, es schmerzt nur abscheulich.«
»Diese tückischen Franzosen!« sagte Merwig. »Ich wette, der Mensch hat es ganz absichtlich gethan.«
»Dann lasse ich als Commandant von Void die ganze Gesellschaft wegen Angriffs auf die deutschen Truppen füsiliren!« sagte halb im Ernst, halb im Scherz der Hauptmann.
Hartig kam mit einer Schale voll Wasser aus dem Hause herbeigeeilt; die hübsche blonde Kellnerin folgte ihm mit einem Tuche. Daveland athmete tief auf, als er über die Schale gebeugt das kühlende Naß auf der getroffenen Stelle fühlte.
»Wer sind die Leute, die vorüberfuhren?« fragte Sontheim die Kellnerin.
»Es wird ein Unglück sein,« versetzte eifrig Nicaise, »ein bloßes Ungeschick – mein Gott, so was kann so leicht kommen, wenn man nicht genau aufpaßt, so leicht!«
»Siehst Du, kleine Schlange, Du denkst auch, es war viel mehr Geschick als Ungeschick bei der Sache, und freust Dich wohl im Stillen darüber – jedenfalls willst Du Deine Landsleute entschuldigen! Wer sind sie?«
»O Monsieur!« antwortete Nicaise mit dem Tone tugendhafter Entrüstung. »Ich mich freuen! Ich sehe doch, wie der arme Herr leidet. …«
»Das sagt mir immer noch nicht, wer diese Menschen sind!« fuhr der Hauptmann fort.
»Da ist der Herr, der es Ihnen selbst sagen wird,« versetzte Nicaise, auf den ältern Herrn deutend, der neben der Dame im Wagen gesessen hatte und der in diesem Augenblicke, rasch aus dem Billardsaale tretend, auf die Gruppe der Officiere zuging.
Es war ein ziemlich großer stämmiger Mann, für einen Franzosen fast zu stämmig gebaut, mit in’s Graue übergehendem aschblonden Haar und einem großen ausdrucksvollen Kopfe. Es war eine Art Kopf wie der Gustav Adolph’s, ein Gemisch von derben, wettergebräunten Zügen und feinerem, geistig durchgearbeitetem Ausdruck; ein Paar helle stahlgraue und scharfe Augen zeigten unter ihren dichten Brauen eine ungewöhnliche Beweglichkeit – vielleicht war es eine innere Erregung, die sie so rasch von Einem zum Andern in der Gruppe irren ließ, während die Augendeckel sich so nervös zitternd abwechselnd schlossen und öffneten. Ein Bart, der aus der Farbe des Kopfhaares stellenweise in’s Fuchsige überging, umrahmte sein Gesicht – seine Kleidung war die eines wohlhabenden Landbewohners.
Er trat, den Hut abziehend, heran, und sich mit Würde verbeugend, sagte er, zur Ueberraschung der jungen Männer in deutscher Sprache – mit einem leichten französischen Accent und einer gewissen Schwerfälligkeit der Zunge, wie sie in Folge mangelnder Uebung eintritt:
»Meine Herren, ich hoffe, daß Sie mit Güte die Entschuldigungen annehmen, die ich komme Ihnen zu machen. Ich brauche Ihnen nicht auszusprechen, in welchem Maße ich erschrocken bin über den ärgerlichen Zufall, der zu Ihrer Verletzung geführt hat, Herr Lieutenant.« Er richtete sich dabei an Max Daveland, der, das nasse Tuch vor das getroffene Auge haltend, jetzt mit dem andern ihn musterte.
»Es war allerdings ein sehr sonderbarer Zufall,« fiel ganz ungerührt durch die würdige Weise des Herrn und grollend Sontheim ein. »Es bedurfte nur sehr geringer Vorsicht, ihn zu vermeiden. Sie sahen doch, daß hier auf der Terrasse ein preußischer Officier stand, der …«
»Mein Gott, ich sah es, meine Tochter sah es auch! Aber mit der Führung der Pferde beschäftigt, sah es mein Freund, der den Schlag so unglücklich führte, nicht … mein Freund wird jeden Augenblick zu jeder Genugthuung, die er geben kann, bereit sein – ich hoffe jedoch, Sie, der zunächst betroffen ist,« wandte der Fremde sich wieder an Max Daveland, »werden den Ausdruck des aufrichtigsten Bedauerns und die Bitte um Verzeihung, die ich Ihnen ausspreche, mit Güte aufnehmen und mir glauben, wenn ich Ihnen versichere, ich gäbe Alles darum, wenn ich die Verletzung ungeschehen machen könnte.«
Max, in der Rechten das triefende Tuch, das er an sein Auge drückte, streckte die Linke gutmüthig lächelnd dem fremden Herrn hin, in dessen Zügen sich wirklich unverkennbar ein so aufrichtiges Bedauern malte; der Mann befand sich in einer peinlichen Lage und mußte als Franzose diese Demüthigung von den feindlichen Officieren doppelt empfinden; Daveland that Alles, um ihr ein Ende zu machen.
»Der Schmerz schwindet, und das wird Alles sein,« fuhr er fort; »das Auge ist nicht verletzt, fühl’ ich; es ist nicht der Mühe werth, so viel Aufhebens davon zu machen; wirklich, es ist nicht der Mühe werth; es thut mir leid, daß Sie Ihre Fahrt deshalb haben unterbrechen müssen, und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Theilnahme!«
»Man kann die Sache nicht liebenswürdiger aufnehmen, als Sie es thun, mein Herr,« antwortete der Fremde, dessen Züge bei diesen Worten sich sehr erhellten und eine gewisse Spannung verloren; »ich möchte mich nur überzeugen, daß Ihr Auge wirklich keinen Schaden gelitten – sonst würde ich mir erlauben, Ihnen meinen Arzt zu schicken, einen geschickten Mann, der hier in Void wohnt …«
»Es bedarf dessen gewiß nicht,« versetzte Daveland. »Sie sind also hier aus der Nachbarschaft daheim?«
»Ich wohne nur eine starke Stunde thalaufwärts.«
»Ah, so können Sie uns gewiß sagen, wie weit Domremi von hier ist?« fiel hier, weniger um der Sache willen, als um die friedliche Wendung, welche das Gespräch nahm, zu erhalten, seinerseits der Hauptmann Sontheim ein.
»Genau sechs Stunden.«
»Also ein wenig zu weit für einen Spazierritt an einem dienstfreien Nachmittage,« versetzte Sontheim.
»Wenn die Herren einen Spazierritt thalaufwärts machen wollen, würde allerdings mein Haus ein bequemeres Ziel für Sie sein,« antwortete höflich der Fremde; »es würde mir eine große Freude sein, Sie da zu bewirthen und mich bei dieser Gelegenheit zu überzeugen, daß Sie« – er wandte sich wieder an Max – »durchaus keine Folgen von dem ärgerlichen Zufall davongetragen haben. Werden Sie mir diese Freude machen? Ihr Versprechen wird mir am besten beweisen, daß Sie uns verziehen haben.«
»O, wenn das ist, gebe ich Ihnen recht gern das Versprechen,« antwortete sehr eifrig und lebhaft erröthend Max.
Der Fremde zog eine Karte hervor, überreichte sie Max, verbeugte sich und ging.
Max las, während die Anderen Jenem nachsahen, auf der Karte die Worte: »A. d’Avelon.«
»Wie heißt der höfliche Mann?« fragte Sontheim, als der Fremde im Billardsaal verschwunden war.
»D’Avelon!« antwortete Hartig, der sich der Karte bemächtigt hatte.
»Das lautet ja fast wie Daveland … es muß am Ende diese Namensvetterschaft es thun, daß Sie so bald Freunde geworden sind … mir gefällt der Geselle nicht!« bemerkte der Hauptmann.
»Weshalb nicht?« fragte Max.
»Sein Gesicht hat etwas Abstoßendes – es ist von zu viel Seelenunruhe durcharbeitet, wie es bei einfach ehrlichen Leuten nicht der Fall ist.«
»Das ist,« entgegnete Max, noch einmal das nasse Tuch zum Auge führend, »ein hartes Urtheil. Weshalb soll das Gesicht, welches, wie Sie sich ausdrücken, von Seelenunruhe durcharbeitet ist, abstoßen? Es kann auch anziehen; das Leben kann auch für den Besten eine Kette von schweren geistigen Aufgaben und innerer Unruhe, von Kampf und Sturm werden. Mich zieht das Gesicht dieses Herrn d’Avelon an, es hat etwas Deutsches, Heimathliches – er sprach auch sehr gut Deutsch –, wenn der Name nicht wäre, sollte man ihn für einen Landsmann halten.«
»Nicaise,« rief Hartig der Kellnerin entgegen, die eben diensteifrig noch eine Schale kalten Wassers brachte, »ist dieser Herr ein geborener Franzose, hier aus der Gegend?«
»Hier aus der Gegend freilich – er wohnt seit vielen Jahren auf der Ferme des Auges; aber ich denke, ich habe sagen hören, er sei von Geburt ein Belgier – es ist ein sehr schönes Gut, la Ferme des Auges, und Herr d’Avelon ein vorzüglicher Landwirth; er gehört auch zum Conseil général und ist ein Freund des Herrn Präfecten …«
»Sieh, sieh, Nicaise,« rief jetzt Sontheim aus, »wie genaue Auskunft Du jetzt über den Herrn weißt, den Du anfangs mit Deiner patriotischen Discretion in Schutz nehmen wolltest.«
Max meldete sich scherzend bei seinem Hauptmann als wieder dienstfähig und die Anderen kehrten zu ihrem Spiel zurück.
2.
La Ferme des Auges lag nicht im offenen Flußthal der Maas, sondern im Hintergrunde einer Seitenbucht des Thals, eines nach allen Seiten hin leise anschwellenden Terrains, das, von einem Kranz von oben bewaldeten Höhen umgeben, nur nach Südost, nach dem Flusse hin offen war. Diese geschützte Lage mußte viel zu der Fruchtbarkeit des hübschen kleinen, in den Bergen versteckt liegenden Erdwinkels beigetragen haben – viel auch der fleißige und sorgsame Anbau, die zweckmäßige Bewirthschaftung, die überall wahrnehmbar war; der Besitzer schien besonders auf Obstcultur großes Gewicht gelegt zu haben; überall durchzogen Reihen wohlgepflegter Obstbäume die Felder; eine stattliche Nußbaumallee durchschnitt das Terrain in gerader Linie und führte auf das Wohnhaus zu – zunächst auf einen mauerumzogenen großen Garten, der, heute noch wie er vielleicht vor hundert Jahren angelegt worden, die ganze Regelmäßigkeit des alten französischen Geschmacks zeigte, sogar noch Taxushecken und Sandsteinfiguren am Ende dunkler Berceaux – im Hintergrunde des Gartens führte eine breite Steintreppe auf eine Terrasse und über ihr erhob sich das Herrenhaus – nicht, wie es der Charakter der Gartenanlage erwarten ließ, ein kleines Rococoschloß mit stattlichen Flügeln, sondern nur ein einfaches Landhaus, nur ein Stockwerk mit hohem Mansardendach darüber zeigend, weiß getüncht, mit grünen Jalousien; statt der Flügel nur ein kleines Gewächshaus an der einen und eine Volière an der anderen Seite.
Das Alles recognoscirte Daveland, als er am andern Tage um die Nachmittagsstunde, von Hartig begleitet, durch die Kastanienallee auf die Ferme des Auges zuritt und dann um die Gartenmauer herum den Hof des Gebäudes erreichte. Er hatte Hartig bewogen, ihn zu begleiten, und es bei diesem an Gründen, weshalb er so rasch das Versprechen erfüllen wolle, welches er Herrn d’Avelon gegeben, nicht fehlen lassen. Zuerst den, daß es in Void in Frankreich gerade ebenso langweilig war wie in jedem anderen Orte auf Erden, wo man eben nichts zu thun hat. Und weiter den, daß es sehr interessant sein mußte, eine vornehme französische Familie in ihrem »Interieur« kennen zu lernen; ganz zuletzt den, daß ihn dieser Herr d’Avelon, sein Wesen, sein Gesicht anziehe – vielleicht nur aus Widerspruchsgeist, weil sich Sontheim so scharf wider ihn erklärt. Und doch war, was ihn zog, etwas ganz Anderes, ein Gefühl, das sich eigenthümlich mit Spannung, Scheu und Beklemmung vermischte und doch stark genug war, ihn mit einem gewissen Heroismus dieses Alles, was ihn zurückhalten wollte, überwinden zu lassen. Genug, unser Landwehrlieutenant hielt am anderen Tage, von Hartig, dem Gelehrten der Compagnie, gefolgt, auf dem Oekonomiehofe der Ferme und wurde, nachdem ein Knecht die Pferde übernommen, auf die Terrasse vor dem Wohnhause geführt, wo die Herrschaft sich befinden sollte.