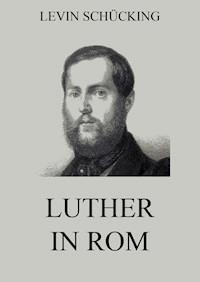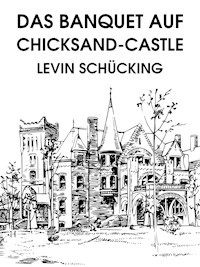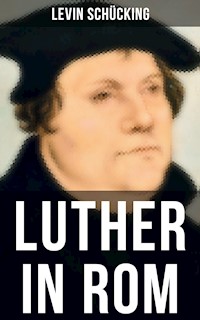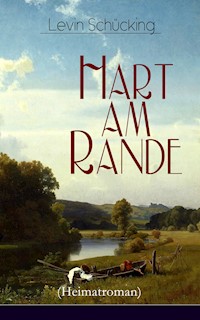1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Christoph Bernhard Levin Matthias Schücking war ein deutscher Schriftsteller und Journalist. Sein Werk "Die Königin der Nacht" gehört zu seinen bekanntesten Werken. #lestmalbittemehrbuch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Levin Schücking
Die Königin der Nacht
Erstes Kapitel. Der geheimnißvolle Gast.
Aus einem freundlichen kleinen Hause, das sich mit dem Rücken an die Stämme und das üppig wuchernde Unterholz eines dunklen Parkes lehnte, erscholl eintöniges, cascadenartiges Stimmengemurmel. Es wurde drinnen der Abendsegen gebetet, wie es auf dem Lande Sitte ist; eine wohlklingende Männerstimme betete vor und ein helleres Frauenorgan fiel mit den Antworten ein.
Die frommen Bewohner des Häuschens hatten in der That wohl Ursache, dem Himmel dankbar zu sein; denn der liebe Gott hatte ihnen ein so wohnliches Dach bescheert, wie ein bescheidenes Menschenherz es sich nur wünschen kann. Grüne Reben und Clematis waren in üppiger Fülle an den blanken weißen Wänden heraufgezogen; zur Seite der Eingangsthür prangten auf sauberen Lattengestellen ganze Reihen schöner ausländischer Blumen; hinten hoben die prächtigen hohen Eichen sich wie eine undurchdringliche Schutzmauer gegen die Stürme, die von draußen, von der »Welt« aus, dieses friedliche Idyll bedrohen konnten; und vorn und zu den Seiten lag ein wohlgepflegter Garten ausgebreitet.
Es war eine poetische Siedelei, wie sie ein liebendes Paar für das Höchste seiner Wünsche ausgibt und – wie sie nach der Hochzeit doch noch von keinem bezogen worden ist! Daß dies auch hier nicht geschehen, war desto besser für den ehrlichen Burschen, für den sie mithin frei geblieben, und der sich eben damit beschäftigte, seinen Schöpfer zu loben; er hieß Martin, war ein tüchtiger Gärtner, eine kräftige, stämmige Gestalt, und noch nicht dreißig Jahre alt. Die hübsche junge Frau, welche ihm gegenüber saß in dem engen Wohnstübchen und, die Hände in den Schooß gelegt, die hellblauen Augen auf den glatten braunen Scheitel geheftet hielt, den der Mann, über das Buch gebeugt, ihr zukehrte, war sein treues Eheweib Gertrude.
Also doch einem liebenden Paare war die Siedelei zugefallen …!
Nein, Martin und seine treue Gertrude hätten wol befremdet gelächelt, wenn es Jemandem eingefallen wäre, sie so zu nennen! Er war eine redliche Haut und seiner braven jungen Frau so treu wie Gold; aber aus »Liebe« hatte er sie nicht genommen, und das hatte er ihr auch nie gesagt, und sie, glauben wir, ihm wol eben so wenig. Er war der Sohn eines Bauers; der Gutsherr hatte ihn als Gehülfen seines Gärtners angenommen, und nachdem dieser, wie ein verdorrtes Gewächs, nach achtzigjährigem Perenniren endlich sich selbst zu seinen Samen in die Erde gelegt hatte, da war Martin feierlich in dessen Stelle eingesetzt worden.
So mußte denn der junge Mann auch eine Frau heimführen, die das Hauswesen in dem rebenumsponnenen Hüttchen besorgte und zwei hülfreiche Hände hatte, wo die seinen nicht reichten. Er suchte sie und glaubte sie gefunden zu haben. Es wohnte eine redliche Witwe in seiner Nähe, die zwei Töchter besaß; sie hießen Anna und Gertrude, und auf Anna hatte Martin sein Auge geworfen und auch den Brautwerber gefunden, der seine Fürsprache einlegte. Dann hatte er sich selbst eines schönen Nachmittags aufgemacht und war in die Hütte der Frau getreten, »um im Vorbeigehen seine Pfeife anzuzünden.« Die Frau hatte ihm einen Stuhl gesetzt und hatte die Herdgluth angefacht und geschürt, und dann hatten sie zusammen vom Wetter und von der Heuernte gesprochen, kaltblütig, als ob nichts in der Welt sie näher angehe. Unterdeß hatte die Frau die Pfanne herbeigeholt und sie langsam blank gescheuert und sorgsam übers Feuer gehängt.
Jetzt war der Augenblick gekommen, in welchem Martin's Herz zu schlagen anfing. Gespannt sah er auf das Thun der Frau. Nahm sie Mehl, Milch, Eier zu einem Pfannkuchen, so wäre ihm nichts übrig geblieben, als die dicke silberne Uhr hervorzuziehen und mit der Behauptung, daß er durchaus keine Zeit mehr zu verlieren habe, sich zurückzuziehen; aber nein, sie griff zu Speck und Eiern – das hieß in der sinnigen landesüblichen Pfannensymbolik, daß seine Werbung angenommen war; er durfte jetzt sein Wort anbringen, und Anna wechselte mit ihm am andern Tage die »Treue«, ein Paar große silberne Schaustücke.
Martin's Brautstand sollte jedoch nicht lange dauern; Anna erkrankte und starb; und so fühlte sich der arme Schelm denn wieder hülflos und verlassen wie vorher. Da war es nun nichts Anderes als Christenpflicht, daß Gertrude in ihrer verstorbenen Schwester Stelle trat; ob ihr Herz sie zu dem jungen Gärtner ziehe, danach wurde sie nicht, hatte sie selbst sich schwerlich viel gefragt: sie trat in die Ehe, die ja ein von Gott eingesetzter Stand ist, mit einem Herzen voll Frömmigkeit und einem Kopf voll guten Willens; und als Martin neben ihr vor dem Altar stand, da wußte auch er nur Eines – daß er ihr sein Leben lang treu sein werde – über mehr sich Rechenschaft zu geben, daran hatte er nicht gedacht.
Wie wenig Poesie liegt in solcher Leidenschaftslosigkeit, in solcher Unbewegtheit der Seelen, die wie ein stehendes Gewässer ist, dessen Spiegel nie ein Lufthauch kräuselt, nie eine Strömung durchrauscht! … Doch – es liegt doch Poesie darin … der See, den nichts aufwühlt, spiegelt desto treuer das Stück blauen Himmels, welches die Wolken über ihm freilassen … es liegt Poesie in dem resignirten Vorüberwandeln an den Gärten, in welche Leidenschaft und Gefühlsleben wie trügerische Geister locken, zu den Freuden und Gefahren der Müßigen und Leichtfertigen … es liegt Poesie in der freiwilligen Armuth frommer Herzen, welche den Luxus des Gefühls um der Schlange willen, die unter den Blättern lauert, Gott aufopfern, wie all' den andern Luxus der Welt, auf den die Armuth sie zu verzichten zwingt. – –
Der Gärtner hatte sein Abendgebet vollendet; Gertrude ging Holz herbei zu holen, um es am andern Morgen zum Feueranzünden gleich bei der Hand zu haben. Martin trat in die Hausthür, welche er mit seiner stattlichen Gestalt beinahe ganz ausfüllte. Es war ein wunderbar schöner Sommerabend, oder vielmehr es war Nacht – es mochte etwa zehn Uhr sein; vom dunkelblauen Himmel goß ein eigenthümlich helles Mondlicht seine bläuliche silberne Fluth herab. Man sah alle Gegenstände ringsum beinahe so klar wie am Tage. Drüben, über den Wipfeln des Obstbaumgartens und zwischen den hohen canadischen Pappeln hoben sich schwere breite Thürme mit spitzen Wetterfahnen und runden glockenförmigen Schindeldächern auf; zwischen ihnen ein eigenthümlich geformter Giebel mit gothischen Zacken, der so hoch und so schmal war – es sah aus, als hätte er in feudalem Hochmuth und aus Aerger über das kecke Emporschießen der Parvenus von Pappeln sich so gewaltig in die Höhe gereckt und gespreizt, bis er diese schmale und dünnleibige Figur bekommen. Rechts und links hinter dem Gärtnerhause zog sich der Eichenwald hin; vor Martin dehnte sich die ganze Fläche seines Gartens aus mit einer Welt von Bäumen, Stauden, Beeten, mit den pyramidenförmigen Zwergobstbäumen, den feinen Spargelaufschüssen voll rother Beeren, und den sauberen Buxeinfassungen der reinlichen Pfade. Dem Gärtner gerade gegenüber lag ein stattliches Gitterthor aus kunstreich geschmiedetem Eisen, und an beiden Seiten von diesem Thore zogen sich niedrige Gebäude, Stallungen und Remisen hin, welche nach dem Garten zu keinen Ausgang hatten und deren Mauern mit Spalieren bedeckt waren, und weiter oben schimmerte das Mondlicht durch das Rebenlaub eines langen, dichten Berceaus.
Das Alles lag hell im klarsten Mondschein vor dem Gärtner, aber eben so still war es rings umher. Selbst die Mücken, welche am Abend in vollen Schwärmen über den Gießkannen des Gärtners gesummt, hatten sich ihre kleinen Schlafstellen bei dem großen Herbergvater aller Obdach- und Heimatlosen aufgesucht. Martin hörte weit her die Schritte seines Weibes auf dem Sande und das Reisigholz in ihrer Schürze knistern, als ihre lichte Gestalt am Saume des dunkeln Waldes entlang zurück kam: es war ihm wohl ums Herz, als er die hellgekleidete Frau, etwas gebückt von ihrer Last, auf sich zuschreiten sah; es war ihm, als gehe leise sein Glück auf ihn zu. Er hatte die Arme untergeschlagen, Schulter und Kopf an den Thürpfosten gelehnt; so kam eine gewisse Schlaftrunkenheit über ihn, und mit müden Blicken verfolgte er den sonderbar planlosen, trunkenen Flug einer großen Eule, die über ihm völlig unhörbar sich hin und her fallen ließ in der Luft, ein verlorenes Geschöpf, dem Gott so gut Schwingen gab, wie den andern Vögeln, aber das nicht vorwärts will zum Ziel und zum Lichte, sondern irrwähnig in der Nacht taumelt.
Martin fielen die Augen zu bei diesem trunkenen, schwindelig machenden Treiben: er gerieth in einen halbwachen Zustand, worin ihm war, als hebe sich leise die große Dachglocke von dem breiten Thurme jenseits des Gebüsches, auf den er geblickt hatte, in die Höhe und gerathe in langsame Schwingungen und bewege sich stärker und stärker, wie eine Glocke, welche zum Geläute geschwungen wird. Und dann war ihm, als wenn der Abendwind die höchste Pappel hin und her beuge und damit gegen die inneren Wände der Glocke schlage, so daß ein Tönen, ein Geläute entstand, welches einen wunderbar bezaubernden Metallklang, etwas unendlich Süßes und Schwermüthiges und Herzbezauberndes hatte, obwol es nur leise, bald anschwellend, bald ganz verwehend, herüber scholl.
Martin hatte eine Weile so im Traum gelauscht, als er plötzlich mit einem gellen kreischenden Ton die Glocke, welche sich eben noch in Wunderklängen gewiegt, zerspringen hörte – es mußte ein großer klaffender Riß sein … doch nein, die Glocke war es ja nicht – Martin fuhr erschrocken aus seinem Halbschlummer auf – sein Weib stand neben ihm und umklammerte mit beiden Händen seinen Arm; sein Weib hatte den Schrei des Entsetzens ausgestoßen!
Unser Kind! rief sie, unser Kind ist fort!
Sie stand nur einen Augenblick da, einen Augenblick hatte Martin Zeit, während sie ihr Gesicht ihm und dem Mondlichte zuwandte, ihre Leichenblässe, ihre von der Todesangst entstellten Züge zu sehen – dann eilte sie zurück in die offenstehende Thür, links im Hintergrunde des schmalen Hausganges, wo die Schlafkammer lag, hinein … Martin war mit einem Sprunge neben ihr, sein erster Blick fiel auf die leere kleine Bettstatt seines Söhnchens, und sein Herz erstarrte.
Das Kind – fort?! stammelten seine Lippen.
Vor einer Stunde erst habe ich nach ihm gesehen, sagte Gertrude, mühsam so viel Athem sammelnd, um die Worte aus der gepreßten Brust zu stoßen – er lag im ruhigsten Schlaf.
Das kleine Zimmer hatte nur Ein Fenster, das nach hinten auf den Wald hinaus ging, zwischen welchem letzteren und dem Hause hier ein breiter Pfad herlief. Dieser Pfad zog sich an der ganzen Länge des Gartens, den Park und die Beete trennend, dahin; wer ihn wandelte, war durch die dichten und tiefen Schatten des Waldes verborgen. Das Fenster der Schlafkammer stand offen, unterhalb des breiten Fensterbrettes befand sich das leere Bettchen des verschwundenen kleinen Heinrich.
Der erschrockene Vater warf sich darauf, er fühlte, ob die Kissen noch warm waren – sie waren kalt – und dann stürzten beide Gatten in ihrer Herzensangst hinaus, um die nächste Umgebung des Hauses zu durchsuchen, und mit dem vergeblichen Rufe: »Heinrich – Heinrich – wo bist du?« die ruhige Stille der schlummernden Nacht zu durchbrechen und die Nachtvögel aus den Zweigen aufzuschrecken. Hin und her eilten sie in furchtbarster Qual und flogen vergebens zwischen den Gartenbeeten, zwischen den Stämmen des Waldes hindurch; fast instinktartig, wie von einer Ahnung des Schlimmsten, welche sie sich zu gestehen sträubten, abgehalten, vermieden sie Anfangs die Seite des Gartens, wo sich die Thürme und die Giebel des Gebäudes zeigten und wo breite Wassergräben und Weiher das Gebiet Martin's abgrenzten. Und doch, es war, als ob etwas Unwiderstehliches sie dahin zöge, und immer näher und näher kamen sie bald jener Gegend; auf Beider Brust lag Ein Gedanke, aber sie wagten nicht, ihn auszusprechen, und sie riefen sich, wenn sie in hastigem Suchen an einander vorüberschossen, nichts als kurze, abgebrochene Laute zu – ein: Nichts! ein: Sieh du dort! ich will hierhin! und abermals ein: Nichts, nichts! o Gott im Himmel – wo ist unser Kind?!
Plötzlich blieb Martin stehen. Wunderbare Töne schlugen wieder an sein Ohr. Er wußte nicht recht, erhoben sie sich erst in diesem Augenblicke, oder waren sie schon länger, so wie sie jetzt es thaten, durch die stille Nachtluft geschwommen, und hatte er sie in seiner Herzensangst nur nicht beachtet – es waren dieselben Töne, welche durch seinen Traum klangen, wie von den Schwingungen einer riesigen, in der Luft schwebenden Glocke herrührend; jetzt, das hörte er wohl, war es kein Glockengeläute, es war eine menschliche Stimme, welche zu einem fremdartigen Saiten-Instrumente wie aus der Luft herab sang, aber mit unbeschreiblichem Wohllaut, so wie der Gärtner in seinem Leben nicht hatte singen hören.
Martin blieb stehen, lauschte, athmete hoch auf, die Töne hatten etwas Lockendes, sie zogen ihn sich nach; es war ihm, als lockten gute Geister darin, die ihn riefen, um ihm sein Kind wieder in die Arme zu legen; er folgte ihnen unwillkürlich, und so kam er dem vordersten Schloßthurme mit dem Glockendach, welcher seinen grabenumgürteten Fuß bis in den oberen Theil des Gartens geschoben hatte, immer näher; er trat endlich unter das Dunkel einer kreisförmigen Gruppe von hohen Maulbeerbäumen, in deren Schatten eine Moosbank angelegt war – dunkel war es unter diesen Bäumen, ganz dunkel, aber ein Strahl des Mondes fiel durch das Laubgewölbe, und gerade da, wo dieses todte bleierne Licht unten auf der Moosbank lag, da schimmerte ein schwaches, rothes Glühen, wie ein trüber Docht durch ein mattgeschliffenes Glas, und dunkle Formen eines kleinen Körpers waren da, der auf der Bank ausgestreckt lag – ein blonder lockiger Kopf und zwei Aermchen, welche im Schlummer von der Bank niedergesunken waren; und: Gertrude, Gertrude! rief Martin halblaut und doch mit einer Macht, als ob er Felsen damit sprengen wolle; und Gertrude kam herbeigeflogen, hielt sich athemlos an seinem Arme aufrecht und sank dann schluchzend vor ihrem wiedergefundenen Kinde in die Kniee.
Martin wischte sich den Schweiß von der Stirn; er sprach kein Wort. Auch die Frau trocknete rasch und verstohlen ihre Thränen, nahm das Kind, das dabei erwachte und schlaftrunken mit den runden Händchen die Augen rieb, auf ihren Arm, schlug die Schürze um seine nackten Beinchen und sagte mit vorwurfsvollem, aber noch immer beklommenem Tone:
Heinrich, Heinrich, wie bist du hierhin gekommen? wie bist du aus der Kammer gekommen?!
Das Kind war zu schläfrig, um zu antworten: es klammerte sich mit seinen beiden Armen um den Hals der Mutter und ließ den schlummertrunkenen lockigen Kopf auf Gertrudens Schulter sinken.
Martin hatte sich unterdessen gebückt, um den Gegenstand aufzunehmen, welcher ihm vorhin entgegenglühte und der auf den Boden gerollt war, als Gertrude das Kind in die Höhe gehoben. Es war ein schöner großer Stein, in einen schmalen Goldreif gefaßt, der als Spange dienen konnte. Martin zeigte ihn seiner Frau, aber diese warf nur einen flüchtigen Blick darauf, sie eilte zum Hause zurück, weil sie fürchtete, daß das Kind sich in seinem dünnen Nachtröckchen erkälte. Martin folgte ihr, so einsylbig und still wie seine Frau.
Hatte Gertrude, die eng und warm ihren Liebling ans Herz gepreßt hielt, keine Worte, ihr Glück auszudrücken? … war die Brust Martin's zu voll, als daß er hätte reden können?
Nein, das war es nicht, was ihren Mund verschlossen hielt – sie schämten sich vor einander, so laut gejammert und geschrieen, solch' ungezügelter Aufregung und Angst sich hingegeben zu haben – sie machten sich vielleicht keine Vorwürfe darüber, aber sie fühlten es, als etwas Beschämendes, als Kleingläubigkeit, daß im Augenblicke des Schreckens der Gedanke, wie der liebe Herrgott uns Alle und also auch das Kind in seiner Hand habe, nicht in ihr gepeinigtes Herz Einlaß gefunden. Darum gingen sie so stumm zurück, die Frau mit raschen Schritten voraus, während das Kind, jetzt von der schnellen Bewegung ganz aufgeweckt, dem nachfolgenden Vater das Händchen zustreckte, das dieser erfaßte und worauf der Knabe nicht mehr loslassen wollte; so schwebte die Gruppe lautlos, vom vollen Mondlichte übergossen, an den Stauden und Gebüschen entlang, bis sie in der Thür des Gärtnerhauses verschwand.
Das Kind ward zu Ruhe gebracht; Gertrude bettete es sorgsam; dann erhob sie sich, und mit gefalteten Händen blickte sie eine Weile auf ihr gerettetes Kleinod nieder. Eine Thräne stieg in ihre Wimper, eine zweite, schwerere folgte und rollte über ihre Wange … sie hielt sich nicht länger, sie warf sich an die Brust ihres Mannes, der ihr zur Seite getreten war, und barg ihr Gesicht an seiner Schulter: er legte die verschränkten Hände auf ihr blondes Haar und drückte seine Wange darauf … es war zum ersten Male, seit sie sich kannten, daß diese starken Herzen überwallten.
Eine Weile später, als Martin wieder im andern Zimmer saß, neben der noch flackernden Lampe, und mit gespannten Blicken das Kleinod betrachtete, welches er aus der Tasche hervorgezogen hatte – es zeigten sich seltsame verschlungene Züge einer unbekannten Schrift auf dem rothglühenden Steine eingegraben – trat Gertrude rasch zu ihm, legte die Hand auf seine Schulter, und indem sie mit erregten, aber blassen Zügen zu ihm niederblickte, sagte sie:
Das Kind will nicht einschlafen, es ist jetzt hell wach, und es erzählt etwas Sonderbares – eine fremde Frau in prächtigen lichten Kleidern sei an dem offenen Fenster der Kammer vorübergekommen, sei stehen geblieben, habe sich herein gebeugt, mit dem Kinde gekos't, und da Heinrich ganz dreist aus seinem Bettchen auf die Fensterbank gestiegen, habe sie ihn auf den Arm genommen und sei mit ihm fortgegangen.
Martin sah eine Weile sprachlos vor Erstaunen zu ihr auf.
Das Kind sagt, es sei eine große schöne Dame gewesen – sie habe ihm etwas geschenkt.
Diese Spange, fiel Martin ein, seiner Frau das Kleinod zeigend.
Sie betrachtete es neugierig beim Lichte. Dann sagte sie: Wirf es in den Weiher – wer weiß, was es ist und was daran klebt!
Martin schüttelte mit dem Kopfe; eine Zeit lang betrachtete er das Ding wieder, dann sagte er halblaut und ohne die Augen zu seiner Frau aufzuschlagen:
Gertrude, hast du nie etwas gesehen oder gehört im Garten … Abends, oder in der Nacht …?
Gertrude schwieg einen Augenblick. Du meinst, sagte sie dann stockend, den Schwarzen …?
Den? fragte Martin – ich habe ein schwarzes Weib gesehen.
Ich einen schwarzgekleideten Mann!
Martin schüttelte den Kopf.
Und den Gesang! fuhr Gertrude fort.
War es Gesang? Es war mir wie eine wundersame Musik – ich dachte nicht, daß es Gesang von einer Menschenstimme sei.
Es war Gesang – gestern in der Nacht noch hörte ich es. Das Kind weckte mich um Wasser. Du schliefst. Ich stand auf, und wie ich über die Schwelle der Kammerthüre trat, hörte ich den Gesang wieder, aber weit näher als früher, und doch nicht so laut wie sonst, wenn er …
Wenn er da aus der Gegend des alten Baues zu kommen scheint …
So ist's … Darum öffnete ich leise das Fenster in der vorderen Stube und blickte hinaus … ich sah es unter dem Rebengeländer langsam vorüber gehen. Das Mondlicht fiel nur schwach in das Berceau, aber ich sah es deutlich daher gehen, und der Gesang kam von derselben Seite, von ihm!
Martin stützte sein Kinn auf die Hand des über der Tischplatte ruhenden Arms, und da das Eis nun einmal gebrochen war, erzählte auch er, was er gesehen.
Es ist thöricht, den Aberglauben in Menschen verdammen zu wollen, denen die Erziehung von frühester Jugend auf den Glauben zu festigen gestrebt hat, deren Gemüth von der Wiege an mit Gläubigkeit wie durchtränkt worden ist, während nichts gethan wurde, in ihnen Scharfsinn, Unterscheidungskraft und analysirende Thätigkeit des Verstandes zu entwickeln. Wie sollten sie die Fähigkeit haben, eine feste Linie zu ziehen, an welcher der Glaube aufhören muß, um nicht jenseits in Aberglauben überzugehen? – wer von uns vermag denn überhaupt eine solche Linie zu ziehen?
Martin und Gertrude aber ahnten gar nicht einmal, daß es eine solche Linie gebe: in ihrem Geiste waren beide Gebiete eines und dasselbe, und die Vorstellungen des einen aufs innigste mit denen des andern verwebt; der kirchliche Glaube hatte von abergläubischen Vorstellungen eine Art dichterischer und romantischer Färbung erhalten, und der Aberglaube von den kirchlichen Vorstellungen wieder eine christliche Weihe und eine Art kirchlicher Bestätigung.
Diese Erscheinung, welche sich bei dem Landvolke der Gegend, die den hier erzählten Ereignissen als Schauplatz dient, und wol überall bei religiösen Bevölkerungen sehr ausgebildet findet, hat eine andere zur Folge. Die Drangsal und die Schwere des Erdendaseins macht dem Armen den tröstenden Gedanken an ein Jenseits so zum Bedürfniß, läßt ihn so fest an die Ueberzeugung, daß geistige Wesen als »Nothhelfer« und Schützer und Gnadenerbitter für ihn da sind, sich klammern, läßt ihn überhaupt die Vorstellungen vom Zusammenhang der »drei Kirchen« so sehr als handgreifliche Wahrheit fühlen, daß er nicht allein an das Durchflossensein unserer Welt von einer Geisterwelt und an Einflüsse des Jenseits glaubt; nein, seine grobsinnliche Weise der Auffassung macht auch, daß er unsere Schauer dabei viel weniger kennt, ja im Stande ist, sich auf einen ganz vertraulichen Fuß mit einem etwa ihm aufstoßenden Gaste jenes Reiches zu setzen,
from whose bourn No traveller returns – –
(und aus dem doch Shakespeare selbst, in demselben Stücke, worin er diese Versicherung gibt, einen Reisenden leibhaftig zurückkehren läßt). Der schlichte fromme Bauer hegt nicht wie wir »Gebildeten« vor einem Geiste ein stilles Entsetzen; er setzt nicht voraus, daß der Geist ein ihm feindseliges Wesen sei, welches ihm Böses thue! Mehr als Ein altes Weib aus dem Volke würde dem ewigen Juden, wenn er an ihre Hütte klopfte, Brot oder Milch zur Erquickung reichen mit einer Hand, die nicht stärker zitterte, als die Zahl ihrer Jahre es verursachte, und würde ihn dann beim Scheidegruße ruhig auf die ewige Barmherzigkeit verweisen. An dem glühenden Manne, welcher an der Schnat, den Waldessaum entlang, umgeht, will mehr als Ein Dorfphilosoph sich den Pfeifenstummel angezündet haben. Jener einsame Pflüger, welcher einem Mohren in rother Lakaien-Livree, der auf dem Felde zu ihm herankommt, um ihn nach dem Wege zu fragen, mit aller Gemüthsruhe einen Pfad beschreibt und dann den Einwurf, es müsse noch einen kürzeren Weg nach demselben Ziele geben, dem Schwarzen mit den Worten beantwortet: Ja, aber an dem Wege steht ein Crucifix, an dem wird der Herr wol nicht vorüber dürfen! – dieser Pflüger ist der stärkste Ausdruck jener, statt mit Furcht, Wohlwollen gegen jegliche Creatur ausgerüsteten Naivetät, welche das Gottvertrauen gibt.
So waren auch Martin und seine Frau nicht eigentlich erschrocken bei den Beobachtungen, welche sie seit einigen Nächten gemacht hatten, wenn auch in eine gewisse Spannung und Erregung versetzt, die ihren gewöhnlichen Ernst erhöhte. Keiner hatte mit dem Anderen von Dem, was er gesehen, sprechen wollen, aus einer gewissen Scheu, unnöthige Worte über einen Gegenstand zu machen, von dem es besser war zu schweigen, wie er sich selbst in Schweigen und in Dunkel hüllte.
Jetzt aber waren die Lippen gelöst, und der Gärtner erzählte seinem Weibe, daß er mehrmals Abends – aber immer nur sehr spät – die eigenthümliche Musik vernommen, welche ihm wie aus dem sogenannten »alten Bau« – jenen Thürmen mit dem schmalen Giebel in der Mitte, von denen oben die Rede war – herzukommen geschienen, so sehr er sich auch gesträubt habe, dies anzunehmen, da er ja wisse, daß der alte Bau seit undenklichen Zeiten nicht mehr bewohnt gewesen sei. Endlich vor mehreren Tagen – es sei an dem Abende gewesen, an welchem seine große »Königin der Nacht« aufgeblüht – habe er sich um elf Uhr noch einmal in das Glashaus oben im Garten begeben, um seine schöne Pflegebefohlene zum letzten Male anzusehen, bevor sie das große strahlende Blumenauge, das sie um die Dämmerungsstunde aufgeschlagen, für immer wieder schließe. Da habe er, nachdem er eine Weile in den Anblick versunken dagestanden, einen dunklen Schatten an sich vorübergleiten sehen; rasch habe er sich gewendet und nun draußen eine an der Glaswand herwandelnde Gestalt gewahrt, ein ganz schwarz gekleidetes weibliches Wesen, mit todtenblassem Gesicht, Niemandem, den er je gekannt, irgend ähnlich sehend; langsam, die Arme untergeschlagen, das Haupt etwas gesenkt, und völlig unhörbar sei sie einhergeschritten, als wenn sie den Boden nicht berühre, sondern schwebe. Einen Augenblick sei ihm der Gedanke durch den Kopf gefahren, hinauszuspringen und ihr zu folgen; gleich darauf aber, nachdem er kaum drei Schritte gemacht, habe er sich diesen Vorwitz als freventlich vorgeworfen und sich wieder zu der Blume gewandt; die Blume aber, die eben noch voll und strahlend geblüht, sei jetzt welk in sich zusammen gesunken gewesen, mit Einem Male wie fort, in ein welkes, vergilbendes Blattgekräusel eingeschrumpft … unwillkürlich habe er an einen geheimnißvollen Zusammenhang alles Dessen denken müssen, und ihm sei gewesen, als sei die Königin der Nacht in der schwarzen Gestalt mit dem lilienweißen Antlitz scheidend an ihm vorüber und davon gegangen.
Gertrude hörte diese Mittheilungen an, ohne Martin zu unterbrechen. Dann erzählte auch sie. Sie hatte zweimal in geringer Entfernung ein fremdes Wesen nächtlich die Pfade des Gartens entlang vorüberwandeln sehen. Das erste Mal, vor etwa acht Tagen, als sie spät Abends Reisig geholt, war es aus dem Düster des Parks unfern von ihr hervorgekommen und, durch den oberen Theil des Gartens schreitend, nach der Gegend des alten Baues hin verschwunden; es sei, das hatte Gertrude deutlich gesehen, in dunkler Männertracht gewesen, oder vielmehr wie ein Knabe habe es ausgesehen; einen grauen piemontesischen Hut und einen faltenreichen Mantel ohne Kragen beschrieb sie ihrem Manne und erinnerte daran, daß es im Schlosse ihrer Herrschaft alte Bilder mit solchen spitzen Hüten gebe. Das zweite Mal, theilte Gertrude ihrem Manne mit, habe sie es in der vorigen Nacht gesehen; in dem Berceau links von dem Gitterthore, welches den Haupteingang in den Garten bildete, sei es, langsam wie immer, auf und ab geschritten, und dieses Mal habe es den sonderbaren, aber eigenthümlich ergreifenden, schwermüthigen Gesang hören lassen, den auch Martin vernommen hatte.
Heinrich aber bleibt dabei, schloß Gertrude, eine Dame in hellem oder weißem Kleide habe mit ihm gespielt und habe ihn auf dem Arme mit sich fortgetragen … Das Kind ist erst vier Jahre alt, aber du weißt, wie verständig es schon ist, und man kann ihm glauben, was es sagt. Unser Herrgott wird es in seinem Schutze gehalten haben, daß ihm nichts angethan worden ist – ich will ihm das Agnus Dei unter das Kopfkißchen legen und die Palme unten am Fußende feststecken. Du solltest morgen mit der Herrschaft reden oder wenigstens mit dem Herrn Caplan.
Martin schüttelte mit dem Kopfe; ihm war ein Gedanke gekommen, den er freilich früher schon hätte haben können; er nahm die Lampe und ging hinaus, und indem er das flackernde Licht sorgsam mit der Hand vor dem Luftzuge zu schützen suchte, eilte er nach der Rückseite des Hauses; dort, unter dem Fenster der Schlafkammer, bückte er sich mit dem Lichte und untersuchte genau den Boden. Er brauchte nicht lange zu suchen – aus dem weichen Grunde unten an der Mauer, gerade da, wo das Fenster sich befand, zeigten sich die deutlichen frischen Spuren eines schmalen, etwas langen, aber feinen Frauenfußes.
Martin hatte weder die Spürkraft eines wilden Naturmenschen, einer irokesischen Rothhaut, noch hatte er den beispiellosen und unvergleichlichen Scharfsinn des witzigen Beaumarchais, welcher aus einem weißen Atlasschuh einer Dame, den er auf den Boulevards fand, den Wuchs, das Alter, die grazienhafte Taille der Besitzerin entdeckte, ja, daß sie verheirathet, aber kinderlos sei, und daß sie ausgezeichnet den Menuet de la reine tanze; aber Martin entging dennoch nicht, daß nie der Fuß eines der adeligen Fräulein, welche von Zeit zu Zeit in seinen Garten kamen, in dem weichen, von ihm sauber gerechenten Grunde einen so feinen, zierlichen Eindruck hinterlassen, eine solche elastische Flüchtigkeit des Schrittes verrathen hatte und eine solche feine Zeichnung der Umrisse.
Martin folgte mit der Lampe den Spuren; er entdeckte sehr bald neben den größeren Fußstapfen die, welche die kleinen nackten Beinchen seines Heinrich zurückgelassen hatten; unter dem Fenster waren sie einmal tief eingedrückt in den Sand – das Kind war also hinabgesprungen: dann folgten sie den andern, theils ihnen zur Seite, theils zwischen, hinter ihnen bleibend; es war deutlich, das Kind war nicht getragen worden, sondern es war neben und hinter dem Wesen einhergeschritten, von dem es, vielleicht aus Furcht vor Strafe, behauptete fortgetragen worden zu sein.
Martin und Gertrude begaben sich zur Ruhe, ohne mit weitere Anstrengungen zu machen, das Räthsel zu lösen. Aber der Schlummer floh sie und so unterhielten sie sich noch lange über das Ereigniß und alles Das, was sie beobachtet und wahrgenommen hatten.
Martin meinte endlich:
Es ist Schade, daß unser junge Herr, der Baron Maximilian, seit er sich verheirathet hat, nicht mehr auf dem Schlosse wohnt. Der würde gewiß der Sache auf den Grund kommen; denn was ihm nicht entgegen kam, das begegnete Keinem, und was er nicht fand, das war auch verloren für Jedermann!
Ja, ein Sonntagskind war er, der junge Baron, fiel Gertrude ein, und wenn etwas Auffallendes geschah, so war es immer der junge Herr gewesen, dem es aufgestoßen, darauf konnte man wetten.
Es ist sonderbar, sagte Martin, wie für Leute, welche einmal das Glück haben, Alles aufgespart wird: wenn der Baron Maximilian reiste und es geschah etwas Großes oder Seltsames um die Zeit, so war es sicher unter seinen Fenstern vorübergezogen; war ein weltberühmter Mann im Lande, so hatte er an der Tafel neben ihm gesessen; war der junge Herr auf der Jagd, und wir trieben, so kam der Hirsch oder der Eber sicher neben seinem Stand heraus; und wenn irgend ein merkwürdiges Ding am Himmel, ein Nordlicht oder sonst ein feuriges Zeichen erscheinen wollte, so wartete es sicherlich, bis der junge Herr zufällig einmal Nachts vor Schlafengehen den Kopf zum Fenster hinausstreckte, um nach dem Wetter zu sehen.
Aber »Glück haben« kann man das nicht nennen, meinte Gertrude; denn wenn ein Unfall sich ereignete, so war auch immer darauf zu wetten, daß es dem Baron geschehen; wenn böse Buben mit Steinen warfen und einer traf, wenn ein Pferd scheu ward oder stürzte, wenn beim Angeln Einer ins Wasser glitt – der Baron brauchte nur dabei gewesen zu sein und man konnte sich darauf verlassen, daß Niemand anders als er der Unglücksvogel war!
Es ist eben doch ein Glück, versetzte Martin; es begegnet ihm doch immer Etwas, und das Leben ist für ihn dadurch voll Abwechselung, voll Zufälligkeiten und unvorhergesehener Ereignisse, während es andre Menschen gibt, denen es so still und sacht dahinschleicht, daß es öde und traurig wird. Die Gaben sind eben ungleich vertheilt; dem Einen scheinen mehr Schutzengel und Geister zu folgen als dem Andern; es ist wie wenn ihrer Mehrere Abends über Land gehen; dem Einen hüpfen die Mückenschwärme wie Bälle um den Kopf und wollen nicht von ihm ablassen; dem Andern folgt keine einzige; an solche Leute machen denn auch die Wespen und die Stechfliegen sich mehr als an andre.
Gertrude sprach den Gedanken nicht aus, welcher bei diesen Worten ihres Mannes in ihr aufstieg; sie dachte, daß es also eine unerklärliche Aristokratie des Glückes gebe, welche die Geister des Zufalls und des Abentheuers wie aus bloßer Laune eingesetzt zu haben schienen. Und da der Geist des Zufalls eben kein Zufall mehr ist, so lag darin eine vom Jenseits ausgehende Begünstigung der Unterschiede zwischen den Menschen, gegen welche nur ein so gläubiges Gemüth wie das der Gärtnerin sich nicht auflehnte. Aber Gertrude wußte nicht wie mit Worten ausdrücken, was sie dachte, und legte, um einzuschlafen, ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes.
Wir wollen unterdeß, während sie entschlummern, uns aufmachen und den jungen Herrn aufsuchen, von dem sie zuletzt redeten und der nach ihren Worten eines jener Sonntagskinder ist, welchen in einer Zeit arithmetischer Ordnung, in einer Zeit, welche sich von dem dürrsten und phantasielosesten aller Dinge, der Zahl, knechten und mishandeln läßt, noch das Abentheuer in den Lebensweg tritt, noch der Dichtung lieblichste und verwöhnteste Tochter erscheint.
Zweites Kapitel. Der Diplomat.
Nicht sehr weit, nicht eine halbe Tagereise von dem Gute entfernt, auf welchem die im vorigen Abschnitt erzählten Ereignisse vorfielen, lag die Hauptstadt der Provinz. Am Morgen nach dem Abende, an welchem Martin und Gertrude ihr einziges Kind geraubt wähnten, waren in dieser Stadt mehrere blauäugige, blondhaarige und blühende junge Männer mit großen Bärten versammelt. Sie standen in einem von der Straße durch ein eisernes Gitterwerk mit stattlichem Einfahrtsthor abgeschlossenen Hofe eines großen Hotels. Im Hintergrunde dieses Raumes erhob sich das ansehnliche Hauptgebäude mit hoher Treppe, rechts und links schlossen Stallungen, Remisen und Diensträume den Hof. Die jungen Leute hatten sich in einer Reihe aufgepflanzt und sahen mit gespannter Aufmerksamkeit den Bewegungen eines auffallend schönen Pferdes zu, welches ein Groom in blau und weiß gestreifter Stalljacke gestreckten Trabes an ihnen vorüberführte.
Trägt und sticht ausgezeichnet! rief einer der jungen Männer, der pockennarbig war, einen großen blonden, ins Fuchsige schillernden Bart hatte und was Pferde- und Reiterkünste anging, für den Graf Sander der Provinz galt … aber, fügte er hinzu, er ist noch etwas steif in den Gamaschen.
Das wird sich bald geben; das Thier hat Bewegungen so elastisch wie eine Stahlfeder, versetzte ein anderer der blonden Hippologen – nur vielleicht etwas zu kräftig durchschlagend für eine Dame.
O, Margarethe liebt das! antwortete der Herr vom Hause, ein schöner junger Mann, kaum in den Dreißigen, der sich von den Andern dadurch unterschied, daß seine Gestalt noch etwas größer und schlanker und seine Züge etwas dunkler und gebräunter waren, als die seiner Freunde; Margarethe liebt das, sie spottet immer über die andern Frauen, die auf einem Pferde wie auf einem Sopha sitzen wollen – o, sie hat Courage!
Dann wird sie ihre Freude an dem Braunen haben; wahrhaftig, es ist ein hübsches Namenstagsgeschenk! fiel ein Vierter ein; unglaublich, daß du nur sechzig Friedrichsd'or für das Pferd gegeben hast – und die Wahrheit zu sagen, man glaubt auch nicht daran.
Der Hausherr winkte dem Groom, das Pferd in den Stall zurück zu führen, und die Männer wandten sich ab, um in das Gebäude zu treten, in welchem sie ein Frühstück im Zimmer des Hausherrn erwartete. Es war ein hübscher Salon im ersten Stock, wo sie bewirthet wurden, eingerichtet im Geschmacke der Kaiserzeit, die gelben Kirschholzmöbel mit grünbronzirten Köpfen ägyptischer Sphinxe verziert, wie sie einst aus der Fabrik von Jakob Desmalter in Paris kamen; aber an den Wänden hingen moderne Gemälde, mehrere prachtvolle, farbenglühende Landschaften von Hildebrand, welche reizende Küstenpunkte von Südspanien und den Balearen darstellten; auch einige Bossuets mit herrlichen Lichteffekten, ebenfalls spanische Scenerien, maurische Wasserleitungen und Befestigungsthürme, oder einzelne Architektur-Partien aus spanischen Städten darstellend, wie dieser Belgier sie zu malen versteht; aber deutlicher noch als diese Bilder verrieth eine große rothe Baskenmütze, die über gekreuzten kostbaren Waffen aus Toledanischen Werkstätten an der Wand hing, daß der junge Hausherr Cantabrien und die pyrenäische Halbinsel besucht haben mußte und daß er es liebte, sich mit Erinnerungen daran zu umgeben.
Als die jungen Männer um den Tisch vor dem Sopha Platz genommen halten, und als die Gläser gefüllt waren, erhob der Provinz-Sandor das seine mit den Worten:
Nun, Margarethe, deine schöne junge Hausfrau, diese Zierde ihres Geschlechtes, soll leben!
Das soll sie! sagte Der, welcher vorhin seinen Zweifel an dem angegebenen Preise des Pferdes geäußert hatte, ein schlauer Jüngling, welcher sich, wenn man ihn anders dabei nicht störte, mit sehr großen und deutlichen Buchstaben, die Alles eher als Uebereilung verriethen, Fritz Freiherr von Nagler unterschrieb; das soll sie – um ihrer selbst willen und weil sie uns Maximilian jetzt für immer hier an die Erde seiner Väter fest gebannt hält.
Maximilian von Rauschenloo, der Herr vom Hause, stimmte sehr geschmeichelt in den Toast ein, den man seiner jungen Gattin brachte, aber er protestirte gegen die Annahme, daß er nun für immer sich an sein Vaterland gebunden glaube.
Wer weiß, wie bald ich wieder meinen Posten einnehme! sagte er.
Ah bah, fiel der Sandor ein … deinen Posten! Ich möchte wissen, was du auf deinem Posten machst! Es ist ja doch nur die alte Geschichte von Dem, der nichts thut, und Dem, der ihm hilft. Bei Dem, was Graf X., dein Gesandter, thut, – dabei kannst du ihm hier gerade so gut helfen wie in Madrid.
Oho! Maximilian ist durchaus nicht ein schlechter Diplomat, fiel Fritz Nagler ein; ich habe ihn einmal gefragt: Glaubst du, daß unser Ministerium sich noch lange halten kann? Da hat er mir mit wichtiger Miene geantwortet: Seine Majestät der König befinden sich vortrefflich, und dann hat er sich still beseitigt. Wenn das nicht eine fein ausweichende diplomatische Antwort ist, so weiß ich's nicht!
Alle brachen in ein Gelächter aus.
Talent verräth sie doch, sagte Der mit dem fuchsig schillernden Bart – er hieß Philipp von Mainhövel – das Talent, die Leute ins Gesicht zum Besten zu haben, das ist die Hauptkunst der Diplomaten!
Ja, ja, der Max ist ein Diplomat! hieß es – – sonst hätte er uns auch nicht das Juwel, die Krone aller Mädchen im Lande wegzufischen gewußt.
Und das so rasch, fiel ein Andrer ein, so gleich Cäsar, der kommt, sieht und siegt –
Das ist nun wieder nicht diplomatisch, rief Mainhövel; die Diplomatie kommt langsam, sieht schlecht und gesiegt hat die unsere wenigstens noch nie.
Ist dir irgend ein liebenswürdiger Bösewicht von Attaché kürzlich ins Gehege gekommen, daß du der armen Diplomatie so böse Dinge nachsagst? fragte Maximilian von Rauschenloo.
Mainhövel wollte antworten, aber er wurde unterbrochen; denn in diesem Augenblicke öffnete sich die Thür des Salons, und das Juwel, die vielbesprochene junge Frau, trat ein; die Männer sprangen von ihren Stühlen auf, nur Maximilian blieb sitzen; es war ihm unangenehm, daß Margarethe sich in diesen Kreis wagte.
Margarethe war in der That eine schöne Erscheinung, und weil sie schön war und lebhaft, so war sie auch Das, was ihre Freunde geistreich nannten.
Schönen Frauen ist es so leicht gemacht, geistreich zu sein, wie Königen, populär zu werden. Weil sie nur Huldigungen begegnen, und weil sie eine Art von Herrschergewalt üben, so entwickelt sich leicht in ihnen jene Kühnheit, alle Gedanken und Einfälle frischweg auszusprechen, welche den unschönen Frauen oft weit mehr mangelt, als die Einfälle selbst ihnen mangeln. Die Welt will betrogen – aber sie will in noch höherem Grade mishandelt sein. Der Uebermuth des Selbstgefühls imponirt ihr – je naiver, sprudelnder, kecker dieser Uebermuth hervortritt, desto mehr wird er verehrt. Beatrix in »Viel Lärmen um nichts« wird um so glühender geliebt, je kühner und rücksichtsloser sie mit Benedikt umspringt.
So war auch Margarethe »geistreich«, das heißt, sie war schön, lebhaft, gebildet, und sagte Jedem, was sie von ihm dachte; sie hatte den Muth ihrer Ideen, und jedenfalls war sie ein Phönix in dem Lebenskreise, in welchem sie sich bewegte.
Ich komme, dich zu fragen, Maximilian, begann sie, ob du nach Tisch mit mir ausfahren willst, um Besuche zu machen – aber ich sehe und höre, du wirst von Fritz Nagler und Philipp Mainhövel in Beschlag genommen und mußt ihnen erklären, was Diplomatie ist; nun werdet ihr so tief in die Politik gerathen, daß du nicht Zeit hast, an so etwas wie Besuche machen zu denken!
Du irrst, Margarethe; wenn ich ihnen erklären müßte, was Diplomatie ist, so würde ich sie zu dir gesandt haben, die Frauen verstehen das weit besser als wir.
Einer der jungen Herren hatte unterdeß für die Dame einen Sessel herbeigeschoben, sie setzte sich und lächelte dabei neckisch Maximilian an, als ob sie sagen wollte: Sieh, ich bleibe doch, kleiner Haus-Tyrann, wenn du mich auch wieder fortschicken möchtest! Und dann wandte sie sich an Mainhövel.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: