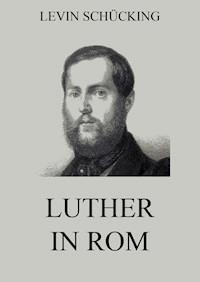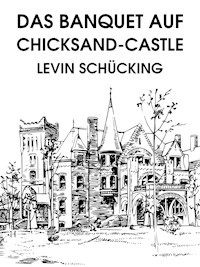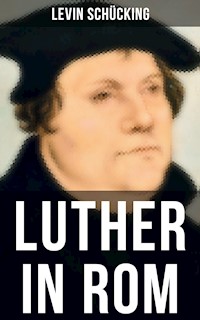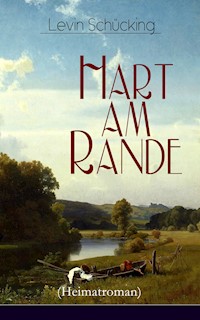Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Levin Schücking, ein bedeutender deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, präsentiert in seinem Werk 'Historische Romane, Heimatromane, Erzählungen & Briefe' eine vielseitige Sammlung seiner Werke. Die historischen Romane zeichnen sich durch detaillierte Recherchen und lebendige Darstellungen vergangener Epochen aus, während die Heimatromane liebevoll die Schönheit der Landschaft Westfalens einfangen. Schückings Erzählungen spiegeln sein feines Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen und moralische Dilemmas wider, während seine Briefe Einblicke in sein künstlerisches Schaffen gewähren. Sein literarischer Stil ist geprägt von einer präzisen Sprache und einer subtilen Darstellung von Emotionen, die den Leser in den Bann ziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 4070
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Levin Schücking: Historische Romane, Heimatromane, Erzählungen & Briefe
Books
Inhaltsverzeichnis
Eine dunkle That
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Kennt ihr das grüne Hügelland von Berg? Ich kann in diesem Augenblick nicht sagen, unter welchem Grade der Breite und Länge, von der Sternwarte zu Greenwich oder von der Insel Ferro an, der liebe Gott es so säuberlich hingelegt hat; aber ich weiß, daß er es gesegnet hat mit Fruchtbarkeit und einem tüchtigen, betriebsamen Menschenschlag, in dem sächsisches und fränkisches Blut sich begegnen, und daß es ein schönes Land ist, wie es daliegt zwischen dem Ebbegebirge und dem Rhein, zwischen der Sieg und der Ruhr. Auch ist es reich an schönen Sagen und Legenden von höchst wunderbaren Ereignissen, die niemand glauben sollte: an Geschichten von Feme und Liebe, von Mord und Andacht; von frommen Mönchen, die nichts taugten, und höchst ritterlichen Straßenräubern; von Edelleuten, die sich die Harnische zerhieben, die Schwerter zuschanden schlugen und ihrer Liebhaberei für blutige Köpfe mit all der großartigen Gravität nachgingen, mit der ein Mingo oder Delaware für sein Kabinett skalpierte Hirnhäute sammelt. In der Tat, dies Land ist so reich in der Erinnerung an jene romantischen Strauchgesellen, es sind ihrer so viele mit jedem alten Gemäuer verwebt, um jedes einsame Steinkreuz geschlungen, daß man in der Ferne keine duftige Höhe aus dem blauen Wellenschlage der Hügelreihen hervortreten sieht, ohne zu erwarten, daß im nächsten Augenblicke ein Reiter im Eisenkleide mit wackelndem Helmbusch, mit flatterndem Wimpel an der Turnierstange darüber auftauche und seiner Stegreifpoesie nachtrabe. Sind doeh heute noch die Männer von Berg die besten Waffenschmiede der Welt; noch heute sieht man sie Schwerter und Dolche schmieden, biegsam wie die Klingen von Damaskus, scharf und hart wie die Klingen von Toledo, mit einem Worte: die Solinger Klingen.
In diesem schönen Hügellande ging eines klaren, duftigen Herbstmorgens die Sonne auf und erblickte zuerst unter vielen andern Dingen drei Gegenstände, die für uns von Wichtigkeit sind. Der erste ist ein ungeheurer Aktenhaufen, der zweite ein lockiger Mädchenkopf und der dritte ein Hofrat, drei Dinge, auf welche die Sonne in ihrem täglichen Laufe mit sehr gemischten Gefühlen schauen mag. Der Aktenhaufen lag auf dem grünen Tische des Sessionszimmers der Kurfürstlich-Pfälzischen Hofkammer zu Düsseldorf und trug die Inschrift: »Von Schemmey, nunc von Katterbach contra von Driesch, puncto Koppeljagdgerechtsame.« Dabei ist zu bemerken, daß das Klaglibell zu diesen Akten nun schon seit hundertundsieben Jahren eingereicht war, das Endurteil aber auch während des Verlaufs dieser Geschichte noch nicht erscheinen wird. Der Lockenkopf, der, zusammengefaßt mit der ganzen Person, der er seit etwa fünfunddreißig Jahren erb- und eigentümlich zugehörte, den Namen Freiin Maria Anna Josina von Katterbach zu Rheindorf, Bornheim und Leichlingen führte, wär' auffallend hübsch zu nennen gewesen, wenn nicht irgend etwas eine Art leisen Mißbehagens beim Beschauen dieses Kopfes erweckt hätte. Entweder war es der allzukühne Blick des Auges oder ein Gepräge von Unternehmungsgeist, der jedenfalls sich nur auf Kosten weiblicher Anmut geltend machen kann. Ihre volle und starke Gestalt war in einen sehr anständigen und gut kleidenden Morgenanzug gewandet, und so war sie immerhin eine Erscheinung, die ihr Gefährliches haben konnte und einen großen Gegensatz zu ihrer Umgebung bildete. Sie saß am Kaffeetisch in einem großen, wüsten Zimmer des Herrenhauses zu Diependahl am Murrbache, das in allen Ecken und Winkeln Vernachlässigung und unordentliche Wirtschaft zeigte. Einige zur Hälfte zerfetzte, auf der andern Hälfte bis zur Unkenntlichkeit mit Staub und Spinngeweben bedeckte Ahnenbilder in schwarzen Eichenrahmen sprachen allein die Ansprüche des Hauses auf vornehmen Anstrich aus, der ihm doch wie aller Anstrich überhaupt mangelte.
Was nun endlich den Hofrat betrifft, so war dieser Hofrat nicht deshalb, weil er nie bei Hofe gewesen, oder weil es nicht rätlich, sich Rats bei ihm zu erholen, vor vielen andern Hofräten ausgezeichnet, sondern lediglich durch eine gewisse diktatorische Feierlichkeit seiner Erscheinung, die ohne diese Eigenschaft nichts als einen stämmigen Roßtäuscher angekündigt hätte, als er jetzt im grünen, breitschößigen Jagdrock, unten Stulpenstiefel, oben eine hohe Nachtmütze zu seiner Jungfer Schwester ins Zimmer trat und sich zu ihr an den Frühstückstisch setzte. Indem er sich so zu einem der wichtigsten Geschäfte des Tages anschickte, zeigte er ein mürrisches, von tiefen Linien und zackigen Zügen durchfurchtes Gesicht mit blauen, vorquellenden Augen und sah aus wie der Admiral Peter de Tromp oder ein Baummarder, der beißen will.
»Spülwasser!« sagte er verdrießlich, nachdem er die erste Tasse hinuntergeschluckt hatte, setzte die Schale auf den gebohnten Klapptisch nieder und lehnte sich, die Glieder reckend, in den Armstuhl zurück. Dann starrte er seiner Schwester ins Gesicht. »Ma soeur«, sagte er und brach in ein schallendes Gelächter aus.
»Was ist's, alter Bär?«
»Verfluchter Kerl, der Schäfer! Ich glaube, du hast ihm Anträge gemacht, daß er solche Bosheit auf dich hatte!« sagte der Hofrat.
Um diese jedes weibliche Zartgefühl so hart verletzende Anspielung zu verstehen, muß ein Abenteuer berichtet werden, das der Freiin Josina am Abend zuvor zugestoßen war. Sie hatte einen Spaziergang gemacht und war in einer engen Schlucht einem Schäfer begegnet, der geradeswegs aus einem zum Gute des Hofrats gehörenden Schlag jungen Holzes kam und voranschreitend seine Herde zur Abendruhe wieder in das Dorf hinabführte. Mit erhobener Rechten war die Dame dem auf der Tat ertappten Frevler entgegengeschritten, um ihn am Kragen zu fassen und mitsamt seiner blökenden Begleitung in den Pfandstall »einschütten« zu lassen. Der Schäfer aber hatte, wie es schien, an die Milde ihres Frauenbusens appellieren wollen; er hatte das zur Flucht vorgebeugte Haupt an die Brust gelegt und war dann zugeschritten, als ob sie gar nicht im Wege stände. Die Folge dieses mit einem kräftigen Nacken ausgeführten Manövers konnte kein andres sein, als daß die Dame zu Boden stürzte. Nun trat zuerst der Schäfer über sie weg, sodann Fix, der treue Wächter, drittens der Leithammel und endlich die ganze zahllose trippelnde Herde, die den Fersen ihres flüchtigen Führers folgte.
»Ma soeur war ein eingetretenes Hindernis für den Schelm«, fuhr der lachende Hofrat fort.
»Du magst dich freuen, daß das Lumpenpack dir den Schlag abweidet«, sagte die Schwester zornig. Dann glättete sie plötzlich ihre Mienen, zog das Nachthäubchen zurecht und sagte mit einer schmelzend freundlichen Stimme: »Wie haben Sie geruht, Philipp?«
Philipp war ins Zimmer getreten, der lang aufgeschossene Jagdjunker, umsprungen von zwei entfesselten Bracken. Er machte eine Verbeugung und versetzte: »Schlecht genug; dachte immer dran, ob's nicht bald Tag wär', daß es bald losgehen könnte. Nun bin ich doch der letzte. Ich habe den Herrn Vetter über mir rumoren hören und da dacht' ich, nu is Zeit. – Danke, danke.«
Die Freiin Josina war aufgestanden und hatte Philipp mit einem Knicks eine gefüllte Tasse überreicht.
»Na, Junge, mach' jetzt rasch!« rief der Hofrat; »so, trink' aus und sag' dein Jagdsprüchlein auf.« – Er begann mit halb aufsagender Stimme, aber sehr laut, zu singen:
»Sag' an, lieber Weidmann, wie viel End-Ahn Hat der edle Hirsch auf seinem Kopf stahn?«
Philipp versetzte mit einem höchst anmutigen Bariton, der sich etwas unsicher und schwankend weiter bewegte, aber darin keinen Grund fand, sich weniger laut zu machen:
»So oft sich der edle Hirsch hat gepetzt und gewetzt. So viel End' hat der edle Hirsch auf seinen Kopf gesetzt.«
»Richtig,« sagte der Hofrat; »nun wart', noch eins:
Sag' mir an, mein lieber Weidmann, Wo hast du das schöne, hübsche Jungfräulein lassen stahn?«
Donnernd intonierte Philipp (man sah, seine ganze Seele war bei diesen Tönen):
»Ich hab' sie gelassen zu Holz Unter einem Baum stolz, Unter einer grünen Buchen, Da will ich sie suchen. Wohlauf, eine Jungfrau in einem weißen Kleid, Die wünschet mir heut' Glück und alle Seligkeit!«
Philipp schlug nun einen Triller, worüber eine der Bracken zu knurren anfing, und machte der Dame lächelnd eine Verbeugung, der man nichts Uebles nachsagen darf, denn sie war gerade so anmutig, als er es nur immer verstand.
»Schönes Morgengebet!« sagte die Dame. »Mon frère,« fuhr sie fort, »ehe du gehst, vergiß nicht, das Geld abzusenden.«
»Geld, welches Geld? Was weißt du von Geld?«
»Nun das, welches ich dich für die alte Fahrstein abzählen sah, obwohl ich nie habe begreifen können, weshalb du das Weib zu füttern hast.«
Die Freiin hatte im Sinne, sich an ihrem Bruder für den unzarten Spaß von vorhin zu rächen; augenscheinlich gelang ihr dies, denn der Freiherr von Katterbach ward nicht allein verlegen, sondern auch so blaß, als es sein gebräuntes Gesicht zu werden vermochte.
»Ei,« stotterte er, sich abwendend, »du weißt ja, der einfältige Junge, den sie hat« – er stand auf und spuckte zum offenen Fenster hinaus, welche Gelegenheit er benutzte, von der Gesellschaft abgewendet darin liegen zu bleiben.
»Nun, der Junge!« fragte Josina mit einem Ton von Unschuld und Naivität, dessen Unverfänglichkeit nicht wiederzugeben ist.
Philipp lachte laut auf, über die Freiin sowohl als auch aus Vergnügen, ein so interessantes Familiengeheimnis zu entdecken. Der Hofrat trat aus dem Fenster zurück. »Komm, Philipp,« sagte er, »hüte dich vor den Weibern; sie taugen alle miteinander nichts, und ein ordentlicher Jäger sollte sie alle aus dem Hause jagen, denn seine Hunde bekommen nur Flöhe von ihnen – – Was – Teufel! – Wo war das? Das sind die Grünscheidter!«
Zweites Kapitel
In einem frischen, wiesengrünen Talgrunde, eine kleine Stunde oberhalb Diependahls, an demselben Murrbache, liegt das Rittergut Grünscheidt, das zu der Zeit, von der wir reden, etwas vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts, von einem seit einigen Jahren verwitweten Herrn und seinem einzigen Sohne bewohnt wurde. Herr von Driesch war ein Mann von etwa fünfzig Jahren, klein und ziemlich starken Körperumfangs, was aber der außerordentlichen Lebendigkeit seines Geistes und aller seiner Bewegungen keinen Eintrag tat. Er hatte eine von der Erziehung seiner meisten Standesgenossen sich vorteilhaft unterscheidende Bildung erhalten; während jene, als Jagdjunker an irgendeinen kleinen Fürstenhof gegeben, durch allerlei Mühsal, schlimmer als die Prüfungen eines Johanniterordensnovizen, unter häufig beigezogener Hilfe der Hundepeitsche zum »fermen Weidgesellen« ausgebildet wurden, war Herr von Driesch als ein jüngerer Sohn zu den Jesuiten in die Schule gegeben worden und hatte von ihnen ein sehr gutes Latein und viel mehr Griechisch gelernt, als er später, nach dem Tode des älteren Bruders, zur Regierung seiner Güter anwendbar fand. Trotzdem war er bis jetzt ein Liebhaber der Humaniora geblieben und übersetzte Anakreon und Vergils Eklogen im Geschmacke der zweiten schlesischen Dichterschule; er war Mitglied des Pegnitzer Blumenordens und seinen Mitschäfern unter dem Namen »der Säuberliche« bekannt.
Im Besitze einer größeren Bildung und Wissenschaft, als die seiner meisten Standesgenossen war, mochte Herr von Driesch seiner Erhaltung auch größere Rücksichten schuldig zu sein glauben; er hatte zum Symbolum, weil ein solches jeder ausgezeichnete Mann damals führen mußte, die Eule der Minerva gewählt, die sehr tiefsinnig auf einer kahlen Leimrute saß und die Spatzen betrachtete, die festgeklebt an den kleinen Stangen flatterten. Darüber stand: »Wer sich unnütz in Gefahr begibt, kommt darin um.« Der Hofrat, Freiherr von Katterbach, der jedem Menschen etwas Schlechtes nachsagte, behauptete, daß Driesch an jedem Hasen vorbeischieße, sei lauter Sympathie. Dies war eine abscheuliche Verleumdung; es war nichts anderes, als eine sehr lebendige Phantasie, die Herrn von Driesch bei einzelnen Gelegenheiten auf Augenblicke zaghaft erscheinen ließ.
Er war ein gutmütiger Mann, solange es nicht wider seinen eigenen Vorteil lief, und liebte den Frieden und das Geld, aber von allen Dingen Zänkereien und Feindschaften am wenigsten. Ein wahres Herzeleid war ihm deshalb, daß ihm so nahe, drüben auf Diependahl, der Hofrat saß, der die Unverschämtheit hatte, seine Koppeljagd auf dem Mühlberge, einem Distrikte inmitten beider Güter, in Anspruch zu nehmen und ihm nebenbei alles mögliche Leid zu tun. – Schon die Familie von Schemmey, die vor den Katterbachs Diependahl und die andern Güter des Hofrats besessen, hatte den Prozeß über die Koppeljagdgerechtsame auf dem Mühlenberge mit den Grünscheidtern begonnen; aber sie hatte dem Rechte seinen Lauf gelassen und die Driesch waren im Besitze geblieben. Der Hofrat dagegen, obwohl er mit Driesch verwandt war und diesen nach seinem Tode zum Lehnsfolger gehabt haben würde, schritt, nach langjährigem Harren auf ein Urteil, auf dem Wege der Tat vor, ließ auf dem Mühlenberge keine Rebhuhnfeder übrig und versicherte, er werde jeden totschießen, der sich mit Hund und Flinte in seiner Hofesaat sehen lasse.
Laßt nur den ersten Jagdtag kommen, hatte Herr von Driesch schon oft mit Würde gesagt; ihr sollt sehen, wie ich mich werde zu maintenieren wissen. – Der erste Jagdtag war nun gekommen. Herr von Driesch erhob sich vor Sonnenaufgang, weckte seinen Sohn Johannes, einen vielversprechenden Jüngling von bedeutender Körperkraft, fast weißen Haaren und mit einem Gesichte, das an Ausdruck rührender Kindlichkeit mit einem weinenden Säugling wetteifern konnte, und stieg, von ihm, einem Jäger und seinen Hunden begleitet, auf den Mühlenberg.
Oben angekommen mußten Johannes und der Jäger sich auf eine Wallhecke stellen und die Jagdsignale der Grünscheidter blasen. Die Töne schmetterten hell und lustig durch die frische, duftige Morgenluft; eine Fanfare nach der anderen rollte über die tauglänzenden Gebüsche, durch die dünnen, flockigen Nebelwolken, die auf den Talgründen standen und jetzt, unter den Strahlen der aufsteigenden Sonne sich kräuselnd, leise verflatterten. Hoch in den Lüften schmetterten die Lerchen, die Hunde liefen suchend den Hang hinan und hinab, brachen schnuppernd durch den Ginster und die Brombeerranken. Dann schlugen sie plötzlich laut an und machten wütende Sätze im Kreise umher, denn der Pegnitzschäfer hatte aus lauter Vergnügen über die schöne Natur und den herrlichen Morgen seine Flinte in die Luft abgeschossen.
»Ei, ei! Ew. Gnaden!« sagte der Jäger, indem er das Horn absetzte und ein saures Gesicht machte.
»Was willst du, Anton? Blas' weiter! Immer lustig drein! Wir wollen uns maintenieren, wir wollen den jüngsten Besitz wahren! Hurra! Geblasen, Johannes!«
»Aber, Gnaden Papa, jetzt wird's Zeit; die Diependahler könnten kommen; der Rauch steht schon lange über ihrem Dach!«
»Ei was, die schlafen, die Sonne ist ja kaum auf; und laß sie kommen! Noch eins, Anton! So, immer zu! Hurra, hoho!« – Herr, von Driesch feuert den zweiten Schuß in die Luft ab; dann sprang er in die Höhe und sang, so heiter wie eine Meise im Hanfsamen, mit improvisierter Melodie seine jüngste Uebersetzung aus dem Vergil:
O Tityrus, der du im Buchenschatten ruhst, Auf magrem Haberrohr ein Liedchen pfeifen tust, Wir fliehn die Grenze jetzt und süße Vatermatten, Indes du, Tityrus, ganz faul gelehnt im Schatten, Läßt widerhallen Feld und Wald, das ist gewiß, Vom Lob der schön' und zarten Amaryllidas! – Hurra!
»So, Anton, immer lustig fort! Das ist die possessio novissima, Johannes! Merk' das, Junker! Der Teufel hole die Diependahler! 's ist doch ein wunderschöner Morgen. Da, Anton, lade die Flinte mal wieder.«
Anton zögerte mit dem Laden, da er gar nicht für angemessen fand, seinem Herrn in der abscheulichen Angewohnheit Vorschub zu leisten, das gute Pulver in die Luft ab- und so sich selber anzufeuern. – »Ew. Gnaden, Ew. Gnaden!« sagte er kopfschüttelnd, »wir können's anderswo nötig haben!«
»Um Gottes willen, Papa!« rief jetzt Johannes, indem er von der Wallhecke heruntersprang.
»Was ist's, Schlingel? Du fürchtest dich? Junker, willst du blasen!«
In diesem Augenblick knallte seitwärts ein Schuß – noch einer. – »0 Gott, die Juno, die Juno!« rief Anton, der oben stand; »Herr von Katterbach haben die Juno totgeschossen!« Er griff nach seinem Gewehr und wollte in das nahe Gebüsch eilen.
»Bleib hier, Anton, hier!« rief Herr von Driesch, der blaß geworden war und zu zittern anfing. Die Zweige des Gebüsches öffneten sich, und Türk, der andere Hund, kam heraus mit blutigem, zerschossenem Hinterlauf und hüpfte winselnd auf seinen Herrn zu. Gleich darauf wurden die tauspritzenden Aeste höher noch einmal bewegt, schlugen auseinander und heraustrat der Hofrat, Freiherr von Katterbach, mit verzerrten Mienen, ohne Mütze, die Haare wild ums Gesicht und den Kolben seines Gewehrs an die Wange schlagend; hinter ihm stand lachend der lange Philipp.
Jetzt schrie Herr von Driesch laut auf und nahm Reißaus, Johannes hinter ihm her. Ein Schuß fiel. »Fort, fort, Papa!« rief Johannes. Papa bedurfte des Sporns nicht. Ein donnerndes Hoho! schallte hinter ihm her.
»Mord, Mord!« keuchte er und lief durch frischgepflügte Ackerschollen, durch Gestrüpp und Dorn, über Gräben und Hecken in die weite Welt hinein.
Der letzte Schuß war jedoch kein Mordversuch gewesen; es war Anton, der, wütend geworden über den Schmerz seines Lieblings Türk, die gelbe Bracke des Hofrats totgeschossen hatte und dann gleichfalls davonlief, ins nächste Gebüsch hinein. Der Hofrat und Philipp folgten nun diesem in raschem Laufe. – Trotzdem gönnte Herr von Driesch sich fürs erste keine Ruhe. Johannes, der längere Beine hatte, fand endlich Spaß an dieser Jagd. – »Gnaden Papa«, sagte er:
»Wir fliehn die Grenze jetzt und süße Vatermatten.«
»Schau einmal um, schau mal um«, sagte Herr von Driesch.
Johannes schaute um. – »Ich sehe niemand, Papa!«
Herr von Driesch blieb stehen und holte Atem. »In der Tat, niemand!« sagte er dann, nachdem er sein Auge hatte über die Gegend schweifen lassen. »Sie werden meinen, wir wären nach Grünscheidt gelaufen, und uns dahin folgen wollen; sie werden uns in unserm eigenen Hause erschießen wollen. O canina rabies! Aber wart', das soll euch betrügen. Johannes, da wir nun doch einmal auf dem Wege sind, so wollen wir gleich weiter gehen bis nach Bechenburg; wir können heut' abend da sein. Dann hat der Waldteufel, der Mörder doch seinen Weg nach Grünscheidt umsonst gemacht!«
Johannes war's schon recht, und beide wanderten weiter. Nach einer Weile hub Herr von Driesch wieder an: »Johannes, ich mag Bechenburg wohl!«
»Ja, Gnaden Papa, aber die Hexe!«
»Ist immer besser als solch ein Waldteufel. Ich denke, wir wollen auf Bechenburg fürs erste wohnen bleiben, Johannes.«
»Nein, Papa, auf Bechenburg sind lauter alte Binsenstühle.«
»Verwöhnter Schlingel, sollen wir uns in Grünscheidt totschießen lassen?«
Johannes antwortete nicht; nach einer Weile Trabens sagte er: »Wenn Papa mir den falben Fritze schenkt.«
»Den falben Fritz? Daß du ihn in drei Wochen zuschanden reitest? Nichts da. Aber ein Sofa will ich dir auf Bechenburg anschaffen.«
Johannes gab seine Einwilligung anfangs nicht zu erkennen. Je weiter aber die beiden Wanderer fortschritten und je müder die Gliedmaßen des Junkers wurden, desto mehr Wert und Reiz bekam für ihn das gepolsterte Möbel, worauf das Versprechen des Vaters lautete.
Nachdem sie etwa noch zwei Stunden schweigend zurückgelegt hatten, blieb er endlich stehen, um auszuruhen und sagte dann zögernd: »Aber es muß von Roßhaaren sein, Gnaden Papa!«
»O Junkerlein, wie wird es dir ergehen!« seufzte Herr von Driesch.
Die beiden Reisenden schritten fürder. Nachdem sie in einer kleinen Stadt Mittagsruhe gehalten und sich gelabt, erhob sich ein Zank zwischen beiden, weil Johannes durchaus verlangte, daß man Extrapost nehme, wogegen Herr von Driesch einwandte, daß er erstens noch heute und zweitens ungefährdeten Leibes und heiler Gliedmaßen auf Bechenburg ankommen wolle.
»Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, Johannes«, sagte Herr von Driesch.
Wege und Posten waren damals so, daß Johannes gegen diese Argumente endlich nichts mehr anzuführen wußte. Sie kamen nun in Westfalen hinein. Das Land zeigte sich ihnen anfangs von seiner schlechten Seite; es waren stundenlange Heiden, über die sie oft, um gerader zu gehen, auf wenig betretenen Schäferpfaden wandern mußten. Der Tag war heiß, und Herr von Driesch mußte häufig stehen bleiben, um sich die Stirn abzuwischen. Endlich gegen Abend zog ein Gewitter am Horizonte auf. Herr von Driesch war durchaus kein Liebhaber dieser Naturerscheinung; Das Toben der Elemente verschwendete alle seine Großartigkeit an ihn umsonst, denn er pflegte Türen und Läden schließen zu lassen und sich in den tiefsten Keller zurückzuziehen, um ein De profundis anzustimmen, solange er Gott in den Donnern hörte. Und nun auf offener Heide! Er schritt weit, weit aus; der Sturm begann, schwere Tropfen fielen einzeln auf seine Stirn, dicke Staubwirbel wehten über die Heide. Endlich war der Saum eines Gehölzes erreicht, dessen Aeste und Stämme gepeitscht wurden, als seien es schlanke Kornhalme. Johannes stellte' sich unter einen der nächsten Wipfel, Herr von Driesch aber hielt die Nähe der hohen Bäume zu gefährlich; er schritt wieder auf die Heide hinaus und legte sich der Länge nach in ein tiefausgefahrenes Wagengleis. Die Blitze schienen ihm alle bloß nach seinem Kopfe zu zielen, so nahe zuckten sie über die Erde hin. Ein prasselnder Donnerschlag schmetterte in den andern; – »Johannes, Johannes!« rief Herr von Driesch.
»Was soll ich, Papa?«
»Gott möge ihnen vergelten, was sie heute an mir tun«, stöhnte der geängstigte Schäfer der Pegnitz, die in dem tiefen Gleis von den Regengüssen nachgebildet wurde und um ihn rauschte – »O Johannes, mein lieber Sohn Johannes!« – Johannes kam heran. – »So, Kind, du verlässest mich nicht; du sollst Vater und Mutter ehren, Johannes; komm, tritt hierhin, über mich, auf beide Ufer von diesem Gleise – mit gespreizten Beinen, so – etwas weiter die Beine auseinander, so!«
»Aber, was hilft's? Ich werde naß und Gnaden Papa auch.«
»Tut nichts, mein Sohn, bleib' nur so stehen, Kind!«
»Nein, Papa, laß mich unter den Baum zurück.«
»Bleib, sage ich oder« – fuhr Herr von Driesch zornig auf; dann bekreuzigte er sich: »Gott verzeih' mir die Sünde!«
»Aber Papa, wenn ich nur wüßte, was es bedeuten soll?«
»Sollst es erfahren, nachher; steh nur, steh!«
»Soll ich den falben Fritze haben, Papa? – Ich kann's gar nicht mehr aushalten.«
»Nimm ihn, nimm ihn, lieber Sohn, Herzensjunge, aber steh!«
Johannes stand wie der Koloß von Rhodus in verjüngtem Maßstab, die Beine über seinen Vater spreizend, der unten im Gleise lag und nur zuweilen hin und her ruckte, wenn das Wasser in gar zu starken Güssen auf ihn zubrodelte; sooft aber ein Blitz und fast im Augenblicke darauf der Donnerschlag kam, schnellte er vor Angst aus der Flut in die Höhe wie ein Fisch an warmen Sommertagen. So verging fast eine halbe Stunde, worauf die Zwischenräume zwischen Blitz und Donner länger wurden und das Rollen des letztern aus knatterndem Rasseln in ein dumpfes und fernes Getöse überging.
»Gott sei Dank!« sagte Herr von Driesch; »laß mich jetzt aufstehen, Johannes!« Er erhob sich; sein Schäfername, der Säuberliche, war im eigentlichen Wortverstande beschmutzt, und alle Versuche, ihn wieder zu Ehren zu bringen, blieben ohne Erfolg.
»Papa,« sagte Johannes und schlenkerte rechts und links seinen Hut, um das Wasser daraus zu spritzen; »weshalb habe ich so stehen müssen, Papa?«
»Das will ich dir jetzt sagen, mein Sohn. Sieh, der Blitz trifft immer die höchsten Gegenstände und fährt an ihnen herunter in die Erde hinein, wo er den Donnerkeil stecken läßt. Hätte der Blitz nun heute hier einschlagen wollen, so wäre er unfehlbar in deinen Kopf, als den höchsten Gegenstand in der Nähe, geschlagen und hätte alsdann seinen weiteren Verlauf durch deinen Leib, ferner durch eines deiner Beine genommen und das Bein hätte ihn ganz unschädlich in die Erde abgeleitet.«
»O?!« sagte Johannes voll Verwunderung über die tiefe Naturkunde seines Vaters. – »Aber, Papa, ich wäre doch totgeschlagen?«
»Lieber Sohn, du hättest das neidenswerte Los gehabt, für deinen Vater den Heldentod zu sterben; dulce est pro patre mori!«
»Aber 's nächste Mal tu' ich's nicht wieder, Gnaden Papa,« brummte Johannes.
Drittes Kapitel
Das Gut Bechenburg liegt nahe bei dem Städtchen L. in Westfalen. Man geht an einem breiten Graben her, den ein Wald alter gewaltiger Kastanienbäume beschattet, wendet sich dann rechts und hat nun nach zwanzig Schritten eine tiefliegende Mühle, mit Wiesengründen dahinter, zu seiner Linken; zur Rechten das erste Tor des Gutes, zwei Steinsäulen, auf deren einer ein wappenhaltender Löwe, ein höchst blutdürstiges Ungeheuer, kauert, während sein Nachbar, von der andern heruntergefallen, im Schilf des versumpfenden Grabens liegt, von einer üppig grünenden Vegetation Schlammpflanzen bedeckt. Die Zugbrücke war ehemals in gutem Stande; man kann noch die eisernen Rollen oben an den Torsäulen sehen, über die ihre Ketten liefen. Das zweite Tor bildet eine niedere Durchfahrt, so niedrig, daß ein verdeckter Wagen vergeblich versuchte hindurchzukommen; man darf daraus auf das Alter der Burg schließen, die, klein und eng zusammengebaut, nicht jünger als das fünfzehnte Jahrhundert sein mag und jedenfalls für Menschen mit bescheidenen Ansprüchen auf Bequemlichkeit und äußeren Glanz gebaut ward, als unsre Generation hegt.
Unsre Reisenden hatten nach ihrem Unfall ein Unterkommen für die Nacht gesucht und im nächsten Kirchdorfe bei dem Pfarrer gefunden. So schritten sie erst am andern Tage, fast gegen Mittag, in den Hof ihres Gutes ein und gelangten, um einige Haufen aufgeschichteten Bauholzes her, durch ein ganzes Volk durcheinanderstäubender Hühner, endlich über eine auf den Treppenstufen sich sonnende Katze, der Johannes nicht unterließ auf den Schwanz zu treten, in das Innere. In der kirchengroßen Küche saß eine Frau am Feuer und reihte Zwiebeln auf.
»Guten Morgen, Frau Fahrstein,« sagte Herr von Driesch.
»Ach, Ew. Gnaden! Sieh mal, sieh mal, schon da! Ich wußte wohl, daß Ew. Gnaden kommen würden.«
»Ihr wußtet das?« fragte Johannes.
Herr von Driesch stieß ihn in die Seite.
»Frag' doch nicht nach ihren Hexenstücken,« flüsterte er.
»Ei freilich, Junker,« sagte Frau Fahrstein; »das kleine Hütchen hat schon alles in Bereitschaft gesetzt, auch den Großvaterstuhl für den jungen Herrn abgestäubt und an den Kamin geschoben; dann weiß ich immer, wieviel die Uhr geschlagen.« Sie war aufgestanden und suchte nach ihren Schlüsseln. Johannes blickte unterdes in der Küche umher; dann ging er in den Hintergrund und schaute durch die Fenster in den Garten, zuletzt durch eine halb offenstehende Tür in das Schlafkämmerchen der Frau Fahrstein: »Wer schläft denn da noch?« sagte er.
»Johannes, Johannes!« rief Herr von Driesch ängstlich.
Frau Fahrstein näherte sich der Kammertür und schaute mit verschmitzten Blicken hinein.
»Still, still, Junker,« flüsterte sie, »mein Mann schläft noch; der arme Schelm ist schwachen Leibes.«
»Aber,« sagte Johannes, »ihr Mann? Der ist ja lange – er hat ja tote Augen!«
Johannes starrte den Schläfer an, der ihn mit hohlen gläsernen Augen aus den Kissen anblickte; es war nichts als eine Maske, über einem, wie es schien, ausgestopften Biberwams befestigt und eine Schlafmütze darüber. Der Junker sah fragend nach dem Vater hin, der noch am Herde stand und hinter Frau Fahrsteins Rücken seinem Sohne ein Zeichen nach dem andern machte. Die Frau schien Johannes' letzte Worte überhört zu haben und klapperte in ihren Holzschuhen zur Küche hinaus, um ihrer Herrschaft die Wohnzimmer aufzuschließen.
Herr von Driesch trug der Verwalterin auf, ihm einen Boten zu besorgen, der seine Domestiken und Sachen von Grünscheidt nach Bechenburg beordern sollte. Als sie gegangen war, sagte er: »Johannes, was deines Amtes nicht ist, da laß deinen Fürwitz. Was geht es dich an, wenn die Alte lieber einen Strohmann mit sich zu Bette nimmt als gar keinen. Reize sie nicht; ihr ist nicht zu trauen. Sonst ist sie ein gutes Weib, und wenn sie etwas wirre ist, so hat sie in ihrer Jugend auch viel aushalten müssen, wovon mehr Leute zu viel bekommen haben würden; laß sie in Frieden, sag' ich dir.«
Johannes setzte sich in seinen Großvaterstuhl und Herr von Driesch machte Anstalten zu einem Bericht wegen Mordanfalls und Landfriedensbruchs von Seiten des P. P. von Katterbach auf Diependahl an eine Kurfürstlich Pfälzische hochpreisliche Landesregierung zu Düsseldorf.
Den Nachmittag brachte der Gutsherr mit Schreiben zu, während Johannes draußen wilde Holztauben jagte. Als der Abend eingebrochen war, fühlte er schmerzlich den Mangel seines Vergil und Horaz; er hatte nur des Erasmus Colloquia in die Jagdtasche gesteckt, als er zu seiner glorreichen Wahrung der possessio novissima des Mühlenbergs ausgezogen war; leider war es eine Elzevirausgabe in Duodez; und Herr von Driesch konnte die kleinen Lettern abends nicht mehr lesen. Die Langeweile führte ihn zu der Verwalterin hinunter. Die Frau saß wieder allein an ihrem Herde, hatte ihre Katze auf den Schoß genommen und sprach leise Worte vor sich hin. Das knisternde Holzfeuer, das hoch um eine aufgehängte Eierkuchenpfanne lohte, erleuchtete den weiten Rauchfang voll Wintervorräte an Zwiebeln, Fenchelbüscheln, Würsten und Speckseiten; der große übrige Raum wurde nur zuweilen erhellt, je nachdem die Flamme sich bewegte, so daß bald die hölzerne Wendelstiege in der Ecke, bald die entgegengesetzte Wand mit den Hirschgeweihen, den paar verrosteten Jagdgewehren und dem Blasinstrumente, das Jäger den halben Mond nennen, grell beschienen, hervortrat. In dem Winkel unter der Treppe saß eine Magd und reinigte den Salat zum Abendessen. Der Gutsherr setzte sich ans Feuer, aber so, daß er die Tür zu der Schlafkammer, wohin er zuweilen einen scheuen Blick streifen ließ, nicht im Rücken hatte.
Herr von Driesch hatte immer ein unheimliches Gefühl der Alten gegenüber; um sich zu beruhigen, begann er zu sprechen und erzählte ihr von seinem Abenteuer mit dem Hofrat. Bei dem Namen Katterbach zuckte das Gesicht der Alten leise zusammen; ihre grauen Augen blickten wie bohrend durch die langen weißen Wimpern den Gutsherrn an.
»Herr,« sagte sie, »ich bin eine alte Frau und weiß nicht, ob die Diependähler oder ob Ihr das Recht habt, auf dem Berge zu jagen; aber das weiß ich, daß Ihr den Mann, so Ihr da nanntet, in Gottes Namen jagen lassen würdet, wo er will, wenn Ihr sehen könntet, was ich sehe –« sie stockte.
»Was habt Ihr gesehen, Margaret?« sagte Driesch gespannt.
»O Herr, ich bin alt geworden und habe vieles gesehen in diesem Lande und auch in andern Ländern bei den Welschen.«
»Ja, Margret, das mein' ich nicht; Ihr könnt mehr sehen als andre Leute, und ich möchte wissen, was Ihr von Katterbach gesehen habt – Ihr versteht mich wohl – so des Naehts,« flüsterte der Gutsherr und fügte laut hinzu: »Lene, geh mal hinaus.«
»Laßt das Mädchen nur bleiben,« sagte die Verwalterin, »ich habe nichts gesehen.«
Der Schein der Flamme fiel in ihr Gesieht, in dessen markierten Zügen der Freiherr eine starke innere Bewegung sich abspiegeln sah; vielleicht täuschte er sich auch, denn es konnte der grelle gelbe Lichtschein sein, was die Wirkung hervorbrachte.
»Aber Margret,« hub der Freiherr, dem alles daran gelegen war, die Frau zum Sprechen zu bringen, nach einer Pause wieder an, »wie war es, als Ihr den Gellers Kotten brennen sahet, der ein Halbjahr später wirklich in Asche lag?«
»O Herr, es ist keine Freude, so in der Nacht heraus zu müssen; in den Mondstrahlen ist viel scharfes Gift für manche Leute, wenn sie ihnen auf dem Kopfe stehen. Die Nächte sind kalt; aber man merkt es nicht, daß man friert, und ging es auch bis auf die Knochen.«
»Und dann seht Ihr die Flammen und die Menschen so deutlich, als wenn es wirklich geschehe? Und könnt Ihr das Rufen und das Glockenläuten auch hören?«
Die Verwalterin stand auf, rückte einen Stuhl und zündete die Oellampe an, die ein hölzerner Arm, der aus der Außenseite des Rauchfangs sich in die Küche erstreckte, vor einem gebräunten Magdalenenbilde hielt: »Es ist morgen Schutzengelfest,« sagte sie. Dann nahmen ihre Züge plötzlich einen sehr heitern Ausdruck an: »Guten Abend, junger Herr, da setzt Euch, Ihr seid gewiß kalt geworden. Mein Sohn, Ew. Gnaden!«
Der Eintretende war ein junger Mensch von etwas über zwanzig Jahren; in seiner Haltung lag viel Schüchternheit, etwas sehr Befangenes; er war so verlegen, daß er zur Begrüßung des Gutsherrn nur einige rasch wiederholte Verbeugungen, aber keine Worte hatte. Herr von Driesch hätte freilich für sein Leben gern mehr von der Alten vernommen, was sie denn eigentlich von seinem Feinde wisse; aber dennoch war ihm der Eintritt des jungen Menschen willkommen, weil er ihm einen Anflug von ängstlichem Grausen vertrieb, das bei den Reden der Frau ihn immer kälter angeweht hatte. Beide waren bald in ein Gespräch vertieft, das des Gutsherrn Ideen eine ganz andre Richtung gab und großes Interesse für ihn bekam. Der Sohn der Verwalterin war ein Dichter wie er, aber statt daß Herr von Driesch darüber eine gewisse Unbehaglichkeit gefühlt hätte, mit einem Plebejer auf demselben Felde sich zu begegnen, beteuerte er, der junge Mann sei der einzige, von dem man etwas lernen könne, das nicht in Büchern stehe.
Viertes Kapitel
Es war eine wunderliche Frau, die Verwalterin von Bechenburg, Margret Fahrstein oder auch die Römische Margret genannt. Einige sagten gerade heraus, sie sei nicht besser als eine Hexe, und der Pfarrer schüttelte bloß den Kopf und zuckte die Achseln, wenn man das sagte, aber gar nicht so, als wolle er mit dem Kopf schütteln die Behauptung in Abrede stellen. Sie saß immer auf dem alten Kastell und kam nicht einmal in der österlichen Zeit herunter, um in ihrer Pfarrkirche, wie es doch deutlich in den fünf Geboten der heiligen Kirche geschrieben steht und eines jeden Christenmenschen Pflicht ist, zur Beichte und zur Kommunion zu gehen. Sie könne die Kirchenluft nicht vertragen, sagte sie. Das war aber nur ein leerer Vorwand, denn wäre sie in der Tat so kränklich gewesen, dann hätte sie's nur sagen dürfen, und der Pfarrer wäre gern zu ihr gekommen und hätte ihr das Sakrament ins Haus gebracht. Nun wäre kein altes Weib männlichen oder weiblichen Geschlechtes, von jungen oder alten Jahren, in dem Städtchen L. gewesen, das nicht dreist behauptet hätte, der Teufel habe es ihr verboten in Gottes Kirchen zu gehen, wenn nicht ein merkwürdiger Umstand laut dagegen gesprochen: Frau Margret war nämlich vor vielen Jahren, als sie noch kräftig und gesund und blühend gewesen, einmal nach Sankt Jago di Compostella in dem fernen Lande Galicia, das noch hinter den Spaniolen liegt, einmal sogar nach Jerusalem und zweimal nach Rom gewallfahrtet; das letztemal, nach Rom, mit nackten Füßen; auf dem Wege hatte sie zur Ehre Gottes gebettelt und nachts ein Obdach in den Klöstern erhalten, da man damals noch gar keine lange Tagereise zu machen brauchte, um von einem Kloster zu dem andern zu kommen. Später war sie noch jedes Jahr um Pfingsten zu dem wundertätigen Christus nach Coesfeld gepilgert. Freilich sagten die Leute, das habe sie nur getan, um ihren Mann tot zu beten. Aber das sei dummes Zeug, meinte die Küsterin, die sich immer ihrer anzunehmen pflegte; dann hätte sie nach Werl zu der heiligen Mutter Gottes gehen müssen, denn die Mannsleute ständen immer einander bei.
So viel war gewiß, daß die Römische Margret – diesen Namen hatten ihre Pilgerfahrten ihr eingebracht – aus einer Familie war, auf der kein Segen lag. Dies verhielt sich so: Ihr Vater, ein wohlhabender Schulze in einem mehrere Stunden entfernten Dorfe und ein sehr stolzer, hartnäckiger Mann, dessen Nacken so steif schien wie das Holz seiner hohen Eichen, stand eines schönen Nachmittags auf dem Anger vor seinem Hause. Es war ein warmer Tag, auf Kreuzerhöhung, wenn die Gemeinde jährlich einen feierlichen Umzug mit dem Sakramente und den Fahnen hielt, daß der liebe Gott eine gesegnete Ernte verleihe. Die Prozession zog dann um die sämtlichen Getreidefelder des Dorfes und auch über ein Kornstück des Schulzen, durch das ein schmaler Fußpfad von seinem Hofe nach der Kirche und dem Mittelpunkt des Dorfes lief. Eigentlich brauchte der Schulze den Fußpfad nicht zu leiden, denn niemand konnte sagen, daß er dies als Servitut auf seinem Grundstücke habe; aber da es zur Bequemlichkeit seines eignen Hofes war, hatte er es so einreißen lassen und auch geduldet, daß andre Kirchengänger sich des Richtweges bedienten. Seit einigen Jahren war nun auch die Prozession denselben Pfad gezogen. Das war aber ein andres; das war eine ganze Flut von Leuten, die ihm seine Saat zwei Ellen breit an jeder Seite niederstampften. Der Schulze wollte das nicht ferner dulden und war jetzt da, um seine Protestation einzulegen. Er hatte das Wams abgeworfen und ging, eine lange Tabakspfeife im Munde, unter den Eichen seines Kampes auf und,ab, aus deren Schatten er die üppig aufgeschossenen Saaten seiner Felder überschauen konnte. Aus der Ferne hörte er das Singen; helle, etwas kreischende Stimmen der Frauenzimmer und dann als Chor den tieferen Gesang der ganzen Gemeinde; von seinen Leuten war niemand dabei, er hatte sie alle zu Hause gehalten, und sie kamen jetzt heraus und stellten sich auf die Wallhecke des Kampes, um zuzuschauen. Die Prozession kam näher; zuerst ein Chorknabe mit dem Kreuz, nach ihm zwei andre mit den beiden Kirchenfahnen und nun die Weiber zuerst, alle in buntem Sonntagsstaat. Dann schritt der Pfarrer heran, unter dem Baldachin, und die Männer schlossen mit der Bruderschaftsfahne den Zug. So gingen sie eine Strecke zwischen den Eichen und dem Ackerfelde den grünen Rain entlang; als die vordersten nun da angekommen waren, wo der Weg links abbog und über des Schulzen Grundstück lief, entstand ein Gedränge; die Fahnen- und Kreuzträger hielten still, die Mädchen drängten sich aufeinander, und der ihnen folgende Pfarrer begann zu schelten, weshalb sie den Zug in Unordnung brächten.
»Herr Ohm,« sagte eines der Mädchen, indem sie so den Pfarrer nach der Sitte des Landes zum Verwandten machte, »Schulze Wellmeyer hat einen Schlag vor den Pfad machen lassen.«
Das war in der Tat so; es war ein breiter Schlag quer über den Weg gezogen; an beiden Seiten war ein Wall aufgeworfen und Dorngestrüpp darüber gelegt.
Hierüber ward der Pfarrer erzürnt, denn wenn der Schulze eine solche Neuerung anfangen wollte und Recht dazu zu haben glaubte, so hätte er's den Tag vorher ja anzeigen können.
»Oeffnet den Schlag, Schulze!« sagte der Pfarrer laut, indem er sich nach dem Eichkamp wandte. Da stand der lange Schlingel – er hatte nicht so viel getan, sein Wams wieder anzuziehen – und schüttelte den Kopf, denn laut zu antworten wagte er doch nicht, und drohte mit geballter Faust ein paar Buben, die von seinem Wall die Dornsträucher wegzureißen im Begriff waren. Der Pfarrer aber besann sich, was in seinen Händen ruhte, und daß es sich deshalb für ihn nicht zieme, einen Streit anzufangen. Darum ließ er die vordersten sich wieder ordnen und befahl, daß sie auf demselben Wege zurückziehen sollten; bevor er aber selbst umkehrte, sagte er: »Wellmeyer, Wellmeyer, du verschließest nicht mir deine Wege, sondern unserm Herrgott!«
»Ei, ob der Pfaffe was schwatzt!« sagte Wellmeyer; innerlich schien er aber betroffen; er räsonierte wenigstens den ganzen Tag über aufs grimmigste. Endlich ward es Zeit zum Schlafengehen; Wellmeyer, der zumeist der letzte im Hause auf war, hatte auch schon die Mütze über die Ohren gezogen und drückte sie müde in die Kissen. Auf einmal hob er den Kopf wieder. »Das ist doch wunderbarlich,« sagte er langsam, fuhr mit der flachen Hand über die Augen und machte seine Ohren von der Schlafmütze frei; dann schüttelte er heftig den Kopf und horchte nun wieder: »Ja, immer noch – immerzu,« sagte er leise; »ei, mein Gott, sollte das einem so ins Geblüt fahren können? – Aber es ist ja deutlich draußen!« – Er sprang auf und trat ans Fenster. Draußen war heller Mondschein; das war alles, was Wellmeyer sah. Er legte sich wieder hin, aber schlafen konnte er die Nacht nicht; er mußte immerzu horchen, bis nach drei Uhr, wo es aufhörte.
Als er des Morgens aufstand und in die Küche ging, standen seine beiden Töchter und der Großknecht am Herd und flüsterten mit verstörten Gesichtern untereinander. Er fragte mürrisch, was sie hätten. »Vater,« sagte Thekla, »wir haben die ganze Nacht draußen laut die Prozession singen gehört. Hermann ist auch aufgestanden, aber er hat nichts sehen können; nur Margret hat etwas gesehen, aber sie will nicht mit der Sprache heraus.« Der Schulze ward blaß, er wendete ihnen schnell den Rücken zu und sagte: »Dummes Zeug! – Wollt ihrs Maul halten!?« Dann ging er, ohne das Frühstück anzusehen, auf den Eichkamp hinaus. Es war nicht viel Gutes, was Schulze Wellmeyer sah, als er auf dem Eichkamp stand: drüben auf dem Grundstücke, worüber der Fußweg lief, war rechts und links den Pfad entlang alle Saat niedergetreten, als ob nun doch eine Menge Menschen sich hinübergedrängt hätte; sein Schlagbaum und der Wall, den er aufgeworfen, mit dem Dorngestrüpp, die waren unbeschädigt, aber alle Frucht am Wege war verdorben.
Von nun an ging es dem Schulzen schlecht. Es schien, als ob Hagelschlag und Gewitter es allein auf des Schulzen Acker abgesehen hätten; drei Jahre nachher – es war just in der Oktave von Kreuzerhöhung – brannte sein Haus und der Speicher ab; seine Frau bekam die fallende Sucht, und, was das Merkwürdigste, noch bis auf diese Stunde ist auf dem Wellmeyershofe nie ein männlicher Anerbe geboren, ebensowenig wie jetzt seit über tausend Jahren auf dem Mordhofe zu Apierbeck, wo man in heidnischen Zeiten die heiligen Brüder Ewaldi erschlagen hat.
So war der reiche Schulze nach und nach heruntergekommen, daß seine Töchter, von denen nur die jüngste, die ihrem Mann den Hof zubrachte, heiraten konnte, bei fremden Leuten dienen mußten. Margret kam als Magd nach Diependahl, zu der Familie von Schemmey, die dort wohnte und aus einer alten Dame und ihrem Stiefsohne bestand. Sie wohnte lange dort; sie war schön, bildschön, sagten die Leute, die sie damals gesehen hatten, aber auch hoffärtig, eigensinnig und verschlossen, gerade so wie ihr Vater, der alte Wellmeyer. Nun, es ist auch eine harte Sache, fremder Leute Brot essen zu müssen, für die Tochter eines freien Schulzen, der vielleicht über Karls des Großen Schwert gesetzt ist, damit zu richten über alles, was Femwroege, und der jedenfalls weiß, daß seine Vorfahren seit uranfänglichen Zeiten auf seinem Hofe gesessen haben und die eigentlichen Herren des Landes sind, so daß der heutige Adel nur braucht auszusterben, und es kann dann nicht fehlen, daß alle seine Güter und Grundstücke wieder den Schulzen zufallen. Wer kann es der schönen Margret also verargen, daß sie sich nichts wollte bieten lassen? Die von Schemmey behandelten sie auch gut; denn als der letzte Baron geheiratet hatte, ward sie Wärterin bei seinen Kindern. Und doch hatten sie so viel Not mit den Kindern und ließen von allen Domestiken keinen ihnen nahe kommen als nur die schöne Margret, die auch mit nach Paris mußte, als die Herrschaft dahin zog.
Die Schemmeys waren gestorben. Nach ihrem Tode war sie noch eine Zeitlang auf dem Gute gewesen, bei dem neuen Herrn von Katterbach, der als Lehnsfolger die Besitzungen der erloschenen Familie angetreten hatte. Darauf folgten ihre weiten Pilgerfahrten und nach diesen ihre Heirat. Mit der war es auch sonderbar zugegangen. Als sie das letztemal wieder nach Hause gekommen, hörte sie, daß es dem Schulmeister ihres Dorfes so erbärmlich gehe. Der arme Mann hatte die Gicht so stark in allen Gliedern, daß man ihm seine Stelle hatte nehmen müssen; zu gleicher Zeit waren ihm zwei Kühe, sein einziger Reichtum, innerhalb dreier Wochen nacheinander gefallen; und nun lag der arme Mensch kontrakt in seiner Hütte, ohne daß sieh jemand um ihn kümmerte und ihn pflegte; seine Frau war lange tot, und seinen Sohn, einen baumlangen Menschen, hatten die Preußen für die Potsdamer Wachtparade gestohlen. Der Mann hätte durchaus wieder eine Frau haben müssen, die Tag und Nacht um ihn wäre; aber wer wollte den kranken Schulmeister nehmen, um mit ihm auf dem blanken Stroh zu liegen und sich was vorstöhnen zu lassen?
Margret ging zu ihm und sagte ihm, daß sie es wolle. Der arme Schelm traute seinen Ohren nicht, aber als sie damit anfing, ihn zu pflegen und einen Doktor herbeizuholen, der nur aufschreiben durfte – Margret bezahlte alles – brachte sie ihn bald so weit, daß er mit ihr den Kirchgang machen konnte. Und weil sie so gut angeschrieben stand bei den vornehmen Leuten auf Diependahl und da herum, kostete es ihr nur eine oder zwei kleine Fußreisen – und der arme Schulmeister ward plötzlich als Verwalter auf Bechenburg angestellt, wo freilich nicht viel zu verwalten war denn die Grundstücke des Gutes waren alle verpachtet. Endlich starb er ihr ab; Margret schien sich aber so an ihn gewöhnt zu haben, daß sie auch nach dem Tode nicht von ihm lassen konnte; wer ihn sehen wollte, dem zeigte sie ihn, wie er in ihrem Bette lag, das heißt seine Schlafmütze und sein Nachtwams mit einer Maske dazwischen.
Nur zwei Umstände blieben geheimnisvoll an ihr. Ich meine nicht den, daß Margret für eine Vorgeschichtenseherin galt, denn das ist nichts Verwunderliches in Westfalen, daß es einzelne Leute gibt, die es nachts heraustreibt – zumeist wenn der Vollmond am Himmel steht – um Dinge zu sehen, die sich erst später wirklich zutragen sollen und die aus ihrer Zukunft herauf einen Schatten werfen, der ihnen oft um lange Zeit vorausgeht. Das hab' ich selber schon erlebt. Es sind meistens Leute mit hellblonden Haaren und nixhaften Augen, aus denen eigentümlich bohrende Blicke kommen, diese Seher; und sie klagen sehr über diese Gabe, als ob Gott sie damit strafen wolle; aber jeder Mensch hat seine Gaben, und was einem auferlegt ist, das muß man tragen. Nein, Margret besaß zwei Dinge, von denen niemand recht wußte, woher sie kamen; das eine war viel Geld und das zweite ein Sohn.
Die Leute wußten nur, daß sie den Sohn als Knaben von drei Jahren zu sich genommen, als sie Haushälterin bei dem von Katterbach auf Diependahl war, und daß sie ihm eine außerordentliche Sorgfalt widmete; auch nannte sie ihn »junger Herr« und »Ihr«, was darauf hindeutete, daß er wohl einen vornehmen Vater haben mußte; doch konnte man darauf keine Schlüsse bauen, denn Margret war in allen Dingen wunderlich. Woher sie aber das Geld bekam, ihn studieren zu lassen, das wußte und begriff anfangs keiner. Zuerst war er in M*** auf dem Gymnasium gewesen; dann hatte sie ihn zu Altdorf und Helmstedt studieren lassen, als wär er weiß Gott welcher vornehme Junker gewesen, und nachdem er nun zurückgekommen, sollte er, wie es hieß, noch nach Harderwyk gehen, um sich dort zum Doktor beider Rechte machen zu lassen, was doch, wie der Pfarrer sagte, nur für hundert holländische Dukaten zu haben war. Er war übrigens ein stiller und sanfter, aber etwas grillenhafter Mensch, den jeder lieb hatte, obwohl man selten eigentlich verstand, was er sagen wollte, wenn er sprach; er sah alles mit andern Augen an als andre Leute, und es hätte keinen gewundert, wenn Bernhard Fahrstein – er hatte den Namen mitbekommen in Ermangelung eines andern – behauptet hätte, der aufgehängte Buntekuh sei ein braver Mensch gewesen und er selbst sei ein Galgenstrick. Er hatte ein etwas blasses Gesicht, das zart und fein geschnitten war, und sehr weiche Züge. Weil er so zart gebaut war, schien er auch nicht groß; doch war er über mittlere Größe. Sein Auge war so blau und treu wie das einer zahmen Taube, sein ganzes Wesen aber jungfräulich und sanft; ich glaube, er war so unschuldig wie ein neugeborenes Kind.
Fünftes Kapitel
Der Grundzug im Charakter Bernhards war ein sinniges, tiefes Gemüt, das still und ohne äußern Prunk wie eine zarte, rotblühende Erika auf den Heiden Westfalens erwachsen. Seine rätselhafte Abstammung, deren Geheimnis die Mutter nicht lüften wollte, diese still und wechsellos dahinfließende Kindheit – die Mauern eines alten verfallenen Ritterschlosses, dem nur der dunkle Wald drüben seine Grüße zurauschte, an dessen Toren nur der kalte Nordwest, wie ein durchfrorener Pilger, um Einlaß pochte, den ihm die klappernden Bohlen nicht verwehrten; – die wunderlichen Bilder, welche die abergläubische und abenteuerliche Gestalt der Römischen Marget in einer empfänglichen Phantasie wecken mußte; die Erziehung, die eine solche Frau nur geben konnte, alles das hatte seinem Gemüt eine ganz eigentümliche Richtung erteilt. Wer zweifelt, daß die fessellosen Aussprudelungen desselben originell, tief wehmütig und voll echter Poesie gewesen, wenn sie auch formlos waren? – Sie waren voll der Poesie, die auf der Heide wächst, die mit schlichten, gelben Ginsterblüten sich begnügen muß, voll Muttersorge über das Nest der Lerche sich beugt und das Rieseln und Pfeifen des Windes in den Aesten einer einsamen Föhre belauscht; die aber, wenn sie ihren Aufschwung nehmen will, gleich zum blauen Himmel hinauf muß, weil die Heide keine andern Höhen hat.
Als Bernhard größer geworden und von den Schulen zurückgekommen war, begann sein Leben reicher an Ereignissen zu werden, als seine Kindheit gewesen. In der Nähe von Bechenburg war ein adliges, freiweltliches Damenstift, zu dem er häufig von seiner Mutter gern gesehene Ausflüge machte. Wir wollen ihn auf einem derselben begleiten.
Es war ein heißer Nachmittag am Tage nach Herrn von Drieschs Ankunft auf seinem Gute. Als Bernhard aus dem Forste trat, der nach zwei Seiten hin das Gut umgibt, flimmerte die Luft wie lauter Silberfäden über den Pflanzen der Heide. Sie lag wie ein großes braunes Tuch ausgespannt vor ihm, von den Blüten der Immortelle hier und da rötlich überhaucht; dazwischen hielt eine Orchis den stämmigen Stengel mit der Blütenperücke dem Luftzuge entgegen oder ließ die Gentiane ihre tiefblauen Glocken im Winde spielen. Den Horizont besäumten blaue Waldungen; aus näheren Baumgruppen lauschten einzelne Strohdächer hervor, hier und dort auch mehrere zusammen, von denen das größte dann zum Teil mit Ziegeln gedeckt war, ein ansehnlicheres Gehöft. Auf der Mitte des Weges stand eine alte Buche mit einem Marienbild am Stamme und darunter eine Steinbank. Bernhard rastete dort, denn es knüpften sich liebe Erinnerungen für ihn an diese moosige Steinplatte; er überblickte seinen Pfad, den er so oft jetzt, trotz Regen und Wetter, trotz prellender Sonnenstrahlen zurückgelegt hatte; er kannte jeden Stein, jeden Baumstumpf am Wege, und jedes Ding hatte ein besonderes Auge, mit dem es ihn ansah; vor allen das Muttergottesbild, das nicht schlecht gehauen, wenn auch etwas verwittert war und ihm mit den Zweigen, die es oben schützten, zu sprechen schien. Als Knabe hatte er es oft genug mit dem Kopfe nicken gesehen, vorzüglich in der Dämmerung; und wenn er fortgegangen, winkten ihn die Zweige zurück.
Er schritt weiter, immer über die Heide fort; als er fast eine Stunde zurückgelegt, kamen Wiesengründe mit Erlengebüsch, dahinter eine Mühle an einem von Schwertlilien umgebenen Weiher, auf dem Enten in der grünen Wasserlinsendecke schnatterten und lange Fäden aus dem Grunde zogen. Am Ufer stand ein zwölfjähriges Mädchen mit hochblondem Lockenhaar und wasserblauen Augen, das einen zierlichen Knicks machte und dem jungen Herrn eine Kußhand gab; sie war nett gekleidet, ein Drahthäubchen mit Bandschleifen, ein weißes Fürtuch – sie sah nicht aus wie ein Bauernmädchen, sondern wie eine Kammerzofe in Miniatur.
»Wie heißt du, Kleine?« fragte Bernhard.
»Müllers Veronika«, antwortete sie ohne Anstand.
»So, Veronika? Dann ist wohl die gnädige Frau Aebtissin deine Pate?«
»Ja, Onkel, sie hat mir noch heute etwas geschenkt.« Die Kleine zeigte ein auf Pergament gemaltes Bildchen mit einem Rand, der künstlich durchbrochen war, wie die sauberste Filigranarbeit. Man sah, die Kleine war gewohnt, von vorüberwandelnden Fremden angeredet zu werden und zugleich zu einem jüngferlich sittigen Betragen angehalten worden.
Bernhard hatte die Immunitas sancti Cyriaci oder die Abteifreiheit betreten, wie eine am Wege stehende Steinsäule zeigte; nun kam ein langer, hölzerner Steg, der wie eine Brücke über sumpfige Wiesengründe führte. Die ganze Fläche unten war blau von Vergißmeinnicht; an den tieferen Stellen standen kleine Wasserflächen, in denen gelbe Nymphäen sich auf ihrem breiten glänzenden Blatte schaukelten, wie eine Orange auf ihrem Fruchtteller. Geißblatt und weiße Winden überrankten das Weidengebüsch, das sich hier und dort an den Steg drängte und wie müde Arme seine Aeste auf das Geländer gelegt hatte: es war ein Spaziergang, wie ein Stiftsfräulein mit Trillers Gedichten in der Hand ihn nur wünschen konnte. Der Steg endete an dem Gehölze, das unmittelbar die Abtei umgab; ein recht gut gehaltener Forst, in dem sich an vielen Bäumen saubere Täfelchen mit Nummern zeigten, als Beweis, daß die Aebtissen ihren Förster hielt, der ein sehr ordentlicher Mann war und unter tausend unnützen Umständlichkeiten – Kapuzinerarbeit nennt man's bei uns – seinen Mangel an eigentlicher Arbeit zu verbergen suchte. Hier und dort waren Alleen angelegt und Points de vue ausgeschlagen; in alle Bäume am Wege waren Namenszüge und brennende Herzen eingeschnitten, auch Verse an Phyllis oder Chimene in Ueberfluß, wo sich irgendeine glatte Rinde zeigte. Auf einer Rasenbank in einer der Alleen saß eine Stiftsdame, ein Buch, in dem der Wind blätterte, in der Hand. Sie stand auf und entfloh bei der Annäherung des jungen Mannes in das Gebüsch wie eine scheue Hinde; doch sah Bernhard bald nachher, wie sie in einem Seitenwege, der parallel mit dem seinen lief, gleichen Schritt mit ihm hielt und zuweilen durch die Lücken des Unterholzes verstohlene Seitenblicke nach ihm aussandte. Wo die Wege zusammentrafen, war sie verschwunden.
Vor dem Tore begegneten ihm drei Zofen, die Arme umeinander schlagend, wie drei Grazien, mit feinen Drahthäubchen und glänzend weißen Schürzen, deren Bruststück nonnenhaft bis an die Schultern hinaufging, daß sich das gekrönte Herzchen von Goldfiligran mit den blutroten Tiroler Granaten in der Mitte desto glänzender abhob. Bernhard zog artig sein Käppchen vor ihnen; sie gingen knicksend und mit niedergeschlagenen Augen an ihm vorüber, aber drei Schritte weit hinter seinem Rücken hörte er sie lebhaft flüstern und kichern.
Der Hof war groß und von den Häusern der Stiftsdamen umschlossen, von denen immer eines von dem andern durch den Garten, der es umgab, getrennt war. Die Kurien waren ansehnlich, jede mit einer hohen Treppe und ihrem Wappen über der Eingangstür. Nur die Abtei hatte auch einen Balkon und bekam dadurch den vornehmern Charakter; auch stand eine ausgespannte, schwerfällige Karosse davor, und ein Knecht war beschäftigt, das Leder einer Sänfte abzuseifen. Hinter ihr sah man die drei spitzen Türme und die Giebel der Abteikirche sich emporheben. Das Ganze bot ein stilles Bild: das Klappern von Flachsbrechen, das aus den Oekonomiegebäuden scholl, und einige Pfauen, die auf dem Hofe gellend das Wetter anschrien, machten den einzigen Lärm darin, wenn man die Kanarienvögel nicht rechnet, denn an jedem Fenster hingen mindestens drei Käfige voll dieser gelben Musikanten.
Bernhard öffnete ein Gitter vor einer der Kurien, die rechts nahe bei der Abtei lag, und schritt über den gelben Sand des Blumengartens, an verblühten Aurikelbeeten her, durch zwei lange Reihen von Blumenscherben mit herrlichen, farbenglühenden Nelken, bis er auf der obersten Treppenstufe stand. Die Tür wurde von einer Magd geöffnet, die ganz ihre Bauerntracht beibehalten hatte, dieselbe, die auch der alten Margret so gut stand, eine seidene Nebelkappe mit silberner Tresse, ein Tuchrock mit schweren Falten, an den Aermeln offen, die Jacke von demselben Stoff und ein schweres Silberkreuz an einem Samtbande auf der Brust.
»Ist das gnädige Fräulein zu Hause? Guten Tag, Anne- Marie, wie geht's?« sagte Bernhard, durch die halbgeöffnete Tür schlüpfend.
»Ach, junger Herr, ja wohl, gewiß wohl, sie hat schon zweimal gefragt, ob Ihr noch nicht da wäret. So, hier nur herein, ich will sie gleich rufen.« Bernhard pochte das Herz, als er das Empfangszimmer, den sogenannten Saal betrat, den Anne-Marie aufschloß. Weshalb? wußte er selbst nicht; er sah sie ja zweimal in jeder Woche, seine Gönnerin, und stolz war sie auch nicht, sondern die Freundlichkeit selber; aber er war beklommen, als er wieder in dem bekannten Räume wartete und, ohne zu schauen, seine Blicke auf den ernsten Herrn im blauen Fürstenmantel heftete, der über dem Kamine hing und auf die Domtürme von M. wies, die man hinter einem zurückgeschlagenen Vorhang im Hintergrunde des lebensgroßen Gemäldes erblickte. Es war der letzte Fürstbischof, der Oheim der Stiftsdame, die Bernhard erwartete. Sonst war das Zimmer einfach; weiße Wände, an der Decke das Gebälke sichtbar, aber mit Stukkaturarbeit bedeckt, Kanapee und Stühle von rotem Plüsch mit gelben Nägeln beschlagen; auf der Kommode Porzellanfiguren, ein Topf mit Potpourri in der Mitte und eine bronzene Uhr, an die sich ein flötender Schläfer lehnte mit einem Geschöpf zu seinen Füßen, das ebensogut Fidel, das treue Tier, als ein Lamm sein konnte – das und noch zwei Konsolen zu beiden Seiten des Kanapees mit großen blauen Vasen aus chinesischem Porzellan machten das Ameublement aus, alles in dem hübsehen und phantasiereichen Geschmack, der nicht allein das Bedürfnis befriedigt sehen will durch eckige, schneidende Linien, wie wir sie vorziehen, sondern auch geschweifte Schönheitslinien, Schnitzarbeiten und Schnörkel verlangt, zum Zeichen, daß ein übriges vorhanden, das zugunsten der Zierlichkeit verwendet werden mag.
Das Stiftsfräulein trat herein. Sie begrüßte ihn mit einem sehr feierlichen Knicks und einem freundlich-ernsten: »Guten Tag, wie geht es Ihnen, Herr Doktor?« – so hieß in den guten alten Zeiten jeder, der von der Universität heimkam – und setzte sich dann. Anne-Marie stand an der Tür, um auf ihre Befehle zu warten, als diese gegeben waren, ging die Alte und brachte gleich darauf eine Flasche Landwein mit einer Zuckerdose und einem Teller voll geschälter Mandelkerne und Traubenrosinen herein; ein andrer voll duftiger blauer Pflaumen, von der eignen Hand des Fräuleins für ihren Gast gepflückt, stand schon auf dem Tische. Sobald Anne-Marie aus der Tür war, stand die Dame wieder auf, ergriff mit ihren spottkleinen weißen Händen die beiden Bernhards und sagte: »Wie geht's meinem Jungen?« mit einem viel weicheren Tone, als ihre erste Begrüßungsformel trug. Bernhard sah sie mit einer schweigenden Innigkeit an und es konnte nun nur ein innerliches Seelenergötzen verursachen, ein Paar dieser treuen blauen Augen so in das andre blicken zu sehen, als ob es darin die Seele wiedersuche, die aus dem eignen hinüberschlüpfe.
Habt ihr wohl je eine Stiftsdame gesehen? ich meine eine rechte ordentliche Stiftsdame, die von einer jetzigen gerade so verschieden ist, wie ein jetziger Johanniter-Ordensritter von den panzerklirrenden Söhnen des heiligen Johannes von Jerusalem, damals, als sie noch den weißbekreuzten Mantel trugen und ihrer zwei auf einem Pferde saßen. Nein, eine solche Stiftsdame habt ihr noch nicht gesehen, ihr seid zu jung dazu, ihr seid sogar jung und eure Gedanken sind Wickelkinder; wenn sie schon im Jahre 1830 ein Schattenspiel angeschrien haben, so ist es viel, sehr viel.
Ich muß euch die Stiftsdame beschreiben. Sie trug ein weißes faltiges Kleid, das die volle, schöne Büste bis an den Hals hoch hinauf umschloß und von der schlanken Taille bis über den Fuß niederhing; es war schade für den Fuß. Die Aermel waren an den Ellbogen offen und mit langen herabhängenden Spitzen-Engageanten geziert; auch die Schürze hatte einen breiten Spitzenbesatz. Das Haar war zum Teil von dem Wimpel bedeckt, was wieder schade war für das goldne, fabelhaft reiche und seidenweiche Haar. Der Wimpel ist ein weißes gefälteltes Tuch von sehr dünnem, Linon genanntem Zeuge, das, um das Kinn gelegt, auf dem Scheitel zusammengenestelt wird und dann seine zwei Enden lang auf den Rücken hinabhängen läßt. Am Nacken, mitten zwischen den Schultern, war ein schmales Stück schwarzen faltigen Zeuges befestigt, das bis auf den Boden hinabflatterte, ganz wie ein Domherrnmantel.
Das Stiftsfräulein – sie hieß Katharina und war eine geborne Reichsfreiin von Plassenstein – war eine große, volle und blühende Gestalt. Das Gesicht war ein regelmäßiges Oval, die Stirne hoch und schön geschwungen, das große blaue Auge hatte etwas Träumerisches; wenn sie die langen Lider schloß, konnte man deutlich darunter die Bewegungen sehen, die der Apfel machte. Die Nase war lang und fein geschnitten, und der Mund klein; die ganze Partie umher hatte einen weichen kindlichen Charakter behalten. So nannte jeder das Fräulein von Plassenstein schön; freilich, man hätte manches gegen die unbeschränkte Anwendung dieses Beiworts auf ihre Züge einwerfen können, zum Beispiel, daß die Röte der Gesundheit nicht auf ihre Wangen sich beschränkte, ferner, daß die Nase, ganz scharf betrachtet, eine geringe Abweichung von der geraden Linie zeige, wie das gewöhnlich bei klugen Leuten der Fall ist. Aber, wer hätte das bei einem Gesichte, wie das ihrige, bemerkt? Es verschwand unter dem Eindrucke, den das Ganze machte, und dieser Eindruck war im höchsten Grade anziehend. Das Alter der Frauen ist zwar ein Geheimnis, außer bei den armen Prinzessinnen, die im Staatskalender stehen; aber man konnte es bei ihr doch ungefähr bestimmen. Sie hatte vor zwei Jahren ihre eigne Kurie bekommen; das geschah, wenn die Stiftsdamen fünfundzwanzig Jahre zählten; so lange mußten sie als Residenzfräulein bei einer ältern Chanoinesse wohnen: also war sie mindestens siebenundzwanzig Jahre alt. Aber Menschen mit umfassendem Geiste, wie der Katharinens war, sind jung und alt zu gleicher Zeit; sie haben alle inneren Schätze und Gefühle des Kindes, seine lebhaften Empfindungen und seine Lust an allen kräftig gefärbten Erscheinungen sich gerettet und zugleich durch Intuition alle Erfahrungen des Alters vorweggenommen. Sie umfassen auf einem Standpunkte das ganze Leben. Das ist das Geheimnis des Genies.