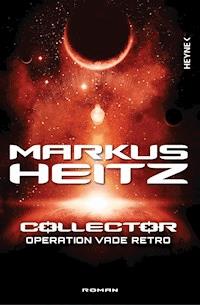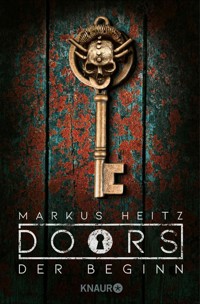6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Meisterhafte Dark Fantasy von SPIEGEL-Bestseller-Autor Markus Heitz: Historisches trifft Phantastisches - und belebt eine alte Legende neu! Eine Söldnerin, finstere Mächte und Magie... 1629. Der 30 Jährige Krieg mit seinen Konflikten erschüttert Europa und tobt besonders gnadenlos in Deutschland. Die junge Abenteurerin Aenlin Kane reist in die neutrale Stadt Hamburg, um das Erbe ihres berühmten Vaters Solomon Kane zu ergründen. Zusammen mit ihrer Freundin Tahmina, einer persischen Mystikerin, gerät sie in die Wirren des Krieges. Sie nehmen einen folgenschweren Auftrag der West-Indischen Compagnie an: Eine zusammengewürfelte Truppe soll sich durch die Linien nach Süddeutschland durchschlagen, bis nach Bamberg, wo grausamste Hexenprozesse die Scheiterhaufen brennen lassen - doch es kommt vieles anders. Zu viel für einen Zufall! Aenlin und Tahmina wissen um das Böse und die Dämonen, die sich auf der Erde tummeln und die Wirren des Krieges zu ihrem Vorteil nutzen. Schon bald geht es um mehr als einen Auftrag der Compagnie. Und der Anführer der Truppe, Nicolas, hat ein düsteres Geheimnis … "Die dunklen Lande" spielt in einer der prägendsten, düstersten Zeiten des heutigen Deutschlands und vermischt Wahres mit Erfundenem. »Fein austarierte Mischung raffinierter Horrorelemente, historischer Verweise und rasanter Actionszenen.« Kölner Stadt-Anzeiger über »Des Teufels Gebetbuch«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Markus Heitz
Die dunklen Lande
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1629. Der 30 Jährige Krieg mit seinen Konflikten erschüttert Europa und tobt besonders gnadenlos in Deutschland.
Die junge Abenteurerin Aenlin Kane reist in die neutrale Stadt Hamburg, um das Erbe ihres berühmten Vaters Solomon Kane zu ergründen. Zusammen mit ihrer Freundin Tahmina, einer persischen Mystikerin, gerät sie in die Wirren des Krieges. Sie nehmen einen folgenschweren Auftrag der West-Indischen Compagnie an: Eine zusammengewürfelte Truppe soll sich durch die Linien nach Süddeutschland durchschlagen, bis nach Bamberg, wo grausamste Hexenprozesse die Scheiterhaufen brennen lassen – doch es kommt vieles anders. Zu viel für einen Zufall!
Aenlin und Tahmina wissen um das Böse und die Dämonen, die sich auf der Erde tummeln und die Wirren des Krieges zu ihrem Vorteil nutzen. Schon bald geht es um mehr als einen Auftrag der Compagnie.
Und der Anführer der Truppe, Nicolas, hat ein düsteres Geheimnis …
Inhaltsübersicht
Dramatis personae
Glossar
Karte
Zur Lektüre des Romans: Das reale Szenario 1629
EXORDIUM
Capitulum I
Capitulum II
Capitulum III
Capitulum IV
Capitulum V
Capitulum VI
Capitulum VII
Capitulum VIII
Capitulum IX
Capitulum X
Capitulum XI
Capitulum XII
Capitulum XIII
Capitulum XIV
Capitulum XV
Capitulum XVI
Capitulum XVII
Capitulum XVIII
Capitulum XIX
CONCLUSIO
Nachwort
Bildteil
Blind Guardian in Die dunklen Lande
Die Rückkehr der Zwerge 1
Die Rückkehr der Zwerge 2
Dramatis personae
Aenlin Salomé Kane: Abenteurerin, Solomon Kanes Tochter
Tahmina: Mystikerin, Aenlins Freundin
Caspar von und zu dem Dorffe: Duellist und Abenteurer
Nicolas: Landsknecht und Hauptmann
Jakob, genannt Jäcklein: Landsknecht
Statius, genannt Stats: Landsknecht
Moritz Mühler: Landsknecht und »Gefrorener«
Joß von Cramm: freier Söldnerwerber
Osanna: Schankmaid
Barthel Hofmeister: Landsknecht und Hauptmann
Valentin: Landsknecht
Der Venezianer: Pestarzt
Henry Rich: Erster Earl of Holland und Baron von Kensington
Melchior Pieck, genannt Brack: Kopfgeldjäger, Söldner, Spion, Auftragsmörder
Claas de Hertoghe und Hans II. de Hertoghe: niederländische Geschäftsmänner der West-Indischen Compagnie
Kettler: Banquier der Hamburger Bank
Großfürst Mihail Alexandrowitsch Fjodorow: Diplomat des Zaren
Agatha Mühlbach, genannt Gatchen: Einwohnerin Bambergs
Veronica Stadler, genannt Nica: Einwohnerin Bambergs
Ursula Garnhuber, genannt Ula: Einwohnerin Bambergs
Martin Huber: Wirt
Franz: Gasthausbursche
Pater Hubertus: Jesuit
Sebastian: Wachmann
Sophia: Hexe
Anna: Hexe
Meister Schneider: Mühlhausener Ratsmann
Katharina und Peter: Müller-Ehepaar
David: Müllerssohn
Maria: Dorfbewohnerin
Christian Schwarz: Einwohner Magdeburgs
Karl Schulzenmüller: Einwohner Magdeburgs
Tännel: Riese
Valna: Nixe
Glossar
Daeva: Unholde
Djinn: übersinnliches Wesen, kann gut und böse sein
Fougasse: Erdlochmine, über eine Schnur aus der Ferne zündbar
Hagzussa: alter Begriff für Hexe
Niederländische Westindien-Kompanie, Geoctroyeerde West-Indische Compagnie: Handelsunternehmen
Ōrmozd: Schöpfergott der Zharathustrier
Passauer Kunst: auf magische Weise gegen Schüsse und Stiche immun machen, auch »gefroren machen« genannt
Tercio: Kampfformation auf dem Schlachtfeld
Xolotl: Gottheit oder Ungeheuer
Yatu: altpersisch für Magie, Zauber, Hexerei, Hexenkunst
Karte
Diese Landkarte finden Sie auch im Internet unter folgendem Link: https://rebrand.ly/droem-51908
Zur Lektüre des Romans: Das reale Szenario 1629
Keine Sorge, es ist und bleibt ein fantastischer Roman. Zum besseren Verständnis jedoch ein kleiner Überblick über die historische Kulisse im siebzehnten Jahrhundert.
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war kein eigener Staat, sondern ein Zusammenschluss aus dreihundert Reichsstädten, Grafschaften und Fürstentümern – von riesigen Kurfürstentümern bis hin zu winzigen Territorien mit ein paar Gehöften, die von Reichsrittern verwaltet wurden.
Der Kaiser war kein Alleinherrscher, sondern wurde von den sieben Kurfürsten gewählt: drei geistliche, vier weltliche, mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Der regierende und erzkatholische Kaiser, Ferdinand II., musste zudem mit dem Reichstag zusammenarbeiten, in dem Adlige, Geistliche und Stadtbürgertum Sitz und Stimme hatten. Auch unter diesen gab es verschiedene Konfessionen, die Spannungen wuchsen.
So kam es, dass manche katholischen Fürsten, Länder, Städte sich zur »Liga« zusammenschlossen, die protestantische Seite hingegen zur »Union«, andere wieder erklärten sich für unabhängig und neutral. Sowohl katholische Liga als auch protestantische Union hoben Soldaten aus, um sich vor Überfällen der jeweils anderen Seite zu schützen. Mit wechselndem Erfolg für beide.
Ausländische Mächte wie Niederländer, Dänen, Schweden, Engländer und Franzosen griffen in die Konflikte auf deutschem Boden ein oder hatten gar durch Lehensverhältnisse ein Mitbestimmungsrecht.
Was mit dem bekannten Prager Fenstersturz 1618 begann und mit dem Westfälischen Frieden 1648 endetete, ist als Dreißigjähriger Krieg in die Geschichtsbücher eingegangen. Tatsächlich handelte es sich nicht um einen langen Krieg, sondern um viele, aufeinander aufbauende Auseinandersetzungen mit wechselnden Verbündeten und Gegnern.
Bis zum Beginn des Romans sind bereits der Böhmisch-Pfälzische Krieg (1618–1623) sowie der Niedersächsisch-Dänische Krieg (1625–1629) geschehen oder im Begriff zu enden.
Das Heilige Römische Reich befand sich im Zustand permanenter Unruhe, ausgelöst durch konfessionellen Streit, befeuert durch die Machtgier der Mächtigen und Kriegslust der Söldnerführer, die gutes Geld verdienten.
Für ein tiefergehendes Wissen sei das Selbststudium empfohlen – und etwas Geduld, um das Wirrwarr an Konflikten zu lösen.
Nun aber Bühne frei für Abenteurer, Intrigen und … Magie!
»Better to reign in Hell, than serve in Heav’n.«
– Lieber in der Hölle regieren, als im Himmel dienen. –
aus: Paradise Lost (1667)
von John Milton
EXORDIUM
Vergeben Sie den Lärm und den Dreck. Aber wenn man es gemütlich haben will, muss es manchmal erst ungemütlich werden.«
Beim Klang der Stimme, die durch den hohen, vertäfelten Raum hallte, wandte sich Melchior Pieck zum Eingang um, durch den er vor einer halben Stunde geführt worden war. Sein Gastgeber hatte ihn warten lassen. Pünktlichkeit war etwas für Könige, nicht für Lords.
»Ich habe es nicht bemerkt, Eure Lordschaft.« Auch wenn er aus Hannover stammte, sprach Melchior das Englisch nur leidlich. »Eure Dienerschaft weiß den Staub selbst in den hintersten Winkeln zu finden und auszumerzen.«
»So wie Sie Ihre Beute finden, nicht wahr? Sei sie Mensch oder Tier.« Henry Rich, der Erste Earl of Holland und Baron von Kensington, betrat das riesige Zimmer.
An der Stuckdecke prangten verschiedene Szenen, die im Wettstreit mit den Bildern an der Wand standen. Gegen die dunklen Farben kämpften etliche Petroleumlampen und Kerzen an, das sterbende Abendlicht, das durch die torgleichen Fenster fiel, genügte nicht.
»Deswegen sind Sie hier, bester Pieck.« Die lange, taillierte Brokatjacke reichte über die Hüften, die gepufften Ärmel und Hosenbeine verliehen dem schlanken Mann mehr Fülle. Das Haar lag in Locken, in seinem Gesicht stand ein modischer Schnurr- sowie ein Kinnbart. »Man brachte Ihnen nichts zu trinken?«
Melchior, knapp über fünfzig, mit gestutztem grausilbernem Bart und kurzen Haaren, deutete eine Verbeugung an, die trotz seiner Beleibtheit fließend ausfiel. »Ich lehnte ab, Eure Lordschaft. Meine Kehle ist Euren feinen Wein nicht gewohnt.« In seinem bewusst einfach gehaltenen Gewand und den speckigen Lederstiefeln wirkte er wie das komplette Gegenteil zum Earl.
»Nicht zu bescheiden. Ich weiß, dass Sie ein Mann mit Wohlstand und Geschmack sind. Wer zu Graf Mansfelds Lieblingen gehörte, verdiente doch gut.« Rich deutete auf die beiden Sessel neben dem prasselnden Kamin. »Setzen Sie sich. Ich sehe, meine Botin hat Sie wohlbehalten zu mir gebracht.«
»Danke, Eure Lordschaft. Eine liebreizende Dame, in der Tat. Und die Kutsche war komfortabel.« Melchior nahm Platz und sortierte sein Waffengehänge, an dem ein breiter Säbel baumelte, die Radschlosspistole steckte in einem Futteral vor der Brust. »Ihr kanntet den Grafen?«
»Nein. Es genügte mir, von ihm und seinen Schlachten zu hören. Exzellenter Söldnerführer, kämpfte zuletzt bei Breda für die englische Krone. Aber nach Dessau und gegen Wallenstein ging’s bergab.«
»Der Schein trog«, erwiderte Melchior kühl. Er hatte es nicht nötig, sich angreifen und herabsetzen zu lassen. Innerlich addierte er fünfzig Gulden zum Preis. »Der Graf ersann einen neuen Plan.«
»Tat er das? Zu schade, dass ihn die Osmanen vergifteten. War er nicht just im Begriff, mit Ihnen nach Venedig zu reisen und neue Gelder für ein frisches Heer zu beschaffen?«
»Ich sah keine Türken in der Nähe, als er uns, Blut und Lungenstückchen hustend, sein Testament diktierte. Es war ein Blutsturz, Eure Lordschaft.«
»Wie bedauerlich. Weniger heroisch.«
»Wenn Eure Lordschaft wollen, dürft Ihr Euch vorstellen, dass ein Osmane dahintersteckte. Ich für meinen Teil bleibe bei einer Krankheit.« Melchior sah sich um. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit gefiel ihm nicht. Erinnerungen, die schmerzten wie die Narben an seinem Leib und im Gesicht. Er hatte seinen Anführer sehr gemocht und viel von ihm gelernt. »Eure Lordschaft haben einiges mit dem Holland House vor?«
»Oh, ja, gewiss! Dieser Ziegelbau ist mir zu unprätentiös. Die Zierereien aus Stuck und Stein reichen bei Weitem nicht aus für einen Mann meines Standes«, gestand Rich. »Nachdem meine Gemahlin das Gebäude erbte, habe ich sofort die Erweiterung um Seitenflügel und Arkaden angeordnet. Und dorische Säulen werden sich auch noch gut machen. Am Eingang. Was meinen Sie, Pieck?«
»Werden sie, Eure Lordschaft.«
Der Earl wies mit einem Wink die wartenden Diener an, Kleinigkeiten zu essen und zu trinken auf dem Tisch zwischen ihnen abzustellen, und sandte sie wieder hinaus.
Rich, mit seinen vierzig Lenzen zehn Jahre jünger als Melchior, lächelte verschlagen. Es sollte demnach wohl geschäftlich werden. »Nachdem Graf von Mansfeld tot war, machten Sie sich in den letzten drei Jahren einen hübschen Namen als …«
»Ich bevorzuge das Wort Entrepreneur.«
»Nun, und ich bevorzuge es, Dinge beim Namen zu nennen.« Rich lehnte sich nach vorne. »Kopfgeldjäger. Söldner. Spion. Auftragsmörder. Intrigant.« Er nahm den Pokal mit Portwein und schlürfte laut. »Vergaß ich etwas, guter Pieck?«
»Mein Angebot als Entrepreneur ist umfangreich. So werden Eure Lordschaft Gebrauch davon machen wollen?« Melchior ergriff den Port und leerte ihn mit einem großen Schluck. »Eure Lordschaft hatten recht.« Er stellte den weniger aufwendig verzierten Becher zurück auf die Platte. »Euer Port ist nicht zu gut für mich.«
»Touché.« Rich lachte leise. »Ein Kerl nach meinem Geschmack.« Er langte unter den Tisch, zog eine Mappe heraus und reichte sie herüber. »Ihr Auftrag, Pieck.«
Melchior öffnete sie neugierig. Zum Vorschein kam die Bleistiftzeichnung einer jungen Frau von Mitte zwanzig, mal im Profil, mal von vorne. Sie trug lange schwarze Haare mit einer fingerbreiten nachtschwarzen Strähne, die das Licht absorbierte, wie der Zeichner als Notiz hinzugefügt hatte; zusammengehalten wurden sie von einem weißen Samtband. Die linke Augenbraue wies einen bemerkenswerten hellen Strich auf. Eine Narbe? Auf dem Kopf führte die Lady in der Seitenansicht einen weißen Hut mit schwarzem Band und großer Krempe, die rechts in die Höhe geklappt war.
»Hübsch. Ein wenig … dünn im Gesicht«, kommentierte Melchior, um nicht hager zu sagen. Die Züge kannte er vage, wusste aber nicht, woher. Unter der Zeichnung prangte das persönliche Wappen der Frau sowie ihr Name. Neben zwei gekreuzten brennenden Fackeln mit Rapier und Pistolen stand: Aenlin Salomé Kane.
»Das hat sie von ihrem Vater.« Rich tippte mit dem Finger auf das Wappen. »Sie versteht es, mit Rapier und Linkshanddolch umzugehen. Dazu führt sie zwei verborgene Stilette mit sich. Zudem ist sie eine sehr gute Schützin. Sagt man.«
»Kane?« Melchiors Augen wurden zu Schlitzen. Der Name ermöglichte ihm, das Antlitz zuzuordnen. Er hatte es gezeichnet in vielen Büchern gesehen. »Ist es … Ist das etwa die Tochter von Solomon Kane, Eure Lordschaft? Dem Solomon Kane?«
»Spielt das eine Rolle, Pieck?«
Für den Preis auf alle Fälle, dachte er und betrachtete die Züge. »Ich wusste nicht, dass dieser legendäre Mann Nachfahren hat.«
»Sagen wir, seine Geliebte Bess wartete vergebens auf seine Rückkehr, um ihm das Wunder zu zeigen, das er ihr hinterließ«, antwortete Rich mit Süffisanz. »Nach ihrem Tod hielt er es nicht für nötig, Nachforschungen anzustellen.« Er goss sich neuen Port ein. »Die junge Aenlin machte eine bemerkenswerte Karriere als Haudegin, wie man sich zuflüstert. Deswegen warnte ich Sie vor ihren Waffen. Lassen Sie sich von der Jugendlichkeit nicht täuschen. Sie sticht angeblich präzise.«
Melchior kannte die Erzählungen von Solomon Kane, dem puritanischen Abenteurer, der in Europa und Afrika die wildesten Abenteuer erlebt und gegen das Böse gekämpft hatte. Schauergeschichten, so dachten die meisten.
Aber Melchior war im Kampf, auf den Schlachtfeldern, in verwüsteten Gegenden und verzweifelten Ortschaften gewesen und wusste, was die Dunkelheit gebar, wenn man sie ließ. Oder sie gerufen wurde. »Und was erwarten Eure Lordschaft von mir, dass ich tue?«
»Sie, guter Pieck, werden Aenlin Kane nach Hamburg folgen und sie dort beschatten. Es darf ihr nichts geschehen. Sie müssen sie beschützen, ganz egal, wie Sie es anstellen und was dazu nötig ist, ohne dass sie von Ihnen etwas erfährt.« Rich nahm einen Schluck.
»Dann sind Eure Lordschaft ihr Gönner?«
»Bis zu einem gewissen Moment, ja.«
»Wann ist der, Eure Lordschaft?«
»Sobald Aenlin Kane die Stadt wieder verlässt.« Rich betrachtete versonnen das Bild zu seiner Rechten, das ihn bei einer Jagdszene zeigte. »Dann werden Sie die Frau umbringen.«
Melchior hob die ergrauten Augenbrauen und goss sich ebenfalls Port nach, den er erneut in einem Zug in sich hineinschüttete. »Möchten Sie mir dies erläutern?«
»Alles, was sie im Moment ihres Todes bei sich trägt und mit sich führt, jegliches Hab und Gut, das Aenlin Kane in Hamburg erwirbt, stecken Sie in eine Kiste und schaffen es nach London. An eine Adresse in den Docks, die ich Ihnen gebe, sobald wir einen Vertrag unterschrieben haben.«
Melchior nickte langsam. »Eure Lordschaft wollen etwas, was sie in Hamburg abholt. Aber sie holt es nur dann, wenn sie sich unbeobachtet wähnt.«
»Genau, Pieck.«
»Muss sie deswegen sterben, Eure Lordschaft?«
»Skrupel stehen einem Mann wie Ihnen nicht, Pieck. Freiwillig wird sie es nicht herausgeben. Außerdem möchte ich nicht, dass wir deswegen Scherereien bekommen. Die Angelegenheit ist delikat.«
»Wie die Affaire Eurer Lordschafts Mätresse mit dem Comte de Chalais?«, fügte Melchior unschuldig dreinblickend hinzu. »Ihn hat man für das Komplott gegen Richelieu hingerichtet, aber die Duchesse …«
»… weilt wieder in Paris. Die Verbannung ist aufgehoben. Der Duchesse de Chevreuse wurde verziehen«, sagte Rich barsch, und sein Gesicht lief rot an. Er gehörte in die Reihe Liebhaber der schönen Französin, und ihm als Ehemann schmeckte es gleich zweimal nicht, davon zu hören.
»Unterhalten Eure Lordschaft noch freundschaftliche Beziehungen zur Duchesse?« Melchior legte unauffällig eine Hand auf den Dolchgriff, der in der Doppelscheide neben dem Säbel steckte.
»Das ist für Ihren Auftrag nicht von Belang, Pieck. Maßen Sie sich nicht zu viel an.«
»Das Interesse ist rein geschäftlich. Mir steht der Sinn nicht nach Klatsch und Tratsch. Meinetwegen können Eure Lordschaft so viele Liaisons haben, wie Ihr wollt und stemmen könnt.« Melchior mochte den Port. »Sagt, war das Ende von Lord Buckingham im letzten Sommer nicht tragisch? Erdolcht von einem eigenen Mann!«
»Möge seine Seele in der Hölle schmoren! Buckingham kostete uns vor La Rochelle mehr als viertausend gute Männer. Ich hätte …« Rich ballte die Hand zur Faust. »Drehen Sie die Zeichnung um.«
Melchior grinste. Die Sticheleien gegen ihn und seine Söldnerei hatte er dem Lord zurückgegeben. Englands Krone hatte sich beim Kriegspielen auf zu viele Feinde eingelassen und zahlte dafür einen Preis.
Er wendete die Zeichnung. »Noch eine Frau? Oder eine Verkleidung?«
Sie war erkennbar jünger und zierlicher, die Haut mit winzigen Punkten gedunkelt, daneben hatte der Künstler brauner Teint vermerkt, auch die Augen wirkten dunkel. Die Kleidung war orientalischer Natur, wie Melchior sie bei den Frauen der Osmanen kannte, die in manchen Söldnerheeren dienten. In der Hand hielt sie einen geschnitzten Wanderstab.
»Eine persische Mystikerin namens Tahmina. Sie ist seit einiger Zeit die Begleiterin von Aenlin Kane. Angeblich hat Kane sie vor irgendwas gerettet, und seitdem folgt sie ihr.«
»Dann ist sie eine Hexe?«
»Sagen wir, dieses Kind steht in Verbindung mit exquisiten Mächten, die jemand näher erkunden möchte.« Rich deutete auf den versiegelten Umschlag in der Mappe. »Daher: Diesen Brief werden Sie Tahmina unbemerkt zustecken. Nach dem Tod von Kane.«
»Was tue ich, wenn sie Anspruch auf Kanes Erbe erhebt?«
»Bewusstlos schlagen. Nicht töten, Pieck.«
»Wie Eure Lordschaft wünschen.« Melchior betrachtete die Porträts im schnellen Wechsel. Gegen eine Hexe wollte er nicht antreten. Vielleicht hatte sie einen Schutzzauber über sich und das angehende Mordopfer geworfen. Ganz so einfach würde es womöglich nicht werden. »Ein ungewöhnliches Gespann.«
»Bald nur noch ein Pferdchen. Und Sie sorgen dafür.« Rich erholte sich sichtlich von seiner Erregung über die Niederlage bei La Rochelle und über Lord Buckingham. »Halten Sie das für machbar?«
»Gewiss, Eure Lordschaft.« Melchior hatte seinen Sold berechnet. »Das macht zweihundert Gulden im Monat. Oder zweihundert englische Silbertaler. Was Eure Lordschaft schneller zur Hand haben. Den ersten Monat im Voraus.«
Rich atmete lange und laut ein, die sorgsam gelegten Barthaare unter seiner Nase vibrierten.
»Es sind zwei Aufträge, Eure Lordschaft«, erläuterte Melchior, »und ich gehe dabei ein großes Wagnis ein. Diese Mystikerin kann mir tödlichen Ärger machen. Zudem muss ich anderen Dames und Seigneures absagen, die –«
Rich hob die Hand, die Finger nach oben ausgestreckt, um den Vortrag abzukürzen. »Einverstanden, Pieck. Die Hälfte jetzt, die andere später. Zu meiner Sicherheit.«
»Eure Lordschaft, vergebt mir, aber ich weiß, dass die englische Krone Geldsorgen hat. Dank der Kriegsbereitschaft Eures Königs«, beharrte Melchior. »Sind nicht schon Krongut und Juwelen verkauft sowie wertvolles Besteck eingeschmolzen worden? Und Eintreibung von Zwangsanleihen nicht zu vergessen. Hatte das Parlament nicht weitere Mittel bewilligt?«
»Meine Hochachtung. Für einen deutschen Söldner kennen Sie sich sehr gut aus.«
»Ich achte auf die Liquidität meiner Geschäftspartner. Wenn es Seiner Majestät in den Sinn käme, das Vermögen seiner Lords anzutasten, dann –«
»Seien Sie unbesorgt. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Charles erste Sondierungen mit den Franzosen und den Spaniern unterhält, um die kostspieligen Kriege zu beenden. Ich hörte, dass Rubens vielleicht nach London reisen wird, um für Madrid zu verhandeln.«
»Dennoch bleibt Charles ein König mit eiserner Krone, nicht mit goldener.« Melchior legte die Zeichnung der beiden Frauen zurück in die Mappe und schloss sie. »Eure Lordschaft können jemand Günstigeren als mich –«
»Nein, Pieck. Sie sollen Ihr Geld bekommen.« Rich nahm die Glocke und läutete nach den Bediensteten, die er den Sold holen schickte. »Unterzeichnen Sie den Vertrag. Die Münzen sind gleich bei uns.«
Melchior fand die Vereinbarung über einen Auftrag, dessen Details mündlich abgesprochen worden waren, trug den ausgemachten Lohn in die gelassene Lücke ein und signierte.
»Eines noch. Sollten Sie die Angelegenheit nicht zu Ende bringen«, sagte Rich derweil, »sollten Sie die Weiber warnen, sollten Sie nicht alles abliefern, was Kane in Hamburg an sich nimmt, Pieck, hetze ich Mörder auf Sie.«
»Ei der Daus!« Melchior überflog die Abmachung erneut, absichtlich übertrieben. »Wo steht das denn, Eure Lordschaft?«
»Das sind die mündlich vereinbarten Details.« Rich signierte und siegelte seine Ausfertigung, die er an Melchior gab. »Sie kennen die Klauseln nun. Sollten Sie länger als zwei Wochen zu tun haben, senden Sie mir Nachrichten. Verstanden, Pieck?«
»Sehr wohl, Eure Lordschaft.«
»Kennen Sie Hamburg?«
»Ich war ein- oder zweimal dort. Uneinnehmbar und voller Händler, Diplomaten und Agenten aller Nationen.« Melchior überlegte bei seiner Aufzählung, ob er seinen Sold zu niedrig angesetzt hatte. »Ich werde sie rasch finden, Eure Lordschaft, und verfahren, wie wir es besprochen haben.«
Rich notierte etwas auf ein Blatt, wedelte die Tinte trocken und faltete es klein, um es danach mit Siegelwachs zu verschließen. »Das ist die Adresse, wohin Sie das Hab und Gut von Aenlin Kane bringen. Erst öffnen, nachdem sie tot ist.«
»So mache ich es.« Melchior steckte das Papier ein, stopfte seine Vertragsausfertigung unter das Wams und bekam von Rich den schweren Sack mit den Silbertalern gereicht. Vor den Augen des Earls öffnete er ihn und zählte nach. »Zweihundert.«
»Sie vertrauen mir nicht?«
»Eure Lordschaft wären erstaunt, wie viele Münzen auf kurzer Strecke Beine bekommen.« Er sah zu den Dienern, die an den Türen standen und geradeaus gegen die Vertäfelungen stierten. Sie ließen sich nichts anmerken. »Dieses Mal nicht. Eure Bediensteten sind ehrlich.«
»Dann gute Jagd, Pieck. Jetzt raus mit Ihnen.« Rich erhob sich nicht aus dem Sessel, sondern wedelte ihn mit der Hand davon. »Bis bald. Hoffe ich.«
Melchior stand auf und verbeugte sich. »Eure Lordschaft.«
Ohne ein weiteres Wort ging er zur Tür, richtete dabei sein Wehrgehänge und nahm seinen Schlapphut mit den zwei geknickten grauen Federn von einem Diener entgegen. Außerdem reichten sie ihm seine große Tasche, die er mit einem Schloss gegen unbefugtes Öffnen gesichert hatte.
Melchior verließ das Holland House, das ausgereicht hätte, Dutzende Familien unterzubringen, ganz zu schweigen von dem gewaltigen parkähnlichen Land, auf dem man Jagden veranstalten konnte.
Vor dem Eingangstor stand die Kutsche. Man ließ ihn die Schritte bis zum Tor laufen. Noch eine kleine Spitze gegen ihn.
Melchior ging los und stieg bald darauf ein.
Wie von ihm gehofft, saß darin die Frau, die ihn aus dem Hafenviertel abgeholt hatte. Angelique, knapp dreißig Jahre alt. Aufgefallen waren ihm sofort die französischen Accessoires, die sie zum englischen Schnitt ihres Kleides trug.
»Guten Abend. Sie sorgen für meine Sicherheit, Mylady?« Den Sack mit dem Silber packte er in seine Tasche.
Sie neigte leicht den Kopf, die blonden Locken rutschten nach vorne und wippten im Schein der kleinen Lampe. »Das tue ich.« Sie pochte gegen den Kutschenhimmel, und der Einspänner setzte sich in Bewegung. »Der Earl möchte sichergehen, dass Sie sogleich an Bord der Ivy gehen. Sie verlässt London mit der Flut und bringt Sie nach Calais.«
Melchior freute sich. Damit stand seiner Abreise nichts im Wege. »Mein Gepäck ist schon verladen?«
»Selbstverständlich.« Sie lächelte. »Sie haben von –«
Melchior zog seinen gehärteten Dreikantsilberdolch aus der Hülle neben dem Säbel und stach ihn der Frau mitten in die Brust. Die Waffe, die im Feld als Panzerbrecher gegen Harnisch und Kürassier diente, ging spielend leicht durch dünne Haut und Knochen. Der Stich jagte ins Herz, die Frau riss die Augen weit auf.
»Mit den besten Grüßen von Kardinal Richelieu, Comtesse Henriette«, sagte er. »Sie konnten mich nicht täuschen.«
An den Wundrändern kräuselte Rauch auf, zischend verbrannte die Haut, wo sie mit dem Silber in Berührung kam.
Die Adlige wollte etwas erwidern, doch die Schmerzen ließen sie lediglich keuchen. Die lähmende Wirkung des Argentums verhinderte, dass sie ihre Selbstheilungskräfte nutzte. Leise knurrend starrte sie auf den Dolchgriff, der aus ihrer Brust ragte. Ihre Finger verwandelten sich in Klauen, die Nägel wurden lang und scharf.
»Ich habe mich im Vorfeld meines Besuchs von Holland House schlaugemacht, wen der Earl beherbergt und Schutz gewährt«, erklärte Melchior und zog seine Pistole. »Sie sind die hugenottische Freundin der begnadigten Duchesse de Chevreuse und fühlten sich in London sicher.« Er beugte sich vor. »Und Sie sind eine Wandlerin, Comtesse. Die Gerüchte stimmen also.«
Henriette grollte und versuchte, nach Melchior zu schnappen. Die Zähne waren zu Fängen geformt. »Sie Unmensch!« Sie umfasste den Griff des Dolches mit ihren Krallen, aber die Kraft reichte nicht aus. »Ich habe nichts getan!«
»Ihr geringer Titel schützt Sie nicht vor Richelieus Rache, im Gegensatz zur Duchesse mit ihren mächtigen Freunden am Hof«, erklärte ihr Melchior. »London kann mir dankbar sein. Je weniger Bestien wie Ihr durch die Gegend laufen, umso besser.«
»Sie werden …«, setzte Henriette an, und ihre Augen flammten rot auf. Einen halben Atemzug später starb sie und wandelte sich zurück in eine normale Frau. Nichts wies mehr darauf hin, was sie zu Lebzeiten gewesen war.
»Excusez-moi.« Melchior zog seinen Dolch aus der Toten und wischte ihn an dem Kleid ab. Danach legte er die Leiche so auf die gepolsterte Sitzbank, dass er Henriettes Kopf mit dem Säbel abschlagen konnte, was ihm wegen des Wackelns der Kutsche erst nach dem dritten Anlauf gelang. »Geschäft bleibt Geschäft.«
Zügig klappte er seine geräumige Tasche auf und nahm das große Glasgefäß mit dem flüssigen Honig heraus.
Die größten Locken schnitt er ab, danach versenkte er ihren Schädel im Honig, um ihn zu konservieren. In Calais würde er den Kopf bei einem Boten abgeben und sich bald über seine Belohnung freuen. Richelieu zahlte gut.
Die Kutsche rumpelte durch die menschenleere Gegend rund um das Holland House, während Melchior den Schmuck der Ermordeten an sich nahm.
Auf seiner Jagdliste stand außerdem Benjamin de Rohan, seines Zeichens Duc de Frontenay und Baron de Soubise, der militärische Anführer der Hugenotten, der nach dem Fall von La Rochelle nach London geflohen war. Und auf Rückkehr sann.
Soweit Melchior wusste, handelte es sich bei de Rohan ebenfalls um einen Wandler. Der Duc halte ein Haustier, raunte man sich zu, einen Jaguar aus der Neuen Welt. Allerdings sah man de Rohan und den Jaguar nie zur gleichen Zeit. Melchior bezweifelte nicht, dass der Adlige selbst die Bestie war.
Doch die zweihundert Silbertaler gaben dem Earl Vorrang. Um de Rohan konnte er sich kümmern, wenn er Aenlin Kanes Besitztümer in London ablieferte.
»Kutscher, anhalten!«, rief Melchior und zog seine schussbereite Pistole, als sie über eine kleine Brücke rollten. »Mylady ist schlecht geworden. Sie möchte vomuieren.«
Sobald der Mann das Gespann anhielt und sich besorgt zur Seite beugte, um nach Mylady zu sehen, schoss Melchior.
Knallend zündete die Treibladung, weißlicher Pulverdampf raste wie wütender Nebel heraus, gespickt mit Funken. Die Kugel traf ihn mitten zwischen die Augen. Die Hälfte des Schädels und der Hut des Mannes wurden weggerissen, er sackte auf dem Bock zusammen und blieb mit dem Rücken auf dem Dach liegen. Tröpfelnd rann das Blut herab.
Schnell stieg Melchior aus und warf die enthauptete Leiche der Comtesse ins Gewässer, das in die Themse und von da ins offene Meer floss.
Um den Anschein eines Überfalls perfekt zu machen, versetzte er der Kutsche einige Hiebe mit dem Säbel. Das Rapier des Fahrers tränkte er mit dessen Blut, bevor er es ihm in die Hand drückte. Einen Ring der Comtesse warf er zurück in das Gefährt, als hätten die Räuber ihn verloren, einen anderen ließ er neben der Kutsche fallen. Den Rest behielt er.
Auf dem ausgespannten Pferd ritt er zum Hafen.
Unterwegs überlegte Melchior, was ihn bei Aenlin Kane und Tahmina wohl erwartete. Eine Kämpferin und eine Mystikerin.
So leicht wie die Hugenottin machten sie es ihm bestimmt nicht.
Sein erster Gang würde ihn in Hamburg zum Henker führen oder jemanden, der sich auf die Passauer Kunst verstand, um sich einen magischen Schutzbrief zu verschaffen, der ihn vor allerlei Ungemach bewahren sollte. Sicher war sicher.
»Die Erde, deren Gewohnheit ist, die Toten zu bedecken, war damals an selbigem Ort selbst mit Toten überstreut, welche auf unterschiedliche Manier gezeichnet waren, Köpf lagen dorten, welche ihre natürlichen Herren verloren hatten, und hingegen Leiber, die ihrer Köpf mangelten; etliche hatten grausam- und jämmerlicher Weis das Ingeweid heraus, und andern war der Kopf zerschmettert und das Hirn zerspritzt.«
Aus: Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch (1668)
über die Schlacht bei Wittstock am 4. Oktober 1636
von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
Capitulum I
Aenlin fiel in dem Getümmel und Gewusel des Niederhafens auf. Und das aus gleich mehreren Gründen.
Zum einen stand sie inmitten des Treibens still, an einen Stapel mit Kisten voller Kanonenkugeln gelehnt. Zum anderen trug sie helle Kleidung von aufwendigem Schnitt, einschließlich eines hellgrauen breitkrempigen Huts mit schwarzem Band auf den langen, dunklen Haaren. Aber vor allem fiel sie auf, weil es Männerkleidung war. Zudem präsentierte sie die Waffen sichtbar unter ihrem offen stehenden Mantel.
Sie achtete nicht auf die Blicke, die ihr von den schwirrenden Knechten, den Mägden, den Krämern, Kaufleuten und Tagelöhnern zugeworfen wurden. Gedankenverloren las sie den Brief ihres Vaters, der ihrer Mutter zugestellt worden war. Vor langer, langer Zeit.
Geliebte Bess,
es mag der Tag kommen, an dem ich nicht mehr zurückkehre. An dem ich im Kampf gegen das Böse mein Leben verliere.
Gräme Dich nicht. Ich habe Sorge dafür getragen, dass Du in einem solchen Fall ausgesorgt hast.
Wie wir beide die letzten Jahre verbracht haben, weiß ich nicht in diesen Stunden, in denen ich den Brief an Dich aufsetze. Aber wisse: Jedes Mal, wenn mich meine Aufgabe von Dir wegzog, blieb ich in Gedanken bei Dir. Du gabst mir neben meinem Glauben Kraft, gegen die Bestien der Finsternis anzutreten, Bess.
Nun verhält es sich so, dass ich ein bescheidenes Vermögen und einige Artefakte zusammentragen konnte, die ich Dir hinterlasse. Da es sich um einen nicht unbeträchtlichen Wert handelt, traf ich Vorkehrungen, um sie gegen unbefugten Zugriff zu sichern.
Um zu erhalten, was Dir zusteht und was Du mehr als verdienst, reise nach Hamburg. Dort triff Dich mit Jacobus Maus, den Du im Niederhafen finden wirst, und weise ihm Deinen Siegelring. Er betreibt einen Reephandel. Von ihm erfährst Du, wie es weitergeht.
Weilt Jacobus Maus nicht mehr unter den Lebenden, hat er seinerseits Vorbereitungen getroffen, die Dir Zugang zu Deinem Schatz gewähren.
Weiteres möchte ich in dem Brief nicht andeuten. Es könnte den Neid von Königen und Königinnen wecken, sollte jemand lesen, was Dich an Reichtümern erwartet.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen, ob in diesem Leben oder im Paradies, wo uns Gott zusammenführen wird. Möge der Gerechte Dich segnen.
In tiefer Liebe und der Deine auf ewig
Solomon
Aenlin senkte das Schreiben und atmete durch, richtete die Augen auf das vielfache Be- und Entladen der vor Anker liegenden großen Schiffe. Die Masten stachen hoch in den Himmel, an den Rahen waren die gerefften Segel festgebunden. Hier und da kletterten Matrosen in den Wanten und prüften die Taue auf Beschädigungen, bevor die nächste Fahrt begann.
Aenlins Gedanken und Gefühle ordneten sich allmählich, das Ziel ihrer Reise war zum Greifen nahe: Einen Steinwurf von ihr entfernt lag das Geschäft von Jacobus Maus.
Aber Aenlin wollte den letzten Schritt nicht alleine tun, sondern ihre Freundin Tahmina an ihrer Seite wissen. Daher wartete sie angespannt.
Das Geschrei und Gerufe, das Rattern der Lastkräne und Laufräder, mit denen die Maschinen angetrieben wurden, das Klappern von Gespannen und das knirschende Rollen der vielen Räder tönten über den Kai und wurden von den Kontoren und Speichern zurückgeworfen. Der Handel über die Elbe lief ununterbrochen, auch die sporadischen Blockaden und Kontrollen durch Dänen, Engländer und Niederländer bremsten die Kiele nicht aus.
Täglich stachen verschiedenste Schiffe von Hamburg in See, in jeden Winkel der bekannten Welt, mehrere Tausend waren es im Jahr. Krieg oder nicht, ganz gleich, welcher, die Stadt belieferte alle verfeindeten Parteien gleichermaßen. Sie konnte es sich leisten, hatte sich für neutral erklärt und gleichzeitig Befestigungen errichtet, dank derer niemand einen Angriff wagte.
Aenlin mochte das Geschäftige des Hafens und ließ die Blicke aus ihren hellen Augen über die Fronten der Backstein- und Fachwerkgebäude schweifen. Sie hatte den Brief im Nachlass ihrer Mutter gefunden, eingeklemmt in einer Bibel. Elisabeth Kane war so gut wie mittellos mit knapp fünfundvierzig Jahren gestorben, an Typhus, der die Bewohner Londons im Wechsel mit der Pest heimsuchte.
Auch andere Städte litten unter diesen Plagen. Auf dem Weg nach Hamburg hatte Aenlin von der Pest gehört, die im nahe liegenden Altona wütete, und Hamburg selbst hatte bis vor Kurzem mit Typhus zu kämpfen gehabt. Die Einheimischen freuten sich zum einen über die Prosperität, während große Teile der umliegenden Landstriche Opfer der umherziehenden Heere wurden; zum anderen schimpften sie auf die Flüchtlinge, die ihnen der Krieg hinter die Mauern schwemmte und die Krankheiten einschleppten, wie man sagte.
Aenlin war schon öfter in Hamburg gewesen, aber zum ersten Mal sah sie die gewaltigen Wälle in Vollendung, die Bastionen mit den Verteidigungsanlagen, die in jede Richtung das Feuer aus den Kanonen eröffnen konnten. Egal wie lange dieser Krieg zwischen Katholiken und Protestanten, Nationen und Interessen noch dauerte, diese Stadt würde ihn überstehen – außer eine Krankheit oder eine Feuersbrunst machte ihr den Garaus. Der Schatz ihres Vaters für ihre Mutter war hier gut aufgehoben.
»He! Was glaubst du, wohin du mit meinem Beutel rennst?«, schrie ein Händler in teurem Gewand und mit geckenhaftem Hut quer über den Kai einem rennenden Jungen in Lumpen hinterher. Er gab die Leine seiner grauen Dogge frei, der Hund bellte dunkel auf. »Brutus, fass! Fass! Zerreiß den kleinen Langfinger!«
Aenlin sah den etwa elfjährigen Jungen Haken schlagen und über Säcke und Kisten hinwegsetzen. Einen Erwachsenen hätte er damit abgehängt, aber die Dogge ließ sich nicht abschütteln. Der Geruch führte sie weiter, selbst wenn sie den Dieb aus den Augen verlor.
Das Herz in Aenlins Brust schlug rascher. Ein Eingreifen wäre heikel, doch sie konnte nicht zusehen, wie die Jagd ein böses Ende nahm. Daher hob sie einen leeren Sack vom Boden auf und ging dem Jungen entgegen. Lucifer, steh mir bei.
»So ist’s recht! Schneid ihm den Weg ab, Weib«, schrie der Händler vorfreudig. »Aber pass auf, dass dich Brutus nicht fasst.«
Die Umstehenden lachten, einige zeigten ihre Sympathie mit dem Kind und pfiffen laut, um den Hund abzulenken.
Der kleine Dieb versuchte, Aenlin zu entgehen, aber sie hatte seine Schritte bestens eingeschätzt. Noch bevor die Dogge ihre langen Fänge in den Nacken des Jungen schlagen konnte, zog sie ihm die Beine weg, sodass er aus vollem Lauf stürzte und sich mehrmals auf dem Pflaster überschlug.
Geschickt warf sie dem tobenden Hund den Sack mit der Öffnung voraus über den Kopf, und das bösartige Bellen endete abrupt. Blind und überrascht prallte Brutus gegen die Kisten und schüttelte sich jaulend, versuchte mit den Pfoten, den grobmaschigen Stoff abzustreifen.
Aenlin ging zu dem kleinen Dieb, der sich aufrappelte, und packte ihn an der Schulter. »Her damit«, verlangte sie und hielt die behandschuhte Linke hin.
»Aber es steht mir zu«, begehrte er auf. »Mir und meinen Leuten.«
Der Kaufmann kam heran. »Wattwurm, elender!«
Eine Menschentraube bildete sich um Aenlin und den Jungen, der abwechselnd nach ihr und nach dem Mann trat, als würde er entkommen können.
»Mich bestiehlst du nicht nochmals!« Der Geck befahl seinem Hund, sich zu setzen, und befreite ihn von dem Sack. Die Dogge setzte sich knurrend neben ihn, den Blick aufmerksam auf den Menschen vor sich gerichtet. »Heraus mit deiner Beute.«
»Ihr habt uns betrogen, Herr Fischer!« Der Junge klammerte sich an seinen Hosenbund. »Schuldet uns Geld. Für einen Monat.«
»Halt dein vorlautes Maul, Dieb!«, fauchte der Kaufmann.
»Haben aufgeladen und die Karren geschoben, vom Tiefhafen hoch zur Waage«, redete der Junge unerschrocken weiter. »Den ganzen März. Nichts habt Ihr uns gegeben!«
Aenlin bewunderte seinen Mut. Weder die Menge noch der Krämer noch der riesige Hund, der im Sitzen so groß war wie er, schüchterten ihn ein. »Stimmt das, Herr Fischer?«
»Was geht’s dich an?« Der Kaufmann griff nach dem Jungen, aber Aenlin schob ihn an der Schulter zur Seite, die Finger des Mannes fassten ins Leere.
»Stimmt es, was der Knabe sagt?«
Ein leises Raunen ging durch die Umstehenden.
»Brutus!« Die Dogge erhob sich grollend, derweil der Kaufmann Aenlin anherrschte. »Gib mir den Dieb heraus, damit ich an mein Geld komme, du närrisches und seltsames Weib. Wie gehst du eigentlich vor die Tür? Ziehst dich an wie unsereins.«
»Wie hoch ist der Lohn, Junge?« Aenlin sah ihn freundlich und streng zugleich an.
»Ein Dukaten. Für uns alle.«
»Dann nimm einen Dukaten aus der Börse und gib den Rest zurück.«
»Bist du von Sinnen?«, tobte Fischer und erwog wohl, handgreiflich zu werden.
Unterdessen nahm der Junge die passende Münze aus dem Beutel und gab ihn Aenlin. Schnell steckte er seinen Lohn ein, hing aber noch im Griff seiner Bezwingerin.
»Hier. Ihre Börse, Herr Fischer.« Aenlin reichte sie an den Bestohlenen zurück, und die Umstehenden lachten leise. »Und da haben Sie einen Gulden. Von mir.« Sie langte in die Manteltasche und nahm eine Münze heraus. »Damit ist die Welt wieder im Einklang.«
»Im Einklang?« Fischer riss ihr den Beutel sowie das Geldstück aus den Fingern und zwängte beides unter seinen Überwurf. »Meine Welt ist erst im Einklang, wenn der räudige Dieb bestraft wurde.« Er zog einen Knüppel aus dem Gürtel, dem man die häufige Nutzung ansah. »Die Hand werde ich ihm zerschlagen, damit er gewiss nicht mehr an das Eigentum anderer Leute geht.« Er holte aus. »Her mit dem Arm!«
Aenlin ließ den Jungen los, der sofort davonstürmte.
»Brutus, fass!«, schrie Fischer.
Aenlin trat auf die lose Leine, und die startende Dogge wurde herumgerissen und stürzte mit einem Aufjaulen. Es tat ihr leid, dem Tier wehzutun. »Brutus, aus.«
Jetzt lachten die Zuschauerinnen und Zuschauer.
»Du wagst es, einen Dieb zu schützen?« Fischer holte mit dem Knüppel gegen sie aus. »Dann bekommst du eins auf dein freches Maul, Weib. Das sollst du nicht mehr vergessen! Deine Zähne wirst du aus der Gosse sammeln.«
Aenlin atmete tief ein und stemmte die Hände in die Hüften; dabei strich sie den Mantel zurück, wodurch ihre beiden Radschlosspistolen und das Rapier zum Vorschein kamen. »Bezahlen Sie doch Ihre Leute, und sie werden Sie nicht mehr bestehlen müssen, um an ihren Lohn zu kommen.« Sie nahm den Fuß langsam von der Leine. »Sie und Ihr Brutus müssten sich nicht aufregen und durch den Hafen rennen.«
Fischer musterte die unerschrockene junge Frau, in seinem Blick flackerte Unentschlossenheit. »Das wird nicht vergessen sein!«
Er wandte sich um und stapfte durch den Ring aus Zaungästen zurück zu dem Kistenstapel und der alten Kogge, die er beladen ließ. Ein lauter Pfiff, und die Dogge folgte ihrem zornigen Herrn.
Aenlin lächelte und sah dorthin, wo der Dieb verschwunden war. Es war ihm hoffentlich eine Lehre.
Die Versammlung löste sich auf, die Ladungen mussten an Bord der Schiffe oder aus deren Bäuchen geschafft werden. Die kurzweilige Abwechslung war vorüber.
Aenlins Herzschlag beruhigte sich nur langsam. Ihre Knie zitterten leicht, sie setzte sich auf eine Kiste. Ein großer Schluck Ale wäre jetzt genau richtig.
Die Präsentation ihres stattlichen und für eine Frau ungewöhnlichen Waffenarsenals hatte lediglich zur Einschüchterung des Widersachers gedient, um nichts davon nutzen zu müssen. Gewiss konnte sie mit dem Rapier umgehen. Sie schoss mit der Pistole ziemlich gut, und auch die Stilette wusste sie einzusetzen. In ihren Unterrichtsstunden.
Aber noch nie hatte sie die Klingen und Kugeln gegen einen Menschen gerichtet.
Ihre Mutter hatte großen Wert auf die Ausbildung gelegt. Mit Waffen und Wissen. Aenlin fühlte sich mehr zum Wissen hingezogen, doch die moderne Welt mochte jene lieber, die sich mit den Instrumenten des Todes auskannten.
Hinzu kam der Ruf, der ihr in England als Tochter Solomon Kanes vorauseilte. In Hamburg besaß sie den jedoch nicht. Niemand kannte ihren Vater in der Freien Reichsstadt, da war sie sich sicher. Und Aenlin würde damit nicht hausieren gehen.
Ebenso behielt sie ihre Überzeugungen für sich. In England hatte Aenlin einige interessante Konversationen mit einem jungen Studiosus namens John Milton in einem Pub geführt, über die Religion, Himmel und Hölle und Dämonen. Ihre Ansichten hatten ihn zutiefst beeindruckt, doch darüber sprach sie besser nicht laut in diesen Jahren, in denen Katholiken, Protestanten, Calvinisten, Puritaner, Quäker und sonstige Christenglauben alle ihr Vorrecht behaupteten.
»Da bist du!« Tahmina eilte heran.
Im ersten Moment mochte man sie wegen ihres dunkleren Teints für eine exotische Mönchin aus der Karibik oder dem Orient halten. Das weite, nachtblaue Gewand erlaubte keinen Blick auf die Figur, der Gürtel um ihre Hüfte saß locker. In ihrer Rechten trug sie einen langen, geschnitzten Wanderstab, der ihr bis an die Brust reichte und erst bei näherem Betrachten seine Besonderheiten offenbarte.
»Warst du der Grund für den Aufstand?«, fragte Tahmina.
»Nein. Ein Dieb. Hab ihm wohl das Leben gerettet.«
»Und einen Feind gefunden?« Tahmina deutete zum Kaufmann, der vor seiner alten Kogge stand und böse zu ihnen herüberblickte. Die Dogge hatte sich neben ihn gelegt und betrachtete die Menschen bei der Arbeit. »Das ging ja rasch. Kaum sind wir in Hamburg, machst du dir das Leben schwer. Und damit uns.« Die Perserin war fünf Jahre jünger als Aenlin und trug ihr langes braunes Haar unter einer Haube verborgen. Ihre Augen leuchteten blau wie das offene Meer bei Sonnenschein, auch wenn sie in diesem Moment etwas Missbilligendes bargen. »Hatte ich nicht gesagt, dass wir kein Aufsehen während unserer kleinen Reise brauchen?«
Aenlin lachte leise. »Wir beide fallen selbst in Hamburg auf, wo es vor anderen Staaten und Menschen nur so wimmelt.« Sie deutete die Kaimauer des Niederhafens hinab, wo die Großsegler vertäut lagen und stetig neue hinzukamen; mit dem Ende des Winters und des Eises auf der Elbe nahm der Handel Schwung auf. »Sieh doch: Franzosen, Engländer, Spanier, Portugiesen, Niederländer, sogar Menschen aus der Karibik und Asien. Mir scheint, sämtliche Hautfarben und Sprachen dieser Erde sind versammelt.«
»Es war deine Eingebung, das Erbe deines Vaters anzutreten«, sagte Tahmina. »Und dich auffällig zu kleiden.«
»Ich dachte, es schreckt die Schurken ab, wenn ich bewaffnet bin.« Aenlin nickte in Richtung des Kaufmanns. »Bei ihm gelang es. Aber vielleicht hast du recht. Ich sollte mich dezenter anziehen. Ein Sack wird seine Dienste tun, oder?«
»Keine spitze Zunge gegen deine Dienerin«, erwiderte Tahmina. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass die Perserin als Aenlins Untergebene auftrat, auch wenn es nicht stimmte. Doch sich als Mystikerin vorzustellen, brächte jedes Fässchen Toleranz zum Überlaufen, sogar im neutralen Hamburg, wo man über Glaubensfragen gerne mal hinwegsah. Bei Hexerei und ähnlichen Künsten verstand man jedoch keinen Spaß. Reisig und Holz für Scheiterhaufen waren schnell beisammen und versprachen den Bewohnern und Gästen ein Spektakel.
Aenlin legte ihrer Freundin die Hand auf die Schulter. »Und was hast du erreicht, während ich einen Jungen vor den Zähnen der Bestie bewahrte?«
»Eine Unterkunft habe ich uns besorgt. Unser Gepäck ist schon dort.« Tahmina zeigte auf das Gasthaus mit der kleinsten Front: Der durstige Reepschläger. »Da können wir unsere müden Häupter zur Ruhe legen, wenn wir endlich diesen Mann gefunden haben. Wie war sein Name? Irgendwas mit Nagetier. Hamster? Ratte?«
»Maus.« Aenlin zeigte auf den Laden. »Jacobus Maus. Das ist sein Geschäft.«
»Du warst noch nicht drin?«
»Ich wollte dich an meiner Seite wissen, wenn ich von meinem Erbe höre.«
Tahmina klimperte mit den Wimpern und legte die Linke auf Herzhöhe. »Ach, gütige Herrin. Ihr seid so gnädig und lasst mich –«
»Hör auf damit.« Aenlin erhob sich und ignorierte das Magenknurren. Sie war schon den ganzen Tag zu aufgeregt, um etwas zu essen. »Nun denn. Lösen wir das Rätsel.«
Gemeinsam gingen sie auf den Laden des Reepverkäufers zu, der sich zwischen große und kleine Gebäude zwängte, in denen unentwegtes Kommen und Gehen herrschte. Die verschiedensten Sprachen umschwirrten die beiden Frauen, es wurden im Laufen Geschäfte gemacht und gefeilscht, wie Aenlin an den Handbewegungen deutlich sah. Den Mienen nach verliefen die Verhandlungen unterschiedlich gut oder schlecht.
Aenlin wusste, dass sich Agenten und Diplomaten in Hamburg tummelten und die Reiche sogar eigene Niederlassungen unterhielten, wo man bei den Gesandten der Könige vorsprechen konnte. Um Subsidien zu erhalten, einen Handel vorzuschlagen oder andere Dinge zu besprechen.
»Höret, höret: Ist unser schönes Hamburg in Gefahr? Kommen nun die Schweden? Lest es, lest es!«, pries ein Mann laut seine Zeitung an, die er aus einem Ziehwagen heraus verkaufte. Entgegen der üblichen Praxis, die Blätter in einer Buchhandlung anzubieten, zog er geschäftstüchtig wie ein fliegender Händler durch die Straßen. »Silberflotte der Spanier gekapert! Lest, wie viel Reichtum die Niederländer raubten!«
Aenlin rümpfte die Nase über derlei Aufdringlichkeit, die dem seriösen Nachrichtenaustausch nicht zustand. Dennoch warf sie im Vorbeigehen einen Blick auf die erste Seite der Wöchentliche Zeitung auß mehrerley örther, auf der sich Begebenheiten von Venedig bis Stockholm tummelten. Kaufen und lesen mochte sie sie nicht; ihr Deutsch war nicht schlecht, aber sie musste sich beim Erfassen sehr konzentrieren. Davon abgesehen empfand sie den Buchdruck als Segen und die Informationsvermittlung von größter Wichtigkeit. Alle möglichen Neuigkeiten und die Ereignisse in den Schlachten strömten in Flugschriften und Zeitungen zusammen, sowohl in England als auch im Kriegsgebiet auf deutschem Boden.
Sie bewegten sich auf das Seilgeschäft zu, in dem sie von einem Mann namens Jacobus Maus erfahren sollten, wie sie an Solomon Kanes Erbe kamen.
»Was denkst du, was mich erwartet?« Aenlin hatte Dokumente dabei, die ihre Herkunft bewiesen, und auch den im Brief erwähnten Siegelring, den sie von der Hand ihrer toten Mutter gezogen hatte.
»Schätze, Artefakte … Das kann alles sein«, befand Tahmina. »Dein Vater bereiste die halbe Welt. Wenn er jedes Mal nur einen Diamanten oder Smaragd mitnahm, bist du reicher als die Königin von Saba. Und Midas wird sich voller Neid vor dir verbeugen.«
Verwundert betrachtete Aenlin die verwitterte Fassade. »Aber weswegen ein Seiler?«
»Er wird nicht immer Seiler gewesen sein. Vielleicht ein verzauberter Djinn, der dir deine Wünsche erfüllen muss? Wähle also weise.«
»Ich höre wieder diese scharfe Zunge.« Aenlin rieb sich die schweißnassen Hände am Mantel ab. »Die ist nicht hilfreich.«
»Lassen wir das Spekulieren.« Tahmina machte zwei schnelle Schritte vor und öffnete die Tür zum Seilgeschäft. Mit der Wärme kam ihnen der Geruch von Hanf und Staub entgegen. »Herrin, geht voraus. Und lasst Euch mit Reichtümern überhäufen.«
Aenlins Aufregung wuchs, und mit sehr gemischten Gefühlen trat sie über die Schwelle.
»Her mit dem Bier, verflucht!«, brüllte Statius quer durch die Schenke. Sie trug den schönen Namen Kaventsmann und lag unmittelbar an der Elbe in der Nähe der Fähre, mit der er und seine zwei Begleiter übergesetzt hatten. »Weiblein, wie lange müssen wir noch warten? Weißt du nicht, dass es gefährlich ist, Männer des Krieges darben zu lassen?«
»Gleich, gleich«, rief verzagt die Schankmaid, die allenfalls vierzehn Jahre alt war, und füllte den Trunk aus einer großen Kanne in die Humpen.
Die restlichen Besucher duckten sich hinter ihre Krüge und redeten leise, vier Kartenspieler mühten sich, die Blätter behutsam abzulegen, um die Aufmerksamkeit und damit den Unmut der Söldner nicht auf sich zu ziehen.
»Und das Essen? Was ist mit dem Essen?«, setzte Statius nach, dessen Kleidung ebenso bunt wie die seiner beiden Freunde am Tisch war. Sie trugen mehrfarbig gestreifte Hemden mit bauschigen Ärmeln, geplusterte Schlitzhosen sowie Barette und Hüte mit langen, gefärbten Federn. Stolz machten sie deutlich, dass sie nichts mit den einfachen Menschen gemein hatten. Ihre Bärte waren sauber gestutzt, Statius’ Schnäuzer war an den Enden verwegen waagrecht gedreht.
»Ja, Mutter ist schon dabei«, versicherte das Mädchen und schleppte die Krüge an den Tisch. »Hier, bitte sehr.« Kaum hatten die Böden der Behältnisse die Platte berührt, hastete sie von dannen, um nicht von einem der Männer auf den Schoß gezogen zu werden. »Wohl bekomm’s.«
»Das hoffe ich. Sonst wirst du mir heute Nacht wohl bekommen.« Statius verteilte die Krüge. »Ein Hoch auf das Leben, das uns wiederhat, meine Freunde!«
Jacob, der Kleinste und Schmalste von ihnen, den sie nur Jäcklein nannten, hob seinen Humpen und stieß mit Statius an. »Jawoll! Mögen die Klingen der Gegner stets stumpf sein.« Seine blonden Haare, sowohl Bart als auch Schopf, schafften es zu jeder Zeit, in alle Richtungen abzustehen. Stets wirkte er etwas struppig.
Nicolas, mit knapp dreißig Jahren der Älteste und ein Baum von einem Kerl, warf einen Blick aus dem offenen Fenster, durch den der Rauch der zahlreichen glühenden Pfeifen abzog. Sein Augenmerk galt dem Wagen, auf dem sich ihr Zelt, die Rüstungen und Stangenwaffen befanden, sowie dem daneben angebundenen Pferd. Er hätte Karren und Tier lieber in einer Scheune gewusst, aber Jacob und Statius hatten beim Anblick der Schenke keinen Schritt mehr gemacht. Ohnehin wage es niemand, sich daran zu vergreifen, meinten sie. Keiner wolle Streit mit Landsknechten, schon gar nicht, wenn sie betrunken waren.
Letztlich blieb Altona eine armselige Ansammlung von Bauernhöfen, Fischerkaten und Wirtshäusern, ungeliebt von der blühenden Schwester Hamburg. Die Grafen von Schauenburg hatten die Ansiedlung von verfolgten Protestanten aus den spanischen Niederlanden, Mennoniten sowie deutschen und portugiesischen Juden veranlasst. Nachdem die Dänen Altona besetzt hatten, kamen die Kaiserlichen und tobten. Und danach der Schwarze Tod. Etliche Häuser standen leer, einige trugen noch die Pestmarkierung.
Nicolas kannte das aus anderen Regionen, in denen er gewesen war. Ohne nach dem Krug zu sehen, packte er ihn. »Mögen die Klingen stumpf sein«, stimmte er zu und leerte das Bier in einem Zug; es schmeckte bitter und wässrig, doch es löschte den Durst. Dann wandte er sich seinen Freunden zu. »Ist nun wieder mit euch zu reden?«
»Mit mir immer«, sagte Jäcklein und wischte sich Schaum von der Oberlippe.
»Mit mir erst, wenn ich gegessen habe.« Statius schlug mit der Faust rhythmisch auf den Tisch, dass seine nackenlangen braunen Haare hüpften, und rief: »Hunger, Hunger, Hunger!«
»Lass es sein«, herrschte ihn Nicolas an. »Die Kleine fürchtet sich vor dir zu Tode.«
»Dann fügt sie sich leichter, wenn ich sie nachher –« Er unterbrach sich, als er den bösen Blick seines Anführers sah. »Ist gut. Ich lass sie. Aber ich wette mit dir um dein Mahl, dass sie schon mehr als ein Dutzend Schwänze in sich hatte.« Er zeigte durch den Innenraum. »Ist doch ein gutes Zubrot für ein hübsches Ding wie sie. Wer weiß, wie lange sie noch hübsch ist?«
Nicolas ging nicht darauf ein. Statius war ein grober Kerl, oft zu laut und zu derb, ganz genau dem entsprechend, was über Landsknechte zu hören und lesen war. Aber in der Schlacht konnte man sich auf ihn verlassen. Das war überlebenswichtig, wenn man in einem Tercio stand und um sein Dasein focht. Wenn die Reiterei nahte und in die Reihen schoss, wenn der Gegner heranmarschierte, Musketenkugeln flogen und die Piken wie überlange Dorne zustachen; wenn man vor Pulverdampf nichts mehr sah – dann war Statius an Nicolas’ Seite. Daher tolerierte der Anführer vieles von dem, was sich Statius abseits der Gefechte leistete.
Jäcklein nahm noch einen Schluck und betrachtete Nicolas. »Was denkst du? Lassen sie uns nach Hamburg rein?«
»Hängt davon ab, wie er sich benimmt.« Nicolas zeigte auf Statius. »Der Rat mag umherziehende Landsknechte nicht sonderlich. Sagt man.«
»Oh, ich kann fromm wie ein Lamm sein.«
Jäcklein lachte. »Du wärst das erste Lamm mit Klauen und Reißzähnen.«
»Und immer noch fromm.« Statius erhob sich und warf den Krug hinter den Tresen, wo er rumpelnd zu Boden fiel. »Vollmachen, Mädchen. Oder ich mach dich voll.«
Die Spieler packten ihre Karten ein und verließen das kleine Gasthaus, murrend und protestierend paffend gingen sie hinaus.
Nicolas schaute aus dem Fenster, damit sie nicht auf den Gedanken kamen, sich am Wagen zu schaffen zu machen. Einer pisste gegen das Rad, was Nicolas nicht kümmerte. Nur wenn der Strahl die Ladung getroffen hätte, wäre er eingeschritten.
»Und? Sind die Leutlein brav?«, hörte er Jäcklein fragen. »Wir hätten eine Fougasse zum Schutz unsrer Sachen draußen legen sollen. Klick, bumm und Ruhe.«
»Eine Mine wär doch arg übertrieben.« Nicolas wandte den Blick wieder in die Stube, auf den schartigen Bidenhänder, der neben ihm an der Wand lehnte. Es war seiner. Er trug ihn im Kampf auf dem Rücken, während er eine Hellebarde gegen Kürassiere und Musketenschützen führte. Erst wenn die gegnerische Formation nahe genug herangekommen war, löste er sich aus dem Tercio und mähte sich mit dem Zweihänder durch die Reihen von Pikenieren und Musketieren. Die schwere Klinge knackte Knochen, Schädel und Holzschäfte gleichermaßen.
In seinem Kopf stiegen die grausamen Erinnerungen an die letzte Schlacht empor. »Branntwein, Mädchen«, rief er rasch. Er musste die Bilder bekämpfen, um nicht in Trübsinn zu verfallen. Langsam zog er das bunte Barett von den langen aschblonden Haaren.
Jeder Söldner ging damit anders um. Jäcklein flüchtete sich in Witz und Schalk, Statius in Unflätigkeit und unentwegte Prügeleien. Nicolas fand den Rausch lindernd.
»Gleich, mein Herr.« Die Schankmaid brachte zuerst neues Bier, wobei sie darauf achtete, es nahe bei Jäcklein abzustellen, um nicht an Statius heranzumüssen, danach stellte sie eine Flasche Schnaps dazu und trug Teller mit dampfendem Eintopf herbei, der aus fettigem Fleisch in Hafergrütze bestand. »Mahlzeit.«
Blitzschnell schnappte Statius nach ihrem linken Handgelenk. »Sag, meine Kleine, wie ist dein Name? Hättest du nicht Lust, die Welt zu sehen? Ich brauch noch jemand, der mich näht und bekocht und auf meine Dinge schaut, während wir über die Schlachtfelder zieh’n.«
»Nein, nein. Ich mag die Welt in Altona«, gab sie stammelnd zurück und sah hilfesuchend zu den beiden anderen Söldnern. Die hellbraunen Haare hatte sie unter ein speckiges Kopftuch gestopft, an der Wange leuchtete eine alte Narbe. Sie war aufgeregt. »Osanna heiße ich.«
»Iss jetzt, Stats«, befahl Nicolas. »Wir finden schon willige Seelen.«
»Schade, Kind. Du wärst mir recht gekommen.« Statius ließ sie los und machte sich über das Essen her. »Hab schon schlechter gefressen«, murmelte er zwischen den Bissen, die er hinunterschlang. Eine Angewohnheit aus dem Feld. Was man im Bauch hatte, konnte einem nicht mehr genommen werden.
»Also, wir geh’n nach Hamburg«, nahm Jäcklein die Unterredung auf. »Hör’n uns um, wo die nächste Schlacht ansteht, und sputen uns, damit wir einen Werber finden, der uns aufnimmt. Joß von Cramm, der Halsabschneider, ist vielleicht in der Stadt. Er weiß immer, wer Bedarf an tüchtigen Recken hat.« Er aß langsam und kaute über zwanzig Mal. Es machte so mehr satt.
Nicolas nickte. »Bringen wir uns bei den Pfeffersäcken auf den Stand der Dinge. Die Hafenstadt weiß, wo Bedarf für unsere Piken und Klingen ist. Die Dänen mögen sich verpissen, aber auf die Schweden ist Verlass. Die lassen ihre Protestanten und die Union nicht im Stich.« Er sah löffelnd in die Runde. »Wie sieht’s mit den Ersparnissen aus? Reicht es bei jemandem für eine Muskete? Eine Pistole?«
»Ich wär froh, könnte ich mir den Harnisch ausbessern lassen«, erwiderte Statius und rülpste laut.
»So eine Muskete, das wär was Feines! Aber nicht mit einer blöden Lunte, die mir mit den glimmenden Funken den Bart versengt. Ich hab gehört, es gibt schon wieder neue. Mit einem Schloss, das dem Radschloss ähnelt, aber weniger umständlich ist.« Jäckleins Gesicht verklärte sich vor Entzücken. »Dagegen würd ich meine Pike tauschen.«
»Wer nimmt denn ein altes Eisen mit einem Holzstiel und gibt dir dafür ein Gewehr?« Statius lachte ihn aus. »Wir haben es doch gut, oder nicht?«
Nicolas hörte vor allem eines heraus: Ihnen fehlte es an Geld. Noch zehn lausige Dukaten, ein paar Heller, Batzen und Kreuzer aus verschiedenen Fürstentümern steckten in seiner Börse, die seines Erachtens weniger wogen, als sie sollten. Er hatte gehört, dass manche Münzstätten auf Befehl der Fürsten heimlich den Anteil von edlem Metall verringerten. Betrug allerorten.
»Dann bleiben uns nicht viele Möglichkeiten, wählerisch zu sein«, sprach er in die Runde. »Sobald wir in Hamburg sind, suchen wir uns eine ordentliche Schlacht. Von mir aus auch in Böhmen. Am Laufen soll’s nicht scheitern.«
»Gegen die Katholiken oder gegen die Protestanten?«, wollte Statius wissen und warf den Holzlöffel nach dem Mädchen; klappernd landete er neben ihr am Tresen. »Hey! Bring mir den wieder, zusammen mit einer zweiten vollen Schüssel und Bier.«
Osanna machte sich ans Werk.
»Meinem Eisen ist’s gleich, wen’s durchbohrt.« Jäcklein hatte nicht mal die Hälfte des Eintopfs gegessen. »Für Wallenstein würd ich gerne fechten. Schade war’s um den Mansfeld. Der verstand sich auf Kampf und List. Für das Fernbleiben im Gefecht beim Weißen Berg hat er hunderttausend Taler eingesackt! So ein Fuchs!«
»Und tot ist er dennoch.« Nicolas dachte nach. »Wallenstein. Warum nicht? Ja, mal sehen, ob er Leute sucht. Ansonsten Tilly. Oder Wachdienste. Oder Böhmen. Oder doch aufs Meer und in die Südsee, dahin, wo die anderen Schlachten der Länder geschlagen werden.« Er scharrte die Reste in der Schüssel zusammen, während Statius ein neuer Schmaus und Bier gebracht wurden.
»Aufs Meer? Nein, nicht für hunderttausend Gulden! Mir hat eine Hexe gesagt, dass ich auf der See den Tod find. Nein, das lass ich lieber sein.« Jäcklein beobachtete ihren Anführer und wippte mit dem Löffel. »Sag, was war das eigentlich? Letztens?«
»Ich weiß nicht, was du meinst.« Nicolas wusste es genau.
»Als wir ins Feld zogen.« Der kleine, sehnige Mann ritzte mit dem runden Ende des Löffels eine Linie auf dem grob gezimmerten Tisch. »Eine Schneise hast du geschlagen, quer durch das ganze gegnerische Tercio, als wäre der Teufel hinter dir her.«
»Und nicht eine Wunde.« Statius pochte sich gegen die Brust. »Du hast doch einen Schutzbrief bei dir, gib’s ruhig zu. Ich hab auch einen. Hilft immer.«
Nicolas erinnerte sich nur schemenhaft daran. Im Getümmel war er in einen Rausch verfallen, wie einer dieser Berserker, von denen die Römer einst sprachen. Wie ein Dämon, den man von der Kette gelassen hatte, war er über die Gegner gekommen. Nichts davon wusste er noch wirklich.
»Der leibhaftige Schnitter, Nicolas. So was habe ich in den letzten Jahren noch nie bei dir gesehen.« Jäcklein klang nicht besorgt. »Du solltest mehr Sold für dich verlangen.«
»Für uns! Denn wir folgen ihm, vergiss das nicht«, warf Statius sogleich ein. Dann schaute er verschwörerisch drein. »Hattet ihr auch das Gefühl, dass da einige Kerle, denen wir die Köpfe von den Schultern schlugen, gar stark stanken? Wie … Tote?«
»Es waren Tote.« Daran erinnerte sich Nicolas wiederum sehr genau.
»Sie haben die Gestorbenen aus den Gräbern gezerrt und sie mit unheiligem Leben erfüllt«, bestätigte Jäcklein abgebrüht. »Meiner Treu! Das muss die Wiederauferstehung sein, von der alle sprechen. Ich hätt sie mir anders vorgestellt. Im Paradiese sind wir nicht, edle Herren!«
Die drei Söldner lachten.
»Wie geht das?« Statius schob die zweite leere Schale von sich und zwirbelte die Bartenden nach. »Wie macht man Leichen lebendig? Das kann doch kein Christenzauber sein.«
»Ich habe gehört, dass man den Pestopfern befehlen kann, wenn man ihnen die Zunge herausschneidet.« Jäcklein zuckte mit den Achseln. »Oder die Männer wussten nicht, dass sie tot sind, und taten ihre Pflicht.«
»Pest.« Nicolas dachte an die vielen markierten Häuser in Altona, in denen der Schwarze Tod gehaust hatte oder immer noch hauste.
»Die Dörfer der Toten«, sagte eine leise Frauenstimme neben ihnen. Die Söldner wandten sich erstaunt um, und Osanna legte ein Flugblatt vor sie hin. »Davon erzählen manche. Landstriche voller Bosheit, in denen die Dunkelheit und Dämonen ihre Reiche errichtet haben. Und das ist erst der Anfang.«
Jäcklein warf einen Blick auf das fleckige Blatt, das durch viele Hände gegangen war. »Ah. Verfasst von einem Pfaffen«, sagte er. »Was auch sonst?«
»Dämonen«, wiederholte Statius und schauderte, dann bekreuzigte er sich. Lesen konnte er das Flugblatt nicht, aber die Bilder reichten aus, um zu verstehen, worum es ging. Er sah zu Osanna. »Dörfer voller Toter?«
»Ja, Herr. Sie … die Leichname streifen umher, manche fallen über die Menschen her, andere lassen sich anwerben, erzählt man sich.«
»Für Geld?« Jäcklein lachte. »Sapperlot! Was säuft und frisst so ein Toter?«
»Die Lebenden. Das ist ihr größter Antrieb. Und die frisch Gefallenen gehören ihnen.« Osanna räumte die leeren Schalen ab und kehrte zurück zum Tresen.
»Da furz mir einer ins Gesicht«, rief Statius nach einer Weile des Schweigens. »Jetzt hat das Weiblein mir Angst gemacht. Herrgott, die hat es faustdick hinter den Ohren!« Er lachte laut. Laut und falsch. Das Unbehagen vertrieb das nicht.
Nicolas sah Jäcklein an, dass er sich ebenfalls sorgte.
Sie stießen nicht zum ersten Mal auf Seltsamkeiten bei ihren Zügen durch die Reiche und Fürstentümer und Städte. Deutlich in Erinnerung war Nicolas der verrückte Wanderprediger in bunter Kleidung, wie ein Pfau, dem eine Schar grün angemalter und singender Kinder gefolgt war. Er hatte ihnen zugerufen, dass die Dunklen Lande um sich griffen, in denen die Knechtschaft der Menschen begann. In denen Dämonen, Hexen, Zauberer und die Bestien der Finsternis herrschten. Dann war er vorüber gewesen. Zwei Städte weiter hatten sie erfahren, dass man den Irren in den Kerker geworfen hatte wegen Gotteslästerung. Die Kinder waren von ihm entführt worden.
»Die Dunklen Lande«, wiederholte Nicolas leise. Der Begriff ließ ihn nicht mehr los.
Sie hatten bereits Dämonen im Kampf gesehen, Schemen auf einem Feuerpferd oder Gestalten mit Fledermausschwingen, die in Getümmel und Pulverdampf erschienen waren und darauf vertrauten, dass man sie dort nicht bemerkte. Aber Nicolas, Statius und Jäcklein hatten sie gesehen. Genauso wie sie die leuchtend roten Augen eines Obristen gesehen hatten, der Fangzähne entblößt hatte, bevor er sich fauchend in die Feinde warf.
»Wir brauchen dringend Geld. Für größere Waffen«, sagte Nicolas zu seinen Freunden.
»Und Schutzbriefchen.« Statius pochte erneut gegen die Brust, dass die Bartspitzen zitterten. »Ich werd mir noch den Christophorus malen lassen. Und den Judas. Die bind ich mir um.«
»Den Judas?« Jäcklein lachte auf. »Meiner Treu, sollt ich im Kampf besser auf meinen Rücken achten, Kerl?«
»Er war ein Attentäter. Sichelkämpfer. Der wird mich schon fein schützen.« Statius deutete auf das Flugblatt zu den Dörfern der Toten. »Einritzen lass ich mir seinen Namen besser. In die Haut und über das Herz, damit mir der Beistand nicht flöten geht.«
Die Tür zum Kaventsmann öffnete sich, und der Rahmen füllte sich sogleich mit einem titanischen Umriss, der sich gebeugt ins Innere schob. Erst als der Neuankömmling über die Schwelle getreten war, konnte er sich zu seiner gesamten Größe aufrichten und ragte mehr als zwei Schritte in die Höhe.
»Guten Tag«, grüßte er artig und blickte sich um. Seine Kleidung bestand aus Hemd und Hose, die Schuhe waren geflickt, auf dem Rücken hing ein Tragesack und ein zerschlissener Schäfermantel gegen die Kälte.
An sämtlichen Tischen erstarben die Gespräche. Jeder starrte den Gast an.
»Scheiß mir die Stiefel voll«, entfuhr es Statius. »Der Bursche ist nicht mal fünfzehn, aber groß und breit wie ein kleiner Riese.«