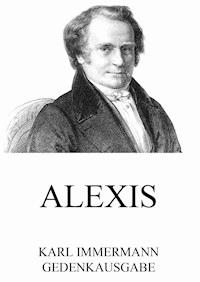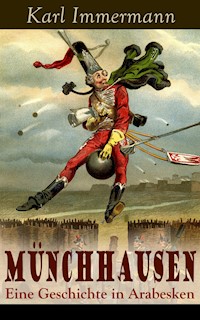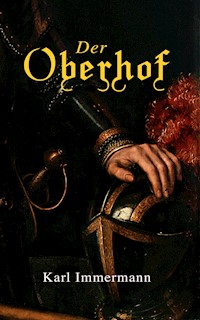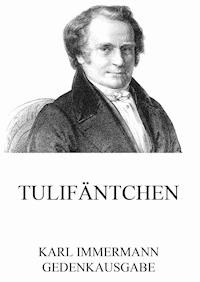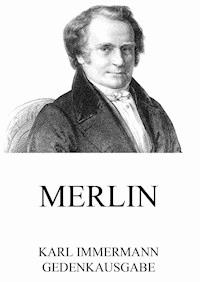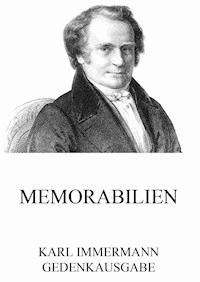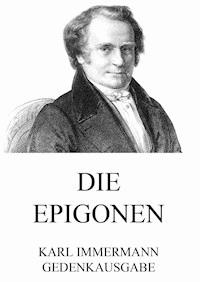
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Epigonen ist ein Roman von Karl Immermann, der 1836 erschien. Der Roman spielt im Unterschied zu Wilhelm Meister fast nur in der Adelssphäre, enthält allerdings eine deutlich schärfere Kritik des Adels, als sie sich bei Goethe findet. Auch kommt die Industriewelt weit realistischer in den Blick als bei Goethe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 989
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Epigonen
Karl Immermann
Inhalt:
Karl Immermann – Biografie und Bibliografie
Die Epigonen
Erstes Buch - Klugheit und Irrtum
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Zweites Buch - Das Schloß des Standesherrn
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Drittes Buch - Die Verlobung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Viertes Buch - Das Caroussel, der Adelsbrief
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebenzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Fünftes Buch - Die Demagogen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Sechstes Buch - Medon und Johanna
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Siebentes Buch - Byzantinische Händel
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Achtes Buch - Korrespondenz mit dem Arzte – 1835
I. Der Herausgeber an den Arzt
II. Der Arzt an den Herausgeber
III. Derselbe an Denselben
IV. Der Herausgeber an den Arzt
V. Derselbe an Denselben
VI. Derselbe an Denselben
VII. Der Arzt an den Herausgeber
VIII. Derselbe an Denselben
IX. Der Herausgeber an den Arzt
X. Der Arzt an den Herausgeber
XI. Geschichte des Herzogs
XII. Auch eine Bekehrungsgeschichte
XIII. Hermann
XIV. Der Herausgeber an den Arzt
Neuntes Buch - Cornelie – 1828-1829
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Eilftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Letztes Kapitel
Die Epigonen, K. Immermann
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628429
www.jazzybee-verlag.de
Karl Immermann – Biografie und Bibliografie
Dichter und Dramaturg, geb. 24. April 1796 in Magdeburg, gest. 25. Aug. 1840 in Düsseldorf, besuchte bis 1813 das Gymnasium seiner Vaterstadt und bezog, um Rechtswissenschaft zu studieren, im Frühling des großen deutschen Erhebungsjahrs die Universität Halle. Durch Napoleons Wiederkunft von Elba 1815 zu den Waffen gerufen, nahm er an den Schlachten von Ligny und Waterloo teil, zog mit Blüchers Heer in Paris ein und wurde als Offizier entlassen. Die Selbständigkeit seines Charakters betätigte er 1817, als die Burschenschafter zu Halle einen armen Studenten, der nicht zu ihnen halten wollte, brutal mißhandelten. I. wandte sich in einer Immediateingabe an den König und schrieb die (beim Wartburgfest mit verbrannte) Schrift »Über die Streitigkeiten der Studierenden zu Halle« (Leipz. 1817). Im I. 1817 trat er in den preußischen Staatsdienst, arbeitete bis 1819 als Referendar in Aschersleben und wurde darauf als Auditeur nach Münster versetzt. Hier lernte er die Gräfin Elisa v. Ahlefeldt, die Gattin des Freischarenführers v. Lützow, kennen und blieb in langjährigen Beziehungen zu ihr, nachdem sie sich von ihrem Gatten hatte scheiden lassen. I. trat während der Münsterschen Zeit zuerst mit dem Lustspiel »Die Prinzen von Syrakus« (Hamm 1821) hervor, dem eine Sammlung »Gedichte« (das. 1822) und die Trauerspiele: »Petrarca« (1822), »König Periander und sein Haus« (Elberf. 1823) u. a. folgten, Werke, in denen er durchaus die Wege der Romantiker wandelte. 1824 als Kriminalrichter an das Oberlandesgericht seiner Vaterstadt berufen, wohin ihm die Gräfin folgte, übersetzte er daselbst Walter Scotts »Ivanhoe« (1826), schrieb die ästhetische Abhandlung »Über den rasenden Ajax des Sophokles« (Magdeb. 1826) und veröffentlichte neue Dramen, wie das Lustspiel »Das Auge der Liebe« (Hamm 1824), die seltsame Tragödie »Cardenio und Celinde« (Berl. 1826), die das Interesse literarischer Kreise auf ihn lenkten. Als er 1827 als Landgerichtsrat nach Düsseldorf versetzt ward, folgte ihm die Gräfin auch dahin nach. Düsseldorf hatte eben damals den künstlerischen Aufschwung genommen; I. und andre brachten das literarische Element in die Kunstkreise. Allseitig angeregt, schuf er die ersten selbständigen Werke. Bald nacheinander entstanden die Tragödien: »Das Trauerspiel in Tirol« (Hamb. 1827) und »Kaiser Friedrich II« (das. 1828; vgl. Deetjen, Immermanns ›Kaiser Friedrich II.‹ Berl. 1901), das komische Heldengedicht »Tulifäntchen« (Hamb. 1827; neue Ausg., Berl. 1862), die Lustspiele: »Die Verkleidungen« (Hamb. 1828) und »Die Schule der Frommen« (Stuttg. 1829), das phantastische und tiefsinnige Mysterium »Merlin« (Düsseld. 1831; vgl. Kurt Jahn, Immermanns ›Merlin‹, Berl. 1899; Zielinski, Die Tragödie des Glaubens. Betrachtungen zu Immermanns ›Merlin›, Leipz. 1901) und die Trilogie ›Alexis‹ (Düsseld. 1832; vgl. Leffson, Immermanns ›Alexis‹, Gotha 1904). Auch »Der im Irrgarten der Metrik umhertaumelnde Kavalier«, eine gegen Graf Platen gerichtete »literarische Tragödie« (Hamb. 1829), die »Miszellen« (Stuttg. 1830), eine neue Folge von »Gedichten« (das. 1830) u. a. fallen in jene Zeit. Mit dem Roman »Die Epigonen« (Düsseld. 1836; 2. Aufl., Berl. 1856), den er 1835 vollendete, betrat I. das Gebiet der erzählenden Prosadichtung, wofür sich seine Begabung am meisten eignete. Bedeutenden Gehalt und Schwung erhielt sein Leben durch die Leitung des Düsseldorfer Theaters zwischen 1835 und 1838. Aus zufälligen Anfängen war der Gedanke, eine Musterbühne zu errichten, emporgewachsen; I. nahm Urlaub von seinem Amt, um sich der Leitung des Theaters ausschließlich zu widmen, und erreichte mit verhältnismäßig geringen Kräften Ungewöhnliches in Repertoire und Ensemble. Nicht an den Prinzipien, sondern am Mangel einer ausgiebigen materiellen Unterstützung scheiterte diese Reformbühne, und es war ein Fehler, daß keins der größern Theater Immermanns dramaturgisches Talent in Dienst nahm. Der Untergang seiner Lieblingsschöpfung verstimmte ihn tief, beugte aber seinen freudigen Schaffensmut nicht. Er begann den humoristisch-idyllischen Roman »Münchhausen, eine Geschichte in Arabesken« (Düsseld. 1839, 4 Tle.; 3. Aufl., Berl. 1854), der im Grund aus zwei locker verknüpften Romanen bestand und sich durch Gestaltenreichtum, Fülle realen und poetischen Lebens im idyllischen Teil (»Der Oberhof«, wovon zahlreiche Sonderausgaben erschienen), durch eine Reihe satirischer Meisterzüge in der humoristisch-satirischen Zeitdarstellung auszeichnete (vgl. die Programme von F. Bauer, Sternescher Humor in Immermanns;Münchhausen', Wien 1897, und W. Volkmann, Beiträge zur Erläuterung von Immermanns. Münchhausen', Bresl. 1897). Im Herbst 1839 vermählte sich I. mit Marianne, einer Enkelin des Kanzlers Niemeyer in Halle (gest. 17. Febr. 1886 in Hamburg). Im Glück seiner jungen Ehe, im Vollgefühl der mit seinem letzten Werk endlich errungenen allgemeinen Anerkennung schritt I. zur Neugestaltung des Liebesepos »Tristan und Isolde« (Hamb. 1842; 2. Aufl., Berl. 1854) und schrieb gleichzeitig an seinen »Memorabilien« (Hamb. 1840–43, 3 Tle.); aber die Vollendung beider Werke war ihm nicht vergönnt, ein tückisches Nervenfieber raffte den Dichter mitten aus seinem Schaffen hinweg. I. gehörte zu jenen spröden Talenten, die erst mit den Jahren voll erglühen und in Fluß kommen. Mit seinen »Epigonen« und dem »Münchhausen« hat er der poetischen Darstellung modernen Lebens Bahn gebrochen und seine Stellung in der Geschichte der deutschen Dichtung gesichert. Eine Gesamtausgabe seiner Schriften, in sorgfältiger Auswahl, erschien in 14 Bänden (Düsseld. u. Hamb. 1835–43), eine neuere, herausgegeben von Boxberger, in 20 Bänden (Berl. 1883), eine Auswahl besorgte Muncker für Cottas »Bibliothek der Weltliteratur« (Stuttg. 1898, 6 Bde). Aus seinem Nachlaß veröffentlichte G. zu Putlitz seine »Theaterbriefe« (Berl. 1851). Vgl. Freiligrath, Karl I. Blätter der Erinnerung an ihn (Stuttg. 1842); D. F. Strauß, Kleine Schriften (Leipz. 1866); »Karl I., sein Leben und seine Werke« (von der Witwe Immermanns; hrsg. von G. zu Putlitz, Berl. 1870, 2 Bde.); Müller (von Königswinter), Erzählungen eines rheinischen Chronisten, Bd. 1: »Karl I. und sein Kreis« (Leipz. 1860); Fellner, Geschichte einer deutschen Musterbühne. K. Immermanns Leitung des Stadttheaters zu Düssel dorf (Stuttg. 1888); »Karl I. Eine Gedächtnisschrift zum 100. Geburtstag des Dichters« (Hamb. 1896; mit Beiträgen von R. Fellner, I. Geffcken, O. H. Geffcken, R. M. Meyer und F. Schulteß); Deetjen, Immermanns Jugenddramen (Leipz. 1904).
Die Epigonen
Erstes Buch - Klugheit und Irrtum
Irre ich, so irre ich mir.
Hiob
Erstes Kapitel
An einem deutschen Sommertage, wo Gußregen und schwüler Sonnenblick wechselten, und das Gefilde zu öfterem halb unter grauen Wolken, halb unter glühendem Lichte lag, gingen mehrere Männer suchend durch die Heide. »Sie muß sich in die Erde verkrochen haben«, sagte der eine, »wir haben doch nirgends eine Spur von ihr gefunden.«
»Wenn nur die Alte, die ihr hat wahrsagen müssen, uns nicht angeführt hat«, versetzte ein anderer. »Sie schickt uns vielleicht nach einer falschen Gegend, und hält das Kind unterdessen in ihrer Spelunke verborgen. Ich habe es dem Landrat oft gesagt, er solle das Luder von hier fortweisen zu den Zigeunern nach Friedrichslohra.«
»Zigeuner!« rief ein Dritter aus. »Das alte Weib ist so wenig eine Zigeunerin, als deine und meine Frau. Ich habe sie als Unteroffizier dazumal im Kriege recht wohl gekannt. Zu der Zeit war sie unsre Marketenderin. Sie ist aus Halle in Sachsen. Mit
Büchern und allerhand Schnurren hatte sie immer ihr Wesen, davon sind ihr die Redensarten sitzengeblieben, und nun tut sie so, als wäre sie von weit her, weil sie merkt, daß es in ihrem Gewerbe dann vor den Leuten besser fleckt. Aber da kommt wieder am Himmel so ein Schlauch hergezogen, laßt uns bei den Bäumen untertreten.«
Die Männer bargen sich vor dem Wetter an einer Waldecke. Ihr Gespräch verließ bald die Zigeunerin und das entflohene Kind, dem sie nachspüren sollten, und wandte sich auf die Mühsale der Polizei, welche für alles sorgen müsse und von jedermann für überflüssig erachtet werde. Bei diesen Reden machte eine Branntweinflasche, die nicht zu den kleinsten gehörte, fleißig die Runde. Als die Unterhaltung erschöpft, die Flasche ausgetrunken, und der Regen verzogen war, sagte der eine Mann: »Wenn ihr mir folgen wollt, so nehmen wir jetzt am Stern noch einen, und gehn dann zu Rathause. Mit dem Busch können wir uns doch nicht befassen, denn er ist zu groß. Wir haben getan, was möglich war, und der Komödiant mag nun selbst ausgehn, wenn er sein Mädchen wiederhaben will.«
Diesem Vorschlage gaben die andern mit der Bemerkung, daß eine ungesunde Witterung herrsche, lebhaften Beifall, worauf sich alle, ohne dem Walde weitere Aufmerksamkeit zu schenken, nach dem Wirtshause in Bewegung setzten, welches sie vor kurzem erst verlassen hatten.
Währenddessen saßen im Dickicht zwei junge Leute auf einem umgestürzten Stamme. Der Regen tröpfelte durch die Blätter und schien dem einen, welcher schlank und wohlgebildet war, beschwerlich zu fallen, wogegen der andre, untersetzt und knochicht, dessen nicht achtete. Er hielt eine Landkarte auf seinen Knieen entfaltet, und redete, unbekümmert darum, daß sie naß ward, auf seinen Genossen mit Feuer und heftiger Gebärde ein.
»Nach acht Tagen«, rief er, »bin ich in Genf. – In vierzehn Tagen kann ich Marseille erreichen, und wenn die Winde des Himmels dem Wunsche der Freiheit günstig sind, so küsse ich nach sechs Wochen den Boden der heiligen Hellas.«
»Nehmt nur eine Taschenausgabe der Klassiker mit«, versetzte der andere lächelnd, »damit ihr die Illusion immer wiederherstellen könnt. Die Neugriechen werden euch mitunter unsanft in euren Träumen stören.«
»Es gilt«, versetzte der mit der Landkarte, »ein gesunkenes Volk aus den Fesseln der Knechtschaft erlösen, es gilt, edlen Herzen eine Freistatt erobern, wohin sie sich vor der Zwingherrschaft verrotteter Kerkermeister retten können; es gilt, den Grundstein zu einer neuen Ordnung der Dinge legen, und du tätest besser, Hermann, statt über das Heilige zu spotten, dich unsrem Bunde anzuschließen. Was willst du in Deutschland?«
»Traurig für mich, wenn ich in Deutschland etwas wollte«, erwiderte sein Freund. »Als ob in unsrer mit Dünsten geschwängerten Atmosphäre ein Entschluß nur entstehn, geschweige denn ausgeführt werden könnte. Aber eben, weil ich nichts mehr will, tauge ich auch nirgend mehr hin, als nach Deutschland. Ich habe abgeschlossen mit dem Leben. Seit ich das getan, bin ich ruhig. Ich wünsche nichts, ich verlange nichts; die Zeit der Täuschungen ist für mich vorüber. Tummelt ihr euch immerhin umher zwischen Schein und Irrtum, nur hofft nicht, in mir einen Nachfolger zu finden! Ich war in London, in Paris; ich habe sie gesehn, die sogenannten bedeutenden Charaktere der Zeit. Nun, was waren sie denn mehr, als gewöhnliche Figuren, nur deshalb hervorragend, weil der Zufall sie auf hohe Postamente gestellt hatte. Nein, mich soll nichts mehr betrügen, und da jetzt an einen großen Inhalt des Lebens doch nicht zu denken ist, so will ich meine Tage wenigstens heiter hinleben. Ohne Zweck und Ziel sollen mir die Stunden verfließen, denn Zweck ist nur ein andres Wort für Torheit, und wenn man sich ein Ziel setzt, so kann man wohl gewiß sein, daß man von dem Strudel der Umstände in entgegengesetzter Richtung fortgerissen wird.«
Der Freund stand auf, faltete die Landkarte zusammen, und sprach sehr ernsthaft: »Diese Reden klingen wie die Philosophie der Verzweiflung. Möge dich Gott bald von solcher Sinnesart heilen! – Der Mensch muß würdige Entwürfe verfolgen, darin besteht sein eigentliches Leben. Was man recht will, das kann man auch, und wenn uns das Jahrhundert, dessen Gehalt du gegen deine Überzeugung leugnest, irgend etwas gelehrt hat, so ist es das Gebot, nicht unsrem beschränkten Selbst, sondern den allgemeinen Interessen der Menschheit zu leben. Doch, von etwas andrem zu reden, bis ich nach Marseille komme, wo ich den ersten Sold vom Vereine beziehe, reiche ich wohl schwerlich aus. Könntest du mir vielleicht –«
Hermann ließ den Philhellenen nicht vollenden, griff in seine Tasche, und reichte ihm eine Note. Der andre steckte, ohne sich zu bedanken, das Papier ein, schüttelte seinem Freunde herzhaft die Hand, und sprach: »Auf Wiedersehn in Napoli. Du kommst uns nach, ich weiß das schon. Du bist besser und wärmer, als du dich stellst.«
Statt einer Antwort faßte Hermann in den Busen, zog ein versiegeltes Päckchen hervor, wandte sich ab, und drückte, wie er meinte, unbemerkt vom Freunde, einen Kuß auf das Papier. »Du gehst über München«, sagte er zum Philhellenen, »gib das an Fränzchen ab, du kennst sie ja.«
»Das sieht wie eine Trennung aus. Seid ihr auseinander?«
»Man tut am besten, fallen zu lassen, was sich nicht länger halten kann. Sie ist sonderbar mit mir umgegangen. Und doch war sie allein aufrichtig. Ich habe mich um ein Dutzend Weiber gedreht, und die Schwüre ewiger Treue von ihnen empfangen, die dann in den Armen eines neuen Freundes vergessen wurden. Franziska sagte: ›Wir wollen ein paar vergnügte Tage zusammen haben und weiter nichts.‹ Wenn ich auf eine ernstere Verbindung drang, so lachte sie mich aus, und meinte, sähe ich sie einmal verheiratet, so wüßte ich, wen sie für den größten Gimpel auf der Welt gehalten habe. Sage ihr, ich hätte anfangs diese lieben Briefchen als Unterpfand, daß unser Bündnis nicht ganz zerrissen sei, behalten wollen, aber die Freiheit sei das höchste Gut, sie solle mich vergessen und glücklich sein.«
»Daß du die Weiber verachtest«, sprach der Freund, »ist recht und gut. Kein frauenhaft-gesinnter Mensch kann höheren Ideen leben. Du bist auf gutem Wege, ich gehe beruhigt von dir. Ich weiß, daß wir uns nicht zum letzten Male gesehen haben. Tanze nur nicht, hörst du? Gottlob! Die Neigung zu diesem entnervenden Vergnügen nimmt doch immer mehr ab.«
Er umarmte Hermann feierlich-herzlich, und ging mit großen Schritten, sein kleines Ränzel tragend, quer durch den Wald. Der jugendliche Philosoph blieb auf dem Stamme sitzen.
Zweites Kapitel
Zufällig hatten sie einander in dem Dorfe, wo beide tags zuvor eingetroffen waren, gefunden. Manche Erinnerungen verknüpften sie, der Abend und ein Teil der Nacht war unter Gesprächen hingegangen. Als Hermann die Gestalt des Freundes hinter den Stämmen verschwinden sah, schlich eine unangenehme Empfindung über sein Herz. Ihm war, als gehe seine Vergangenheit von ihm, er kam sich wie ein ausgesetzter Findling vor. Beinahe wäre er aufgesprungen, jenen zurückzurufen, und sich Fränzchens Liebespfänder wiederzuerbitten, hätte ihn nicht die Scheu vor dem Ausbruche einer solchen Weichlichkeit an seinen Sitz gefesselt.
»Ihr grünen Kräuter, ihr schlanken Stauden, ihr kräftigen Bäume, wie beneide ich euch!« rief er aus. »Ihr steht so gesund da, so selbstvergnügt, daß euch die kränklichen Menschen, die ihr unter euch umherschleichen seht, recht zum Hohn und Spott dienen mögen. Der Frühling ruft eure Knospen hervor, der Sommer schenkt euch Laub und Blüten, der Herbst bringt euch, wie Wiegenkinder, zur Ruhe. Die Knospenzeit denkt nicht an die Blütenmonde, und wenn eure vollen Kronen in den warmen Lüften schaukeln, sie erschrecken nicht vor der Ahnung winterkahler Zweige! Wir armen Menschen! Wir Frühgereiften! Wir haben keine Knospen mehr, keine Blüten;
mit dem Schnee auf dem Haupte werden wir schon geboren. Wahrlich, unser Los ist ein recht lächerlicher Jammer! Daß man heutzutage so früh gescheit wird, gescheit werden muß, daß es gar nicht möglich ist, die törichten Streiche bis in die Dreißig mit hinüberzunehmen! O gäbe mir ein Gott die glückliche Dunkelheit, die hoffnungsreiche Nacht, statt des kalten Lichtes, welches Verstand und Erfahrung uns Spätlingen unwiderstehlich anzünden.«
Zwei Arme strickten sich um seinen Nacken, zwei weiche, warme Händchen hielten ihm die Augen zu. Erschrocken wollte er sich losmachen, das Ding hinter ihm vereitelte durch aalartiges Drehen und Wenden seine Bestrebungen. »Nun hast du ja, was du wolltest, die Finsternis vor den Augen!« rief eine zarte Mädchenstimme. Endlich bekam er das Gesicht frei. Er sah sich um. Ein wunderhübscher Kopf stak, wie das Haupt der Dryas, zwischen den Aststumpfen des Baums, unter welchem er gesessen hatte. Er zog das Wesen hinter dem Stamme hervor. Es war ein schönes Geschöpf zwischen Kind und Jungfrau.
»Wer bist du? Woher kommst du? Was willst du von mir?« fragte Hermann, der sich von seinem Erstaunen kaum erholen konnte.
»Ich bin Fiametta oder Flämmchen, ich komme aus meiner Grotte hier nebenan, wo ich hörte, was ihr miteinander spracht, du und dein dummer Freund. Was ich von dir will, weißt du, denn die Alte hat es gesagt, und es steht in den Sternen geschrieben.«
Sie schmiegte sich bei diesen Worten an Hermann, und sah ihm zärtlich in die Augen. Dieser wußte nicht, ob er mit etwas Menschlichem oder ob er mit einem neckischen Waldgeiste zu tun habe. Er strich dem Kinde die braunen Haare, die, ungefesselt von Kamm und Nadel, in üppiger Fülle bis zu den Hüften niederwogten. Er wollte fragen, und doch unterließ er es, aus Furcht, einen anmutigen Zauber zu zerstören. Das Kind setzte sich auf seinen Schoß, streifte ihm die Weste auf, legte die Hand auf sein Herz, lehnte den Kopf an, horchte, und sagte dann: »Das klingt, wenn man nur so obenhin zuhört, wie:
'Vorbei! Vorbei! Vorbei!' wenn man aber genauer acht gibt, so klopft es: 'Aufs neu! Aufs neu! Aufs neu!' – Komm, du schöner Prinz, nach meinem Palaste, du sollst sehen, wo Flämmchen dieser Tage gesteckt hat.«
Sie zog ihn tänzelnd und singend vom Stamm auf, und den Erdwall hinunter, an dessen Kante jener lag. Rasch schlug sie ein wucherndes Gesträuch auseinander, und der Eingang zu einer Art von Grotte wurde sichtbar. Man schien dort früher Ton gegraben zu haben, dadurch mochte die Aushöhlung entstanden sein. Hermann sah bei dem Scheine des gedämpft einfallenden Lichts ein Mooslager, und einen Sitz, aus Steinen zusammengefügt. – Er versuchte, das Mädchen auszuforschen, erfuhr aber nichts weiter, als daß ihr wahrer Vater, wie sie sich ausdruckte, längst gestorben sei, daß sie darauf viele Jahre bei dem falschen Vater zugebracht habe, der in dem Städtchen nahebei hause. Dieser habe sie an einen häßlichen alten Ritter verkaufen wollen, da sei sie ihm entsprungen.
»Und wo hast du dich denn seitdem befunden?« fragte Hermann.
»Hier, im Walde, in der Höhle, du siehst es ja. Da ist mein Lager, und hier mein Sitz. Heute morgen hungerte mich, da fiel mir der Mut, ich weinte und rief meinen toten Vater. Der muß mich gehört haben, denn er schickte mir die Alte, die versprach mir Hülfe, und nun ist die Hülfe da.«
Hermann redete ihr jetzt mit guten und bösen Worten zu, ihm zu folgen, er wolle sie zu dem Vater zurückbringen, und dafür sorgen, daß sie freundlich empfangen werde. Alles Bitten war jedoch vergebens. Endlich beschloß er, Gewalt zu brauchen, da er die Verirrte sich nicht selbst überlassen zu dürfen meinte. Er nahm sie auf den Arm und wollte sie forttragen. Aber heftig riß sich das Abenteuer von ihm los, stieß ein Geschrei aus, welches ihm durch Mark und Bein drang, warf sich gewaltsam zu Boden, und rief, die Hände vorgestreckt, in einem wunderbar schneidenden Tone: »Du willst mich verraten? Du?« Darauf sprang sie empor, der junge knospende Busen flog, ein blutiges Rot überlief ihre Augäpfel, sie schien außer sich zu sein, und nicht zu wissen, was sie begann. Wie eine Wütende zerriß sie das seidne Fähnchen, welches sie trug. Es glitt von ihren Schultern, das Hemd glitt ihm nach, oder warf sie es ab? er konnte es nicht unterscheiden, so rasch waren ihre Bewegungen. Nun stand sie, nur von ihren langen Haaren umflogen, Hermann gegenüber, und unaufhörlich ertönte aus ihren zitternden, dunkelgeröteten Lippen jener Ruf: »Du willst mich verraten? Du?«
Endlich gelang es ihm, sie durch Liebkosungen und Schmeicheleien zu beruhigen. Sie legte die Hand an die Stirne, sah betroffen an sich herab, huschte, schnell wie ein Wiesel, in die dunkelste Ecke der Höhle, und hockte dort in der Stellung nieder, welche die Alten, die jedes Ding am besten verstanden, dem weiblichen Gefühl in einer solchen Lage für alle Zeiten geliehen haben.
Hermann war in der größten Verlegenheit. Was sollte der Unsinn nun anziehn? Das rote seidne Kleidchen war von oben bis unten zerrissen. »Es ist kein andres Mittel«, rief er dem Mädchen zu, »du mußt dich als Knabe kleiden, bis man für dich anderweit gesorgt hat.«
Er klomm aus der Grotte den Erdwall hinauf, zu dem Stamme, auf welchem seine Reisetasche lag. Vorsorglich hatte er Collet und Pantalons für den Fall der Not auf dieser Fußwanderung eingepackt; beides warf er von der Erhöhung dem nackten Kinde hinunter. –
Oben rieb er seine Augen, und fragte sich, ob er wache oder träume? Dann ging er mit großen Schritten unter den Bäumen auf und nieder, denn er fühlte, daß ihm hier ein kräftiges Eingreifen obliege. Er ahnete ein Bubenstück, und beschloß, das Seinige zu tun, die gekränkte Unschuld zu schützen. Als er mit solchen Gedanken einige Male unter den Bäumen auf und nieder gegangen war, sprang ein allerliebster Junge durch das Gesträuch, dem das veilchenblaue Jäckchen und die gestreiften Hosen sehr hübsch standen.
Der Grundtrieb des Geschlechts hatte sich tätig erwiesen. Aller Überfluß an den Kleidungsstücken war so weggebunden, weggesteckt und weggenestelt, daß sie knapp, wie angegossen, saßen.
Flämmchen nahm seinen Arm, und sagte: »Ich will dich nun auf den Weg bringen.« Sie führte ihn durch den Wald, und zwar entgegengesetzt der Richtung, welche er, seinem Reisezwecke gemäß, einschlagen mußte. Jede Spur der Leidenschaft, in welcher Hermann sie gesehen hatte, war verschwunden. »Du hast nichts weiter zu tun«, sagte sie gleichmütig, »als in der Stadt dich nach meinem falschen Vater zu erkundigen, und ihm zu sagen, daß du mich heiraten wollest, dann hat er keine Gewalt mehr über mich, und der alte häßliche Ritter muß von mir ablassen.«
Hermann sah sie mitleidig an. »Die Mißhandlungen, die sie erdulden mußte, haben ihr den Verstand genommen«, dachte er bei sich. Er legte die Hand auf ihr Haupt und sprach: »Ich schwöre dir, du armes Kind, dich nicht zu verlassen.«
Sie standen am Ausgange des Waldes. In einiger Entfernung ragte eine Turmspitze empor. »Das ist das Nest!« rief Flämmchen. Sie faßte ihren Beschützer schmeichelnd bei der Hand, strich hätschelnd mit dem kleinen Finger über den Ballen und die innere Fläche, und sagte: »Höre, wenn wir erst in deinem Fürstentume sind, und du mein Herr Gemahl bist, dann lassen wir auch die Alte kommen, damit wir immer wissen, was uns begegnet, nicht?«
»Hältst du mich für einen Fürsten?« fragte Hermann verwundert.
Das Mädchen wollte sich vor Lachen ausschütten. »Nun tut er, als wisse er nichts davon!« rief sie. »Aber alle deine Verstellungen werden ein Ende nehmen. Gib mir deinen Hut! Die Sonne und die Kälte in meinem Walde machen mir Kopfweh.« Ohne eine Antwort zu erwarten, hatte sie ihm den Strohhut vom Kopfe gestreift, und sich aufgesetzt. Sie gaukelte in den Wald zurück. Hermann sah ihr eine Weile stutzig nach, dann ging er der Stadt zu.
Alles dieses begab sich in der ehrbarsten Provinz unsres Vaterlandes, nämlich in Westfalen, auf einer bekannten Heide. Woraus zu entnehmen, daß auch der trockenste Boden mitunter seine Früchte trägt.
Drittes Kapitel
Vor der Tür des Gasthofs im kleinen Städtchen stand der Gastwirt, wie es schien, erhitzt von der Anstrengung des Tages. Hermann trat zu ihm, und fragte: ob er bei ihm Unterkommen finden könne? Der verständige Mann, welcher einen sichern Blick für den wahren Wert seiner Gäste hatte, betrachtete unsern hutlosen Wandrer und sein schmächtiges Reisetäschchen prüfend, und schien auf eine abschlägige Antwort zu sinnen. Endlich aber sagte er zum Hausknecht, der mit eingeknickten Beinen, die Hände in den Hosentaschen, gähnend unter dem Torwege stand: »Führe den Mann nach Nummer Zwölf.«
Der Hausknecht schlenderte voran, ohne dem Gaste das Bündel abzunehmen. Sie gingen über den Hof, durch einen langen Garten, und betraten eine Remise, worin der Wirt seine Felle trocknete, denn er war zugleich ein Lohgerber. Eine schmale Treppe, die sich zuletzt in eine Leiter verlor, führte zum obern Teile dieses Fellmagazins. Als die Leiter erklommen war, machte der Hausknecht einen bretternen Verschlag auf, und sagte: »Dieses ist Seine Stube.« – »Das ist ein Taubenschlag!« rief Hermann. »Nein, der ist darüber«, versetzte der Hausknecht kaltblütig, und kletterte die Stiegen hinunter.
Hermann sah sich in diesem Wohnorte um, und mußte laut lachen. Hierauf machte er die Runde durch denselben, was nicht viel Zeit erforderte, da er, genau gemessen, sechs Fuß im Gevierte hielt. Die Wände waren unschuldig weiß, und nur mit jenen Spielen der Laune bemalt, welche die Bedienten- oder Soldatenkammern zu schmücken pflegen. Es fehlte nicht an Nasen verschiedner Größe; Zöpfe und Grenadiere wechselten mit Störchen und Blumen ab. Ein beständiges Piepen, Sand und Federn, die von Zeit zu Zeit durch die ritzenvolle Decke fielen, diese Umstände überzeugten unsern Freund, daß der Hausknecht recht gehabt habe. Der Taubenschlag war wirklich über seinem Sorgenfrei vorhanden.
Der Wirt hatte unterdessen überlegt, daß heutzutage manche Personen von Stande zu Fuß reisen (in seinen Augen eine sonderbare Liebhaberei!), und daß ein solcher Querkopf auch wohl einmal den Einfall gehabt haben könne, die Welt barhaupt zu durchstreifen. Um daher nicht etwa einen der Achtung werten Ankömmling zum Nachteile des Gasthofs zu beleidigen, entschloß er sich, durch Höflichkeit mit Worten gutzumachen, was er in der Tat verbrochen hatte; denn jenes so üble Quartier, welches dem Eingekehrten gegeben worden war, stand selbst bei den Wirtshausleuten in Verachtung und hieß gemeiniglich bei ihnen nur das Loch. Er nahm sich in der Stille vor, dem Fußwandrer ein beßres Stübchen abzulassen, sobald er nur erst die moralische Überzeugung von dessen Zahlungsfähigkeit geschöpft haben würde. Übrigens war der Raum in dem Gasthofe wirklich beschränkt. Ein Herzog, der zu den Mediatisierten gehörte, hatte mit Gemahlin und Gefolge fast alles in Beschlag genommen.
Der Wirt trat unter Entschuldigungen über das etwas enge Logis in das sogenannte Loch, welches er, da niemand das Seinige beschelten soll, in seinen Reden zu einer Pièce erhob. »Wahrhaftig!« rief er, »es tut mir leid, einen solchen Herrn nicht ganz nach Wunsch aufnehmen zu können. Das Hotel steckt aber heute so voll von Fürsten, Grafen und Freiherrn, daß, mit Respekt zu sagen, kein Apfel zur Erde kommt.«
»Lassen Sie das gut sein«, versetzte Hermann. »Ein Reisender von Profession ist an dergleichen gewöhnt. In Dijon hat man mich einmal in einem Stalle untergebracht.«
»In einem Stalle!« rief der Wirt, mit einer Miene, die das Entsetzen ausdrücken sollte. »Nein, da ginge ich selbst lieber in den Stall, und gäbe einem solchen Herrn meine Schlafkammer.«
Hermann fand an diesen unnützen Reden kein Behagen. Ihm lag das Abenteuer im Walde am Herzen. Ehe der Wirt daher zu seinem Zwecke gelangte, unterbrach ihn jener mit der Frage:
Ob nicht vor einigen Tagen hier ein junges Mädchen seinen Angehörigen verlorengegangen sei?
Hierauf bediente ihn der Wirt sofort ausführlich und überflüssig. Er war die wandelnde Chronik des Städtchens, und wußte, was von dem einen Tore bis zum andern sich ereignete, oder doch hätte ereignen können. »Das ist eine wilde Geschichte!« rief er. »Haben der Herr auch schon davon gehört? Kommt hier ein nichtsnutziger Komödiant an, mietet sich ein, lebt, man weiß nicht wovon? treibt, man weiß nicht was? Er hat ein Kind bei sich, schön wie die Sonne und wild wie der Teufel, mit dem gibt es alle Tage Lärmen, daß die Nachbarn zum Burgemeister gehn, und bitten, dem Unfuge zu steuern. Was ist der Grund gewesen? Denken Sie nur; der Abschaum von Vater hat das unschuldige Kind einem alten Sündengesellen zur Unehre verkaufen wollen. Seine leibliche Tochter! Da ist das Mädchen weggelaufen. Die beiden Alten haben gestern und heute die Gegend abgesucht, und der Burgemeister hat gesagt, er werde suchen. Die arme Person ist weg, und wer weiß, in welchem Weiher schon ihr Leichnam schwimmt!«
Hermann erwiderte, daß man das Beste hoffen müsse, und daß das Schicksal der Witwen und Waisen in höherer Hand ruhe. Damit war der Wirt zwar einverstanden, aber es beruhigte ihn nicht. Er sagte daher, weil ihm keine feinere Wendung einfiel: »Es ist hier weder Schrank noch Kommode. Wenn der Herr vielleicht Ihre Sachen, und besonders die Barschaften mir zum Aufbewahren geben wollten ...«
Hermann fand dieses Anerbieten vernünftig, und griff nach seiner Brieftasche, in welcher er bedeutende Wechsel führte, um sie dem Wirte einzuhändigen. Wie erschrak er, als er nicht die seinige, sondern die des Philhellenen hervorzog! Beide sahen einander ähnlich, und waren im Nachtquartiere vertauscht worden. Hermann erblaßte; die Sache konnte von den übelsten Folgen sein. Indessen faßte er sich, und sagte dem Wirte, daß er denn doch lieber alles, was er habe, selbst behalten wolle. Dieser aber hatte ihn erblassen sehn, und verließ ihn mit bedenklichem Gesichte.
Hermann kannte die Umstände, in welchen sich ein Philhellene zu befinden pflegt. Er wußte, daß versteckte Schätze hier wohl kaum zu erwarten seien, und öffnete mit einer bösen Ahnung die Brieftasche. Ach, da waren Freiheitslieder in großer Anzahl, Logenzertifikate, und Marschrouten nach allen vier Himmelsgegenden, aber keine Dinge, welche einem irdischen Bedürfnisse abzuhelfen vermochten!
Er verwünschte diesen Zufall. Drei bis vier Taler in der Tasche, ohne Kreditbriefe, ohne Hut auf dem Kopfe, ein einziges Kleid am Leibe, irrte er hier umher, mehrere Tagereisen von seinen Quellen entfernt. Was sollte er beginnen? Fremd in der Gegend, wie leicht konnte er den Strich verfehlen, den der Philhellene gegangen war, der ohnehin von der Landstraße abzuweichen liebte, um in weniger besuchten Gegenden seine Grundsätze auszubreiten! Dazu schwebte ihm die Gestalt jenes Kindes vor, dem schleunige Rettung vom Verderben not tat. Flämmchen und der Philhellene zogen ihn nach verschiednen Seiten; er wußte nicht, was er tun sollte, und blätterte zerstreut in den Freiheitsliedern seines Freundes, der dagegen das Geld und die Wechsel hatte. Wie das ferne Licht in der Grube dämmerte ihm aber doch die Hoffnung, sein Geist werde ihm auch dieses Mal helfen, wie er ihm so oft in Bedrängnissen geholfen hatte.
Viertes Kapitel
Währenddessen hatte sich unten im Gasthofe ein großer Lärmen erhoben. Der Wirt hinkte, (denn er war lahm) im Hausflur und in der anstoßenden Stube umher, die Wirtin rang die Hände, vier bis fünf Neugierige standen vor dem Ehebette des Paars; alles schwatzte durcheinander.
Der Grund dieses Aufruhrs war die Kammerjungfer der Herzogin. Diese litt an der Epilepsie, und war eben von ihrem Übel befallen worden, als sie in der Küche das Brenneisen wärmen wollte, um die Gebieterin zu frisieren. Der Wirt sollte einen Friseur schaffen, und konnte es nicht. Von solchem Gewerbe hatte das kleine elende Landstädtchen nie gehört; das Haarabschneiden wurde dort in den Familien besorgt.
Die Person zuckte auf dem Bette, die Umstehenden gaben Mittel an, ihr zu helfen, jeder ein anderes. Die Wirtin rief der Kranken zu, wenn es ihr möglich sei, das frisch überzogne Bett mit ihren heftigen Bewegungen zu verschonen; worauf die Arme natürlich keine Rücksicht nahm. Der Wirt beteuerte unter allerhand Flüchen, daß der Stadt niemand nötiger tue, als ein Friseur, wie er stets gesagt habe.
In dieses Getöse trat Hermann. Das Flattern und Mausern der Tauben über ihm, der Dunst und Geruch der Felle unter ihm, seine Unruhe und Ratlosigkeit hatten ihn aus der abscheulichen Nummer Zwölf ins Freie getrieben. Von einem gelaßnen Karrentreiber, der mit seinem Hundegespann, um besser hören zu können, bis vor die Tür des Zimmers gefahren war, in welchem die Kranke stöhnte, vernahm er die Geschichte. Er ließ sich den Namen des eingekehrten Herzogs sagen, und erschrak, diesmal aber freudig, als der Karrentreiber ihn aussprach. Er schloß aus der für ihn unerwarteten Neuigkeit auf die Nähe seines Dämons. Schnell kam ihm ein närrischer Einfall. Er wußte, daß, um zwei Verlegenheiten zu entgehn, es nichts Beßres gebe, als sich in eine dritte zu begeben. In die Küche eilend, nahm er dort Kohlen und Brenneisen, war blitzschnell die Treppe hinauf, ließ sich durch den Bedienten als den Mann melden, der die Herzogin frisieren solle, und stand bald darauf im Zimmer der Fürstin.
Die Dame saß im Lehnstuhl, das Gesicht von dem Haarkünstler aus dem Stegreife abgewendet, und las. Sie mochte an diesem Orte für ihr Haupt nichts Besondres hoffen, und sagte, vom Buche aufsehend, doch ohne sich umzukehren: »Nur ganz schlicht!« – Hermann blickte nach der Toilette, da war alles, was er brauchte. Er stellte sich hinter den Stuhl, und da ihm wirklich einige Reminiszenzen des Handwerks beiwohnten, so ging die Sache ganz erträglich vonstatten. Er prüfte mit Sorgfalt das Eisen, verfuhr behutsam, und so kam denn nach und nach etwas zustande, was wenigstens für die Skizze einer Frisur gelten durfte.
Freilich dauerte das Geschäft ziemlich lange. Die Herzogin, welche die Geduld selbst zu sein schien, brachte die Augen nicht von ihrem Buche. Als er dem Ende seines Werks nahte, meinte er, daß nun der Augenblick gekommen sei, den er erharrt hatte, und sagte: »Gnädigste Herzogin, der Geringste hat Rechte, die auch der Vornehmste nicht kränken darf. So ist es ein altes Privilegium meiner Zunft, daß diejenigen, welche ihr Haupt uns anvertrauen, sich auch unsrem armen und seichten Geschwätze hingeben müssen. Keiner ist davon befreit; selbst der König muß den Friseur plaudern lassen. Untersagt er ihm das, so bin ich überzeugt, daß der Mann das Elend der Verbannung einem stummen Herrendienste vorziehen würde. Ew. Durchlaucht haben gelesen; das hat mich tief verletzt. Ich überlasse Ihrer Gerechtigkeit, zu entscheiden, ob Sie mir nicht werden erlauben müssen, einige Worte zu Ihnen zu reden?«
Die Herzogin legte, erstaunt über diese Apostrophe, das Buch zusammen. Da Hermann schwieg, sagte sie mit einem verlegnen Lächeln: »Nun?«
»Ich habe etwas zu erzählen«, fuhr Hermann fort, »was freilich verdiente, ernsthafter eingeleitet zu werden. Ein Schauspieler will seine Tochter um ein Stück Geld der Erniedrigung, dem Elende preisgeben. Verzeihung, daß ich so unsaubre Dinge in Ew. Durchlaucht reiner Nähe ausspreche. Wer jenen Stand kennt, wer es weiß, wie seine Lügenkunst das Gemüt bis in die innersten Fasern verfälscht, der wird sich über dergleichen Schändlichkeiten kaum wundern. Ein solcher Mensch hat vielleicht jahrelang den Marinelli gespielt, und, wie er den Charakter auf den Brettern behandelte, gedankenlos, so gedankenlos überträgt er die Rolle auch wohl einmal in das Leben. – Ein sonderbarer Zug des Vertrauens führt das Mädchen zu mir, die Verzweiflung beschwört mich um Schutz vor der Entehrung. Ich bin sonst der Meinung, daß man sich vor allen raschen Verpflichtungen zu hüten habe. Oft wird ja durch ein fürwitziges Helfenwollen das Wirrsal nur noch größer. Hier aber überwältigte mich der Anblick der Not, ich versprach mich und alle meine Kräfte dem Mädchen. Aber wie soll ich für mein Wort einstehn, ohne Einfluß, ohne Verbindung in der Gegend, ich, ein junger Mann, der an und für sich der Welt in solcher Sache als ein zweideutiger Vormund erscheint. Da höre ich, daß Ew. Durchlaucht hier angekommen seien. Augenblicklich war meine Sorge gehoben. Ich wußte, daß ich einer solchen Fürstin den bösen Vorsatz eines ehrvergeßnen Vaters, die Trübsal der Tochter nur schmucklos zu melden brauchte, um Rat zu schaffen. Dieses habe ich denn hiemit getan, und nun meinen Worten nichts mehr hinzuzufügen.«
Mit so entschiednen Farben hatte unser Abenteurer diese Angelegenheit darzustellen sich gedrungen gefühlt. Die Herzogin hörte mehr auf den Ton seiner Rede, als auf den Inhalt. Der reine Dialekt, die gebildeten Wendungen hatten sie ganz verwirrt gemacht. Sie wußte nicht, was sie von dem Menschen denken sollte.
Hermann nahm ihr mit einer anständigen Verbeugung den Staubmantel ab. Ihr erster Blick war in den Spiegel. Sie sah sich wenigstens nicht verunstaltet. Ihr zweiter fiel auf Hermann. Wie erschreckt senkte sie die Wimpern, und eine Marmorblässe überzog die zarten, ohnehin nur leicht gefärbten Wangen. Noch einmal schickt sie zweifelnd und forschend ihren Blick aus, als wolle sie die Widerlegung eines Irrtums erspähn. Aber unwillkürlich flüsterte sie: »Mein Gott, welche Ähnlichkeit!«
Die Tür öffnete sich, und ein großer ernster Mann im schlichten Überrock trat ein. Es war der Herzog. »Ist der Not abgeholfen?« fragte er lächelnd. Dann, näher tretend, musterte er Hermann auch nicht ohne ein gewisses Erstaunen, doch schien die Befremdung weniger durch das Antlitz, als durch den Aufzug Hermanns veranlaßt zu sein, der im modischen Kleide, den Staubmantel der Herzogin auf dem Arme, und die Friseurwerkzeuge in den Händen, dastand.
»Ich bin von jemand bedient worden, den man wohl schwerlich zu diesem Gewerbe erzogen hat«; sagte die Herzogin.
»Der Rock sieht freilich nicht nach Kamm und Schere aus«, sagte der Herzog. »Wie heißen Sie?«
Hermann nannte sich. »Ist es möglich?« rief der Herzog. »Sie sind der Sohn des Senators in Bremen? des vertrautesten Freundes meines seligen Vaters?«
»Derselbe.«
Der Herzog konnte sich über dieses Zusammentreffen nicht zufriedengeben. »So unerwartet muß ich den Sohn des würdigen Mannes hier finden, von dem mein Vater nie ohne Rührung redete! Aber sagen Sie mir, wie kommen Sie darauf, sich bei uns in dieser wunderbaren Weise einzuführen?«
»Man muß überall aushelfen, wo es fehlt«, versetzte Hermann. »Unsrer Fürstin gebrach ein Mann der Pomade, ich konnte allenfalls so ein Subjekt notdürftig vorstellen, wie hätte ich anstehn sollen, mit meiner geringen Kunstfertigkeit zu dienen?«
Der Herzog fragte ihn lachend, wo er denn diese Geschicklichkeit erworben habe? Hermann versetzte, das dürfe er nicht verraten, das sei ein Handwerksgeheimnis.
Die Herzogin hatte an diesem Gespräche nicht teilgenommen, sondern nur von Zeit zu Zeit ihn verstohlen betrachtet. Ihr Gemahl raunte ihr ein Wort ins Ohr, worauf sie nickte, und Hermann eine Einladung zu Mittag empfing. Als er die Treppe hinabging, sagte er für sich: »Das hätte ich nicht gedacht, als ich im Feldzuge bei dem alten Perückenmacher im Quartier lag, und seine Tochter Lotte mich zu ihrem Werther machen wollte, und ich ihr aus Langerweile die Locken und die Touren fertigen half, daß mir die Possen noch einmal bei den vornehmsten Leuten helfen würden. In unsrer Zeit muß man sich auf alles schicken, denn man kann alles gebrauchen. Die Lotte und der alte Perückenmacher sollen leben!«
Fünftes Kapitel
»Welche Ähnlichkeit!« Diese Worte der Herzogin gaben ihm viel zu sinnen. Er fragte den Wirt nach der Ursache, weshalb das fürstliche Paar hier verweile? erfuhr aber nur, daß es eine Bewandtnis mit den Herrschaften haben müsse, denn es sei viel Fragens und Schickens nach dem alten verfallnen Schlosse in der Nähe gewesen, von dessen Bewohner man allerhand erzähle.
Ein langer grauer Mann von verdrießlichem Ansehn trat ein, und sagte zum Wirte: »Ich habe Sie so sehr gebeten, mir eine Stube ohne Zug zu geben, den ich durchaus nicht vertragen kann, und dennoch ist mir eine angewiesen worden, worin kein Fenster und keine Tür schließt. Ich habe nicht Lust, hier ungesund zu werden, und verlange von Ihnen auf der Stelle ein andres Quartier.«
Der Wirt versicherte, es sei alles besetzt, er werde aber sogleich Schreiner und Glaser kommen lassen, damit jede Ritze verleimt und verstopft werde.
Es war um die Zeit der Hundstage, und selbst dem entschiedensten Rheumatiker konnte ein kühles Lüftchen nur willkommen sein. Hermann hatte an der eigentümlichen Falte des Überdrusses um den Mund sogleich den Hypochondristen erkannt. Er trat höflich zu dem Verstimmten und sagte, daß er sich glücklich schätzen würde, wenn er ihm ein besseres Gelaß anzubieten vermöchte, das seinige werde aber auf jeden Fall wohl das allerschlechteste im ganzen Hause sein. Der andre maß ihn mit einem matten, sterbenden Blick, als verdrösse ihn jede Artigkeit, und ging, ohne ihm etwas auf seine freundliche Anrede zu erwidern, fort.
Hermann, sehr böse über dieses rauhe Benehmen, fragte den zurückkehrenden Wirt, wer jener Bär sei und erfuhr, daß er Wilhelmi heiße und bei dem Herzoge in Diensten stehe. Auch der Wirt nannte ihn einen eigensinnigen Kauz, dem nichts recht zu machen sei, »aber«, setzte er hinzu, »man muß ihn schonen, denn er ist des Herzogs rechte Hand.« Hermann beschloß im stillen, die Unart nicht so hingehn zu lassen.
Doch für den Augenblick hatte er eine dringendere Sorge. Im Überrocke setzt man sich bekanntlich nicht zu einer fürstlichen Tafel. Er aber besaß kein andres Kleidungsstück, er hatte sich erst in der nahen Stadt neu equipieren wollen. Lange dachte er darüber nach, was vorzunehmen? endlich erinnerte er sich aus der Geschichte der Moden, daß der Frack aus dem Überrock entstanden ist, indem nach und nach die Vorderblätter immer weiter und weiter weggeschnitten wurden. Er beschloß, diesen historischen Weg zu verfolgen, und erkundigte sich nach dem besten Schneider, der ihm leicht nachgewiesen werden konnte, da es nur einen am Orte gab.
Der Meister, welcher wegen der geringen Nahrung im Städtchen zugleich sein eigner Junge und Geselle war, saß mit gekreuzten Beinen auf dem Tische und nähte, was das Zeug halten wollte. Hermann trat in das kleine Stübchen, an dessen Wänden die papiernen Maße herabhingen, und welches durch verschmauchte Fensterchen sein spärliches Licht erhielt. Er sagte dem Meister, was er von ihm wolle, nämlich, er solle die Vorderteile des Rockes abschneiden, denn er habe einen Frack nötig. Der kleine blasse Mann kam von seinem Tische herab, tat die Brille hinweg, prüfte den Schnitt des Kleides, befühlte das Tuch, sah erschrocken empor, und fragte mit wehmütigem Tone: »In dieses Tuch soll ich hineinschneiden?«
»Es geht nicht anders, Meister«, versetzte Hermann, »es muß so sein«.
Der Meister schüttelte den Kopf, legte unschlüssig die Hände auf den Rücken, und murmelte: »So ein Rock! So ein Tuch! Schade! Jammerschade! Die Elle kostet wohl ihre drei Taler?«
»Mehr Meister, mehr.«
»Vier? Fünf?«
»Ich glaube, man hat mir acht auf die Rechnung gesetzt.
Rührt Euch, Meister, ich habe nicht lange Zeit.«
»Acht Taler die Elle! Gott!« war alles, was der Schneider hervorbringen konnte. Er ließ die Schere sinken; nur Ausbesserung und der gröbste Stoff war ihm sein Leben lang unter die Hände geraten. Jetzt erblickte er ein Prachtkleid, von dem seine seligsten Träume nichts wußten, und dieses sollte er verwüsten? Hermann sah nicht ohne Teilnahme dem Seelenkampfe dieses Männleins zu, dem ein feiner Rock zur höchsten Lebenserscheinung wurde. Endlich überwand sich der Meister, zeichnete in wilder Hast mit Kreide die Form auf dem Leibe ab, die Schere arbeitete, die Nadel flog, und bald war ein Frack fertig, wenn nicht von elegantem, doch von wohlgemeintem Schnitte. Hermann freute sich der Metamorphose, die so leicht vonstatten gegangen war. Schwieriger konnte es mit der Bezahlung werden, denn er hatte unterwegs für eine Kopfbedeckung seine Barschaft bis auf einen armseligen Rest ausgegeben. »Was sollen mir die Vorderblätter?« sagte er. »Meister, die wären so etwas für Euch, wollt Ihr sie an Zahlungs Statt annehmen?« – Der Meister war schon daran gewöhnt, von seinen Kunden in Naturalien, als Butter, Käse, Eiern u. dgl. bezahlt zu werden. Die Vorderblätter galten ihm weit mehr, als er fordern durfte, schon sah er sich im Geiste mit der Sonntagsweste aus dem Achttalertuche bekleidet; er schlug freudig ein.
Hermann klopfte ihm auf die spitzen Achseln und sagte: er sei recht geschickt gewesen. In so kurzer Zeit einen Frack zustande zu bringen, möchte nicht jedem gelingen.
Dieses Lob stieg dem Schneiderchen ins Gehirn. Triumphierend rief er: »O, ich habe auch nicht immer geflickt! Ich bin überhaupt nur durch Unglück hieher unter das dumme katholische Pack geraten.« Dann sich scheu umwendend, als fürchte er das Verhängnis einer großen Mitteilung, setzte er geheimnisvoll hinzu: »Ich habe schon einmal einen ganzen Rock gemacht! Der Herr Pastor an meinem früheren Orte wollte sich verheiraten; wie solche Herrn sind, sie haben kein Vertrauen zu unsereinem, er bestellte sich den Bräutigamsrock bei dem Modeschneider in der großen Stadt, den sie den Kleidermacher nennen. Mein Herr Kleidermacher ließ aber meinen Herrn Pastor sitzen. Der wollte zur Braut abreisen, kein Rock war da. Ich hörte von der Not und lief zu ihm. 'Er wird es nicht können', sagte er. 'Vertrauen Sie Gott', sagte ich. Ich ging nach der Stadt, kaufte Tuch, freilich nicht so fein, als das Ihrige, schneiderte Tag und Nacht, und siehe da! der Rock wurde fertig, und der Herr Pastor sind darin getraut worden, und haben darin das heilige Abendmahl ausgeteilt, und tragen ihn noch zur Stunde, und ich bin doch nur ein lumpiger Flickschneider!«
Seine Augen glühten, er hatte sich auf die Fußspitzen gestellt, und drei Finger der rechten Hand vorn in das aufgeknöpfte Wams geschoben. So stand er, und der siegreiche Feldherr, der gegen Abend die Meldung von der letzten eroberten Schanze empfängt, kann nicht stolzer aussehn.
Sechstes Kapitel
Das Gespräch an der Tafel drehte sich um sittlich-anthropologische Fragen.
»Wie kommt es nur«, sagte die Herzogin beim Dessert, »daß wir gleichgültiger gegen die Tugend als gegen die Höflichkeit sind? Wenn man durch seinen Stand gezwungen ist, viele Menschen zu sehn, so muß man auch mitunter Leute empfangen, deren Handlungen sich keineswegs billigen lassen. Ich kann nun wohl sagen, daß mich die Nähe solcher Personen wenig verletzt; unbefangen sehe ich sie kommen und gehn. Dagegen bin ich gleich aus meiner Fassung, wenn in meinem Kreise ein Verstoß gegen die Lebensart vorfällt.«
»Das rührt daher, weil wir alle, auch die Besten unter uns, nie den Hang vollkommen ablegen, uns nach außen zu vergeuden, statt daß wir streben sollten, nur nach innen wahrhaft zu leben«, erwiderte der Kammerrat Wilhelmi.
»Ich denke«, entgegnete die Herzogin, »man lebt in jedem Augenblicke zugleich nach innen und nach außen. Übrigens bitte ich Sie, mich nicht einer schlaffen Moral anzuklagen. Alles, was ich sagte, bezieht sich nur auf die gewöhnlichen gesellschaftlichen Zusammenkünfte, und wenn jene zweideutigen Figuren mich irgendwo im Heiligtume meiner Verhältnisse berühren, so machen sie mir auch Kummer genug.«
»Darin liegt die Antwort auf deine Frage«, versetzte ihr Gemahl. »Das Leben besteht, wo es nicht Geschäft ist, meistenteils aus Repräsentation. Unsittlichkeiten drängen sich uns nicht vor das Auge, wohl aber Roheit, Ungeschick. Was gehn uns also jene an, da wir niemandes Richter sind?«
Hier nahm Hermann das Wort, und sprach: »Vielleicht fordert keine Zeit mehr zur Beobachtung äußerer Sitte auf, als die unsrige. Alle Gegensätze sind bloßgelegt, wo irgend Menschen zusammenkommen, bringen sie die widersprechendsten Gefühle und Überzeugungen in betreff der wichtigsten Dinge mit. Politik, Religion, das Ästhetische, ja selbst, was im Privatleben erlaubt sei? alles ward zum Gegenstande des Zwiespalts. Wie kann man sich aber mit Behagen nebeneinander sehn, wenn nicht wenigstens auf der Oberfläche die in der Tiefe zürnenden Geister beherrscht werden, wenn nicht die strengste Regel der Konvenienz, welche jedem Kunstwerke notwendig ist, waltet? Und die gute Gesellschaft ist doch, wie man mit Recht gesagt hat, eine Art von Kunstwerk, oder sollte wenigstens eins sein.«
»Am schlimmsten hat man es mit den Gelehrten«, sagte der Herzog. »Ich lade auch nie zwei zu gleicher Zeit ein. Denn ich bin dann nicht sicher, daß die Herrn über einen alten römischen König, oder eine Sprache, von der man nur vermutet, daß sie einmal gesprochen sein soll, einander Beleidigungen sagen.«
»Auch die Hypochondristen sind böse Gäste!« rief Hermann.
Die Herzogin warf lächelnd einen Seitenblick auf Wilhelmi, der die ganze Tafel über sein verdrießliches Gesicht noch nicht abgelegt, und, sooft die Tür aufging, ängstlich mit den Händen den Kopf bedeckt hatte, obgleich, wie wir bemerkt haben, die Hitze der Hundstage herrschte. Sie meinte, Hermann solle sich in acht nehmen, er werde da Widerspruch bekommen.
Angereizt vom Lächeln der Dame, rief dieser aus: »Muß ich doch mich selbst verurteilen, wenn von jenen Übeln geredet wird! Ich hatte immer gehört, daß man heutzutage, um interessant zu erscheinen, unzufrieden und kränklich sein müsse. Da die Natur mir aber beide Eigenschaften versagt hatte, so bestrebte ich mich, durch Kunst dieselben hervorzurufen, denn ich wollte nun einmal nicht so unbedeutend durch das Leben gehn. Fürs erste schaffte ich mir eine finstre Miene an, und sah aus, als ruhe die Last der Welt auf meinem Busen. Es war aber nicht so schlimm; das Essen und Trinken schmeckte mir dabei, und ich schlief mit meinem Grame bis an den Morgen. Aber so schon begann ich zu gelten, einige Damen wollten selbst etwas Byronsches an mir bemerken. Es kam nur noch darauf an, krank zu werden. Ich rief die Einbildungskraft zu Hülfe, und richtete meine Aufmerksamkeit stundenlang auf mich selbst. Ich fragte mich so lange und so ernstlich: 'Tut dir nicht da und da etwas weh?' bis es mir endlich vorkam, als tue mir da und da etwas weh. Nicht mit Darstellung der ganzen Methode will ich Ew. Durchlaucht ermüden, nur so viel darf ich versichern, daß ich es in Erzeugung der Schmerzen bis zur Virtuosität gebracht habe. Kopfgicht, Armweh, Brustkrampf, Podagra, jegliches Übel kann ich nach Gefallen hervorbringen. Denke ich zum Beispiel nur daran, daß jene Tür aufgetan werden möchte, so wütet schon ein ganzes Heer von Rheumatismen mir durch Kopf und Genick.«
Diese Beziehungen waren zu deutlich, um nicht verstanden zu werden. Beide Herrschaften hielten den Kammerrat, wie es solchen Leidenden zu gehn pflegt, für krank in der Einbildung. Sie sahen in einer Mischung von Verlegenheit und Schadenfreude auf ihre Teller. Hermann genoß seinen Sieg; aber nicht lange. Wilhelmi hatte ganz gefaßt dessen Rede mit angehört. Als nun die Pause, die nach dem Schlusse derselben entstanden war, nicht enden wollte, sagte er freundlich zu ihm:
»Was Sie vorhin von der Notwendigkeit der feinen Lebensart äußerten, hat mir sehr gefallen.«
Hierauf wurde Hermann rot und stotterte einige Worte, die wie ein Dank für den ihm erteilten Beifall klangen. Die Herrschaften aber taten, als gehe sie der letztre nichts an. Die Herzogin rückte den Stuhl, und die Tafel ward aufgehoben.
Er war mit dem Herzoge allein. Die Gemahlin sprach in einem Nebenzimmer mit dem verdrießlichen Freunde über wichtige Angelegenheiten, welche das fürstliche Paar in diesen jämmerlichen Ort geführt hatten.
Der Herzog schien sich für den Jüngling zu interessieren, er fragte ihn nach dem Zwecke seiner Reise. Hermann versetzte, daß er sich auf der Wandrung befinde, um seinen Oheim, den großen Fabrikherrn, den er noch nie gesehen habe, zu besuchen.
»Da werden Sie einen merkwürdigen Charakter kennenlernen«, sagte der Herzog. »Ich mache oft Geschäfte mit ihm. Er steht ganz einzeln in der heutigen Welt da, und vergegenwärtigt mir immer das Bild eines Bürgers der Hansa. Ihr Vater und er sind ein sehr eigentümliches Brüderpaar gewesen.«
»Sie lebten beide, wo nicht in Haß, doch in stiller Entfremdung«, sagte Hermann. »Ich will nun versuchen, ob der Oheim gegen mich auftaut. Wahr ist es: wenn ich an meinen Vater zurückdenke, so suche ich vergebens nach seinesgleichen in der Gegenwart. Er war mit Sinn und Lebensgewohnheit ungefähr in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stehngeblieben. Von daher schrieben sich die großblumigen Tapeten seines Zimmers, die geschnörkelten Meubles, der Zuschnitt seines Rocks; an welchen Dingen allen er mit hartnäckiger Strenge festhielt. Und doch soll er als junger Mensch munter und beweglich gewesen sein. Aber etwas Störendes scheint plötzlich seinen ganzen Organismus gehemmt zu haben. Überhaupt liegen die Erinnerungen an meine Eltern wie Märchen hinter mir, an deren Wahrheit zu glauben, mir oft schwerfällt.«
Er erzählte noch manches von seinem väterlichen Hause, welches wir später an geeigneter Stelle einschalten werden. Der Herzog, welcher großen Anteil an allem, was aus dieser Familie herrührte, nahm, fragte nach Hermanns Studien und Lebensgange, worauf er die gewöhnliche Geschichte eines unsrer jungen Männer hörte. Hermann hatte als Siebenzehnjähriger den Befreiungskrieg mitgemacht, als Zwanzigjähriger auf der Wartburg gesengt und gebrannt, und war dann auch in jene Händel geraten, welche die Regierungen so sehr beschäftigt haben.
»Indessen«, fuhr er fort, »war ich der Torheiten selbst bald müde geworden. Und, als wolle mich das Geschick für diese zeitige Reue belohnen, meine Rhadamanthen fanden, daß ich zum Ravaillac verdorben sei, und entließen mich nach kurzem Verhör.« Er erzählte weiter, daß er sodann die jetzt gewöhnliche Reise durch Frankreich, England und Italien gemacht habe, demnächst aber in den Dienst des wegen seiner Verwaltung berühmten Staats als sogenannter Referendarius getreten sei.
»Sie sind noch in dieser Anstellung?« fragte der Herzog.
Hermann trat drei Schritte zurück, schöpfte tief Atem und rief: »Nein, Ew. Durchlaucht, in dieser Anstellung bin ich gottlob! nicht mehr. Nachdem ich die Welt gesehen, in Rom und Neapel meine Seele ausgeweitet, in London und Paris mich in die bewegten Wogen großer Völker gestürzt hatte, mußte ich nun mit erheucheltem Ernste protokollieren und expedieren über Dinge, die selten des Federzugs wert waren. Anfangs, solange mir die Handgriffe noch neu waren, trieb ich die Sache wie einen mechanischen Scherz, bald aber ergriff mich die furchtbarste Langeweile, und ein unergründlicher Ekel an meinen Tagen, welche sich in diesem trocknen Nichts dürr und farblos verzettelten. Das altweiberhafte Helfenwollen, wo die Natur schon immer für die Hülfe gesorgt hatte, das Bevormunden von Menschen, welche gewöhnlich klüger waren, als die Herren Vormünder, dieses norddeutsche Vielgeschrei und Vieltun! Die unendlichen, müden Sessionen! Kein Blick aus der quetschenden Grube in die lichte Tageshelle des Geistes, alles umbaut mit Kabinettsbefehlen, Paragraphen, Instruktionen, Akten, Tintefässern, Sandbüchsen! Mir war in dem Getreibe zumute, wie in einer ewig klappernden und sausenden Mühle; nur das Mehl sah ich nie, welches zu gewinnen, so viele Räder sich abarbeiteten. Zum ersten Male in meinem Leben war ich unglücklich, und als ich das recht empfunden hatte, fragte ich mich: 'Warum bist du es denn?' – Da tat ich mit beiden Füßen einen großen Schritt in die Freiheit, und als ich die Tore der Marterstadt hinter mir hatte, jauchzte ich laut, wie Orestes, als die Furien von ihm abließen, und – ich schäme mich des Bekenntnisses nicht – ich habe mich zu Boden geworfen, und habe die grüne Erde geküßt, der ich nach der Fahrt durch ein wüstes Papiermeer nun erst wieder anzugehören glaubte. Nein, Ew. Durchlaucht, ich bin nicht mehr Referendarius! Ich überlasse das Metier den geistigen Nihilisten, deren ganzer Stolz darin besteht, eine Sache mehr abgemacht und aus der Welt geschafft zu haben, während der geringste Handwerker sich freut, ein sichtbares Produkt von seiner Hände Arbeit in die Welt setzen zu können.«
Hermann trocknete von der Stirne den Schweiß ab, in welchen ihn diese leidenschaftliche Herzensergießung versetzt hatte. Der Herzog strich mit einer leichten Bewegung der Hand ihm über die Achsel, als wolle er da etwas wegwischen. Betroffen sah Hermann nach der Stelle hin; er wußte nicht, was die Gebärde bedeuten sollte.
»Beruhigen Sie sich«, sagte der Herzog. »Es kam mir nur so vor, als sei da noch etwas Asche von den Feuern der Wartburg sitzen geblieben!«
Siebentes Kapitel
Inzwischen hatten sich andererorten im Gasthofe wichtige Ereignisse zugetragen. Der Wirt war nämlich nicht so bald innegeworden, daß sein verachteter Gast bei dem Herzoge speise, als er zu seiner Frau sagte, daß man einen solchen Herrn unmöglich auf Nummer Zwölf lassen könne. Nun war aber guter Rat teuer, denn zwischen Vormittag und Nachmittag hatte sich neuer Besuch eingefunden, so daß jetzt wirklich kein Zimmer mehr leer stand. Endlich schlug die Wirtin vor, die
Kammerjungfer der Fürstin nach Nummer Zwölf zu verweisen, und Hermann dagegen die von ihr bewohnte Nummer Vier zu geben.
Wo es Ungerechtigkeiten und Schelmenstücke galt, war der Wirt mit seiner Gattin immer einverstanden. Die Jungfer war, um nach ihrem Anfalle frische Luft zu schöpfen, spazierengegangen. Die redliche Wirtin unternahm es, ihr bei der Rückkunft vorzuspiegeln, daß die Decke in Nummer Vier eingestürzt sei, und daß dieser Umstand eine Quartierverändrung notwendig gemacht habe.
Als Hermann vom Herzog kam, wurde er vom Wirt mit vielen Kratzfüßen nach seinem neuen Zimmer, welches sich in einem Nebenhause befand, geführt. Er freute sich der reinlichen Wohnung und des Blicks nach hinten hinaus über grüne Wiesen. Aber leider sollte dieser ruhige Besitzstand bald gestört werden.
Denn er hatte kaum einige Minuten dort zugebracht, als er auf der Treppe ein heftiges Gezänk hörte. Die Jungfer war in den Gasthof zurückgekehrt, hatte von der Wirtin die Umquartierung vernommen und Nummer Zwölf besichtigt. Der Anblick dieses schauderhaften Gelasses setzte sie bei ihrer cholerischen Gemütsart in einen großen Zorn. Über den Hof streichend, fand sie die Wirtin an der kleinen Treppe im Nebenhause, und überschüttete die Frau mit einer Flut von beleidigenden Worten.
Hermann riet dem Wirte, den er gern loswerden wollte, hinunterzugehn, und seiner Frau beizuspringen. Der Wirt blieb aber, machte ein ängstliches Gesicht, und rief, indem er an den Nägeln kaute: »Wir haben den Skandal hier oben noch früh genug!«
Diese Besorgnis war nur zu gegründet. Denn alsobald betraten beide Frauenzimmer die Stube, die Jungfer, mit Händen und Füßen vorwärtsstrebend, die Wirtin, vergeblich bemüht, sie am Rocke zurückzuhalten. Jene hatte sich mit eignen Augen überzeugen wollen, ob die Decke in Nummer Vier wirklich eingestürzt sei. Da sie nun sah, daß dieselbe so heil war, wie ein neugebornes Kind, so erstarrte sie anfangs über die Tücke der Wirtsleute zu einer stummen Bildsäule. Dann aber brach ein solcher Schwall von Verwünschungen aus ihrem Munde, daß man sich nur wundern muß, wie das Haus stehnbleiben konnte. Sie beschränkte sich nicht auf die eigentlichen Übeltäter, sondern ging bald auch zu Schmähungen unsres Freundes über. Dieser, gescholten, er wußte nicht, weshalb, fragte nach der Reihe herum, was denn der ganze Auftritt bedeuten solle? Aber keiner gab ihm Antwort. Die Kammerjungfer schrie, in die Höhe deutend: »Ist da etwas eingestürzt?« Der Wirt schrie: »Bedenken Sie, daß ich Ihr heute morgen die Daumen aufgebrochen habe!« – »Ist dieses der Dank dafür, daß Sie uns das Bett zerrammelt hat?« schrie die Wirtin.
Während dieses Geschreis war eine neue Figur an der offnen Tür erschienen. Den Reitknecht Wilhelm hatte der Lärmen herbeigezogen; er kam, die kurze Pfeife im Munde. Als die Jungfer den Dienstgenossen erblickte, lebten in ihr alle Hoffnungen auf; sie lief zu ihm, und beschwor ihn bei der Ehre des Stalls und der Gesindestube, ihr das gegen göttliche und menschliche Rechte entrißne Zimmer wiedererringen zu helfen. Es hätte so dringender Worte nicht bedurft. Der brave Kerl war selbst auf den Wirt und dessen schlechten Hafer böse, und eine Gelegenheit, ihm etwas anzuhaben, kam ihm grade erwünscht.
Es rückte nunmehr die Heersäule der Bundesgenossen vor; die Kammerjungfer, mit einer Elle bewaffnet, die sie irgendwo gefunden hatte, der Reitknecht, sich verlassend auf seine derben rotbraunen Fäuste. Sofort duckte sich der Wirt mit seiner Gattin zwischen zwei Stühlen nieder. Hermann, der endlich merkte, worum es sich handle, rief wiederholentlich; »Hört mich an!« Es achtete aber niemand seiner, und nun beschloß er, vorerst die Entwicklung der Begebenheiten abzuwarten. Er zog daher einen Tisch vor das Sofa, auf dem er saß, um sich gegen alle gezwungne Teilnahme an den drohenden Ereignissen der nächsten Zukunft zu sichern.