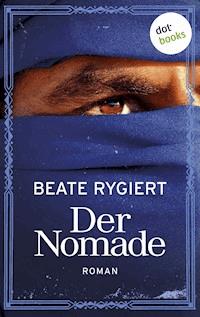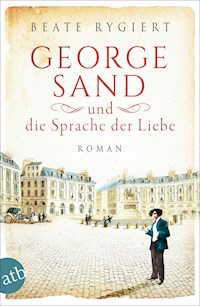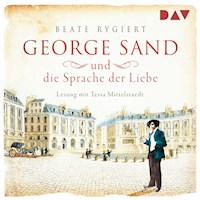4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Caroline erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter noch lebt, ist sie tief erschüttert: Nicht nur, dass ihr Vater sie jahrelang belogen hat - warum hat ihre Mutter nie nach ihr gesucht? Nachdem dann auch noch ihre Gärtnerei bei einem Unwetter zerstört wird, bricht sie endgültig alle Brücken hinter sich ab und begibt sich auf eine Reise ins Unbekannte, um ihre Mutter zu suchen.
Auch Gregors Welt gerät ins Wanken, als er die Urne mit der Asche seines Patenonkels erbt. Gregor, der eigentlich nichts für Sentimentalitäten übrighat, soll seinem Patenonkel einen letzten Wunsch erfüllten und dessen Asche dem Meer übergeben. Nach anfänglichem Zögern schmeißt er alles hin und macht sich auf den Weg.
Auf der Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal begegnen sich Caroline und Gregor immer wieder. Und so unterschiedlich sie sind, haben sie doch eine große Gemeinsamkeit: die Suche nach ihrer Vergangenheit, der Wahrheit und Antworten auf die wichtigen Fragen im Leben.
Ein Roadtrip mit zwei bemerkenswerten Menschen und eine Liebesgeschichte, die eigentlich gar keine werden soll.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
ERSTER TEIL: Die Überwindung der Schwerkraft
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
ZWEITER TEIL: Das Gesetz der Bewegung
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
DRITTER TEIL: Die Eroberung des Himmels
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Impressum
Über dieses Buch
Als Caroline erfährt, dass ihre totgeglaubte Mutter noch lebt, ist sie tief erschüttert: Nicht nur, dass ihr Vater sie jahrelang belogen hat – warum hat ihre Mutter nie nach ihr gesucht? Nachdem dann auch noch ihre Gärtnerei bei einem Unwetter zerstört wird, bricht sie endgültig alle Brücken hinter sich ab und begibt sich auf eine Reise ins Unbekannte, um ihre Mutter zu suchen.
Auch Gregors Welt gerät ins Wanken, als er die Urne mit der Asche seines Patenonkels erbt. Gregor, der eigentlich nichts für Sentimentalitäten übrighat, soll seinem Patenonkel einen letzten Wunsch erfüllten und dessen Asche dem Meer übergeben. Nach anfänglichem Zögern schmeißt er alles hin und macht sich auf den Weg.
Auf der Reise durch Frankreich, Spanien und Portugal begegnen sich Caroline und Gregor immer wieder. Und so unterschiedlich sie sind, haben sie doch eine große Gemeinsamkeit: die Suche nach ihrer Vergangenheit, der Wahrheit und Antworten auf die wichtigen Fragen im Leben.
Ein Roadtrip mit zwei bemerkenswerten Menschen und eine Liebesgeschichte, die eigentlich gar keine werden soll.
Über die Autorin
Beate Rygiert wurde in Tübingen geboren und wuchs im Nordschwarzwald auf. Mit zwölf schrieb sie in ihr Tagebuch: »Eigentlich möchte ich Schriftstellerin werden!« Diesen Traum verwirklichte sie nach dem Studium der Musik- und Theaterwissenschaft und der italienischen Literatur in München und Florenz und nach einigen Jahren als Operndramaturgin an verschiedenen deutschen Bühnen. Ihre Romane erobern die Bestsellerlisten und werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Heute lebt sie mit ihrem Mann im Schwarzwald, in Andalusien und immer wieder in Frankreich.
BEATE RYGIERT
Die Eroberung desHimmels
ERSTER TEILDie Überwindung der Schwerkraft
ERSTES KAPITEL
… in dem Caroline eine Postkarte erhält und dreimal rot sieht
Sechsundzwanzig Jahre war meine Mutter tot. Dann schrieb sie eine Postkarte.
»Wie geht es Dir? Was macht die Kleine? Über Pfingsten bin ich in Deutschland. Vielleicht schau ich mal vorbei. A.«
Auf der Vorderseite eine felsige Küstenlandschaft mit viel stürmischem Himmel darüber. Eine französische Briefmarke.
Ich stehe mitten in meinem Gewächshaus, die Etiketten der Firma kleben noch auf den Glasscheiben, es ist ein blitzblanker Morgen im März, die Sonne fingert sich hartnäckig durch die Wedel der Dicksonia brasiliensis, deren schneckenförmige Triebe ich gerade mit Wasser und Nährlösung besprüht habe, überall der hellgrüne Widerschein meiner Pflanzenwelt, in der ich es mir all die mutterlosen Jahre prächtig eingerichtet habe, all die Jahre, in denen mein Vater mir erzählte, sie sei gestorben, gleich nach meiner Geburt, und das mit einem solchen Weh in der Stimme und Schmerz in den Augen, dass ich nur ganz selten gewagt habe, nach dieser Mutter zu fragen, – sie ist tot und mehr gibt es nicht zu erzählen, sagte mein Vater. Jetzt steht er dort zwischen meinen Farnen, mit eingezogenen Schultern und hängendem Kopf, zu feige, um mir in die Augen zu sehen, ein Lügner, mehr nicht.
Und ihn habe ich einmal so bewundert.
Nein, das kann nicht wahr sein, das ist ein Scherz, wenn auch kein besonders guter, das ist unmöglich, so schnell steht eine tote Mutter nicht auf aus ihrem Grab. Überhaupt, fällt mir ein: Dieses Grab, an das er mich führte, als ich doch einmal nach ihr fragte, der verschlungene Namenszug auf grauem Stein, darüber ein Engel mit Palmzweig, AN-GE-LA, entzifferte ich damals. Ich war sechs Jahre alt und gerade dabei, die Welt der Buchstaben zu erobern. »Angela«, sagte mein Vater, von dem ich damals noch nicht wusste, dass er ein Lügner ist, »das heißt Engel.« Ich betrachtete die Figur auf dem Stein genau, von da an hatte meine Mutter ein Gesicht.
Aber es ist kein Scherz. Mein Vater, der Lügner, findet endlich seine Stimme wieder, redet und fuchtelt mit den Händen, der Schweiß läuft ihm von der Stirn, und das liegt nicht allein am tropischen Klima, das meine Farne zum Leben und Wachsen brauchen. Er redet und redet, und keines seiner Worte dringt in mein Bewusstsein, ich sehe seine ängstlich huschenden Augen, seine fahrigen Bewegungen, betrachte ihn wie einen Fremden und stelle fest: Er ist alt geworden, das Haar farblos und dünn, die Züge schlaff. Sebastian Nadler, denke ich, Professor der Anthropologie, spezialisiert auf Totenkulte, Schwarm aller Studentinnen, Star jedes Symposiums, internationale Koryphäe in Sachen Grablegung, strahlender Held von Kyros und Nephtalos – im Grunde bist du nichts anderes als ein Versager. Und wie er so immer weiterredet, von einem Bein auf das andere tritt und wortreich versucht zu erklären, was nicht zu erklären ist, nicht in Hunderten von Jahren, denke ich: Auch du wirst dich eines Tages hinlegen und sterben, und dann werden wir dich in ein Grab legen – aber glaube bloß nicht, dass ich kommen werde, wie ich heimlich an das Grab mit dem Engel gelaufen bin, eine frische Blume in der Hand, später kleine Pflanzen, die ich einbuddelte und dann rasch davonlief, als hätte ich kein Recht, das zu tun. Dass ich tatsächlich kein Recht dazu hatte, das sehe ich nun klar und deutlich ein. »Wer zum Teufel war diese Angela in dem Grab?«, unterbreche ich ihn mitten in seinem Redestrom.
»Welches Grab?«, fragt da mein Vater, der Lügner. Ja. Er sagt wirklich: »Welches Grab?« Er kann sich tatsächlich nicht erinnern.
»Geh nach Hause«, sage ich. »Erzähl deine Lügen anderswo. Vielleicht finden deine Studentinnen sie ja irgendwie charmant.«
Später sitze ich in meinem grünen Lieferwagen und kämpfe mich durch den Verkehr in Richtung Innenstadt. Ich fluche und schimpfe und haue mit der Faust auf die Hupe, da sich vor mir wieder einmal die Autos ineinander verknäulen und keiner dieser elenden Blechbüchsenfahrer bereit ist, auch nur einen Millimeter nachzugeben, stur auf seinem Vorrecht besteht, bis sie schließlich aussteigen, die feinen Herren, ihre Anzugsjacken ausziehen, ordentlich auf den Beifahrersitz legen, die makellos weißen Hemdsärmel in aller Ruhe hochkrempeln, um sich eine Minute später die Nasen blutig zu schlagen. Alle anderen glotzen neugierig hinter ihren Scheiben hervor, da fühle ich, wie etwas in mir platzt, ganz still und leise, etwas, das über Jahre gewachsen ist, und ich steige ebenfalls aus, erwische einen der Kampfhähne am Arm und wirble ihn herum, mische mich ein, was ich in meinem ganzen Leben noch nie getan habe, bin auch noch nie so geschickt einem Haken ausgewichen, habe niemals, ich schwöre es, selbst mit der Faust zugeschlagen, und in der Millisekunde, bevor meine Rechte dieses fremde, erstaunte Gesicht trifft, verwandelt es sich in das Gesicht meines Vaters. Aber da kassiere ich selbst einen Schlag, der mich in die Realität zurückbringt, Mensch, tut das weh. Caroline, sag ich mir, du prügelst dich hier auf der Straße mit völlig fremden Menschen, doch es gibt kein Zurück mehr, und kurz darauf sitze ich auf der Polizeiwache, gemeinsam mit den beiden feinen Herren, und blute aus der Nase.
»Das müssen Sie sich mal vorstellen«, sage ich dem Wachtmeister. »Sechsundzwanzig Jahre lang ist Ihre Mutter tot. Und dann schreibt sie Ihnen eine Postkarte.«
In seinem Gesicht kann ich lesen wie in einem Buch: Entweder ich schick sie in die Psychiatrie und hab eine Menge Scherereien, denkt er, oder ich lass sie laufen. Aus dem Nachbarraum klingt die Radioübertragung eines Fußballspiels. Er seufzt und schickt mich nach Hause.
Aber ich gehe nicht nach Hause. Ich wasche mir auf der Toilette des Reviers das Gesicht. »Alles halb so wild«, sage ich zu meinem Spiegelbild. »Alles halb so wild. Du hast eine Mutter, was ist daran so schlimm? Jetzt setzt du dich in deinen Wagen und fährst zu dieser Werbeagentur. Schließlich hast du ein Geschäft.«
Es ist mein erster großer Auftrag. Drei Fuhren Farne für eine Präsentation. Nicht verkauft, sondern vermietet. Vor zwei Wochen kam ein Mann in mein Gewächshaus, sah sich alles an und machte mir diesen Vorschlag.
»Schreiben Sie uns ein Angebot«, sagte er. »Was es kostet, Ihre Pflanzen für drei Tage zu mieten. Sie bringen sie, stellen sie auf, holen sie wieder ab.«
»Wie viele Pflanzen sollen es denn sein?«, frage ich.
Er macht mit dem Arm eine vage Bewegung.
»Alle. Und vielleicht noch ein paar mehr. Können Sie noch mehr auftreiben?«
Klar konnte ich. Viel schwieriger war es, das Angebot zu schreiben. Zwei volle Abende schwitzte ich darüber. Dreimal schrieb ich es neu, und als ich es endlich abschickte, hatte ich das Gefühl, zu teuer zu sein und den Auftrag zu verlieren. Als das Angebot schon am nächsten Morgen unterschrieben und bestätigt durch mein Faxgerät lief, war ich mir sicher, ich hatte es doch zu niedrig kalkuliert.
Vollends überzeugt davon war ich, als ich die erste Ladung Farne an den Ort des Geschehens brachte. Die Basilika stand auf der rauchfarbenen Visitenkarte, die mir Arndt Godenflo, Artdirector, in die Hand gedrückt hatte. Und das war nicht gelogen, als ich die Farne anlieferte, fand ich mich vor einer veritablen Kirche. Innen allerdings war alles anders: Dort, wo einst die Gläubigen in stiller Andacht die Hand in das Weihwasserbecken tauchten und sich nach dem Gesangbuch umsahen, befindet sich heute ein Empfangsbereich mit Theken aus Edelstahl und Marmor. Zwei Mädchen, die auch auf einem Laufsteg eine gute Figur machen würden, lächeln dem Besucher entgegen. Dahinter öffnet sich der Blick in ein gewaltiges Kirchenschiff. Purpurrote und ultramarinblaue Glasfenster bündeln hoch oben das Licht und lenken es auf einen Fußboden aus cremefarbenem Travertin. In den Seitenschiffen schweben gläserne Kästen wie Aquarien, darin tummeln sich bunte Menschen. Dort, wo früher einmal der Altar stand, befindet sich der größte Flachbildschirm, den ich je in meinem Leben gesehen habe, dahinter im Chor eine Wand aus Monitoren, auf denen Bilder rhythmisch wechseln, Symmetrien bilden, sich zu einem einzigen, riesigen Bild zusammenfügen, um dann wieder auseinanderzufallen in Wogen und Wellen.
»Willkommen in der Basilika von ›Schmidt-Hoss & Beer‹«, begrüßt mich Arndt Godenflo. »Haben Sie die Farne dabei?«
Vor drei Tagen also verwandelte ich dieses Kirchenschiff in eine grüne Oase. Ein ganzes Heer hilfreicher Geister errichtete unter meiner Anleitung Podeste, die ich so arrangierte und bepflanzte, dass man die Aufbauten darunter nicht mehr erkennen konnte. An Stahlseilen befestigte ich große Arrangements, die von der Decke herabgelassen wurden, sodass es am Ende aussah, als sei über Nacht ein Urwald in die Kirche hereingewuchert und hätte sich dieses riesigen Raumes bemächtigt.
»Achten Sie unbedingt auf das Raumklima«, schärfte ich Arndt Godenflo ein und erklärte ihm die Handhabung der vier Luftbefeuchter. »Und die richtige Temperatur. Sonst lassen die alle morgen schon die Wedel hängen.«
Was es genau mit der Präsentation auf sich hatte, habe ich nicht herausbekommen. Ich sah eine Weile zu, wie eine theatertaugliche Beleuchtungsanlage installiert wurde und hatte eine Idee. Und aus diesem Grund fahre ich jetzt schon zur Basilika, und nicht, wie vereinbart, erst heute Abend: Heimlich, still und leise werde ich von der Empore aus ein paar Fotos machen, und bevor ich eine abschlägige Antwort erhielt, fragte ich lieber gar nicht erst um Erlaubnis, mich bekommt ohnehin niemand zu sehen, denn hinter der Sakristei entdeckte ich eine Treppe, die seitlich hinauf zur Empore führt …
Auf die Idee, eine Werbeagentur in einer Kirche zu betreiben, muss man erst einmal kommen, denke ich, als die Fassade vor mir auftaucht. Heute blinkt es im Hof nur so von edlen Karossen. Keine Chance für meinen Lieferwagen. Ich umkreise die Kirche, finde schließlich einen passenden Parkplatz. Dann biege ich den Rückspiegel zurecht und starre in mein Gesicht. Unter der Nase blüht eine leichte Schwellung auf.
Du hast eine Mutter, sage ich stumm zu meinem Spiegelbild, all die Jahre hattest du eine Mutter und wusstest es nicht. Eine wilde Freude wirbelt in mir auf, reißt an meinen Innereien, lässt sich dann direkt unter meiner Kehle nieder und verwandelt sich in einen stechenden Schmerz. Ich presse die Augen zusammen, sehe die Brandung an einer felsigen Steilküste, darüber in ausladender Schrift: »Wie geht es Dir, was macht die Kleine …«
Angela. All die Jahre hat sie sich nicht für mich interessiert. Was ist von einer solchen Mutter zu erwarten?
Die digitale Kamera in der Hosentasche, schleiche ich mich in das Allerheiligste der Werbewelt ein, durch den Lieferanteneingang in die Sakristei, höre wummernde Discomusik, Lachen und Stimmengewirr. Davon haben Organisten früherer Generationen wohl kaum geträumt auf ihrem Weg die Wendeltreppe hoch zur Orgel. Oben ducke ich mich rasch hinter eine Säule, denn dort, dem Altarraum genau gegenüber, steht ein Mann, aufrecht und ernst, und betrachtet die Szene unten im Kirchenschiff in der Haltung eines Kapitäns, der auf der Brücke seine Mannschaft überwacht. Ganz still steht er da, dann gibt er sich einen Ruck und verschwindet.
Ich spähe hinunter, gleite in der Deckung der Säulen voran auf der Pirsch nach dem besten Blickwinkel, komme mir vor wie James Bond beim Eindringen in die Höhle des Bösewichts, bis mir klar wird, dass meine Kamera diesem Kirchenschiff in seiner Tiefe und Weite bei der spärlichen Beleuchtung nicht gewachsen ist. Auf dem Screen jedenfalls ist nicht mehr zu erkennen als eine grün gefleckte Schwärze.
Enttäuscht stecke ich sie in die Tasche meiner Jeans und lehne mich gegen einen viereckigen Kasten, von denen hier vier herumstehen. Zu sehen ist tatsächlich nicht viel. Rauchschwaden steigen zwischen den grünen Inseln auf, Mädchen mit so etwas wie Kleidern aus Farnwedeln balancieren neongrüne Getränke auf Tabletts, der Flachbildschirm zeigt Bilder von einer Getränkedose und punkig gekleideten Kindern, die in verdrehten Posen aus diesen Dosen zu trinken versuchen. Irgendwie beschleicht mich ein ungutes Gefühl, eine Vorahnung, ich nehme die Witterung auf, ja, da stimmt etwas nicht, die Luft hier oben ist trocken, viel zu trocken, wie es wohl meinen Farnen da unten geht? Um besser sehen zu können, lehne ich mich vor und erkenne die Gestalt von Arndt Godenflo, der etwas abseits mit dem Mann spricht, der eben genau an dieser Stelle hier stand. Er nickt, eilt weiter und gibt ein paar Zeichen. Und dann bricht der Teufel los, die Discorhythmen verdichten sich zu einem Song, ein Mann wirbelt durch die Pflanzen, springt auf eine besonders prächtige Dicksonia und beginnt zu singen, ein ziemlich dämliches Lied, »Gib dir den Dschungel, dschunga, dschunga« oder so ähnlich, aber ich höre schon nicht mehr richtig hin, will zur Treppe rennen und stoße mir böse die Schienbeine an. Und erkenne, woran ich mich gelehnt habe, was nutzlos hier oben auf der Empore herumsteht. Es sind die Luftbefeuchter, die ich mit viel Mühe und für teures Geld ausgeliehen, eigenhändig eingestellt und diesem Idioten von einem Artdirector erklärt habe, und da unten stehen meine Farne wer weiß wie lange schon in einem absolut schädlichen Klima, eingeräuchert und misshandelt.
Zum zweiten Mal an diesem Tag sehe ich rot. Ich stürze die Treppen hinunter, bin schon mitten im Getümmel, hab nur eines im Auge: meine Pflanzen zu retten, denn wenn ich mich auf etwas verlassen kann in diesem Leben, das zeigt dieser Tag wie kein anderer, dann sind es meine Farne, Mondraute, Adlerfarn, Engelsüß und Hahnenkamm, und ich werde nicht zulassen, dass diese Verrückten sie umbringen, auf ihnen herumturnen, ihre Kippen an ihren Rhizomen ausdrücken, sich auf die Triebe setzen, was kann ich dafür, dass in dieser Veranstaltung die Bestuhlung fehlt, aber ich komme zu spät, der Schaden ist enorm, eingerollte und vertrocknete Spitzen, geknickte, ja, sogar abgerissene Zweige, Glasscherben zwischen neonfarbener Limonade in den Wurzelstöcken, und dieser Idiot trampelt auf der Dicksonia herum, als wäre sie Unkraut. Sie versuchen mich von ihm wegzuzerren, aber ich wehre mich, meine Farne können sich nicht wehren, aber ich schon, das bekommt er zu spüren, dieser verdammte Kerl, Artdirector, was?! Aber es werden immer mehr, eine Tür schließt sich hinter mir, und ich sitze in der Sakristei.
Wie aus dem Boden gewachsen steht er dort. Der Mann von der Empore.
Und wer ist das?
Angriff ist die beste Verteidigung. Sagt man.
»Arndt«, sagt der Kerl mit einer Stimme, so ruhig, so unbeteiligt, als sei ich gar nicht da. »Sei doch so nett und bring die Dame in mein Büro.«
Und ist auch schon weg.
»Wer das ist?«, sagt Arndt Godenflo feierlich, als hätte der Papst persönlich vorbeigeschaut. Er reicht mir ein Taschentuch. Erst da merke ich, aus meiner Nase läuft schon wieder Blut.
»Das ist Gregor Beer.«
Als sei damit alles gesagt.
Diese Art von Wichtigtuern – ich kann sie nun mal nicht leiden. Papst Gregor hat sich doch tatsächlich sein Büro hoch oben im Kirchturm eingerichtet, ein quadratischer Raum mit Panoramafenstern in alle vier Himmelsrichtungen, das Gebälk freigelegt und über allem eine riesige Glocke – ein Raum, der beeindrucken, ja, einschüchtern soll, auch mich fast beeindruckt hätte, wäre ich nicht so zornig, und als diese kühlen Augen mich neugierig taxieren, da packt mich der blanke Hass. Ein Wort gibt das andere, und dann wedelt er mit diesem Scheck herum, glaubt tatsächlich, mit Geld die Sache aus der Welt schaffen zu können, ganz wie mein Vater all die Jahre, verreist an Weihnachten, Ostern und natürlich an meinem Geburtstag, irgendwo in Kleinasien oder Nordafrika oder sonstwo beschäftigt, eine Grabstätte auszubuddeln mit irgendwelchen attraktiven Doktorandinnen, und alles, was ihm einfiel, um mich zu trösten, waren Schecks mit astronomischen Summen. So wie dieser hier, den er mir entgegenhält, dieser Gregor Beer, »Verdient haben Sie es nicht«, erdreistet er sich auch noch zu sagen, »nachdem Sie fast unsere Präsentation ruiniert haben«, mit dieser Stimme, so kalt und ruhig, »hier, nehmen Sie diesen Scheck. Kaufen Sie sich was Schönes!« Hat er das gesagt oder hab ich es geträumt? Und vielleicht ist es genau dieser Satz, der meine Sicherungen durchbrennen lässt, kauf dir was Schönes, als hätte er sich mit meinem Vater, dem Lügner, abgesprochen, der genau diesen Satz auch immer sagte, »Kauf dir was Schönes, Kleine«, als könnte das den Schaden ersetzen, den Schmerz stillen, und dann tue ich etwas, was ich vorher noch nie, aber an diesem Tag schon zweimal getan habe: Ich balle die Faust und fahre mit ihr nach vorn, noch während dieser Bewegung weiß ich, dass es ein Fehler ist, weiß, dass das vor mir nicht das Gesicht meines Vaters ist, weiß aber auch ganz genau, dass ich niemals in das Gesicht meines Vaters schlagen könnte, sei er nun ein Lügner oder nicht, aber in dieses schmale, arrogante und doch so verdammt attraktive Gesicht kann ich meine Faust platzieren, und das tue ich dann auch, direkt auf die Nase, es gibt ein trockenes Knacken, und da ist es auch vorbei mit seinem Hochmut: Papst Gregor klappt zusammen und geht zu Boden.
»Bist du nicht hungrig?«, fragt mich mein Vater, der Lügner, am nächsten Tag.
Ich stochere im Thunfisch-Carpaccio. Diese Art von Restaurants, in die mich Sebastian so gern einlädt – im Grunde kann ich sie nicht ausstehen. Ich habe es ihm nie gesagt, schließlich weiß ich, er will mir damit etwas Gutes tun, mir, die als Gärtnerin von jeher an ein kleines Gehalt gewöhnt ist und sich solche Ausgaben nicht leisten kann. Nein, Professor Sebastian Nadler würde nie auf den Gedanken gekommen, dass ich das »Orfani« liebend gerne gegen ein ganz normales Lokal tauschen würde, gegen eine Pizzeria oder ein nettes Bistro, wo ich so hingehen kann, wie ich von der Arbeit komme, ohne mich nochmals umzuziehen, Schuhe zu tragen, in denen ich mich nicht wohlfühle, Kleider, die nicht zu mir passen, um dann vor irgendwelchen neumodischen Tellerkreationen zu sitzen. Meinem Vater zuliebe habe ich all die Jahre dieses Spiel mitgespielt, denn ich weiß, wie gerne er sich mit mir zeigt, wie stolz er auf mich ist und wie viel Freude es ihm macht, den Gönner zu spielen. Aber all das ist jetzt vorbei. Nein, ich bin nicht mehr bereit, ihm auch nur irgendwie entgegenzukommen. Ja, ich trage meine ältesten Jeans und ein T-Shirt, auf dem die Spuren von Blumenerde nicht zu übersehen sind, und das mit voller Absicht. Mein Vater, der Lügner, kann froh sein, dass ich überhaupt gekommen bin!
»Wie läuft das Geschäft?«, fragt er.
»Bestens«, antworte ich und verziehe das Gesicht.
Mein Gewächshaus gleicht einer Krankenstation, die Hälfte der Farne habe ich gleich entsorgen können, acht seltene Exemplare sind nicht mehr zu retten, aber das Geschäft läuft hervorragend, ich kann nicht klagen.
Und meinem ersten großen Kunden, dem hab ich die Nase eingeschlagen.
Denke ich an den gestrigen Tag, und ich denke ständig daran, läuft es mir heiß und kalt den Rücken hinunter. Niemals, noch nie in meinem Leben habe ich um mich geschlagen! Und gestern gleich zwei Mal. Erst als es dunkel wurde, hab ich mich wieder in die Nähe der Basilika getraut, wo sie die Pflanzen einfach auf den Hof geworfen hatten! Bis in die Nacht hinein dauerte die Bergung. Der reinste Albtraum. Als ich weit nach Mitternacht im Gewächshaus Bestandsaufnahme machte, hab ich geheult wie seit Omis Beerdigung nicht mehr.
Fred hat mir das alles vorausgesagt. »Mit Farnen ist kein Geschäft zu machen«, waren seine Worte, als ich mich nicht nur von ihm trennte, sondern auch meine Kündigung einreichte. Sieben Jahre im Botanischen Institut. Von ihm hab ich alles gelernt, was man über Farne wissen kann. Fünf Jahre waren wir ein Paar, ich, die kleine Gärtnerin und er, der Leiter der Abteilung Farne, zwanzig Jahre älter als ich und tödlich verletzt, als ich ihm den Laufpass gab. Für ihn war ich eine Verräterin. »Das hätte ich nicht von dir gedacht«, hat er damals gesagt, »dass ausgerechnet du mein Wissen einmal so missbrauchen würdest, nun, du wirst schon sehen, wohin das führt, Farne sind viel zu empfindlich für Büros und Wohnzimmer, das weiß keine so gut wie du, du wirst sie ruinieren, aber das kann dir ja egal sein, nicht wahr, Hauptsache die Kasse klingelt, ich hatte dich anders eingeschätzt, aber so kann man sich täuschen.«
Vielleicht, denke ich zähneknirschend, während mein Vater den Wein zurückgehen lässt, weil er angeblich nach Korken schmeckt, – Gott, wie mich dieses Getue nervt –, vielleicht hat Fred Recht? Vielleicht sitze ich jetzt auf einem Berg von Schulden, das Gewächshaus gehört schließlich zur Hälfte der Bank, vielleicht sind die Farne tatsächlich ein Flop?
Nein, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Ich bin wie diese Farne, und wenn die auch empfindlich scheinen, so gibt es doch keine zäheren Pflanzen auf der Welt. Seit Jahrmillionen sind sie da, haben Äonen kommen und gehen sehen und die Dinosaurier überlebt, Farne werden die Erde bevölkern und mit ihren Wedeln beschatten, selbst wenn sich eines Tages die Menschheit selbst ausrotten wird, Farne gab es schon immer und wird es immer geben, so lange da noch ein Tröpfchen Wasser ist, um die Sporen zum Keimen zu bringen und die Vermehrung zu vollziehen, ein Farn braucht nichts und niemanden auf der Welt, er ist sich selbst genug, und mir wird der Vorfall von gestern eine Lehre sein, so etwas wird mir nie wieder passieren, in Zukunft muss ich eben Vorkehrungen treffen …
»Schmeckt der Thunfisch nicht?«
Ich schiebe den Teller entschieden von mir und sehe auf, meinem Vater, dem Lügner, direkt in die Augen. Ich kann sehen, wie er erschrickt. Und ohne, dass ich es will, sehe ich wieder diesen Kerl vor mir, wie er mir den Scheck hinhält, und die Wut flammt erneut in mir auf. Genau wie mein Vater, ich habe sie niemals eingelöst, diese Schecks, nicht einmal das ist ihm je aufgefallen, und wenn ich ihm das früher auch alles verziehen habe, weil ich ihn liebte wie keinen anderen Menschen auf dieser Welt, so verzeihe ich ihm von gestern an nichts mehr, sein Kredit ist aufgebraucht, wer seine Tochter dermaßen anlügt, ihr ganzes Leben lang, der ist es nicht wert, dass man noch eine Sekunde lang Geduld mit ihm hat.
»Was ist nun mit meiner Mutter?«, sage ich. »Sag mir die Wahrheit. Falls du weißt, was das ist.«
Niemals hätte ich geglaubt, dass es so weh tun kann, die Wahrheit zu hören. Immer habe ich mich als Kind einer großen Liebe betrachtet, einer unglücklichen, weil zu früh auseinandergerissenen Liebe, aber immerhin einer großen. Schließlich hat Sebastian nie wieder geheiratet. Dass er noch nie verheiratet war, das habe ich, wie offensichtlich so vieles, nicht gewusst.
»Sie war die Freundin meines besten Freundes«, sagt Sebastian, als würde das irgendetwas erklären. »Ich war vierundzwanzig. Mitten im Studium.«
»Und du hattest eine Affaire mit der Freundin deines besten Freundes?!«
»Keine Affaire. Mein Gott, Caroline, wir waren jung. Außerdem …, sie und Tim …, sie machte sowieso bald Schluss mit ihm, du weißt doch, wie das ist in diesem Alter. Es war nach einer Fete.«
Nein, denke ich erbittert, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Vor Fred hatte ich zwei kurze Freundschaften, nicht erwähnenswert.
»Wir hatten zu viel getrunken. Vielleicht auch zu viel gekifft, keine Ahnung. Angela hat mich den ganzen Abend provoziert. Das hat sie gern gemacht. Sie hatte eine spitze Zunge. Eigentlich konnte ich sie nicht leiden. Aber sie war eine attraktive Frau. An diesem Abend …, ich weiß auch nicht, wie das kam … Tatsache ist … es ist eben passiert.«
Sebastian betrachtet seine Hände. Seine Finger zerkrümeln ein frisch gebackenes Baguettebrötchen.
»Das war alles. Ein einziges Mal. Und das Blödsinnigste daran ist, ich kann mich nicht einmal daran erinnern.«
»Und sie?«, frage ich weiter.
»Was und sie?«
»Na Angela, wie … hat sie dann reagiert … ich meine, danach.«
Mein Vater, der Lügner, vermeidet es, mir in die Augen zu sehen, und sucht nach Worten.
»Keine Ahnung«, sagt er schließlich. »Ich bin ihr aus dem Weg gegangen. Ein paar Mal hat sie noch angerufen, glaube ich. Ich fand Nachrichten in meiner WG von ihr. Dass ich mich melden sollte. Aber ich habe mich nicht gemeldet. Ja, ich war feige, ich gebe es zu. Bis sie dann eines Tages vor der Tür stand. Sie sei schwanger. Und zwar von mir. Sie hat gesagt, sie will kein Kind, aber für eine Abtreibung sei es zu spät. Sie habe es einfach nicht gemerkt.«
Wie kann man das nicht merken, denke ich, wie kann man nicht merken, dass man schwanger ist, das gibt es doch nicht.
»Wir haben dann lange dagesessen«, sagt Sebastian. »Ich habe gesagt, dass ich dafür geradestehen werde, natürlich werde ich das. Ich hab gefragt, ob sie erwartet, dass wir heiraten, aber sie hat mich nur ausgelacht. Es war schrecklich, Caroline, ich kann dir gar nicht sagen, wie furchtbar das war. Zu allem, was ich vorschlug, hat sie nur gelacht, und dann stellte sie alles Mögliche an, um das Kind zu verlieren, machte die Nächte durch, experimentierte mit Drogen, verschwand für Wochen, und ich, ich musste bei allem, was ich tat, an das Kind denken, an dich, Caroline, es war ja schließlich auch mein Kind, und da wurde mir klar, dass ich es haben wollte, ich wollte dich großziehen, allein, diese Frau war ja völlig durchgeknallt, wie gesagt: Ich konnte nicht mit ihr und sie nicht mit mir, und schließlich haben wir eine Abmachung getroffen.«
Mein Vater stockt. Was einmal sein Brötchen war, liegt jetzt in verschieden großen, zementartigen Kügelchen auf dem Tischtuch.
»Was für eine Abmachung?«, höre ich mich fragen.
»Eine Vereinbarung. Sie hört auf, Amok zu laufen, bringt das Kind zur Welt und lässt es mir. Dann verschwindet sie. Für immer, verstehst du. Und kommt nie wieder. So haben wir es dann gemacht. Sie war tot, das war Teil unserer Abmachung. Ja, schau mich nicht so an, das war ihr eigener Vorschlag. Ich hab für dich gesorgt, wie ich es versprochen habe. Von ihr hab ich nichts mehr gehört. All die Jahre nicht. Und jetzt auf einmal schreibt sie diese Postkarte.
Ich versuche meine Gedanken zu ordnen. Irgendwie, finde ich, ergibt das alles keinen Sinn.«
»Und wegen dieser Postkarte hast du beschlossen, mir endlich die Wahrheit zu sagen? Du glaubst also wirklich, dass sie kommt?«
Mein Vater sieht völlig erschöpft aus. Auch er hat ganz offensichtlich keinen Appetit mehr. Eine ganze Weile sitzt er da und brütet vor sich hin.
»Ich habe keine Ahnung«, sagt er schließlich. »Ich weiß nur eines: Dieser Frau ist eine Menge zuzutrauen.«
»Was ist das für ein Grab, an das du mich geschleppt hast?«
Sebastian schluckt. Aber ihm ist klar, die Zeit der Lügen und Ausflüchte ist endgültig vorbei.
»Irgendeines«, gesteht er schließlich. »Ich habe es zufällig entdeckt. Du hast mir keine Ruhe gelassen. Da habe ich dich einfach dorthin geführt.«
Eigentlich wusste ich das schon. Dennoch fühle ich weiterhin diese unsagbare Wut in mir wachsen. Erst vor ein paar Tagen habe ich Moosfarn auf das Grab gepflanzt, Selaginella, und jetzt, nach sechsundzwanzig Jahren, erfahre ich, dass es ein wildfremdes Grab ist?
Und ich sehe mich wieder dort stehen, ohne meinen Vater, wie alt war ich damals, elf, zwölf? Und da war eine ältere Dame, die Stiefmütterchen auf das Grab pflanzte. Was macht diese Frau am Grab meiner Mutter?, dachte ich. Aber ich war auch irgendwie gerührt, dass diese fremde Frau meiner Mutter Blumen brachte. Schließlich nahm ich allen Mut zusammen und sprach sie an.
»Haben Sie sie gekannt?«
Die Frau sah mich an und lächelte. Ihre erdigen Hände schwebten über den Stiefmütterchen.
»Ja, freilich«, sagte sie leise, »habe ich sie gekannt. Und du?«
Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich hatte meine Mutter nicht gekannt. Und plötzlich hatte ich einen Kloß im Hals, drehte mich um und lief davon, und lange Zeit ging ich nicht mehr dorthin, auf den Hauptfriedhof, ans Grab mit dem Engel und dem verschlungenen Namenszug.
Auf dem Heimweg mache ich, ohne groß darüber nachzudenken, einen Umweg über den Hauptfriedhof. Ich stelle den Wagen ab und gehe den vertrauten Pfad, den ich, wie oft, gegangen bin, das erste Mal an der Hand meines Vaters, danach allein.
»Kommst du mal wieder mit mir?«, hab ich ihn gefragt. »Gehen wir zu Angelas Grab?«
Er lieferte mir lange Erklärungen, die ich als Kind nur halb verstand. Dass kein Sinn darin läge, Gräber zu besuchen, er als Experte für alle Arten von Totenkulten sähe die Dinge anders als andere Menschen, der Ort, an den die Toten gebracht würden, hätte für ihn keine wahre Bedeutung, denn dort befände sich der geliebte Mensch schließlich nicht mehr. Ich glaubte doch nicht im Ernst, dass in diesem Erdloch meine Mutter sei, alles, was von ihr übrig war, sei verwittert und zerfallen, welchen Sinn könnte es haben, zu morschen Knochen zu pilgern, nein, er hielte nichts davon, und ich täte ebenfalls gut daran, es sein zu lassen.
Ich habe es versucht, eine ganze Weile lang. Aber dann bin ich doch wieder hingegangen, und wenn mein Vater auch Recht haben mochte, es hat mich getröstet, an diesem Grab zu stehen, und vielleicht war es mehr der Engel, denn ich dachte immer, er sei ein Abbild meiner Mutter.
Da ist er wieder, der verwitterte Stein, der Engel, der Namenszug. Und da ist die fremde Frau. Sie hält eine Hacke in der Hand. Ratlos betrachtet sie die Selaginella.
»Darf ich Sie etwas fragen?«, spreche ich sie an.
Die Frau fährt herum, sie hat mich nicht kommen hören. Dann strahlt sie mich an.
»Ja, freilich«, sagt sie. »Kommen’s auch immer noch?«
»Heute zum letzten Mal«, sage ich.
»Ah so, wie schad. Ziehen Sie fort?«
Ich schüttle den Kopf.
»Wer ist sie …, ich meine, wer war sie denn?«, frage ich.
»Die Angela?«
Die Frau stützt sich auf ihre Hacke und sieht mir von unten her ins Gesicht. Sie erinnert mich an Omi, und auch das tut heute unerwartet weh. Dann schaut die Frau aufs Grab, betrachtet die Selaginella.
»Sie war mein einziges Kind. Ja. Das war sie.«
Ich würde ihr gern sagen, dass die Selaginella rasch wachsen und einen wunderschönen Teppich wie aus Moos bilden wird, weich und hellgrün, ein Grund, der die Stiefmütterchen erst richtig zum Leuchten bringt, aber ich schweige.
»Und … wie ist sie gestorben?«, frage ich schließlich.
»Ein Unfall. Mit dem Auto. Ja. So war das.«
Eine Weile stehen wir so da. Dann zeigt die Frau auf den Moosfarn.
»Sie wissen nicht zufällig, was das ist? So ein Unkraut hab ich noch nie gesehn.«
»Es ist kein Unkraut«, sage ich. »Es heißt Selaginella und ist ein Moosfarn.«
Die Augen der Frau werden rund.
»Sie haben das gepflanzt, ach so.«
Ich nicke.
»Wie muss man den pflegen, den Moosfarn?«
»Regelmäßig gießen. Sonst nichts.«
»Ja so …, gießen. So ist das …«
Einen Moment ist sie ganz still.
»Ich habe Sie oft gesehen«, sagt sie dann, »hier auf dem Friedhof. Und hab mich gefragt, warum Sie wohl herkommen. Vielleicht gefällt dem Kind der Engel, hab ich gedacht, wer weiß.«
Ich nicke. Ja, der Engel. Auch ich hatte mich gefragt, wer die Frau war, hab meinem Vater eines Tages von ihr erzählt, »Da kommt immer eine Frau ans Grab, wer kann das sein?« »Das wird die Gärtnerin sein«, sagte er, und mir hat das eingeleuchtet, obwohl die Frau nicht aussah wie eine Gärtnerin, aber sie pflanzte Stiefmütterchen, das sprach dafür. »Können wir ihr nicht sagen«, habe ich ihm vorgeschlagen, »dass sie Farne pflanzen soll, Farne und Rosen, das würde mir besser gefallen«, aber da wurde er unerwartet streng: »Lass sie das machen, was sie für richtig hält, Stiefmütterchen oder Rosen, wo ist da der Unterschied?«
»Sie haben meine Angela für eine andere gehalten.«
Ich nicke. Die Augen der Frau bleiben erwartungsvoll auf mich gerichtet. Am liebsten würde ich davonlaufen. Wie damals. Ich sehe auf den Grabstein, sehe den Engel, die geschwungenen Buchstaben unter dem Palmwedel.
»Meine Mutter«, sage ich dann. »Meine Mutter hieß auch Angela.«
»Sie ist gestorben, Ihre Mutter?«
Ich nicke wieder. Dann schüttle ich den Kopf. Die alte Frau zieht die Augenbrauen hoch, ist ganz Ohr.
»Alle haben gesagt, sie ist tot. Und jetzt schreibt sie plötzlich eine Postkarte.«
»Eine Postkarte?«
Die alte Frau lacht. Sie lacht aus vollem Herzen und hält sich an ihrer Hacke fest.
»Ja, so was«, gluckst sie, »eine Postkarte, die hat mir meine Angela noch nie geschrieben.«
Dann wird sie wieder ernst.
»Da können Sie aber froh und glücklich sein, dass Ihre Mutter noch lebt. Naja, hier bei den Toten werden Sie Ihre Mutter wohl nicht finden. Hier schreibt keiner mehr Postkarten. So viel steht fest.«
Ich sie finden?, denke ich, als ich nach Hause fahre.
Soll sie doch kommen, wenn ihr etwas daran liegt. Doch für den Rest des Tages, während ich geknickte Farnwedel schiene und kleinere und größere Amputationen vornehme, werde ich dieses Bild nicht mehr los: das Bild einer felsigen Küstenlandschaft mit viel stürmischem Himmel darüber.
ZWEITES KAPITEL
… in dem Gregor eine Erbschaft macht und mit einer Gewohnheit bricht
Wie immer liegt das Kirchenschiff still in der Morgendämmerung, nur in einer der hinteren Glasnischen glimmt bereits Licht. Das ist diese Webdesignerin, die darum gebeten hat, früh anzufangen, damit sie ihr Kind mittags rechtzeitig aus der Krippe holen kann. Außer ihr ist nur meine Sekretärin Natascha so früh auf den Beinen. An diesem Morgen empfängt sie mich mit besorgtem Blick auf meine verpflasterte Nase, den ich mit einem Kopfschütteln beantworte: Nein, heißt das. Ich bleibe dabei. Keine Anzeige. Auch wenn sie es verdient hätte, diese wildgewordene Gärtnerin.
»Deine Mutter«, sagt Natascha. »Sie wartet auf einen Rückruf.«
Ich betrete mein Büro. Zwei Minuten später bringt meine Sekretärin den Kaffee, wie jeden Morgen klein und schwarz, eine Sonderröstung aus meinem Spezialgeschäft, einen halben Löffel Zucker, nicht umgerührt. Der Anruf bei meiner Mutter hat Zeit. Alles hat Zeit. Die ersten dreißig Minuten sind heilig. Natascha weiß das und sorgt dafür, dass mich niemand stört.
Es ist diese halbe Stunde am Morgen, die mir die Kraft gibt, in den Turbulenzen des Tages meine Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Oft genug habe ich mit ansehen müssen, wie Kollegen ihre Träume und Ideale, ihre Kreativität und Begeisterungsfähigkeit in kürzester Zeit abhanden kamen. Ausgebrannt und hohl hecheln sie sich selbst hinterher, bringen nichts Neues zustande, kopieren sich gegenseitig und selbst. Ich aber sehe mir jeden Morgen in aller Ruhe die Stadtansicht aus meinen vier Turmfenstern an, steige die Sprossen hinauf in den Dachstuhl und betrachte die Glocke. Ein Feng-Shui-Berater hat mich gewarnt: »Zu viele Balken über dem Kopf, noch dazu diese Masse aus Metall …«, aber ich weiß es besser. Die Glocke hoch oben über mir ist genau das, was ich brauche. Jeden Morgen bewundere ich ihre schlichte Form, die Reinheit des Metalls, die Perfektion des Gusses. Als geballte Energie hängt sie so den ganzen Tag über meinem Kopf, still, ohne sich zu rühren. Jeden Morgen betrachte ich fasziniert den mächtigen Schlegel, entspannt hängt er im Glockenmund und scheint zu träumen. Er träumt von dem mächtigen Ton, den ich mit ihm anschlagen könnte, wann immer ich es wünsche. Dieser Ton ist immer da, dort, über mir, auch ohne zu erklingen, und er beflügelt mich mehr als alles andere.
An diesem Morgen jedoch werde ich das Gefühl einer fremden Gegenwart nicht los. Hier hat sie gestanden und sich umgesehen, beide Fäuste in die Hüfte gestemmt. Es gibt nicht viele Menschen, die sich so wenig beeindruckt zeigen von diesem Raum, nein, korrigiere ich mich, sie war bislang die Einzige, auf die meine Glocke nicht die geringste Wirkung zeigte. Kein Grund, sage ich mir streng, weitere Gedanken an sie zu verschwenden, schließlich gab es auch bis dato niemanden, der mir das Nasenbein brach, und sie kann von Glück reden, dass sie nichts weiter von dieser Sache davonträgt als meinen Scheck. Den ich außerdem noch sperren könnte. Aber ich werde es nicht tun. Auch wenn die Frage berechtigt ist: Wieso diese Großzügigkeit?
Ja, warum? Die Wahrheit ist, sie erinnert mich an jemanden. Nein: an etwas. Sie erinnert mich daran, wie es ist, am Anfang zu stehen. Ein Blick auf sie genügte, um das zu erkennen. Ihre Jeans, das billige T-Shirt, der Haarschnitt. Und der Zorn in ihren Augen. Auch der war mir sonderbar vertraut, obgleich es lange her ist, dass ich diese Art von Zorn in meinem Leben zuließ. Wenn sich das heute vielleicht niemand mehr vorstellen kann, so kenne ich, Gregor Beer, durchaus diesen Zustand. Und darum werde ich den Scheck dieser Gärtnerin nicht sperren lassen. Soll sie doch glücklich werden damit.
»Dein Patenonkel ist gestorben«, sagt Natascha. »Deine Mutter bittet dich, zurückzurufen.«
Sie wirft mir einen scheuen Blick zu, weiß ganz genau, dass ich keine Beileidsbekundungen wünsche. Ich könnte sie leicht beruhigen. Diese Nachricht erschüttert mich nicht im Geringsten. Ich habe den Bruder meines Vaters, Gregor Beer, nach dem ich benannt wurde, kaum gekannt. Als Pate hat er nie viel hergemacht, meine Mutter spricht eher abfällig von ihm, ein Weltenbummler und sonderlicher Kauz, von dem man nie wusste, in welchem Teil der Welt er gerade unterwegs war. Seit ich denken kann, hat mein Onkel die Meere bereist, er war Kapitän und fuhr zur See, und da der Schwarzwald bekanntlich nicht am Meer liegt, sind wir uns selten begegnet. Ein einziges Mal bekamen mein Zwillingsbruder Heinrich, der seinen Namen vom Bruder der Mutter hatte und demzufolge auch jenen Onkel zum Paten, und ich von Onkel Gregor ein Geschenk: zwei identische Kompasse, und schon diese Tatsache, wieder einmal etwas genau Identisches wie mein Bruder geschenkt zu bekommen, verdarb mir jede Freude. Heinrich und ich hatten nichts gemeinsam außer der niederträchtigen Ähnlichkeit, und dennoch oder wahrscheinlich deswegen schenkte man uns das Gleiche: Kleider, die sich höchstenfalls in der Farbe unterschieden, Spielsachen im Doppelpack, und jetzt eben auch diese Kompasse. Noch dazu von meinem Patenonkel, während Onkel Heinrich niemals auf die Idee kam, auch mich zu den Festtagen zu beschenken, sondern stur die Goldmünzensammlung meines Bruders Jahr um Jahr vergrößerte, während ich leer ausging.
Wieso regt mich das überhaupt noch auf?, denke ich, während ich die Nummer meiner Eltern wähle und dann dem Wortschwall meiner Mutter lausche, die nichts Besseres weiß, als mir den Morgen mit ihrem Gerede über Testamente, die nicht da sind, und Beerdigungen, die nicht stattfinden, zu verderben.
Mein Onkel Gregor Beer ist also verstorben. Und irgendwann im Laufe dieses Morgens, während der Abnahme eines Werbespots, kommt mir für den Bruchteil einer Sekunde in den Sinn, dass, wer diese Traueranzeige in irgendeiner Zeitung lesen würde, denken könnte, es handle sich um mich. Ja, meine Fantasie spinnt in Sekundenschnelle diesen absurden Faden weiter, was wäre, wenn ich die Chance nützte, Gregor Beer sterben ließe, fortgehen und irgendwo anders eine neue Identität beginnen würde? Wieso Chance, widerspricht sofort mein praktischer Verstand, was würde ich denn anders machen?
»Nichts«, sage ich laut und begebe mich ins Besprechungszimmer zum nächsten Termin.
Ein paar Tage später finde ich bei meiner Post den Brief eines Notars aus der niederländischen Stadt, in der Onkel Gregor seit vielen Jahren gelebt hat. Ich werde aufgefordert, zur Testamentseröffnung persönlich zu erscheinen. Ich bitte Natascha, anzurufen und lasse ausrichten, dass es mir unmöglich ist, diesen Termin wahrzunehmen. Eine Stunde später ruft ein Anwalt zurück, der sich als Testamentsvollstrecker des verstorbenen Gregor Beer vorstellt und mir eröffnet, ich sei Alleinerbe meines Patenonkels.
»Es geht nicht um Geld«, sagt er, »sondern um eine Art Vermächtnis. Genauer gesagt um die Vollstreckung des letzten Wunsches Ihres Onkels.«
»Hat mein Onkel diesen Wunsch schriftlich niedergelegt?«, frage ich.
»Es liegt mir ein Brief an Sie vor. Und … noch eine andere Sache …«
»Lässt sich diese ›Sache‹ per Post verschicken?«
Der Anwalt räuspert sich.
»Per Post? Nun, wenn es gar nicht anders geht, würde ich einen Kurier damit beauftragen, aber …«
»Schicken Sie mir den Brief und diese ›Sache‹«, unterbreche ich ihn, »so sparen wir beide eine Menge Zeit.«
Onkel Gregor. Warum ausgerechnet mich als Alleinerben eines Briefes und einer »Sache«? Verschiedene Gegenstände tauchen in meiner Vorstellung auf, ein Kompass in Riesenformat, eine Standuhr, ein Chronometer … Und dann habe ich das Ganze erneut vergessen.
Am nächsten Tag aber, als ich mitten in einer Besprechung mit dem Marketingleiter »meiner« Hautcreme-Marke sitze, steckt Natascha den Kopf zur Tür herein. Ein Kurier habe ein Paket aus Holland für mich abzugeben, bestünde aber darauf, es mir persönlich auszuhändigen oder andernfalls wieder mitzunehmen – da fällt es mir wieder ein. Onkel Gregor, denke ich, das sieht dir ähnlich. Ich nehme das Paket in Empfang, unterschreibe an der angegebenen Stelle, kehre zu meinem Gespräch zurück.
Erst als ich spät am Abend im Turm sitze, wie immer der Letzte, weil ich dann die besten Ideen habe, als ich zufrieden mein Notebook zuklappe, kommt mir das Paket wieder in den Sinn. Es ist nicht besonders groß, fast würfelförmig und sehr leicht, als sei ein Fußball darin verpackt. Ich öffne den Karton und finde zwischen viel Füllmaterial aus Styropor einen Gegenstand, den ich zunächst für einen Pokal halte. Onkel Gregor, was hast du mir da vermacht?
Aber es ist kein Pokal. Zwar durchaus ein ähnliches Gefäß, silbern und schwarz, mit zwei Henkeln in Form von Engelsflügeln und einem gutsitzenden Schraubverschluss. Ich öffne den Deckel. Halte das Gefäß unter die Schreibtischlampe. Es dauert eine Weile, bis ich begreife. Sorgfältig schraube ich den Verschluss wieder zu. Ich halte eine Urne in Händen. Eine Urne mit der Asche meines Patenonkels Gregor Beer.
Ich bin nicht der Typ, der hysterisch wird angesichts eines derartigen Gegenstands, aber ich will ehrlich sein – einen Augenblick benötige ich schon, um die Tatsache zu verdauen, dass sich mein verstorbener Onkel, oder besser, seine Überreste, hier auf meinem Schreibtisch befinden. Dann öffne ich den beiliegenden Brief, der zu Onkel Gregors Vermächtnis gehört.
»Ich weiß wohl, lieber Gregor,« lese ich, »es kommt nicht alle Tage vor, dass man die Asche eines Verwandten vor sich hat, und ich weiß auch, dass es wenig Menschen gibt, denen man ein solches Vermächtnis zumuten kann. Du bist einer dieser Menschen, Gregor, und darum habe ich Dich ausgesucht, um meinen letzten Willen zu vollenden. Denn ich brauche Dich, ich, der ich zu meinen Lebzeiten niemanden gebraucht habe, jetzt im Tod benötige ich Deine Hilfe.«
Diese Art meines Paten zu schreiben, »… jetzt im Tod benötige ich Deine Hilfe …«, als spräche er mich direkt aus dem Jenseits an, als dringe eine Stimme aus der Urne …, aber das ist Unsinn, kenne nicht gerade ich die suggestive Macht der Worte?
»Ich weiß auch,« so lese ich weiter, »dass Du ein vielbeschäftigter Mensch bist. Schließlich arbeitest Du für zwei. Vielleicht bin ich der Einzige, der sehr wohl begriffen hat, was wirklich hinter ›Beer & Beer‹ steckte, nämlich alles andere als die Manifestation Deiner Selbstüberschätzung im Pluralis Majestatis, wie so manch einer aus der Verwandtschaft glaubte, sondern eine Hommage an Deinen toten Bruder. Beer & Beer, das stand für ›Heinrich Beer & Gregor Beer‹. Ja, Du glaubst, Du musst für zwei arbeiten, aber Heinrich ist seit vielen Jahren tot und wird nicht lebendiger durch Dein unermüdliches Schaffen.«
Zornig werfe ich das Schriftstück auf den Schreibtisch. »Was weißt denn du?«, fahre ich die Urne an, »du warst damals nicht da, hast dich nie gekümmert. Nicht, dass ich dich gebraucht hätte, oh nein, ich brauche niemanden, weder Heinrich noch dich. Ich brauche deine Einmischung nicht, weder damals noch heute.«
Mit großen Schritten gehe ich in meinem Büro auf und ab. Bilder tauchen auf, verschwinden wieder. Rote Pudelmützen, identisch. Wenn er vor mir auf dem Schlitten saß, dann hüpfte der Bommel auf und ab. Auf und ab. Eine Kinderstimme im hänselnden Singsang: »Feigling! Feigling!« Ich halte mir die Ohren zu. Aber sie ist da drin in meinem Kopf, diese Stimme, »Angsthase, Hosenscheißer«, und dann die Pudelmütze, so rot im Schnee …
Es ist innerhalb weniger Tage das zweite Mal, dass ich an meine Anfänge erinnert werde. Hätte mich Onkel Gregor damals gefragt, was ich einmal für einen Beruf ergreifen wollte, so hätte ich gesagt: Einen mit einem Dach über dem Kopf. Ein Dach über dem Kopf, ob es stürmt oder schneit, das war das Höchste in der Vorstellung eines Jungen, der sich sein Taschengeld mit dem Austragen von Gemeindezeitung und Kirchenblatt, mit dem Verteilen von Plastiksäcken für die Altkleidersammlung und Gratisproben neuer Saftsorten aus dem Getränkemarkt verdiente. Was immer es auch in meiner Heimatstadt im nördlichen Schwarzwald zu verteilen gab, ich sorgte dafür, dass es innerhalb von höchstens zwei Tagen in jedem der fünfzehntausend Haushalte angekommen war. Allerdings traf ich schon damals eine instinktive Qualitätsauswahl: Der Getränkemarkt mit seinen Naturfruchtsäften fand Gnade, die Sonderangebote vom Supermarkt aber landeten schon mal im das Städtchen durchplätschernden Bach. Die Werbeblätter vom neuen Pizzaservice fanden erst dann ihren Weg in die Briefkästen, nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass die Pizza auch wirklich schmeckte. Mit zwölf Jahren erklärte ich dem Besitzer des größten örtlichen Schuhgeschäfts, welche Marken es wert waren, in sein Sortiment aufgenommen zu werden, und was ein werbewirksamer Event ist, mit vierzehn organisierte ich Modenschauen für das einzige Bekleidungsgeschäft, das passable Labels vertrat. Und, ja, es stimmt, mit sechzehn gründete ich meine eigene Werbeagentur und entwarf ihr Logo: eine Weltkugel, über die ein dynamischer roter Blitz hinwegfuhr. »Beer & Beer. Werbung für die Besten« stand auf dem Schild, das ich neben die Klingel der elterlichen Wohnung schraubte …
Es dauert einen Moment, bis mir bewusst wird, was ich so intensiv betrachte. Es sind meine Preise und Auszeichnungen, Best of Europe in Gold, gleich drei Mal, den Art Directors-Preis, den Hennessy-Pokal. Sie holen mich wieder in die Gegenwart zurück. Beer & Beer. Der Scherz eines Halbwüchsigen, einer der wenigen, die ich mir jemals erlaubt habe, das ist alles. Mein Onkel ist gestorben, ein etwas extravaganter alter Mann, ein Seemann, dem es einfiel, mir einen letzten Gruß auf seine Weise zu schicken. »Lass hören«, sage ich zur Urne, »was du von mir willst.« Und damit nehme ich den Brief meines toten Onkels wieder zur Hand.
»Ich habe mich nie in Dein Leben eingemischt, es war nicht meine Art. Aber ich habe sehr wohl verfolgt, was Du so triebst. Ich konnte kaum umhin. Kam ich von einer meiner Fahrten zurück, war mein Anrufbeantworter vollgesprochen von Menschen, die Dich meinten. Schließlich habe ich ihn umbesprochen: ›Wenn Sie meinen Neffen, den erfolgreichen Werber Gregor Beer sprechen wollen, dann wählen Sie bitte folgende Nummer …‹ Dennoch bekam ich den Widerschein Deiner glanzvollen Karriere zu spüren. Ich gönnte sie Dir von Herzen. Aber ich machte mir auch Sorgen.«
Ich muss grinsen. Die Namensgleichheit konnte durchaus Verwirrung stiften. Hatte nicht auch hier in der Agentur jemand tagelang versucht, zu mir durchzudringen, bis er sich der verblüfften Natascha schließlich als »Professor der Anthropologie, spezialisiert auf Totenkulte« vorstellte und sie damit so verwirrte, dass sie ihn anstandslos zu mir durchstellte? Es war bald klar, dass es sich um einen Bekannten meines Onkels handelte.
»Ich war nie ein besonderer Familienmensch, darin sind wir uns ähnlich« lese ich weiter. »Vermutlich hätte ich mich mehr um Dich kümmern sollen, ich weiß, dass Deine Mutter diese Ansicht vertritt. Ich war nie ein großer Kümmerer. Deine Patenschaft habe ich nach langem Zögern angetreten, und möglicherweise hätte ich das gar nicht tun sollen. Aber das ist alles Schnee von gestern. Wenden wir uns der Gegenwart zu. Oder besser: der Zukunft.
Ich habe mir lange überlegt, was ich Dir vermachen soll. Denn ich vertrat immer die Überzeugung, dass wir uns im Tod viel näher sein könnten, als wir das im Leben waren. Ich bin nicht besonders wohlhabend, und Geld ist das, was Du am wenigsten brauchst. So habe ich alle meine materiellen Güter vor meinem Tod verschenkt.
Was Dich anbelangt, so bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich Dir zu etwas ganz Besonderem verhelfen kann: Erfahrung. Einer Erfahrung, die Du Dir niemals selbst gönnen würdest. Und die mit Geld nicht zu bezahlen ist. Glücklicherweise deckt sich dies mit meinem letzten Wunsch, und so fügt sich eins zum anderen.«
»Ich finde«, schreibt Onkel Gregor weiter, »Du hast lange genug auf einem Fleck gesessen. Jetzt wird es Zeit für Dich, die Welt zu sehen. Ein bisschen Tapetenwechsel, das ist es, was Du am dringendsten brauchst. Und darum habe ich eine kleine Reise für Dich zusammengestellt – besser gesagt: Für uns beide.«
Ich nehme den Umschlag zur Hand, dem ich den Brief entnommen habe, halb in der Erwartung, so etwas wie ein Flugticket zu finden. Nein. Kein Ticket. Aber etwas fällt zu Boden, leise klirrend, und als ich unter den Schreibtisch krieche, finde ich einen Schlüssel. Einen Postfachschlüssel.
»Jetzt hast Du sicherlich den Schlüssel gefunden. Aber langsam, noch sind wir nicht so weit. Ich will Dir erst von meiner Bitte erzählen, meinem sogenannten ›letzten Willen‹: Ich möchte nicht in der Erde vergraben werden. Kein Begräbnis. Keine Reden, keine Blumen, kein Grab. Sondern ich will, dass Du mich dem Meer übergibst, und zwar an drei verschiedenen Orten, die mir besonders lieb geworden sind. Wir werden diese Reise gemeinsam unternehmen. Je ein Drittel meiner Asche wirst Du an den von mir festgelegten Stellen ins Meer streuen, die Heimreise wirst Du dann ohne mich antreten. Falls Dir danach ist. Vielleicht bist Du auf den Geschmack gekommen und entscheidest Dich, weiterzureisen, vielleicht kehrst Du nicht alleine zurück – wer weiß das schon. Aber wir beide werden uns an dem dritten Ort voneinander verabschieden. Und ich danke Dir jetzt schon dafür, dass Du mir diesen letzten Wunsch erfüllst. Du wirst einsehen, dass ich dies beim besten Willen nicht allein bewerkstelligen kann. Und Du weißt – das erwähne ich nur für den Fall, dass Du Dich gegen unsere Reise sträubst –, dass man einem Menschen den letzten Willen nicht verwehren darf.«
Ich lasse das Blatt sinken. Es ist lange her, dass mich jemand so verblüfft hat. Nicht schlecht, Alter, wenn mir mein Leben langweilig wäre, könnte ich dem einiges abgewinnen. Aber tut mir leid: Ich habe einfach keine Zeit für diesen Kram.
Ich werfe mich in meinen Sessel, lege die Beine auf den Schreibtisch, schiebe die Urne mit dem einen Fuß gefährlich nahe an den Rand.
Die polierte Oberfläche der silbernen Urne reflektiert einen Lichtstrahl, der durchs Fenster hereinfällt, vielleicht ist es der Mond. Mit den beiden Flügelhenkeln sieht das Gefäß einen Moment lang so aus, als wollte es sich in die Lüfte erheben und davonschweben. Mein Fuß schiebt die Urne einen Zentimeter weiter, das Licht erlischt. Ich sah einmal einen Film über die Arbeit in einem Krematorium. Darin schob man die Leichen in den Särgen in Glutöfen. Und nicht nur einen, nein, gleich mehrere auf einmal. Stunden später schaufelte ein Mann die Reste, die dem Feuer widerstanden hatten, heraus. Nicht alles zerfällt zu Asche. Die größeren Knochen bleiben erhalten. Stückweise werden sie zusammen mit der Asche in Urnen gefüllt …
Ich stehe auf und öffne ein Fenster. Schalte die Deckenbeleuchtung an. Der nüchterne Schein der Tageslichtlampen fließt über Brief und Urne. Einen Moment lang überlege ich, dann nehme ich die Urne, öffne den Deckel, werfe den Schlüssel hinein, stopfe den Brief, den ich nicht zu Ende gelesen habe, hinterher und schraube die Urne wieder zu. Fasse sie an den beiden Flügelhenkeln, halte sie von mir und stelle sie dann in ein Regalfach neben die Pokale und Auszeichnungen. Trete einen Schritt zurück, betrachte das Regal. Die Urne fällt weiter nicht auf. Fügt sich gut ein. Kann vergessen werden.
»Gute Nacht, Onkelchen«, sage ich. Dann schließe ich, wie jeden Abend, sorgfältig die Tür hinter mir.
Am nächsten Tag ist Donnerstag. Ein Besuch beim Friseur steht in meinem Terminkalender. Alle vier Wochen. Immer donnerstags. Danach, wie jede Woche, zum Squash mit Arndt, anschließend Sauna. Arndt ist die perfekte Gesellschaft für diese Abende: ein würdiger Partner im Squash und ein schweigsamer in der Sauna. Nichts hasse ich so sehr wie Gespräche, während mir der Schweiß über den nackten Körper fließt. Dennoch tausche ich mich bei dieser Gelegenheit über alles Nötige mit Arndt aus und stimme mich mit ihm ab: beim Fußbad, auf der Dachterrasse oder im Whirlpool. Kryptisch knappe Satzfetzen wandern dann zwischen uns hin und her, sinnentleert für Außenstehende, doch völlig ausreichend für Arndt und mich.
In der Agentur gibt es zur üblichen Betriebsamkeit an diesem Vormittag regelrechten Katastrophenalarm: Ein Virus hat den Zentralrechner außer Gefecht gesetzt, Panik bricht aus über unerklärlicherweise unbrauchbar gewordene oder unauffindbare Backups – der ganz alltägliche Hexenkessel eben. Je höher die Aufregung aufwallt, desto ruhiger werde ich. Keiner weiß, dass ich jeden Abend, ehe ich die Agentur verlasse, alle Daten des Zentralrechners auf drei verschiedenen Servern sichere und die Datenträger der aktuellsten Arbeiten mit nach Hause nehme. Ein Gutteil meines Vermögens steckt in diesen Bits und Bytes, und ich denke nicht daran, sie der Tagesform, der Vergesslichkeit, dem Hormonhaushalt oder was auch immer meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bis hinunter zum Praktikanten auszuliefern. So überlasse ich die Arbeit in aller Ruhe den Computerfritzen und berufe die Mannschaft zu einem Meeting ein. Das ist eine meiner Spezialitäten: das Adrenalin einer Panikstimmung in kreative Energie umzuwandeln. Als gegen Mittag die Rechner wieder laufen, sind alle bester Laune und voller neuer Impulse. Schmitt-Hoss, mein Partner, der in seiner umgebauten Mühle auf La Palma sitzt und Urlaub macht, kann völlig beruhigt sein.
Ich selbst habe noch nie eine Reise nur zu meinem Vergnügen unternommen. Eine Woche in den Alpen, jeden Tag einen anderen Gipfel, mehr brauche ich nicht. Außerdem bin ich geschäftlich genug unterwegs. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was ich auf La Palma tun sollte. Wenn ich hin und wieder den Stadtkoller bekomme und ein bisschen Grün um mich herum brauche, dann fahre ich in die nahen Berge. Es hat keinen Sinn, jemanden dazu mitzunehmen. Zum einen brauche ich keine Unterhaltung, zum anderen nimmt es niemand mit meinem Tempo auf, nicht einmal Arndt. »Du bist ein echter Gipfelstürmer«, keuchte er das einzige Mal, das er mitkam. Und er hat Recht: Hinauf und wieder hinunter und das auf dem direkten Weg, das ist meine Devise. Dabei kommen mir die besten Ideen. Und am Abend sitze ich wieder in meinem Turm.
Aber jetzt, da ich, wie an jedem ersten Donnerstagabend eines Monats, in Edwins Clubsesselchen sitze und wie immer der Chef höchstpersönlich an meinen Haaren herumschneidet, da erinnere ich mich auf einmal an einen Traum, den ich in der vergangenen Nacht hatte. Und das ich, der ich stolz darauf bin, nie zu träumen!
Ich war wieder ein kleiner Junge und hielt einen Kompass in der Hand. Ich sah meinen Onkel nicht, hörte aber seine Stimme, die mir erklärte, wie ich den Kompass benutzen musste, um die Himmelsrichtungen zu bestimmen. »Es ist ganz einfach«, sagte er, »es gibt vier Himmelsrichtungen: Geburt, die Jugend, das Alter, den Tod.« Ich versuchte, diese vier Himmelsrichtungen auf der Kompassrose zu erkennen, aber alles, was ich sah, waren geheimnisvolle Zahlen und Symbole. »Du musst in den Spiegel sehen«, half mir die Stimme des Onkels, und jetzt erkannte ich, dass in dem Deckel des Kompasses ein Spiegel eingelassen war, und wenn ich den im richtigen Winkel aufstellte, spiegelten sich die Symbole der Kompassrose darin. Ich sah genau hin, und plötzlich fügten sich die Zeichen zueinander, die Kompassnadel drehte sich und blieb auf den Worten: »Der Tod« stehen.
Ein paar millimeterkurze Haarschnipsel fallen auf meinen Handrücken. Ich sehe auf, erkenne mich im Spiegel und darüber Edwins Gesicht und Hände, die emsig meinen Kopf bearbeiten.
»Ich mach’s an den Schläfen heute etwas kürzer«, sagt Edwins Spiegelbild. »Dann fällt es nicht so auf, dass wir allmählich ein bissel grau werden.«
Ich starre bestürzt auf das Haar an meinen Schläfen. Mir ist noch nie auch nur ein einziges graues Haar dort aufgefallen. Aber jetzt, im Licht der tausend indirekten Stylistenlampen, sehe ich sie. Es sind nicht viele, aber sie sind da und leuchten weiß aus der Dunkelheit meines Haares.
»Sollen wir einmal eine Farbe versuchen?«, schlägt Edwin vor.
»Komm mir nie wieder mit einem solchen Vorschlag«, knurre ich ihn an, heftiger, als ich möchte.
Edwin wird es sich merken. Erst recht, nachdem mein Trinkgeld diesmal deutlich weniger großzügig ausfällt als sonst.
Auf einmal habe ich keine Lust mehr, mit Arndt Squash zu spielen. Ich wähle seine Nummer auf dem Autotelefon und sage ihm ab.
Annette staunt, als ich vor ihrer Tür stehe.
»Heute ist Donnerstag«, sagt sie verblüfft, »was ist mit Squash und Sauna, hat Arndt dich versetzt?«
»Ja«, sage ich zerstreut. »Nein. Das heißt, ich habe ihm abgesagt.«
Annette mustert mich genau. Sie weiß, ich bin nicht der Mann, der einfach seinen Squashabend absagt. In den vier Jahren, seit sie mich kennt, habe ich das noch nie getan. Sie hat nicht lange gebraucht, um das herauszufinden. Ihr Tag ist der Dienstag, manchmal auch der Freitag, aber niemals hat Gregor Beer je an einem Donnerstag an ihrer Tür geläutet.
»Das nächste Mal rufst du besser vorher an, wenn du solche Überraschungen planst«, sagt sie.
Ich sehe mich gleichmütig um.
»Störe ich?«
Annette lacht. Ja, ich störe. Aber sie ist zu feinfühlig, um mir das direkt zu sagen. Was soll das, sagt eine Stimme in mir, die vertraute, alte Gregor-Beer-Stimme, wieso bringst du sie in Verlegenheit, hau ab, du siehst doch, dass du störst. Aber ich bleibe, warum nicht mal mit den Gewohnheiten brechen, sind wir denn ein altes Ehepaar, das nur dienstags und freitags Sex miteinander haben kann? Natürlich, Liebe ist es nicht, was uns verbindet, das weiß sie so gut wie ich, aber ich brauche sie und sie braucht mich. Ich bin zufrieden damit, zu ihr zu kommen, den Abend mit ihr zu verbringen und in der Nacht wieder zu gehen. Annette ist eine attraktive Frau. Zehn Jahre älter als ich. Geschieden. Und sie hat ein behindertes Kind.
Sie ist die Erste, die mir nicht nach einem Vierteljahr mit einer gemeinsamen Wohnung und nach einem halben mit mehr oder weniger deutlichen Heiratswünschen kam. Und vor allem will sie kein Kind von mir. Wenn mir danach ist, kann ich bei ihr den ganzen Abend vor dem Fernseher sitzen, ohne dass sie mir auch nur eine einzige Frage stellt. Im Bett lasse ich sie die Fantasie entwickeln, und, bei Gott, sie hat eine Menge Fantasie.
Aber heute ist alles anders. Ich beginne zu bereuen, mit unserer Gewohnheit gebrochen zu haben. Annette wirkt überfallen und nervös. Aber statt zu gehen, verfolge ich aus halbgeschlossenen Augen vom Sofa aus, wie sie am Esstisch Annika füttert, lausche auf den lallenden Singsang des Mädchens, sehe zu, wie Annette sie in ihrem Rollstuhl ins Kinderzimmer fährt. Wie alt mag Annika sein? Zwölf? Oder schon fünfzehn?
»Willonich schlafn!«, protestiert das Mädchen.