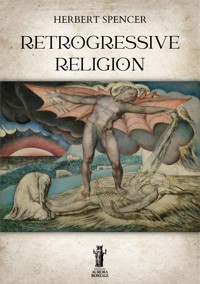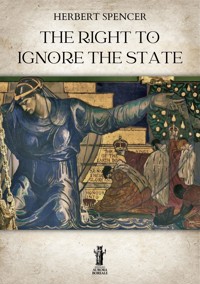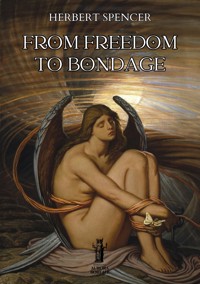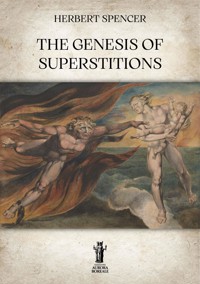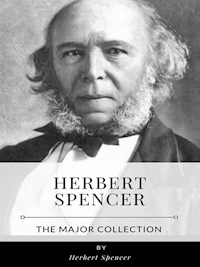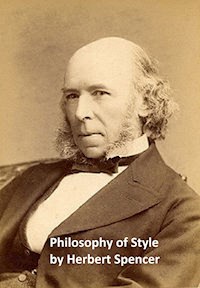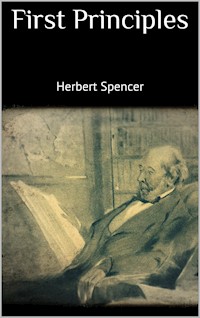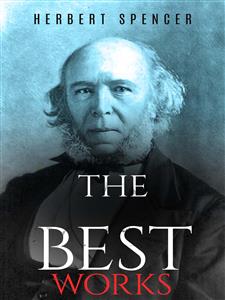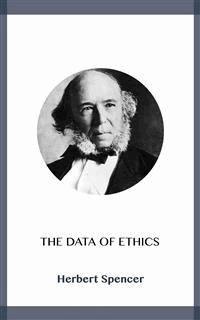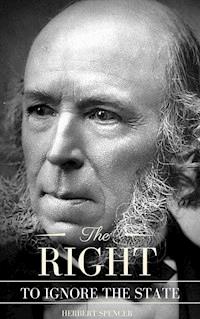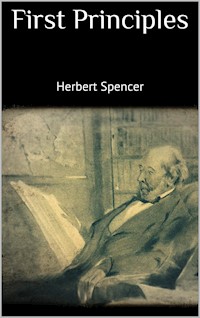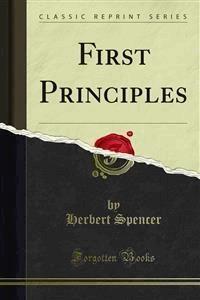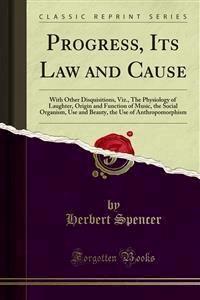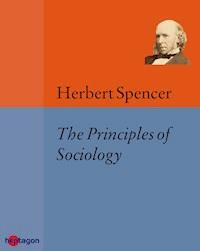24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jolandos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spencer suchte nach einer Erklärung gesellschaftlichen Wandels beziehungsweise der Entwicklungsstufen einer Gesellschaft. Beeindruckt von den Thesen Lamarcks wandte er diese erstmals auf soziale Systeme an. Lamarck postulierte, dass die Evolution der Lebewesen aufgrund äußerer Faktoren stattfinde. In Soziale Statik beschreibt Spencer die Gesellschaft als einen „Überorganismus“ mit Organen, die den Lamarckschen Gesetzen von Wachstum und Niedergang folgen. Um 1860 begann Spencer sein Lebenswerk: Die Synthese des gesamten menschlichen Wissens, bezogen auf ein allgegenwärtiges, in allem Lebenden wirkendes Prinzip: die Evolution. Als begeisterter Anhänger des Darwinismus glaubte er, das Evolutionsprinzip in allen Wissenschaften anwenden und diese dadurch zu einem "System synthetischer Philosophie" vereinigen zu können. Spencer war davon überzeugt, in der sich selbst organisierenden Genese einen wichtigen Schlüssel zu ihrem Verständnis gefunden zu haben. Der Ansatzpunkt, dass sich die Dinge in der Welt ohne göttliche (oder anderweitige) Lenkung entwickeln und dabei aus „Einfachem“ etwas „Komplexeres“ oder „Höheres“ entsteht, war für seine Zeit revolutionär. Spencer bekannte sich zum strikten Empirismus, daher schrieb er den Gegenständen der Erfahrung eine inhärente Kraft zu, die er als Manifestation des "Unergründlichen" sah. Wissenschaftliche Erkenntnis unterscheide sich daher vom Alltäglichen nur durch besonders präzise Beschreibung der Erfahrungswelt und durch die Entdeckung universaler Gesetze innerhalb der Wissenschaftsdisziplinen. Nach der Lektüre von Carpenter übernahm Spencer dessen Thesen in seinen Ersten Prinzipien (1860) und postulierte, dass sich auch im gesellschaftlichen Bereich alle Dinge vom Homogenen zum Heterogenen hin entwickeln. Per Deduktion begründete er sein „Universelles Postulat der kulturellen Evolution“: nicht nur biologische Organismen, sondern auch die Erziehung, die Lebensweisen, die sozialen Konventionen, die Psychologie, die Politik usw. würden diesem Gesetz folgen und zwar ohne „göttliche“ oder anderweitige Einwirkung von außen (Erste Prinzipien, 1862). In einem Punkt befand sich Spencer hier auf einer Linie mit seinen positivistischen Zeitgenossen (beispielsweise Comte): Auch sie sahen die Entwicklung der Soziologie eingebettet in eine breite Entwicklung beziehungsweise Reorganisation aller Wissenschaftsdisziplinen einerseits und eine gleiche, alles durchdringende Gesetzmäßigkeit, andererseits. Schließlich entwickelte Spencer in seinen weiteren Prinzipien, ausgehend von den verschiedenen zuvor entwickelten Evolutionstheorien, eine allgemeine Philosophie: Das gesamte Universum funktioniere wie ein gigantischer Organismus, die immer höhere Spezialisierung und Differenzierung führt mit der Zeit zu einer immer harmonischeren Koordination der einzelnen Komponenten. Spencer stellte dieselbe Entwicklung nicht nur für das Gesamte, sondern innerhalb jeder einzelnen Komponenten fest. (Quelle: Wikipedia, 24.04.17; bearbeitet v. C. Hartmann) Spencers "First Principles of Philosophy" hatte u.a. großen Einfluss auf den Entdecker der Osteopathie, den amerikanischen Landarzt A.T.Still (1828–1917). Hier verwandelt sich Stills bislang eher statisches Modell des beseelten menschlichen Körpers in eine stets veränderliche Gesamtheit, die abhängig von den Rahmenbedingungen ständig bemüht ist, sich den Rahmenbedingungen anzupassen. Als dynamisches System sah Still ihn von ebenfalls dynamischen Systemen bestimmt (Informationssysteme: Blutkreislauf & Nervensysteme), die basierend auf den fließenden Flüssigkeiten maßgeblich die Anpassung an die Umwelt und damit Gesundheit, Krankheit und Überleben bestimmen. In diesem Kontext verschiebt Still den therapeutischen Fokus weg vom "Beseitigen des Bösen" auf die handwerkliche Einflussnahme auf die Rahmenbedingungen, denen sich der Entfaltungsgrad physiologischer Prozesse anpasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Herbert Spencer
Die ersten Prinzipien
der Philosophie
© 2007, JOLANDOS
Ammerseestr. 52 – 82396 Pähl
Bestellungen
Logistik Center Gropper
Neuschmied 31; 83236 Unterwössen
tel. +49.8641.699.2743
fax. +49.8641.699.261
Übersetzung
Dr. Martin Pöttner
Umschlaggestaltung
Anette Page
Satz
post scriptum, www.post-scriptum.biz
E-Book-Herstellung:
Zeilenwert GmbH
Jede Verwertung von Auszügen dieser deutschen Ausgabe ist ohne
Zustimmung von JOLANDOS unzulässig und strafbar. Dies gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen und
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Medien.
ISBN 978-3-941523-85-2
Inhalt
Vorwort des Übersetzers
Teil I: Das Unerkennbare
Kapitel 1 Religion und Wissenschaft
Kapitel 2 Die letzten religiösen Ideen
Kapitel 3 Die letzten wissenschaftlichen Ideen
Kapitel 4 Die Relativität aller Erkenntnis
Kapitel 5 Die Versöhnung
Nachschrift zu Teil 1
Teil II: Das Erkennbare
Kapitel 1 Die Bestimmung der Philosophie
Kapitel 2 Die Daten der Philosophie
Kapitel 3 Raum, Zeit, Materie, Bewegung und Kraft
Kapitel 4 Die Unzerstörbarkeit der Materie
Kapitel 5 Die Kontinuität der Bewegung
Kapitel 6 Die Beharrlichkeit der Kraft
Kapitel 7 Die Beharrlichkeit der Relationen zwischen den Kräften
Kapitel 8 Die Umformung und Äquivalenz der Kräfte
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Zusammenfassung und Schlussfolgerung]
Kapitel 9 Die Richtung der Bewegung
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Zusammenfassung und Schlussfolgerung]
Kapitel 10 Der Rhythmus der Bewegung
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Zusammenfassung und Schlussfolgerung]
Kapitel 11 Zusammenfassung, Kritik und Neubeginn
Kapitel 12 Evolution und Auflösung
Kapitel 13 Einfache und kombinierte Evolution
Kapitel 14 Das Gesetz der Evolution
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Soziologie]
Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Kapitel 15 Das Gesetz der Evolution (Fortsetzung)
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Soziologie]
[Zusammenfassung und Schlussfolgerung]
Kapitel 16 Das Gesetz der Evolution (Fortsetzung)
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Soziologie]
[Zusammenfassung und Schlussfolgerung]
Kapitel 17 Das Gesetz der Evolution (Abschluss)
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Schlussfolgerung]
Kapitel 18 Die Interpretation der Evolution
Kapitel 19 Die Instabilität des Homogenen:Beispiel für die Instabilität im Ganzen
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Schlussfolgerung]
Kapitel 20 Die Vervielfältigung der Wirkungen
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Schlussfolgerung]
Kapitel 21 Trennung
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Schlussfolgerung]
Kapitel 22 Ausgleichung
[Hinführung]
[Astronomie]
[Geologie]
[Biologie]
[Psychologie]
[Soziologie]
[Schlussfolgerung]
Kapitel 23 Auflösung
[Hinführung]
[Soziologie]
[Biologie]
[Geologie]
[Astronomie]
Kapitel 24 Zusammenfassung und Schluss
Appendices (Auszüge)
Bemerkungen zu Kapitel II.17 und 19
Auseinandersetzung mit den Kritiken von Herrn Cliff Leslie
Die Entstehung der gasförmigen Nebel
Index
Vorwort des Übersetzers
Herbert Spencers (1820–1903) Grundlegung der Philosophie und der Einzelwissenschaften erscheint in einer neuen Übersetzung bei Jolandos1, weil seine Konzeption der Evolution neben den Konzeptionen Charles Darwins und Alfred Russel Wallaces wahrscheinlich auf die Ausarbeitung der Osteopathie durch Andrew Taylor Still Einfluss hatte. Der Hauptgrund besteht darin, dass die klassische osteopathische Medizin neben der Interaktiven Einheit des Menschen sowie der Interdependenz von Struktur und Funktion im Menschen auf die menschlichen Selbst-Heilungs-Mechanismen setzt.2 Vor allem die Selbst-Heilungs-Mechanismen beruhen auf dem Prinzip der internen Anpassung an externe Relationen, die Spencer vertrat. Wenn dieser Anpassungsprozess nicht durch körperliche, mentale oder geistige Dysfunktionen gestört ist, sind die Menschen gesund. Darin besteht der Stillsche Normalzustand. Wer Spencer liest, setzt sich daher mit einem philosophischen Kontext auseinander, der zur Ausbildung der Osteopathie geführt hat – und über manipulative Techniken hinaus ihren philosophischen Charakter unterstreicht. Dieser geschichtliche Zufall und eine entsprechende verlegerische Initiative ermöglichen eine Neuübersetzung des philosophischen Hauptwerks Herbert Spencers, das für breitere Interessen und Rezeptionen kosmologischer, geologischer, biologischer, psychologischer und soziologischer Art offen steht.
Die ersten Prinzipien der Philosophie Spencers betreiben Grundlegungsarbeit. Sie erarbeiten Grundprinzipien, die in jeder wissenschaftlichen und alltäglichen Praxis impliziert sind oder bewusst angewendet werden können. Ihr Geltungsbereich umfasst anorganische, organische und gesellschaftliche bzw. über-organische Prozesse. Als allgemeines Prinzip aller dieser Prozesse macht Spencer den kosmischen Prozess aus, der sich in der Doppelstruktur von Evolution und Auflösung vollzieht. Dabei unterstellt er, dass sich die Evolution immer auch als Integration von einfacheren zu komplexeren Einheiten vollzieht. Aber Komplexität bedeutet, dass der Grad der Differenzierung und damit der Unüberschaubarkeit ansteigt.3 Dies besagt: Mit größerer Gleichförmigkeit wird auch die Vielfalt erhöht. Der Aufbau von Ordnung erzielt über das Prinzip der Differenzierung den Aufbau möglicher Unordnung. Diese Differenzierung und Vielfalt führen mit der Zeit zum entgegengesetzten Element des kosmischen Prozesses: der Auflösung – mutmaßlich des gesamten Kosmos oder auch nur einzelner Regionen. Der doppelgesichtige kosmische Prozess, aus dem unsere gewöhnliche Erfahrungswelt nur einen schmalen Ausschnitt darstellt, ist umfassend und folgt möglicherweise keiner eindeutig fortschreitenden Linie. Entsprechend umfassend ist die Wahl von Spencers Beispielen in diesem Buch.
Entwicklung und Auflösung werden von Spencer so dargestellt, dass sie vor grundlegende Fragen stellen. Es überrascht daher nicht, dass er trotz aller ausführlich demonstrierten wissenschaftlichen und argumentativen Sorgfalt einen Sinn für das Bezugsproblem der Religion – so wie er es rekonstruiert – hat. Der Religion geht es Spencer zufolge um die Darstellung der Unerforschlichkeit der Wirklichkeit. Es handelt sich um ein Rätsel (mystery), das unter den gegebenen Bedingungen eben keine Auflösung findet, man könnte in anderer Terminologie auch sagen: Es handelt sich um ein »Geheimnis«, das sich allenfalls selbst erschließen könnte, was aber bedauerlicherweise nicht der Fall ist. Eben dies ahnt die Religion – und die Wissenschaft muss zusehends – trotz aller ihrer Ambitionen und Leistungen – bescheiden eingestehen, dass ihre letzten, durchaus empirisch bestätigten Ideen wie Zeit, Raum, Materie und Ursache auf dasselbe Rätsel hinauslaufen. Insofern legt sich aus Spencers Perspektive eine Versöhnung von Wissenschaft und Religion nahe. Beide haben es mit dem Unerkennbaren zu tun (Teil I). Die Wissenschaft beschäftigt sich darüber hinaus vor allem auf induktive Weise mit dem Erkennbaren (Teil II), stößt aber, wenn sie dies genau und konsequent durchdenkt, wieder auf das Unerkennbare. Natürlich ist diese Spencersche Versöhnung provokativ für die Hardliner beider Seiten. Scheinen doch die Religiösen genau zu wissen, was der Fall und was geboten ist. Dass ihre Botschaft darauf hinausläuft, die Wirklichkeit, wie wir sie erfassen können, sei ein Rätsel, erscheint blasphemisch. Für Wissenschaftler/innen scheint ihre alltägliche Praxis häufig etwas anderes zu bedeuten, zumal dies anscheinend am praktischen Erfolg kontrolliert werden kann. Und in einem zentralen Punkt soll diese praktische Kontrolle auf derselben Irrationalität wie derjenigen der Religion aufruhen? Auf so etwas kann wohl nur ein philosophierender Privatgelehrter kommen! Die klassische Osteopathie hat offenbar nicht auf diese Weise reagiert. Der Einfluss von Spencers Komplexitätsgedanken und seiner Wertschätzung des Problembezugs der Religion lässt sich zumindest indirekt ausmachen. Er liegt bei Stills Ansicht, der tatsächliche Arzt und die eigentliche Apotheke sei der »innere Mensch«, auf der Hand. Denn dies ist eine Chiffre, die auf die Unverfügbarkeit des Heilens verweist. Sie bricht die Idee, dass der Mensch eine überschaubare Maschine sei. Zumindest ist die Maschine so komplex, dass man nicht einfach einen Hebel bewegen oder einen Knopf drücken kann, um sie zu reparieren. Osteopathische Behandlung kann dies nur anregen. Indirekt ist auch William Garner Sutherlands Auffassung von der »Potency« der zerebrospinalen Flüssigkeit eine Reaktion auf das von Spencer so eindrücklich markierte Komplexitätsproblem.
Spencer war kein akademischer Philosoph. Er arbeitete zunächst als Hilfslehrer, dann als Eisenbahningenieur und später aufgrund seiner ausgedehnten sozialen und politischen Interessen als Publizist und Mitherausgeber des Economist. Seine philosophische Arbeit und Publizistik wurden durch eine Erbschaft begünstigt. Mit den Ersten Prinzipien der Philosophie wollte er ein Gesamtsystem der Philosophie starten, das die Biologie, die Psychologie, die Soziologie und die Ethik umfassen sollte und dann auch umfasst hat. Er stimmt philosophisch im Grundsatz mit den Positionen von Francis Bacon (1561–1626), Auguste Comte (1798–1857) und William Whewell (1794–1866) überein, mit der so genannten Synthetischen Philosophie. Die Grundprinzipien bzw. die ersten Prinzipien lassen sich als allgemeine Abstraktionen der einzelwissenschaftlichen Erkenntnisse und der durch sie repräsentierten Erfahrung erfassen (vgl. z. B. I.5 und II.1). Aus dem entsprechenden Reichtum des 19. Jahrhunderts, der vor allem in der Entwicklung einer gut begründeten statistischen Wahrheitstheorie, der Relationenlogik, der Semiotik und der Evolutionstheorie besteht, wählte er letztere als Leittheorie seiner Ersten Prinzipien der Philosophie aus – und rezipierte die anderen Errungenschaften allenfalls rudimentär. Die Alternative hätte im 19. Jahrhundert darin bestanden, die alltägliche Erfahrung genau zu untersuchen. Dann hätte sich möglicherweise die Frage aufgedrängt, ob es sich bei der Verallgemeinerung der Formen der Evolutionstheorie seit Charles Darwin nicht um eine »falsche Verallgemeinerung« gehandelt hätte (Charles Peirce [1838–1914]). Man wird aber Spencer bescheinigen müssen, dass er eine Variante der Evolutionstheorie vertrat, die mit der geschichtlichen Vielfalt der individuellen und sozialen Phänomene, vor allem aber einer humanen Sittlichkeit vereinbar war. Die geneigte Leserin und der geneigte Leser werden leicht erkennen, dass Spencers Formulierung vom survival of the fittest (Überleben der Angepasstesten; Principles of Biology,§ 164) keine »sozialdarwinistische« Pointe hat.4 Auch die Bezeichnung »Soziobiologie« geht an Spencers Gesellschaftstheorie vorbei, weil die Prinzipien der Gesellschaft zwar mit denen des Lebens übereinstimmen, aber auch mit denen der anorganischen Materie bis hin zu den »nebulären Massen« im Weltall. Aus Spencers Buch spricht eine sorgfältige Person, die human und tolerant ist. Gewiss treibt er gelegentlich seine »Schlussfolgerungen« recht weit. Aber das ist amüsant zu lesen. Der gelehrte Mann hatte offenbar britischen Humor und besaß einen Schuss Selbstironie.
Philosophisch werden die Fragen Spencers erst wieder mit der technologischen und ökonomischen Problematik der so genannten »Gentechnologie« breiter aufgenommen. Wenn Spencer recht hat, dann ist die Wirklichkeit auch im Bereich der so genannten »Natur« alles andere als statisch. Veränderung findet nicht nur in der Gesellschaft oder bei menschlichen Individuen statt. Gleichwohl stellt sich die sittliche Frage, welche Veränderungen wir wollen. Es wäre ein grobes Missverständnis jedenfalls Spencers, wenn man durch evolutionstheoretische Fragestellungen diese Frage als erledigt ansehen würde. Auch nach Spencer ist der Evolutionsprozess im Bereich der Gesellschaft kulturell, mithin von unseren Lebenskonzeptionen mitbestimmt. In der Tat vertrat er politisch eine »libertäre« Auffassung, also eine Position, die zwischen einer klassisch liberalen und einer anarchistischen Position schwankt. Aber hier ist nicht nur jede Assoziation von »Gewalt« und »Terror« zu vermeiden. Denn als Philosoph muss Spencer diese Position vor allem in den Evolutionsprozess einordnen. Und sie ist deswegen auch nicht schlicht der Endpunkt des Prozesses, sondern wird erwartungsgemäß Gegenreaktionen hervorrufen. Erst allmählich kann eine derartige Position allgemeiner verbreitet sein. Genauso verhält es sich mit seiner naturphilosophischen Konzeption. Seine Position ist offenkundig von der klassischen Physik geprägt (Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik). Doch seine Evolutionstheorie überlagert deren z.T. übervereinfachende und zu stark generalisierte Festlegungen, wie wir heute – quantentheoretisch belehrt – wissen5. Gewisse Uneindeutigkeiten Spencers lassen vermuten, dass er dies zumindest geahnt hat. Die Rezeption Spencers ist deshalb bis heute nicht ganz leicht. Sie erfordert eine gewisse Besonnenheit, die Spencer selbst zu eigen war.
Spencers Besonnenheit kommt vor allem in der Wahl eines wohl auf Platon zurückgehenden Modells seines umfassenden Denkens zum Ausdruck6. Er leugnet faktisch das Bestehen von kontradiktorischen Gegensätzen in der Wirklichkeit des Universums (wenn das eine der Fall ist, dann nicht das andere – und umgekehrt). Die Gegensätze sind in der erfahrbaren Wirklichkeit stattdessen in unterschiedlichen Verhältnissen kombiniert und können so in andere Konstellationen ihrer Kombination übergehen. So gehen auch die beiden Haupttendenzen im Universum ineinander über: Evolution und Auflösung. Als Beispiel mag hierfür der menschliche Tod gelten. In vielen einzelnen Denkansätzen Spencers zeigt sich dieses Modell. Exemplarisch sei auf das faszinierende Kapitel II.10 über »Rhythmen« verwiesen. Aber auch sein Versuch, das Verhältnis von Religion und Wissenschaft zu bestimmen, wird von diesem Modell geprägt.
Spencers Sprache ist gelegentlich umständlich. Er möchte alles genau und sorgfältig sagen, sodass seine Sätze zuweilen den Anschein griechischer Perioden haben. Ich habe mich bemüht, dies möglichst zu vereinfachen. Der verbleibende beachtliche Rest ist meiner Unfähigkeit anzulasten.
Der Text der sechsten Auflage der First Principles wurde vollständig übersetzt. Ausgelassen wurden nur die Vorworte Spencers für die verschiedenen Auflagen der First Principles und redundante sowie wenig aufschlussreiche Elemente der Appendices. Sie hätten die an der Sache interessierten Lesenden gewiss eher gelangweilt. Ganz genaue Historiker/innen müssen ohnehin die englische Ausgabe konsultieren.
Zur Bequemlichkeit der Leser und Leserinnen wurden – der Methode Spencers folgend – den einzelnen Kapiteln Zwischenüberschriften hinzugefügt, welche die entsprechenden einzelwissenschaftlichen Aspekte bezeichnen (Astronomie, Geologie, Biologie, Psychologie, Soziologie). Spencer fügt in der Regel eine Hinführung bzw. eine Zusammenfassung und Schlussfolgerung hinzu. Er verwendet auf seine Weise mithin das Gliederungsmuster der antiken Rhetorik (Prolog, These, Argumentation, Schlussfolgerung, Epilog). Diese Strukturierung erlaubt ein kritisches Querlesen je nach Interessen. Der Index wurde so durch die markierte Strukturierung entlastet. Er müsste ansonsten nahezu enzyklopädischen Charakter haben. Zur Einführung in das Buch und seine Argumentation ist die treffende Zusammenfassung in Kapitel II.24 sehr aufschlussreich. Sie sei daher hier ausdrücklich empfohlen. Für die Art der Argumentation Spencers als charakteristisch und in zusammenfassender Weise einführend erweisen sich weiter die Kapitel II.11.12 und 13. Auch auf sie wird daher an dieser Stelle ebenfalls hingewiesen.
Allen Leserinnen und Lesern liegt also ein Buch vor, das informativ und provokativ ist. Es erhellt eine geschichtliche Position, stellt möglicherweise feste Vorurteile infrage und provoziert zum eigenen Nachdenken. Mithin handelt es sich um ein exemplarisch philosophisches Buch – und ein gutes dazu.
Osteopathische Leser und Leserinnen haben vermutlich Spezialinteressen. Ihnen seien zunächst alle Kapitelsegmente mit der Zwischenüberschrift »[Biologie]« empfohlen. Sie zeigen Spencers Auffassung der organischen Anpassung. Aber seine Interpretationen des Nervensystems sind genauso wichtig. Sie finden sich unter »[Psychologie]«. Wer etwa den Klassiker Andrew Taylor Still näher verstehen will, sei zudem auf die Konzeptionen der »industriellen Gesellschaftsform« mit ihren exemplarisch marktwirtschaftlichen Interpretationsschemata in den mit »[Soziologie]« überschriebenen Kapitelsegmenten verwiesen. Sie erklären wohl weithin Stills Neufassung der antiken Säftelehre. Nicht zuletzt aber ist Stills Religionskonzeption zumindest indirekt durch Spencer beeinflusst. Zwar pflegt Still eine traditionellere Sprache als Spencer, die freilich durch Stills Freimaurertum gegenüber schlichter Gegenständlichkeit gebrochen ist. Sieht man aber genauer zu, dann vertritt auch Spencer eine steile religionsphilosophische These: Ihm zufolge sind alle Gesetzmäßigkeiten, nicht zuletzt die so wichtige »Beharrlichkeit der Kraft« nun einmal »Offenbarungen des Unerkennbaren«. Still-Kennern und -Kennerinnen dürfte dabei ein Licht aufgehen. Dies ist eine Empfehlung, sich dem (nicht ganz leichten) Teil I dieses Buchs ruhig einmal zuzuwenden. Ein unbedingtes Muss ist aber das faszinierende Rhythmenkapitel II.10, an dem sich manches Therapeut(inn)enherz vielleicht doch erfreuen kann. Für detailliertere Interessen empfiehlt sich schließlich eine ruhige Lektüre des Index.
Für hilfreiche Hinweise zur Übersetzung danke ich Dirk Großklaus. Sarah Spitzer und Christian Hartmann haben freundlicherweise den deutschen Text im Blick auf Verständlichkeit hin angesehen.
Die zweite Auflage der Übersetzung enthält die Korrektur einiger Versehen.
Martin Pöttner, Heidelberg im März 2007
Das Unerkennbare
Religion und Wissenschaft
§ 1
Wir vergessen zu oft, dass es nicht nur »einen Geist des Guten in bösen Sachverhalten«, sondern im Allgemeinen auch, dass es einen Geist der Wahrheit in falschen Sachverhalten gibt. Obgleich viele die abstrakte Möglichkeit zugestehen, dass eine falsche Auffassung gewöhnlich einen wahren Kern besitzt, denken daran wenige, wenn sie die Meinungen von anderen beurteilen. Eine Überzeugung, die sich als weit von den Tatsachen entfernt liegend gezeigt hat, wird mit Entrüstung und Verachtung zurückgewiesen. In der Hitze des Streites fragt niemand danach, worin der Grund besteht, dass diese Überzeugung sich dem menschlichen Verstand empfahl. Gleichwohl muss es etwas gegeben haben. Es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass es sich dabei um eine Übereinstimmung mit bestimmten Erfahrungen dieser Menschen handelt. Es mag sein, dass diese Übereinstimmung äußerst begrenzt und unbestimmt ist, gleichwohl handelt es sich um eine Übereinstimmung. Sogar der absurdeste Bericht lässt sich in nahezu jedem Fall auf ein tatsächliches Ereignis beziehen. Wenn es kein solches Ereignis gegeben haben sollte, würde die groteske Repräsentation nicht existieren. Die Überlieferung des verzerrten oder vergrößerten Bilds im Medium eines entstellenden Gerüchts erzeugt ein der Wirklichkeit völlig unähnliches Bild. Doch ganz ohne Wirklichkeit gäbe es kein verzerrtes oder vergrößertes Bild. Genauso verhält es sich mit menschlichen Überzeugungen im Allgemeinen. So vollkommen falsch, wie sie erscheinen mögen, enthielten sie ursprünglich doch – und enthalten vielleicht noch immer – einen kleinen Grad an Wahrheit.
Genaue Perspektiven auf diesen Sachverhalt können für uns sehr nützlich sein. Es ist wichtig, eine Art allgemeiner Theorie gewöhnlicher Meinungen auszubilden, sodass wir ihren Wert nicht über- oder unterschätzen. Viel hängt davon ab, wie die mentale Einstellung beschaffen ist, wenn wir zuhören oder an Auseinandersetzungen teilnehmen, um zu einer zutreffenden Beurteilung zu kommen. Um eine angemessene Einstellung aufrechtzuerhalten, ist es nötig, dass wir lernen wie wahr und doch wie unwahr durchschnittliche menschliche Überzeugungen sind. Auf der einen Seite müssen wir uns frei von der günstigen Neigung für derartige Ideen halten, die sich in solchen Dogmen ausdrücken, wie: »Was alle sagen, muss wahr sein!« oder: »Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes!« Auf der anderen Seite erein Überblick über die Vergangenheit, dass Mehrheiten gewöhnlich falsch lagen. Doch dies darf uns nicht dazu führen, die Behauptung aufzustellen, dass Mehrheiten gewöhnlich vollkommen falsch liegen. Da die Vermeidung dieser Extreme eine Voraussetzung toleranten Denkens ist, tun wir gut daran uns gegen sie zu schützen, indem wir eine Bewertung von Meinungen im Allgemeinen vornehmen. Dazu müssen wir die Art der Beziehung bedenken, die gewöhnlich zwischen Meinungen und Tatsachen besteht. Wir wollen das anhand einer Überzeugung tun, die in verschiedenen Formen bei allen Völkern zu allen Zeiten vorherrschte.
§ 2
Die frühen Traditionen verstehen Herrscher als Götter oder als Halbgötter. Ihre Untertanen betrachteten die frühen Könige als übermenschlich dem Ursprung und der Macht nach. Sie führten königliche Titel, wurden göttlich verehrt und gelegentlich sogar angebetet. Natürlich war in diesen Überzeugungen impliziert, dass dem Herrscher unbegrenzte Macht über seine Untertanen zustehe, sogar über das physische Leben – wie dies jüngst auf den Fidschi-Inseln geschah, als ein zur Tötung bestimmtes Opfer ohne Fesseln erklärte: »Was der König will, muss getan werden!« Zu anderen Zeiten und bei anderen Rassen finden wir diese Überzeugungen leicht modifiziert vor. Vom Monarchen wird – anstelle der Ansicht, es handele sich um einen Gott oder Halbgott – angenommen, er sei ein Mensch mit göttlicher Autorität von vielleicht mehr oder weniger göttlicher Natur. Gleichwohl behält er Titel, die seine himmlische Abstammung bzw. seine himmlischen Beziehungen ausdrücken. Und er wird weiter in Formen und Worten begrüßt, die so unterwürfig wie an die Gottheit gerichtete sind. Auch wenn das Leben und das Eigentum von Menschen nicht mehr so vollständig von seiner Gnade abhängen, so wird es doch so betrachtet, als ob dies der Fall wäre.
Im weiteren Fortschritt der Zivilisation wie im europäischen Mittelalter, veränderten sich die gewöhnlichen Überzeugungen über Herrscher und Beherrschte weiter. An die Stelle der göttlichen Abstammung trat die des göttlichen Rechts. Der König wird nicht mehr als Halbgott bzw. sogar als von Gott abstammend betrachtet, sondern schlicht als Gottes Stellvertreter. Die Verehrungen fallen nicht mehr so extrem unterwürfig aus, die heiligen Titel verlieren vieles von ihrer Bedeutung. Darüber hinaus ist seine Autorität nicht mehr unbegrenzt. Die Untertanen lehnen sein Recht ab, frei über ihr Leben und ihr Eigentum zu bestimmen. Ihre Loyalität beschränkt sich auf den Gehorsam gegenüber seinen Befehlen.
Mit der fortschreitenden Ausbildung politischer Meinungen ergab sich die Einschränkung der königlichen Macht. Die Überzeugung vom übernatürlichen Charakter des Herrschers, die von uns schon vor langer Zeit zurückgewiesen wurde, hat wenig mehr als die populäre Tendenz zurückgelassen, dem König ungewöhnliche Güte, Weisheit und Schönheit zuzuschreiben. Loyalität, die ursprünglich blinde Unterwerfung unter den Willen des Königs bezeichnete, bedeutet heute ein bloß nominelles Bekenntnis zur Unterordnung und die Beachtung bestimmter Formen des Respekts. Wir haben einige Rechte weg genommen und andere an ihre Stelle gesetzt. Auf diese Weise haben wir nicht nur die göttlichen Rechte bestimmter Menschen zu herrschen geleugnet, sondern leugnen darüber hinaus, dass sie irgendwelche Rechte besitzen, die nicht auf der Zustimmung der Nation beruhen. Obgleich die Formen unserer Reden und unsere Staatsurkunden die Unterwerfung der Bürger unter den Herrscher darlegen, bezeugen unsere tatsächlichen Überzeugungen und die tatsächlichen Verfahren doch das Gegenteil. Wir haben den Monarchen ganz der gesetzgebenden Macht entkleidet – und würden sofort rebellieren, wenn er oder sie sich anmaßte etwas zu diktieren, auch wenn es noch so geringfügige Bedeutung hätte.
Gleichwohl hat die Verwerfung der frühen politischen Ansichten nicht bloß zu einer Übertragung der Macht von einem Autokraten auf eine repräsentative Körperschaft geführt. Die Ansichten, die es gegenwärtig über Regierungen der verschiedensten Form im Allgemeinen gibt, sind erheblich anders als diejenigen, die es einst gab. Sie mochten populär oder despotisch sein – immer wurde den Regierungen eine unbegrenzte Macht über ihre Untertanen eingeräumt. Die Individuen existierten zum Nutzen des Staates – und nicht umgekehrt. In unseren Tagen trat jedoch nicht nur der Volkswille an die Stelle des Willens des Königs. Die Ausübung des Volkswillens ist zudem eingeschränkt worden. Obgleich beispielsweise in England lehrmäßig keine feste Grenze von Regierungshandeln gezogen worden ist, so werden doch verschiedene Grenzen stillschweigend von allen anerkannt. Es gibt kein konstitutionelles Gesetz, das erklärt, die Gesetzgebung dürfe nicht frei über das Leben der Bürger verfügen, wie es die alten Könige taten. Doch falls unsere Gesetzgebung einen solchen Versuch unternehmen sollte, wäre ihre eigene Zerstörung – und nicht die der Bürger – die Folge. Wie vollständig wir die persönlichen Freiheiten der Untertanen gegen Übergriffe der Staatsgewalt sichergestellt haben, zeigte sich schnell dann, wenn der Vorschlag durch einen Parlamentsbeschluss käme, von der Nation oder einer Klasse Besitz zu ergreifen und ihre Dienste für öffentliche Zwecke zu verwenden, wie dies bei den Ägyptern der Fall war. Nicht erst heute bestehen die Ansprüche der Bürger auf Leben, Freiheit und Eigentum als Gut gegenüber dem Staat, sondern ebenso verschiedene vergleichsweise kleinere Ansprüche. Schon vor längerer Zeit verloren die Gesetze, die Kleidung und Lebensstil regulierten, ihre Geltung. Jeder Versuch diese wiederzubeleben würde zeigen, dass derartige Angelegenheiten jenseits der Ebene gesetzlicher Kontrolle liegen. Seit einigen Jahrhunderten praktizieren wir die jetzt auch theoretisch erfasste Einsicht, dass jeder Mensch das Recht auf seine eigenen religiösen Überzeugungen hat und keiner staatlich verordneten Religion folgen muss. In den letzten Generationen wurde die volle Freiheit der Rede erreicht, obgleich es gesetzgeberische Versuche gegeben hat, diese zu unterdrücken oder zu begrenzen. Sieht man von wenigen Beschränkungen ab, haben wir jüngst das Recht erhalten, mit jedem Handel zu treiben, wenn wir dies wünschen. Daher unterscheiden sich unsere politischen Überzeugungen von den alten. Dies betrifft nicht nur die Frage, wer die Macht über eine Nation ausüben darf, sondern auch den Umfang dieser Macht.
Selbst hier hat die Veränderung nicht Halt gemacht. Neben den durchschnittlichen Meinungen, die wir gerade als unter uns gewöhnlich dargelegt haben, gibt es eine weniger allgemein verbreitete Ansicht, die in derselben Richtung noch weiter geht. Es finden sich Leute, die behaupten, dass die Sphäre der Regierung noch mehr eingeschränkt werden solle als in England. Sie vertreten die These, dass die Freiheit des Individuums, die durch die Freiheit eines anderen Individuums begrenzt ist, heilig ist. Sie bestehen darauf, die einzige Funktion des Staates sei im Schutz der Individuen voreinander zu finden – und im Schutz vor einem auswärtigen Feind. Sie sind der Überzeugung, dass der höchste politische Zustand derjenige sei, in dem die persönliche Freiheit am Größten und die Macht der Regierung am Geringsten sei.
Daher finden wir in den Fragen des Ursprungs, der Autorität und der Funktionen der Regierung eine große Verschiedenheit. Was müssen wir nun über die Wahrheit bzw. Falschheit dieser Meinungen sagen? Müssen wir sagen, dass eine vollkommen wahr sei und der Rest vollständig falsch? Oder sind wir nicht eher veranlasst anzunehmen, dass jede Meinung Wahrheit enthält, die mehr oder weniger durch Irrtümer entstellt ist? Die letztere Analyse entfaltet für uns Überzeugungskraft. Jede dieser Meinungen besitzt einen lebendigen Kern, eine unbestreitbare Tatsache. Direkt oder implizit wird die individuelle Handlung einem sozialen Diktat unterstellt. Es gibt Unterschiede darin, welcher Macht die Unterordnung verpflichtet ist. Das Motiv der Unterordnung wird verschieden bestimmt. Der Umfang der Unterordnung ist kontrovers. Doch alle stimmen darin überein, dass es überhaupt eine Unterordnung geben muss. Die unterwürfigste und die aufsässigste Meinung stimmen darin überein, dass es Grenzen gibt, die von individuellen Handlungen nicht überschritten werden dürfen. Dabei hängen nach der einen Meinung diese Grenzen vom Willen des Herrschers ab, der anderen zufolge von den gleichberechtigten Ansprüchen der Mitbürger.
Natürlich kann man sagen, dass dies kein besonders aufregendes Ergebnis ist. Gleichwohl ist nicht der Wert oder die Neuheit dieser partikularen Wahrheit von Belang. Es ging mir nur darum zu zeigen, dass zwischen extrem verschiedenen Meinungen gewöhnlich doch etwas Gemeinsames besteht – etwas, das in jeder von ihnen als gegeben unterstellt wird. Wenn man dieses Etwas nicht als unbezweifelbare Wahrheit setzt, darf man doch unterstellen, dass es einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit aufweist.
Ein derartiges Postulat, wie eben als Beispiel erarbeitet, wird nicht bewusst behauptet, sondern ist unbewusst impliziert. Diese unbewusste Implikation liegt nicht nur bei einem Menschen oder einer menschlichen Gesellschaft vor, sondern in zahlreichen Gesellschaften, die in zahllosen Weisen und Graden Unterschiede in ihren übrigen Überzeugungen aufweisen. Ein derartiges Postulat hat einen großen Vorsprung vor anderen, die gewöhnlich aufgezeigt werden.
Haben wir damit eine Verallgemeinerung erreicht, die uns dabei leiten kann, wenn wir nach dem Geist der Wahrheit in irreführenden Darlegungen suchen? Unser Beispiel hat veranschaulicht, dass in offensichtlich falschen Ansichten doch etwas Wahres gefunden werden kann. Dazu erfuhren wir etwas über den Weg, um das Richtige zu finden. Der Weg besteht im Vergleich aller Meinungen derselben Art. Die Elemente, in denen sich diese Meinungen mehr oder weniger widersprechen bzw. diskreditieren, werden beiseite gelassen. Dann beobachten wir, was danach übrig bleibt. Für diesen Rest suchen wir nach einem allgemeinen Ausdruck, der das Beständige in seinen verschiedenen Maskierungen bezeichnen kann.
§ 3
Eine konsequente Anwendung der vorgestellten Methode wird uns bei chronischen Widersprüchen von Überzeugungen helfen. Wenn wir sie nicht nur auf Probleme anwenden, mit denen wir nicht beschäftigt sind, sondern auch auf unsere eigenen Ideen und die unserer Gegner, werden wir in der Lage sein, zutreffendere Urteile zu fällen. Wir werden dazu geführt, dass unsere Überzeugungen nicht völlig richtig sind – und die ihnen entgegenstehenden nicht völlig falsch. Auf der einen Seite werden wir nicht mit der großen Masse der nicht denkenden Menschen unsere Ansichten von unserem zufälligen Leben in einem Zeitalter und auf einem Fleck der Erdoberfläche bestimmt sein lassen. Auf der anderen Seite sind wir vor dem Irrtum der völligen und verächtlichen Negation geschützt, in den viele fallen, welche die Haltung unabhängiger Kritiker einnehmen.
Unter allen Streitigkeiten ist der älteste, breiteste, grundlegendste und wichtigste Streitfall derjenige zwischen Religion und Wissenschaft. Er entstand, als die Erkenntnis der einfachsten Gleichförmigkeiten in den Sachverhalten, die uns umgeben, den ursprünglichen abergläubischen Ansichten eine Grenze setzte. Sie zeigten sich überall im Bereich des menschlichen Wissens. Sie beeinflussten gleichermaßen die menschliche Interpretation der einfachsten mechanischen Zufälle und der komplexen Ereignisse in der Geschichte der Nationen. Sie besitzen ihre Wurzeln tief in verschiedenen Gewohnheiten des Denkens unterschiedlicher Ordnungen des Geistes. Und die widerstreitenden Auffassungen von Natur und Leben, die diese verschiedenen Denkweisen jeweils erzeugen, üben guten oder schlechten Einfluss auf die Grundstimmung von Gefühlen und alltäglicher Lebensführung aus.
Ein Jahrhunderte langer Meinungskampf wie der unter den Bannern von Religion und Wissenschaft erbittert geführte wirkt sich ungünstig auf die gerechte Beurteilung der einen Partei durch die andere aus. Glücklicherweise entwickeln die Zeiten in zunehmendem Maß eine Toleranz des Fühlens, die wir so weit entwickeln sollten, wie es unsere Natur erlaubt. In dem Maß, in dem wir stärker die Wahrheit als den Sieg lieben, bemühen wir uns herauszufinden, was dazu geführt haben könnte, dass unsere Gegner so denken, wie sie denken. Wir beginnen zu erwarten, dass die Hartnäckigkeit der Überzeugung, die sie an den Tag legen, darauf beruht, dass sie etwas wahrgenommen haben, was wir nicht wahrgenommen haben. Und wir werden danach streben, den Anteil an Wahrheit, den wir gefunden haben, durch den Anteil zu ergänzen, den sie gefunden haben. Wenn wir eine rationale Einschätzung menschlicher Autorität entwickeln, dann sollten wir ähnlich die Extreme übermäßiger Unterwerfung und übermäßiger Rebellion vermeiden. Wir betrachten die Ansichten eines Menschen nicht als vollkommen falsch oder vollkommen richtig. Wir bilden stattdessen die besser zu verteidigende Position aus, dass keine vollkommen falsch und keine vollkommen richtig ist.
Wir wollen jetzt so unparteiisch, wie dies möglich ist, die beiden Seiten unserer großen Streitfrage betrachten. Wir nehmen uns in Acht vor der Neigung der Erziehung und schenken sektiererischem Geflüster kein Gehör. Auf diese Weise wollen wir bedenken, was a priori zugunsten der einen oder der anderen Partei spricht.
§ 4
Der allgemeine Grundsatz, den wir zuvor veranschaulicht haben, muss uns dazu führen, dass wir die Voraussetzung entwickeln, die unterschiedlichen vergangenen und gegenwärtigen Formen von religiösen Überzeugungen besäßen alle eine Grundlage in einer letzten Tatsache. Wenn wir analog schließen, ergibt sich: Keine ist ausschließlich im Recht, sondern in jeder finden sich Wahrheitsmomente, die mehr oder weniger von falschen Vorstellungen verschleiert werden. Es kann sein, dass der Geist der Wahrheit, der in irreführenden Glaubensbekenntnissen enthalten ist, seinen Verkörperungen – wenn schon nicht in allen, so doch in den meisten – nicht sehr ähnlich sieht. Und wenn er tatsächlich – wofür wir gute Gründe haben – abstrakter ist als diese, folgt notwendig seine Unähnlichkeit. Doch wir müssen nach einer essenziellen Wahrheit suchen. Die Unterstellung ist nicht plausibel, dass diese vielfältigen Konzeptionen völlig grundlos sein sollten. Dies bringt zu sehr die menschliche Intelligenz in Misskredit, von der alle unsere Intelligenzen abstammen.
Zu der Voraussetzung, dass eine Anzahl von verschiedenen Glaubensüberzeugungen ein Fundament in einer Tatsache haben muss, müssen wir in diesem Fall eine weitere Voraussetzung hinzufügen, die aus der universalen Verbreitung der Überzeugungen stammt. Religiöse Ideen der einen oder anderen Art sind nahezu universal. Gesteht man zu, dass es bei allen Menschen, die eine bestimmte Stufe der intellektuellen Entwicklung durchlaufen haben, unbestimmte Vorstellungen gibt, die den Ursprung und die verborgene Natur der umgebenden Sachverhalte betreffen, wird man auch schließen müssen, dass derartige Vorstellungen notwendige Produkte einer fortschreitenden Intelligenz sind. Ihre unendliche Vielfalt stärkt sogar die Schlussfolgerung: Sie zeigt uns ein mehr oder weniger unabhängiges Entstehen an. Wir sehen, wie an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gleiche Bedingungen zu einer ähnlichen Tendenz der Gedanken geführt haben, die bei analogen Ergebnissen enden. Eine offene Untersuchung der Tatsachen widerlegt vollkommen die Behauptung, dass Glaubensbekenntnisse die Erfindung von Priestern seien. Sogar von einer bloßen Wahrscheinlichkeitsposition aus kann nicht rational geschlossen werden, dass in jeder, wilden oder zivilisierten, Gesellschaft sich Menschen zusammengeschlossen haben, um den Rest auf derart analoge Weise zu täuschen. Darüber hinaus gelingt es der Hypothese eines künstlichen Ursprungs nicht, einen Zugang zu den Tatsachen zu finden. Sie vermag nicht zu erklären, warum – trotz aller Veränderung der Form – bestimmte Elemente der religiösen Überzeugung konstant bleiben. Sie vermag nicht zu zeigen, wie es möglich ist, dass Kritiker von Zeitalter zu Zeitalter partikulare theologische Dogmen zerstören, ohne dass es gelang, die zugrunde liegende Konzeption zu zerstören. Daher stimmen die Universalität religiöser Ideen, ihre unabhängige Entwicklung bei den frühen Rassen und ihre große Lebendigkeit in dem Hinweis überein, dass ihre Quelle sehr tief liegen muss. Mit anderen Worten sind wir verpflichtet zuzugeben, dass – falls sie nicht übernatürlichen Ursprungs sind, wie die Meisten behaupten – sie aus der Erfahrung stammen müssen und allmählich gesammelt und organisiert wurden.
Wenn man behauptet, die religiösen Ideen seien Produkte des religiösen Gefühls, das – um sich selbst zufrieden zu stellen – Fantasien hervorruft, die es danach in die äußere Welt projiziert und nach und nach als Realitäten missversteht, löst man das Problem nicht, sondern schiebt es eine Stufe weiter. Woher kommt das Gefühl? Dass es wesentlich zum Menschen gehört, wird von der Hypothese vorausgesetzt. Auch wenn man andere Hypothesen vorzieht, kann man dies nicht leugnen. Und wenn das religiöse Gefühl, das in der Regel bei der Mehrheit der Menschen auftritt und gelegentlich auch bei denen vorkommt, die es zu entbehren scheinen, unter die menschlichen Gefühle zu rechnen ist, kann es nicht rational ignoriert werden. Es liegt eine Eigenschaft vor, die eine unübersehbare Rolle bis in die jüngste Vergangenheit von den ersten historischen Aufzeichnungen angefangen gespielt hat. Gegenwärtig bestimmt es das Leben zahlreicher Institutionen, löst fortwährende Kontroversen aus und befördert zahllose alltägliche Aktionen. Somit handelt es sich offensichtlich um eine Frage der Philosophie. Wir können uns dieser Aufgabe nicht entledigen. Denn wir müssten unsere Philosophie als unfähig erklären.
Uns stehen nur zwei Erwägungen offen: Die eine, dass jenes Gefühl, das religiösen Ideen entspricht, das Ergebnis einer besonderen Schöpfung sei, oder die andere, dass es gemeinsam mit allem anderem im Prozess der Evolution ausgebildet worden ist. Wenn wir die erste der beiden Möglichkeiten akzeptieren – wie es unsere Vorfahren taten und die allermeisten unserer Zeitgenossen tun – ist die Sache sofort klar: Der Mensch ist direkt von einem Schöpfer mit dem religiösen Gefühl begabt. Und es antwortet wie vorgesehen diesem Schöpfer. Wählen wir die zweite Möglichkeit, dann stellen sich uns die Fragen: Welchen Umständen ist die Entstehung des religiösen Gefühls zuzuschreiben? – und: Worin besteht sein Zweck? Wenn wir bedenken, wie wir es tun müssen, dass alle Fähigkeiten die Resultate akkumulierter Modifikationen sind, die durch den Austausch des Organismus mit seiner Umwelt entstehen, sind wir verpflichtet zuzugeben, dass es in der Umwelt bestimmte Phänomene bzw. Bedingungen gibt, die das Wachstum des religiösen Gefühls bestimmt haben. Daher müssen wir zugeben, dass es so normal ist wie andere Fähigkeiten auch. Dem ist hinzuzufügen, dass es auf irgendeine Weise zur Wohlfahrt der Menschen beiträgt, wenn es gilt, dass niedrigere Formen sich zu höheren entwickeln und das Ziel dieser Entwicklung in der Anpassung an die Erfordernisse des Lebens besteht. Auf diese Weise enthalten beide Möglichkeiten dieselbe letzte Implikation. Wir müssen schließen, dass das religiöse Gefühl entweder direkt erschaffen oder mittels natürlicher Ursachen langsam entwickelt sei. Beide Schlussfolgerungen verpflichten uns das religiöse Gefühl mit Respekt zu behandeln.
Eine andere Erwägung sollte nicht übersehen werden. Insbesondere Studierende der Wissenschaften müssen darauf hingewiesen werden. Als solche sind sie mit bestätigten Wahrheiten konfrontiert und gewohnt Sachverhalte, die noch nicht bekannt sind, als demnächst bekannt werdende einzuschätzen. Daher sind sie anfällig dafür zu vergessen, dass Information, so umfassend sie auch sein mag, die Forschung niemals befriedigen kann. Positives Wissen wird und kann auch nicht den Raum des möglichen Denkens füllen. Am äußersten Punkt einer Entdeckung entsteht die Frage: Was liegt jenseits dessen? Wie es unmöglich ist, die Grenze des Raums so zu denken, als ob die Idee eines Raums außerhalb dieser Grenze vermieden werden könnte, so ist es unmöglich, eine Erklärung derart grundlegend zu fassen, dass nicht die Frage entsteht: Worin besteht die Erklärung dieser Erklärung? Wenn wir uns das Wissen als eine ständig anwachsende Kugel denken, können wir sagen, dass jede Ausweitung ihrer Oberfläche sie nicht in breitere Berührung mit dem sie umgebenden Nicht-Wissen bringt. Es müssen daher stets zwei antithetische Arten der mentalen Aktion bestehen bleiben. So wie jetzt muss sich der menschliche Geist nicht allein mit den sicher erfassten Phänomenen und ihren Beziehungen, sondern auch mit dem unsicheren Etwas, dass die Phänomene und ihre Beziehungen implizieren, beschäftigen. Weil das Wissen nicht das Bewusstsein monopolisieren kann, muss es immer für den Geist die Möglichkeit geben bei dem zu verweilen, was das Wissen transzendiert. Daher wird es immer einen Ort für etwas von der Art der Religion geben. Denn sie unterscheidet sich dadurch von allen anderen Sachverhalten, dass ihr Hauptgegenstand die Sphäre des Intellekts übersteigt.
Daher gilt: Wie unhaltbar auch die existierenden Glaubensbekenntnisse sein mögen, wie plump auch die Absurditäten, die sich mit ihnen verbinden, wie irrational die Argumente, die zu ihrer Verteidigung vorgebracht werden, so dürfen wir doch die Wahrheit nicht verkennen, die dem Anschein nach in ihnen verborgen liegt. Die allgemeine Wahrscheinlichkeit, dass weit verbreitete Überzeugungen nicht völlig grundlos sind, wird in diesem Fall durch die weitere Wahrscheinlichkeit verstärkt, die in der universalen Verbreitung der Überzeugungen liegt. In der Existenz des religiösen Gefühls – worin immer sein Ursprung bestehen mag – besitzen wir eine zweite Evidenz von großer Bedeutung. Und da jenes Nicht-Wissen, das immer als Gegensatz zum Wissen bestehen muss, der Bereich der Ausübung dieses Gefühls ist, so finden wir darin eine dritte allgemeine Tatsache von großer Bedeutung. Daher können wir sicher sein, dass die Religionen, obgleich sie in keinem Fall tatsächlich wahr sein mögen, dennoch zumindest als Andeutung von Wahrheit aufgefasst werden können.
§ 5
Wie es für einen religiösen Menschen absurd erscheint, die Religion zu verteidigen, so ergeht es auch dem wissenschaftlichen Menschen. Doch die Verteidigung der Wissenschaft ist ebenso nötig wie die Verteidigung der Religion. Wie es manche gibt, die aus Verachtung für ihre Torheiten und aus Ekel vor ihrer Korruption sich eine feindliche Haltung gegenüber der Religion zugelegt haben, die sie daran hindert, die grundlegende Wahrheit in ihr zu entdecken, so gibt es andere, die derart verletzt durch die von Wissenschaftlern geäußerte zerstörerische Kritik sind, welche die religiösen Grundsätze betrifft, die sie für wesentlich halten, dass sich in ihnen ein starkes Vorurteil gegen die Wissenschaft als Ganze festgesetzt hat. Sie besitzen keinerlei stichhaltige Gründe für ihre Abneigung. Sie sind geprägt von der Erinnerung an die groben Schläge, welche die Wissenschaft ihren verehrten Überzeugungen zugefügt hat. Sie hegen den Verdacht, diese werde am Ende alles ausrotten, was sie als heilig betrachten. Daher ruft sie in ihnen einen namenlosen Schrecken hervor.
Was ist Wissenschaft? Um die Absurdität des Vorurteils gegen sie zu verstehen, müssen wir nur darauf hinweisen, dass es sich schlicht um eine höhere Entwicklung des alltäglichen Wissens handelt. Wenn also die Wissenschaft zurückgewiesen wird, wird zugleich das alltägliche Wissen zurückgewiesen. Der extremste Frömmler wird nichts Schlimmes in der Beobachtung finden, dass die Sonne im Sommer früher aufgeht und später untergeht als im Winter, sondern diese Einsicht als nützlich bei der Erfüllung der täglichen Pflichten betrachten. Gut, die Astronomie ist eine organisierte Sammlung ähnlicher Beobachtungen, die mit größerer Genauigkeit gemacht werden, auf eine größere Zahl an Objekten ausgedehnt werden und so miteinander verbunden sind, dass sie die tatsächliche Ordnung der Himmel erkennen lassen und unsere falschen Vorstellungen von ihnen vertreiben. Dass Eisen im Wasser rostet, dass Holz brennt, dass lange aufbewahrte Speisen faulen, wird der höchst furchtsame Sektierer ohne Schrecken lehren. Doch es handelt sich um chemische Wahrheiten: Chemie besteht aus einer Sammlung solcher Tatsachen, die mit Genauigkeit abgesichert und so klassifiziert und zusammengestellt sind, dass sie uns ermöglichen, mit Sicherheit vorauszusagen, welche Veränderungen unter gegebenen Umständen vor sich gehen werden. Und so verhält es sich mit allen Wissenschaften. Sie entstehen gesondert aus den Erfahrungen des alltäglichen Lebens. Mit ihrem allmählichen Wachstum ziehen sie entferntere, zahlreichere und verwickeltere Erfahrungen an. Zwischen ihnen erfassen sie Gesetze der Abhängigkeit, wie denen, aus denen unser Wissen von vertrauten Objekten besteht. Es gibt keine Möglichkeit an einer Stelle eine Linie zu ziehen und zu sagen: Hier fängt Wissenschaft an. Wie die allgemeinen Beobachtungen einen Dienst für die Lebensführung leisten, so ist dies auch die Aufgabe der abgelegensten und abstraktesten Untersuchungen der Wissenschaft. Durch die zahllosen industriellen Prozesse und die vielfältigen Möglichkeiten der Ortsveränderung, welche wir durch die Physik erlangt haben, reguliert sie vollständiger unser Leben, als die Vertrautheit eines Wilden mit den Eigenschaften der Umgebung sein Leben regelt. Alle Wissenschaft ist Vorhersehen. Alles Vorhersehen hilft uns letztlich in größerem oder kleineren Grad das Gute zu erreichen und das Böse zu vermeiden. Da Ursprung und Funktion unseres Wissens gleich sind, müssen seine einfachste und komplexeste Form gleich behandelt werden. Wir sind zur Widerspruchsfreiheit verpflichtet: Wenn wir die komplexen Formen ablehnen, zu denen unsere Fähigkeiten ausreichen, müssen wir zugleich auch unser Alltagswissen zurückweisen.
Die Frage zu stellen, die unser Argument unmittelbar betrifft, ob Wissenschaft wahr sei, klingt fast so, als fragte man, ob die Sonne Licht spende. Und genau deswegen, weil die theologische Partei sich darüber klar ist, dass die meisten Sätze der Wissenschaft unerschütterlich fest sind, beobachtet sie die Wissenschaft mit solch geheimen Entsetzen. Sie wissen, dass während ihres fünftausend Jahre währenden Wachstums einige der wichtigen Disziplinen Mathematik, Physik und Astronomie der harten Kritik der folgenden Generationen ausgesetzt waren und in diesem Prozess sich dennoch immer fester ausgebildet haben. Sie wissen, dass es sich anders als bei ihren Lehren verhält, die einst universal akzeptiert waren und von Zeitalter zu Zeitalter in immer größerem Umfang bezweifelt wurden. Anders dagegen die wissenschaftlichen Lehren. Sie waren zuerst auf einige verstreute Forscher beschränkt, verbreiteten sich aber allmählich allgemein und werden heute zum großen Teil als außerhalb der Diskussion liegend betrachtet. Sie wissen, dass die Wissenschaftler in der ganzen Welt ihre Ergebnisse kritisch überprüfen. Ein Irrtum wird gnadenlos angezeigt und – sobald er entdeckt ist – zurückgewiesen. Schließlich wissen sie, dass die tägliche Bestätigung wissenschaftlicher Voraussagen ein wesentliches Zeugnis und den niemals endenden Triumph der Künste darstellt, die von der Wissenschaft geleitet werden.
Dasjenige, was derartige Beglaubigungen erhalten hat, mit Misstrauen anzusehen, ist töricht. Sicher mögen die Verteidiger der Religion im Ton mancher Wissenschaftler, den diese gegenüber ihnen annehmen, eine Entschuldigung finden. Doch diese Entschuldigung genügt nicht. Auf beiden Seiten ist zuzugeben, dass Kurzschlüsse bei der Verteidigung nicht zwingend gegen das Verteidigte sprechen. Die Wissenschaft muss aus sich selbst heraus beurteilt werden. Tut man dies, kann nur ein irregeleiteter Geist verkennen, dass sie aller Verehrung wert ist. Mag es nun noch eine andere Offenbarung geben oder nicht, jedenfalls liegt in der Wissenschaft eine Offenbarung vor, eine fortschreitende Enthüllung der gesetzmäßigen Ordnung des Universums durch die Vernunft, mit der wir begabt sind. Es ist die Pflicht eines jeden diese Enthüllung zu bestätigen – soweit er dies vermag. Und nachdem sie sich für ihn als wahr gezeigt hat, muss er sie mit aller Demut akzeptieren.
§ 6
Es muss auf beiden Seiten dieser großen Kontroverse Recht geben. Die Religion – überall präsent als eine Art roter Faden, der sich durch das Gewebe der Geschichte zieht – drückt irgendeine ewige Tatsache aus. Dagegen ist die Wissenschaft ein organisierter Bau von Wahrheiten, der fortwährend wächst und von Irrtümern gereinigt wird. Und wenn beide Grundlagen in der Realität haben, muss es eine grundlegende Harmonie zwischen ihnen geben. Es ist unmöglich, dass es zwei Ordnungen von Wahrheiten gibt, die in vollkommenem und immer währenden Gegensatz stehen. Höchstens falls jemand einer manichäischen Lehre folgt, was niemand öffentlich zuzugeben wagt, wäre eine derartige Unterstellung denkbar. Dass die Religion von Gott und die Wissenschaft vom Teufel sei, ist eine Behauptung, die sich zwar hinter mancher klerikalen Deklamation verbirgt. Doch sie klar auszusprechen, bringt selbst der extreme Fanatiker nicht über sich. Wer dies nicht behauptet, muss zugeben, dass es unter dem scheinbaren Antagonismus eine verborgene vollständige Übereinstimmung gibt.
Jede Seite muss also die Ansprüche der anderen als solche anerkennen, die Wahrheiten darstellen, welche nicht ignoriert werden dürfen. Es geziemt sich, dass jeder sich bemüht, den anderen zu verstehen. Dabei sollte er die Überzeugung hegen, dass der andere etwas besitzt, was es wert ist verstanden zu werden. Diese wechselseitige Anerkennung von etwas wird die Basis einer Versöhnung bilden.
Wie ist dieses Etwas zu finden? – Das ist das Problem, das wir beharrlich zu lösen versuchen müssen. Es geht nicht um eine behelfsmäßige Versöhnung, sondern um einen tatsächlichen und dauerhaften Frieden. Wir müssen die höchste Wahrheit finden, die beide mit vollkommener Aufrichtigkeit und ohne mentale Zurückhaltung bekennen. Es geht nicht um eine Konzession, die dann nach und nach wieder einkassiert wird. Der gemeinsame Boden, auf dem sie sich treffen können, muss ihnen als der je eigene gelten. Wir müssen eine Wahrheit entdecken, welche die Religion emphatisch behauptet, wenn die Wissenschaft abwesend ist. Und die Wissenschaft spricht sie emphatisch aus, wenn die Religion abwesend ist. Wir müssen nach einer Konzeption suchen, welche die Schlussfolgerungen beider Seiten kombiniert und also sehen, wie Wissenschaft und Religion die beiden entgegengesetzten Seiten einer Tatsache aussprechen: Die eine ist die nahe liegende bzw. die sichtbare Seite, die andere die entfernte bzw. unsichtbare Seite.
Schon zuvor haben wir die Methode, wie eine solche Versöhnung zu finden sei, grob skizziert. Bevor wir aber weiter gehen, sollten wir die Frage der Methode noch genauer behandeln. Um jene Wahrheit zu finden, in der Religion und Wissenschaft verschmelzen, müssen wir erst wissen, wo wir nach ihr suchen sollen und um welche Art von Wahrheit es sich handelt.
§ 7
Religion und Wissenschaft können nur in einer höchst abstrakten Behauptung einen gemeinsamen Boden finden. Es kann sich nicht um solche Dogmen handeln, wie sie bei den Trinitariern oder den Unitariern gelten, auch nicht um eine Idee wie die der Versöhnung, so gemeinsam sie allen Religionen auch sein mag. All dies kann nicht als Grundlage der Verständigung dienen. Denn die Wissenschaft kann derartige Überzeugungen nicht akzeptieren. Sie liegen außerhalb ihrer Sphäre. Das abstrakteste Element der Religion, das alle ihre Formen durchdringt, ist nur ihre essenzielle Wahrheit. Es handelt sich – wie wir jetzt sehen – um das einzige Element, in dem die Religion mit der Wissenschaft übereinstimmt.
Es verhält sich ähnlich, wenn wir von der anderen Seite aus beginnen und fragen, welche wissenschaftliche Wahrheit Wissenschaft und Religion vereinigen kann. Die Religion vermag keine Kenntnis von bestimmten wissenschaftlichen Lehren zu nehmen. Ebenso verhält sich dies bei der Wissenschaft im Blick auf bestimmte religiöse Lehren. Die Wahrheit, auf welche die Wissenschaft einen Scheck ausstellt und den die Religion quittiert, kann nicht von der Mathematik geliefert werden, ebenso nicht von der Physik und auch nicht von der Chemie. Es kann sich nicht um eine Wahrheit handeln, die einer besonderen Disziplin zugehört. Keine Verallgemeinerung der Phänomene von Raum, Zeit, Materie oder der Kraft kann zu einer religiösen Konzeption werden. Eine derartige Konzeption muss – sollte sie in der Wissenschaft existieren – allgemeiner sein und diesen allen zugrunde liegen.
Wenn wir mithin annehmen, dass eine grundlegende Harmonie zwischen Religion und Wissenschaft bestehen müsse, weil sie auf Grundzüge des einen Geistes und auf verschiedene Aspekte des Universums reagieren, haben wir gute Gründe zu unterstellen, dass die abstrakteste Wahrheit in der Religion und in der Wissenschaft diejenigen sein müssen, in der sie verschmelzen. Die allgemeinste Tatsache, die wir in unserer geistigen Welt vorfinden, muss genau diejenige sein, die wir suchen. Wenn sie diese negativen und positiven Pole des menschlichen Denkens vereinigt, muss sie die höchste Tatsache unserer Intelligenz sein.
§ 8
Bevor wir dies genau untersuchen, muss ich um etwas Geduld bitten. Die folgenden drei Kapitel, die von verschiedenen Ausgangspunkten aus im selben Schluss konvergieren, werden eher weniger anziehend sein. Wer sich mit Philosophie beschäftigt, wird darin viel Vertrautes finden. Den meisten derjenigen, die sich nicht mit moderner Metaphysik auseinander setzen, kann es Schwierigkeiten bereiten, der Argumentation zu folgen.
Unser Argument kann freilich nicht auf diese Kapitel verzichten – und die Bedeutung des Themas würde sogar eine stärkere Strapazierung der Aufmerksamkeit des Lesers rechtfertigen. Obgleich uns dies direkt eher wenig betrifft, muss doch die Perspektive, die wir erreichen, indirekt großen Einfluss auf alle unsere Beziehungen ausüben, unsere Auffassung des Universums, des Lebens, der menschlichen Natur bestimmen – sie muss unsere Ideen von Richtig und Falsch beeinflussen und auf diese Weise unsere Lebensführung modifizieren. Diese Perspektive zu erreichen, von der aus der Misston zwischen Religion und Wissenschaft verschwindet und die beiden zusammenfallen, muss sicherlich eine solche Anstrengung wert sein.
Nachdem wir die Vorbemerkungen abgeschlossen haben, wenden wir uns nun dieser überaus wichtigen Untersuchung selbst zu.
Die letzten religiösen Ideen
§ 9
Wenn wir am Ufer des Meeres stehen und bemerken, wie der Rumpf von entfernten Schiffen hinter dem Horizont verborgen ist und wie von noch weiter entfernten Schiffen nur die obersten Segel sichtbar sind, können wir mit akzeptabler Klarheit verstehen, dass der vor uns liegende Teil der Meeresoberfläche leicht gekrümmt ist. Doch wenn wir in der Fantasie dieser gekrümmten Oberfläche in ihrer wirklichen Gestalt zu folgen versuchen, wie sie sich allmählich biegt, bis alle ihre Meridiane sich in einem Punkt schneiden, der 13 000 km unter unseren Füßen liegt, stehen wir vor einem großen Rätsel. Wir können uns nicht den kleinen Abschnitt des Erdballs in seiner tatsächlichen Gestalt und Größe vorstellen, der sich 160 km von uns aus nach allen Seiten erstreckt – geschweige denn den Erdball als Ganzes. Wir können den Felsblock, auf dem wir stehen, mental nahezu vollständig repräsentieren. Wir können zur selben Zeit an seine Spitzen, seine Seiten und seine Grundfläche denken – oder doch wenigstens nahezu zur selben Zeit, sodass sie im Bewusstsein kopräsent zu sein scheinen. Auf diese Weise können wir eine so genannte Konzeption des Felsens bilden. Das Gleiche mit der Erde zu tun, ist unmöglich. Wenn es schon außerhalb unserer Fähigkeit liegt, uns die Antipoden an der Stelle vorzustellen, wo sie sich tatsächlich befinden, um wie viel mehr muss es außerhalb unserer Fähigkeit liegen, uns alle entfernten Punkte auf der Erdoberfläche vorzustellen, wo sie sich tatsächlich befinden! Gleichwohl sprechen wir gewöhnlich so, als ob wir eine Vorstellung der Erde besäßen – so als könnten wir von ihr denken, wie wir von kleinen Objekten denken.
Welche Konzeption machen wir uns nun von ihr? – mag der Leser fragen. Dass ihr Name bei uns einen bestimmten Bewusstseinszustand hervorruft, steht außer Frage. Wenn dieser Bewusstseinszustand keine – im genauen Sinn – Konzeption ist, um was handelt es sich dann? Die Antwort scheint so zu lauten: Wir haben indirekt erschlossen, dass die Erde eine Kugel ist. Wir haben Modelle geformt, die näherungsweise ihre Gestalt und die Proportionen ihrer Teile darstellen. Gewöhnlich denken wir, wenn wir uns auf die Erde beziehen, entweder an eine unbestimmt ausgedehnte Masse unter unseren Füßen oder anders, wenn wir die tatsächliche Erde verlassen, denken wir an einen Körper mit der Gestalt eines Erdballs. Doch wenn wir uns vorzustellen versuchen, wie die Erde tatsächlich ist, verbinden wir diese beiden Ideen so gut wir können – eine derartige Wahrnehmung der Erdoberfläche, wie sie durch unsere Augen vermittelt wird, verbinden wir mit der Konzeption einer Kugel. Auf diese Weise formen wir keine Konzeption der Erde im gewöhnlichen Sinn, sondern eine symbolische Konzeption.*
Ein großer Anteil unserer Konzeptionen, darunter die von großer Allgemeinheit sind von dieser Art. Große Räume, große Zeiten, große Zahlen können nicht tatsächlich erfasst werden. Sie werden alle mehr oder weniger symbolisch erfasst. So verhält es sich bei allen Klassen von Objekten, von denen wir eine gemeinsame Tatsache prädizieren. Bezieht man sich auf einen einzelnen Menschen, formen wir eine akzeptabel vollständige Idee von ihm. Wenn die Familie, zu der er gehört, in Rede steht, wird wahrscheinlich nur ein Teil von ihr im Denken repräsentiert: Weil wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten müssen, was von der Familie ausgesagt wird, realisiert unsere Einbildungskraft nur ihre wichtigsten oder bekanntesten Glieder und geht über den Rest mit einer Art unentwickeltem Bewusstsein hinweg – von dem wir freilich wissen, dass es vervollständigt werden kann, wenn dies erforderlich ist. Soll etwas von der Klasse, zu der die Familie gehört (etwa Landwirte), ausgesagt werden, so zählen wir nicht alle Individuen dieser Klasse in Gedanken auf, die dazu gehören, noch glauben wir, dass wir dies tun könnten, wenn es erforderlich wäre. Wir beschränken uns darauf einige Beispiele herauszugreifen und uns dabei zu erinnern, dass diese unendlich vermehrt werden können. Wenn nun das Subjekt, von dem etwas prädiziert wird, »Engländer« lautet, dann ist der entsprechende Bewusstseinszustand noch inadäquater. Noch weiter entfernt ist die Ähnlichkeit von Gedanke und Sachverhalt, wenn es um die Europäer oder die menschlichen Wesen geht. Wenn sich Behauptungen auf die Säugetiere beziehen oder auf die Wirbeltiere oder auf alle Tiere, schließlich auf alle organischen Wesen, dann erreicht die Unähnlichkeit unserer Konzeptionen zu den konkreten Wirklichkeiten den höchsten Grad. Aus dieser Serie von Beispielen ersehen wir, dass bei Anwachsen der im Denken gruppierten Objekte das Konzept, das aus einigen typischen Beispielen, kombiniert mit der Vorstellung der Vielfalt geformt ist, mehr und mehr zu einem bloßen Symbol wird. Das ist nicht nur deshalb der Fall, weil es allmählich aufhört, die Größe zu erfassen. Darüber hinaus repräsentieren die typischen Beispiele um so weniger die durchschnittlichen Objekte der Gruppe je stärker diese sich heterogen entwickelt.
Diese Formung von symbolischen Konzeptionen, die unausweichlich wird, wenn wir uns von kleinen und konkreten zu großen und allgemeinen Objekten wenden, ist ein meistens nützlicher und in der Tat notwendiger Prozess. Wenn wir uns nicht mit Sachen beschäftigen, deren Eigenschaften recht leicht in einem Bewusstseinszustand vereinigt werden können, sondern mit solchen, deren Eigenschaften zu weit oder zu zahlreich sind, dass eine Vereinigung leicht gelingen kann, müssen wir entweder einen Teil der Eigenschaften fallen lassen oder gar nicht an sie denken – entweder eine symbolische Konzeption bilden oder gar keine Konzeption bilden. Wir können von zu großen oder zu vielfältigen Objekten, um mental repräsentiert zu werden, gar nichts prädizieren – oder wir müssen unsere Prädikationen mittels extrem inadäquater Repräsentationen von ihnen vollziehen.
Insofern wir auf diese Weise in der Lage sind, allgemeine Behauptungen aufzustellen und so allgemeine Schlussfolgerungen zu erreichen, geraten wir fortwährend in Gefahr und irren häufig. Wir halten unsere symbolischen Konzeptionen fälschlich für tatsächliche und werden so zu falschen Schlüssen geführt. Es geht nicht nur darum, dass in demselben Maß wie die Konzeption, die wir von einer Sache oder einer Klasse von Sachen entwerfen, eine falsche Repräsentation der Wirklichkeit darstellt, wir Gefahr laufen, über diese Wirklichkeit Falsches auszusagen. Wir werden auch dazu geführt anzunehmen, wir hätten viele Sachen erfasst, die wir nur in fiktiver Weise dargestellt haben. Und dies konfundieren wir mit einigen Sachen, die überhaupt nicht erfasst werden können. Wir bleiben hier in der Folge aufmerksam, weil wir nahezu unausweichlich in diesen Fehler verfallen.
Es gibt einen unmerklichen Übergang von Objekten, die vollständig repräsentierbar sind, zu solchen, die nur annähernd dargestellt werden können. Zwischen einem Kieselstein und der gesamten Erde kann eine Serie von Größen eingeführt werden, die jede von ihrer benachbarten so wenig unterschieden ist, dass es unmöglich ist, genau zu sagen, an welcher Stelle in der Serie der Konzeptionen diese inadäquat werden. So verhält es sich auch mit dem Verhältnis von Individuum und Gruppen. Wir sind nicht in der Lage, eine scharfe Grenze anzugeben, wann noch in einigermaßener Vollständigkeit von der Gruppe die Rede ist bzw. ab wann wir keine wahre Idee bilden können. Daher schreiten wir von tatsächlichen zu symbolischen Konzeptionen in unendlich kleinen Schritten voran. Wir werden sodann verführt, mit unseren symbolischen Konzeptionen so zu verfahren, als ob sie tatsächliche wären. Das ist nicht nur deshalb der Fall, weil wir die beiden nicht scharf trennen können, sondern auch weil die ersteren unseren Zwecken fast oder genauso gut dienen wie die tatsächlichen Konzeptionen – die bloß abgekürzte Zeichen als Ersatz für die ausgearbeiteteren darstellen, welche wir als Äquivalente für reale Objekte verwenden. Wir wissen, dass diese unvollkommenen Repräsentationen gewöhnlicher Dinge im Denken dann zu adäquaten entwickelt werden können, wenn dies erforderlich ist. Die Konzeptionen von beträchtlicheren Größen und von umfänglicheren Klassen, die wir nicht adäquat machen können, können doch durch einen indirekten Prozess der Messung oder Zählung überprüft werden. Und selbst im Fall eines äußerst unfassbaren Objekts wie dem Sonnensystem gewinnen wir doch die Überzeugung, dass unsere Konzeption auf eine tatsächliche Existenz verweist und in einem gewissen Sinn konstitutive Beziehungen repräsentiert, weil einige Voraussagen, die auf unserer symbolischen Konzeption beruhen, eintreffen. Insofern gilt aufgrund langer Erfahrung, dass unsere symbolischen Konzeptionen notfalls überprüft werden können. Daher werden wir dazu geführt, sie ohne Überprüfung zu akzeptieren. Auf diese Weise öffnen wir die Tür für manche, die vorgeben bekannte Sachen zu repräsentieren, tatsächlich aber solche darstellen, die in keiner Weise gewusst werden können.
Die Implikation liegt auf der Hand: Wenn unsere symbolischen Konzeptionen derart sind, dass weder ein kumulativer oder indirekter Prozess uns in die Lage versetzen kann zu ermitteln, ob es entsprechende Tatsachen gibt, noch irgendeine erfüllte Voraussage als Rechtfertigung für sie angegeben werden kann, dann sind sie alle schlecht oder täuschend und nicht von reinen Fiktionen zu unterscheiden.
§ 10
Und nun beziehen wir unsere allgemeinen Ergebnisse auf unseren Hauptpunkt – die letzten religiösen Ideen.
Den primitiven Menschen geschehen manchmal Dinge, die den gewöhnlichen Verlauf stören: Krankheiten, Stürme, Erdbeben, Echos, Sonnenfinsternisse. Aus Träumen entsteht die Idee eines umherirrenden Doppelgängers. Daraus folgt die Überzeugung, dass der Doppelgänger, nach seinem zeitlichen Weggang fortdauernd als Geist existiert. Auf diese Weise werden Geister zu zurechenbaren Ursachen für fremdartige Ereignisse. Den größeren Geistern wird bald eine größere Aktionssphäre zugeschrieben. Die Menschen entwickelten diese Konzeptionen intelligent von kleineren unsichtbaren Agenzien zur Konzeption einer unsichtbaren Agenzie. So entstehen Hypothesen über den Ursprung, nicht bloß einzelner Ereignisse, sondern aller Sachverhalte.
Gleichwohl beweist eine kritische Untersuchung, dass keine gewöhnliche Hypothese haltbar ist und zu diesem Thema überhaupt keine haltbare Hypothese gebildet werden kann.
§ 11
Drei wörtlich verständliche Unterstellungen über den Ursprung des Universums können gebildet werden. Wir können behaupten, es ist aus sich selbst heraus existent. Oder es ist aus sich selbst heraus geschaffen. Oder es wurde von einer externen Agenzie geschaffen. Welche dieser drei Unterstellungen am glaubwürdigsten ist, müssen wir hier nicht untersuchen. Die tiefere Frage, auf die es letztlich zuläuft, lautet: Welche von diesen ist überhaupt begreifbar im wahren Sinn des Wortes? Wir wollen sie nacheinander testen.
Wenn wir von einem Menschen als sich-selbst-erhaltend, von einem Apparat als selbst-handelnd oder von einem Baum als sich-selbst-entwickelnd sprechen, stehen diese Ausdrücke – allerdings ungenau – für Sachverhalte, die im Denken mit ausreichender Vollständigkeit vorgestellt werden können. Unsere Konzeption von einem sich-selbst-entwickelnden Baum ist zweifellos symbolisch. Obgleich wir im Bewusstsein tatsächlich nicht die ganzen Serien komplexer Veränderungen, die der Baum durchläuft, repräsentieren können, können wir die Hauptzüge der Serien repräsentieren. Die allgemeine Erfahrung lehrt uns, dass wir bei lange fortgesetzter Beobachtung die Fähigkeit gewinnen könnten, sie vollständiger zu repräsentieren. Daher wissen wir, dass unsere symbolische Konzeption der Selbst-Entwicklung zu etwas einer tatsächlichen Konzeption Ähnlichem ausgedehnt werden kann. Insofern drückt sie – jedoch grob – einen tatsächlichen Prozess aus. Wenn wir aber von Selbst-Existenz sprechen und mittels der dargestellten Analogien eine unbestimmte symbolische Konzeption von ihr bilden, täuschen wir uns mit der Annahme selbst, es handele sich um eine symbolische Konzeption der besprochenen Art. Durch die Verbindung des Wortes Selbst mit dem Wort Existenz macht uns die Gewalt der Assoziation glauben, es handele sich um einen Gedanken wie bei dem kombinierten Wort Selbst-Handeln. Ein Versuch, diese symbolische Vorstellung auszudehnen, wird uns jedoch aufklären.
Zunächst ist klar, dass wir mit Selbst-Existenz insbesondere eine Existenz meinen, die unabhängig von jeder anderen ist und nicht von einer anderen Existenz hervorgebracht wurde. Die Behauptung von Selbst-Existenz ist eine indirekte Leugnung von Schöpfung. Wenn wir so die Idee einer vorausgehenden Ursache verneinen, schließen wir notwendig die Idee eines Anfangs aus. Gäbe man zu, es habe eine Zeit gegeben, in der die Existenz noch nicht begonnen hatte, zieht dies nach sich, dass ihr Anfang von etwas anderem bestimmt oder verursacht wäre, was ein Widerspruch ist. Selbst-Existenz bedeutet daher zweifellos Existenz ohne Anfang. Wer eine Konzeption der Selbst-Existenz bildet, muss eine Konzeption ohne einen Anfang bilden. Doch mit keiner denkbaren mentalen Anstrengung können wir dies tun. Die Konzeption von Existenz mittels einer unendlichen Vergangenheit impliziert die Konzeption einer unendlichen Vergangenheit, was unmöglich ist. – Wir fügen hinzu, selbst wenn Selbst-Existenz erfassbar wäre, würde es sich nicht um eine Erklärung des Universums handeln. Niemand wird behaupten wollen, die Existenz eines Objekts in der aktuellen Gegenwart würde leichter verständlich durch die Entdeckung, dass es vor einer Stunde oder vor einem Jahr existiert habe. Wenn seine aktuelle Existenz nicht durch seine Existenz in früheren begrenzten Zeiträumen verständlicher wird, dann kann auch das Wissen um viele derartige Zeiträume nicht zu einer unendlichen Periode ausgedehnt werden, welche jene Existenz verständlicher macht. Daher ist die atheistische Theorie nicht nur völlig undenkbar, sondern wäre – selbst wenn sie denkbar wäre – keine Lösung.
Die Hypothese der Selbst-Erschaffung, die praktisch mit dem so genannten Pantheismus übereinstimmt, ist ähnlich ungeeignet, um im Denken repräsentiert zu werden. Bestimmte Phänomene wie die Transformation von unsichtbarem Dampf zu Wolken helfen uns dabei, eine symbolische Konzeption eines sich selbst entwickelnden Universums zu bilden. Es gibt auch Zeichen in den Himmeln und auf der Erde, die uns dabei unterstützen, dieser Konzeption einige Bestimmtheit zu verleihen. Wenn auch die Folge der Phasen, die das Universum durchlief, um den gegenwärtigen Zustand zu erreichen, vielleicht als selbst-bestimmt aufgefasst werden kann, bleibt doch die Unmöglichkeit unsere symbolische Konzeption der Selbst-Erschaffung zu einer tatsächlichen Konzeption auszudehnen für immer bestehen. Tatsächlich Selbst-Erschaffung zu erfassen heißt, den Übergang von möglicher Existenz in tatsächliche Existenz mittels innewohnender Notwendigkeit zu verstehen. Das ist aber unmöglich. – Wir können keine Idee eines möglichen Universums im Unterschied zu seiner aktuellen Existenz bilden. Wenn dies im Denken repräsentiert wäre, müsste es als Etwas repräsentiert sein, also als aktuelle Existenz. Wenn man unterstellt, es könnte als Nichts repräsentiert werden, schließt dies zwei Absurditäten ein: Dass Nichts mehr ist als eine Negation und positiv im Denken repräsentiert werden kann – und dass ein Nichts dadurch unterschieden von allen anderen Nichtsen ist, weil es die Fähigkeit besitzt, sich zu Etwas zu entwickeln. Doch das ist nicht alles. Wir besitzen keinen Zustand des Bewusstseins, der auf die Worte reagierte, es gäbe eine inhärente Notwendigkeit, durch die mögliche Existenz tatsächliche Existenz würde. Um dies im Denken zu repräsentieren, müsste Existenz, die für eine unbestimmte Zeit in einer Form geblieben ist, so verstanden werden, dass sie ohne äußeren Impuls in eine andere Form übergehe. Dies impliziert die Idee einer Veränderung ohne Ursache – doch das ist undenkbar. Daher bezeichnen die Begriffe dieser Hypothese keine realen Gedanken, sondern schlagen die unbestimmtesten Symbole vor, die keine Interpretation zulassen.