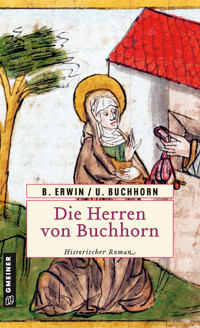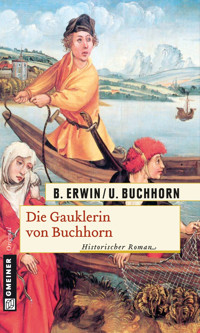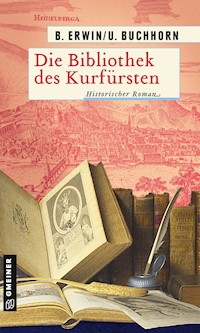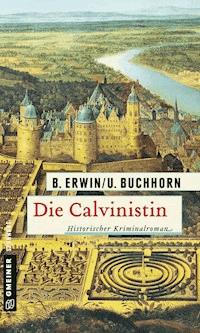Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Baden, Mitte des 19. Jahrhunderts. Mit Begeisterung verfolgt der junge Joseph Victor von Scheffel die Freiheitsbestrebungen seiner Heidelberger Kommilitonen. Doch als die Revolution Baden schließlich ins Chaos stürzt, muss er erkennen, dass politische Ideale, Freundschaft und Liebe mit der Realität nicht zu vereinen sind. Während Freunde sich den bewaffneten Truppen anschließen, besteht sein eigener Kampf darin, den Glauben an ein geeintes Land und eine bessere Zukunft nicht zu verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Erwin / Ulrich Buchhorn
Die Farben der Freiheit
Historischer Kriminalroman
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013–Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: René Stein
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Sitzung der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848«
Vorwort
November 1846 – März 1847
1
Die Gaststube hattesich geleert.Auf den Tischen im Halbdunkel standen Bierhumpen und Weingläser, die Kerzen brannten nieder, abgestandener Pfeifenrauch hing in blauen Schwaden in der Luft. An einem Tisch saß ein letzter Gast vor seinem Bier. Er trank langsam und ließ sich nicht einmal von der Kellnerin stören, die die Tische um ihn herum abräumte.
»Mach Schluss, Johann!«, brummte der Wirt, der hinter dem Tresen stand und sich selbst sein erstes Bier zapfte.
Der alte Mann hob schwerfällig den Kopf. »Setz dich her, Rolf«, murmelte er. »Lass uns über die alten Zeiten reden.«
Der Wirt verdrehte die Augen, nahm seinen Bierkrug und ließ sich schwer auf den freien Stuhl fallen. »Wozu?«, fragte er. »Napoleon ist lange tot. Der Zeit ist gelungen, was wir nicht konnten. Er ist besiegt! Wir sind hier in Heidelberg, wir sind frei, und der Franzose ist tot und begraben.« Er hob den Krug wie zum Salut und trank in langen, durstigen Zügen.
Johann schüttelte unwillig den Kopf. »Und was hat sie uns beschert, deine Zeit? Mein Sohn ist mit seiner Familie nach Berlin gezogen. Zu den verdammten Preußen!« Auch er trank. In seinem Gesicht arbeitete es, als er den Krug härter als nötig auf den Tisch stellte. »Ich will nicht an irgendeine Zeit denken, sondern an die guten Zeiten.«
Der Wirt machte eine Bewegung, als wolle er Johann die Hand auf den Arm legen, aber auf halbem Weg ballte er die Faust und ließ sie sinken. »Johann«, sagte er beschwörend, »auch ich habe meine Frau verloren, sehr früh, wie du weißt. Doch du hast deinen Sohn, ich habe Adele.« Er lächelte dem Mädchen zu, das immer noch damit beschäftigt war, die Spuren des fröhlichen Treibens zu beseitigen. »Deine guten alten Zeiten kannst du vergessen. Kein Franzosenkaiser will mit uns Russland erobern, kein Russe mit uns den Franzosen besiegen. Uns braucht niemand mehr. Die neue Zeit gehört der Jugend.«
Johann machte eine verächtliche Handbewegung. »Die Jugend! Sie schreit nach Veränderungen. Unser Großherzog verändert eh schon alles, was gut war.«
»Jetzt geht das wieder los!«, stöhnte Rolf und verlagerte sein Gewicht, um Johann in die Augen zu sehen. »Gegen die Bürgerkammer ist doch nichts einzuwenden. Ein wenig Mitsprache für alle.«
Johann stierte ihn an. »Und dann? Soll am Ende das Volk regieren? Das soll seine Arbeit tun. Regieren sollen die, die Zeit für so was haben.«
Rolf stützte sich auf die Unterarme. »Als wir uns damals entschieden haben, gegen Napoleon zu kämpfen, wollten auch wir Veränderungen!«
»Verdammt, ich wollte keine Veränderung! Ich wollte frei sein!«
»Und genau das gleiche wollen die jungen Leute heute.«
Johann hieb auf den Tisch. »Ich kenne die verdammte Jugend. Du nicht!«
»Ein Kaiser täte dem deutschen Volk ganz gut, finde ich«, fuhr Rolf unbeirrt fort. »Es gibt kluge Köpfe, die das sagen.«
»Ich bin aber kein kluger Kopf«, erwiderte Johann schroff, »und du auch nicht. Du hast selber gesagt, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Was uns bleibt, sind verdammte Erinnerungen.« Er warf die Zeche auf den Tisch und ächzte, als er aufstand und ein schmerzhafter Stich durch sein steifes Bein fuhr. Er hinkte an Adele vorbei. »Nacht, Kind.«
»Schlafen Sie gut, Herr Weckerle«, erwiderte sie munter, während sie die letzten Krüge auf ein Tablett stapelte.
Johann stieß die Tür auf und wappnete sich gegen die Kälte. Noch zeigte der Spätherbst sich von seiner schönen Seite, doch die alte Verletzung erinnerte ihn unerbittlich daran, dass die kalten Wintermonate bevorstanden. Der Himmel spannte sich sternenklar über ihm. Über dem Schloss schimmerte die Sichel des aufgehenden Mondes, und als er am Neckar entlangging, sah er ein Funkeln auf den Wellen, das ihn für einen süßen Moment an alte Zeiten erinnerte. Zeiten, in denen er–noch jung–mit seiner Frau diesen Anblick genossen und über scheuen Küssen wieder vergessen hatte. Ihr Verlust hatte Wunden gerissen, die ebenso wenig heilten wie das Bein, das ihm die Franzosen zerschossen hatten. Noch einmal schaute er zum Schloss empor, aber da war nur noch eine Ruine, Zeugnis anderer, noch älterer Wunden.
Fröstelnd machte er sich auf den Heimweg.
Eine Glocke schlug Mitternacht.
Als Johann in die Merianstraße einbog, drang von der Heiliggeistkirche her lautes Johlen und Lachen. Der alte Mann stieß ein Schnauben aus. Als Pedell der Universität würde er der frechen Horde, die zur Polizeistunde aus den Kneipen strömte, schon die Leviten lesen. Das Gejohle kam näher. Die jungen Männer sangen laut und falsch, und Johann konnte Wortfetzen heraushören. Es waren sinnfreie Reime wie ›Ein Licht und noch zwei Lichter, ein Richt und doch kein Richter‹ oder ›Jede schöne Bleibe hat auch eine Scheibe‹. Gegen seinen Willen musste er schmunzeln. Doch das Lächeln erstarb, als die ersten Steine gegen Fensterläden und Hauswände krachten. Glas zerbarst mit lautem Klirren. Die Randalierer grölten. Ein Fenster wurde aufgerissen, und eine schlaftrunkene Stimme schrie nach der Polizei. Die Burschen johlten lauter.
»Verdammtes Pack!«, brüllte der Mann. »Einlochen sollte man euch!«
Seine Stimme ging in den Spottversen der jungen Männer unter. Johann überlegte, ob er sich einmischen sollte, bis das Schlagen der Fensterläden ihm verriet, dass der brave Bürger bereits den Rückzug angetreten hatte. Johann schüttelte mürrisch den Kopf. Szenen wie diese waren keine Seltenheit, und die berechtigten Rufe der Bewohner nach der Polizei blieben fast immer ungehört. Ab und zu steckte er einen besonders Übermütigen in den Karzer, die anderen jedoch pöbelten unbeeindruckt weiter. Plötzlich war Johann es leid, sich auf eine weitere sinnlose Konfrontation einzulassen. Er hinkte in eine Seitengasse, aber seine Vorsicht war überflüssig, denn die jungen Männer achteten nicht auf die einsame Gestalt. Fünf Burschen, die sich torkelnd und schlingernd aneinander und an den Hauswänden abstützten, zogen in einer gespenstischen Prozession an ihm vorbei. Ab und zu streifte das Licht der Gaslaternen ihre flüchtig aufblitzenden Gesichter, und wenig später sah der alte Mann nur noch ihre Rücken.
»Jetzt kommt schon! Seid keine Spießbürger, die Nacht ist noch jung!«
Johann sah, dass sie am Ende der Straße stehen blieben.
»Lass gut sein, ich hab genug«, lallte der eine.
»Spießbürger!«
»Selber Spießbürger!«
Es kam zu einer kurzen Rangelei; einer der Betrunkenen verlor das Gleichgewicht und stolperte auf das Kopfsteinpflaster. Während ihn zwei seiner Freunde auf die Füße zogen, bogen die beiden anderen grußlos in die Augustinergasse ein. Die übrigen setzten ihren Weg untergehakt fort, wobei sie lautstark »Langweiler! Langweiler!« skandierten.
Johann wartete, bis in der Gasse Stille einkehrte. Irgendwo in der Ferne zeugten Stimmen davon, dass diese fünf nicht die einzigen späten Zecher waren, die ihre Gelage hatten abbrechen müssen. Johann sehnte sich nach der Wärme seiner kleinen Wohnung in der Ingrimstraße. Mit jedem Schritt schmerzte sein steifes Bein heftiger.
»Nimm das sofort zurück, sonst…«
Ein Schrei gellte aus dem Dunkel.
Johann erstarrte. Er presste sich gegen den kalten Stein der Jesuitenkirche und hielt den Atem an. Schritte näherten sich, harte, unsichere Schritte auf dem Kopfsteinpflaster. Eine hochgewachsene Gestalt rannte an ihm vorbei und stolperte um die nächste Ecke. Gleichzeitig ertönte vom anderen Ende der Gasse ein zweiter Schrei. Als ehemaliger Soldat wusste Johann, was er bedeutete. Obwohl sein Glaube schon lange auf tönernen Füßen stand, bekreuzigte er sich und humpelte los. An der Ecke schöpfte er Atem. Hier gab es keine Straßenbeleuchtung, dennoch sah Johann die dunkle Gestalt am Boden sofort. Ächzend stützte er sich an der Wand ab und beugte sich über den reglosen Mann. Er sah nichts, was er nicht erwartet hatte, dennoch überlief ihn beim Anblick von Blut und gebrochenen Augen ein Frösteln. Johann bückte sich, so gut es sein Bein zuließ, und tastete nach dem Puls. Er spürte nichts. Verstohlen sah er über die Schulter und schlug den Weg zu seiner Wohnung ein.
»Nun?«
Der zierliche blonde Mann schloss die Gardine und setzte sich zu seinen beiden Freunden an den Tisch. »Randale in der Hauptstraße. Das Übliche eben«, sagte er mit einem Funkeln in den Augen und schenkte Wein nach. »Wartet am besten, bis die genug haben.«
»Vernünftig wäre das«, stimmte der eine zu. »Oder sollen wir ein bisschen mitmischen?« Er lachte. »Was meinst du, Lepique?«
Der andere schüttelte unwillig den Kopf. »Ich halte nichts von Randale. Das gibt bloß Ärger.«
»Das ist Ärger«, verbesserte ihn der Blonde verschmitzt. »Oder, Kamm?«
Der grinste. »Nur, wenn man erwischt wird.«
»Hört, hört!«
»Zumindest brächte das ein wenig Schwung in den ganzen traurigen Haufen, Scheffel!«
Joseph Scheffel stieß einen theatralischen Seufzer aus. »Du hast ja recht, Kamm. Unsere stolze Teutonia ist zu einem Haufen von Bummelanten verkommen. Der Konvent heute hat das deutlich gezeigt. Und daran müssen wir etwas ändern.« Er sah erst Lepique, dann Kamm bedeutungsvoll an und trommelte mit den Fingerkuppen gegen den Rand seines Weinglases. Kamm spitzte die Lippen. Das Schweigen zog sich in die Länge.
»Ihr wollt also wirklich ein neues Korps gründen?«, fragte Lepique gespannt.
Kamm und Joseph tauschten einen Blick. »Kein Korps. Wenn, eine Burschenschaft. Keine Kontrolle, keine Zensur, nur Ideen von Freiheit und Gleichheit«, erwiderte Joseph. Als Lepique etwas einwerfen wollte, fuhr er lauter fort: »Ich war unheimlich froh, wieder in Heidelberg zu sein, und was finde ich vor? Hamburger Etepetetes und Breslauer Spaßbremsen!«
Kamm nickte grimmig. »Du hast uns nicht geglaubt, als wir uns in Karlsruhe darüber unterhalten haben.«
»Nein, das habe ich mir wirklich nicht vorstellen können. Vorstellen wollen! Natürlich musstest du aus der Teutonia austreten, Kamm!« Joseph schüttelte die hellblonden Haare aus der Stirn. In der stickigen Enge der Stube war sein Gesicht von einem feinen Schweißfilm überzogen. »Die kennen nicht einmal echte Kneipkultur. Denen muss man erst beibringen, was saufen heißt! Ein Trauerspiel ist das!«
Kamms Augen glitzerten. »Dann tu etwas dagegen, Scheffel! Ich will dich dabeihaben, wenn wir eine Burschenschaft gründen. Die Zeit ist reif. Wir müssen handeln!«
Joseph sprang auf und hob sein Glas. Ehe er einen flammenden Trinkspruch ausbringen konnte, klopfte es laut an der Tür. Joseph zuckte zusammen. »Ja, bitte?«, brachte er hervor.
Ein älterer Herr in Hausschuhen und Morgenrock über einem langen weißen Nachthemd stand auf der Schwelle. Der Zipfel der Nachtmütze hing ihm über die Schulter.
Hastig stellte Joseph das Glas auf den Tisch, während sich seine Freunde zu einer respektablen Haltung aufrichteten. »Herr Hofrat! Bitte entschuldigen Sie, wenn wir Ihre Nachtruhe gestört haben. Wir werden uns selbstverständlich leiser unterhalten.«
Der Geheime Hofrat Rau, Josephs Vermieter, betrachtete die jungen Männer leutselig. »Machen Sie sich keine Gedanken, wahrscheinlich war es lediglich der Lärm auf der Straße. Ihr Herr Vater hatte ganz recht, als er mir versichert hat, dass Sie keiner dieser Saufbrüder und Streithähne sind.« Er schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Es war sicher der Lärm auf der Straße. Finden Sie nicht, dass das überhandnimmt?«
»Wir sprachen gerade davon«, behauptete Joseph. »Sie haben ganz recht, Herr Hofrat, so kann es nicht weitergehen.«
Lepique und Kamm nickten eilfertig, aber in den Augen des Letzteren tanzte der Übermut.
Joseph warf ihm einen beschwörenden Blick zu. »Wir repetieren gerade die Vorlesung von Professor Mittermaier«, improvisierte er verzweifelt, denn sein Vermieter machte keine Anstalten, sich zurückzuziehen. »Ich habe meinem Vater versprochen, mein Studium der Rechtswissenschaft zügig zu beenden. Ich fürchte, ich habe in Berlin ein wenig gebummelt. Meine Freunde helfen mir dabei, die Lücken zu schließen.«
»Es ist schön, gute Freunde zu haben, nicht wahr?« Raus Blick schweifte über die Gesichter der beiden jungen Männer. »Ich werde demnächst wieder an Ihren Herrn Vater schreiben, da wird er sich freuen, so viel Positives über Sie zu erfahren. Ja, ja…« Er unterdrückte ein Gähnen. »Er wird sich freuen, dass Sie es mit der Pflicht so genau nehmen. Aber lernen Sie nicht zu lange, meine Herren, sogar die Jugend braucht ihren Schlaf.«
»Ganz bestimmt.« Joseph rang sich ein Lächeln ab. »Vielen Dank, Herr Hofrat.«
Der alte Herr nickte, und der Zipfel seiner Nachtmütze wippte auf und ab. Da er immer noch die Kerze in der rechten Hand hielt und die Flamme mit der Linken abschirmte, öffnete Joseph ihm und begleitete ihn auf den Flur. Auf dem Treppenabsatz drehte Rau sich noch einmal um. »Und keine Randale, nicht wahr?«, mahnte er.
»Aber Herr Hofrat!«
»Dann ist es gut! Ach, und wenn Sie einen Rat von mir annehmen wollen: Benutzen Sie das nächste Mal Ihre Bücher, wenn Sie den Stoff repetieren. Das hilft.« Ohne ein weiteres Wort ging er die Stiege hinunter. Eine Weile war das Flackern der Kerze noch als unsicherer Lichtpunkt zu sehen, dann verlosch auch dieser. Eine Tür fiel ins Schloss.
Joseph fuhr sich mit beiden Händen über das heiße Gesicht und holte tief Luft. Als er zu seinen Freunden zurückkehrte, begrüßten ihn grinsende Gesichter. »Was?«
»Du hast in Berlin gebummelt?«, fragte Kamm scheinheilig. »Und jetzt hat dich dein Vater bei dem alten Nachtgespenst einquartiert, damit er weiß, was sein Filius treibt? Scheffel, Scheffel, du bist ja ein ganz Wilder. Vielleicht sollten wir lieber ein Damenkränzchen gründen statt einer Burschenschaft.« Seine Schultern bebten vor unterdrücktem Gelächter. »Lepique, was meinst du, haben wir ein Tässchen Tee für den jungen Herrn Scheffel?«
Joseph boxte ihn gegen den Arm. »Jetzt sei schon ruhig! Ja, mein Vater sitzt mir im Nacken, und ja, er wollte, dass ich hier wohne. Und? Jetzt bin ich hier, und ich werde das Beste daraus machen. Und damit meine ich nicht das Studium–nicht nur jedenfalls. Hier ist die Elite, Freunde! Hier können wir Großes vollbringen!«
»Wohlgesprochen!« Kamm hob sein Glas. »Auf das schöne Heidelberg!«
»Auf Heidelberg!«
»Wie schätzt du Mittermaier ein?«, erkundigte sich Kamm unvermittelt.
Joseph setzte sein Glas ab. Seine Augen begannen zu glänzen. »Er will etwas bewirken, genau wie Gervinus. Mittermaier ist Mitglied der Zweiten Badischen Kammer. Und Gervinus hat eine politische Idee. Seine Vorlesungen in Politik sind eine Offenbarung für jeden hungrigen Geist.«
»Womit wir ein Kränzchenthema hätten«, warf Lepique ein. Er lächelte scheu. »Und wieder beim Thema wären. Mit der Teutonia kannst du solche Gespräche nicht mehr führen.«
Joseph seufzte. »Das ist die Crux. Wir brauchen kluge Füchse.«
»Heißt das, du machst mit, wenn wir unsere Burschenschaft gründen?«
»Ich denke ernsthaft darüber nach. Sehr ernsthaft, ehrlich, Kamm.«
Kamm stellte sein leeres Glas ab. »Denk nicht zu lange. Dein Pflichtgefühl in Ehren, Scheffel, doch die Generation unserer Väter versteht nicht, was hier passiert.« Er hielt kurz inne. »Das war ein guter Wein. Und ein gutes Gespräch. Aber jetzt sollten wir an morgen denken.« Er ließ die zweideutige Aussage kurz zwischen ihnen stehen, ehe er mit einem Lachen hinzufügte: »Ich geh heim!«
»Ich komme mit.« Lepique trank aus. »Mir graut es jetzt schon vor der Kälte.«
»Was erwartest du? Wir haben fast Dezember«, versetzte Kamm feixend. »Ich bin allerdings sicher, die Zukunft hält heiße Tage bereit.« Er suchte Josephs Blick.
Der zuckte die Achseln. »Ich bring euch raus. Und seid um Gottes willen leise!«
»Sonst kommt das Nachtgespenst–buhuu!«, wisperte Kamm und handelte sich einen weiteren Schlag gegen die Schulter ein.
Sie schlichen die Treppe hinunter, deren altes Holz bei jedem Schritt ächzte und knarrte. Nichts regte sich, nur aus dem Schlafzimmer der Raus war zweistimmiges Schnarchen zu vernehmen. Joseph öffnete die Haustür und hielt den Atem an, als ihn die eisige Kälte mit voller Wucht traf.
»Wir treffen uns morgen früh im ›Stadt Düsseldorf‹«, wisperte er. »Kommt gut nach Hause.«
»Bis morgen«, erklang es im Flüsterton, bevor die beiden Freunde in die Nacht verschwanden.
Als Joseph kurz darauf in seinem warmen Zimmer stand, beleuchtete der Kerzenschein die Lehrbücher auf dem schmalen Regal. Ein Anflug von schlechtem Gewissen überfiel ihn, doch das Bett lockte. »Wozu einen schönen Abend mit Ochserei verderben!«, murmelte er und blies die Kerze aus.
Eine Windbö rüttelte an den Ästen der Bäume, die kahl in den Nachthimmel ragten. Sie pfiff durch die Friedrichstraße, in der das Haus des Geheimen Hofrats lag. Joseph schlug den Kragen seines Rocks hoch und streifte die Handschuhe über, während er den Weg in die Plöckstraße einschlug. Ein zweiter, noch heftigerer Windstoß brachte vom Schloss her eisige Kälte. Er drückte das Kinn gegen die Brust und stemmte sich gegen den Wind. Über dem Schloss kündigte der erste graue Schimmer den Morgen an. Zu seiner Rechten löste sich die Peterskirche aus dem Winterdunkel. Eine Weile gab Joseph sich seiner Fantasie hin, die aus dem Gotteshaus ein drohend aufragendes Gebäude voller Geister und uralter Legenden machte. Er lächelte selbstironisch. Die meisten kannten ihn als launigen Zechbruder oder als leidenschaftlichen Idealisten. Das war eine Seite, die er selten zeigte. »Dichter«, hauchte er und sah den Atemwolken nach.
Als Joseph in die Kettengasse kam, fiel ihm eine Menschentraube auf, die aufgeregt flüsterte. Neugierig gesellte er sich zu der Gruppe, die im fahlen Morgenlicht einen engen Kreis bildete. Ein alter Mann in einem verschlissenen Mantel reckte den Hals.
»Was ist passiert?«, fragte Joseph.
»Weiß nicht.« Der Alte rempelte den vor ihm Stehenden an.
Der fuhr herum. »He, sachte!« Sein Gesicht, jung, hübsch und verärgert, veränderte sich plötzlich. Er sah an dem Alten vorbei direkt in Josephs Gesicht. Als er den Ellenbogen des alten Mannes erneut in die Rippen bekam, trat er beiseite und stellte sich neben Joseph. »Scheffel, nicht wahr? Sie sind Joseph Scheffel?«
Joseph runzelte die Stirn. Das scharf geschnittene Gesicht unter den modisch frisierten braunen Locken war ihm fremd. »Der bin ich«, antwortete er höflich. »Mit wem habe ich die Ehre?«
»Aufpassen, junger Mann!«
»Verzeihung«, sagte Joseph, ohne sich umzudrehen, als er grob beiseite geschoben wurde. Er wehrte sich nicht, als der Unbekannte ihn am Arm packte und ein Stück von der Gruppe fortzog. Augenblicklich fuhr ihm die Kälte in die Knochen. »Was ist hier eigentlich los?«
Der andere zeigte auf die Rücken der Schaulustigen. »Da liegt ein Toter.«
Joseph riss die Augen auf. Die Spukgestalten der Peterskirche schienen plötzlich lebendig geworden zu sein. »Wie, ein Toter?«
»Ein Toter eben. Irgendjemand hat ihn wohl ermordet.«
»Ein Mord?« Joseph fiel auf, dass sein Anteil an dem Gespräch nicht eben intelligent wirken konnte, und riss sich zusammen. »Ein Duell?«
»Vielleicht. Jedenfalls liegt er kalt und steif in einer großen Blutlache. Ist wohl in der Nacht passiert. Mein Name ist übrigens Maximilian Fuß, kurz Max. Ich studiere bei Gervinus und Häusser.« Er streckte die Hand aus.
Joseph ergriff und schüttelte sie. »Joseph Scheffel, Student des Rechts. Ich…«
Der Klang schwerer Schritte unterbrach ihn, und eine befehlsgewohnte Stimme donnerte: »Steht da nicht rum und haltet Maulaffen feil! Auseinander!«
Gehorsam wich die Menge zurück, um den Gendarmen Platz zu machen.
»Was für eine obrigkeitstreue Bagage«, murmelte Max spöttisch, während er Joseph folgte, der die Lücke nutzte, um den Toten zu betrachten.
Viel war in der Dämmerung nicht zu erkennen, nur die schemenhaften Umrisse eines kräftigen Mannes. Der dunkle Fleck musste Blut sein. Joseph zog die Schultern hoch und fröstelte. »Wer der arme Teufel wohl ist?«
Max zuckte die Achseln. »Kein Student, wie er aussieht. Also wohl kein Duell. Wenn das rote Halstuch Ausdruck seiner Gesinnung ist, war es eine Schande, ihn abzustechen«, fügte er mit mühsam unterdrückter Heftigkeit hinzu.
Joseph streifte seinen Begleiter mit einem forschenden Blick, ehe er sich wieder auf die Szene konzentrierte, die sich vor ihm abspielte. Einer der beiden Gendarmen beugte sich über den Toten, während der andere einen Jungen befragte, der unruhig auf den Ballen wippte und immer wieder zu der Leiche hinüberschielte. Plötzlich sah Joseph am Rande der Menschengruppe zwei vertraute Gesichter. Er hob die Hand und winkte Kamm und Lepique zu.
Der ältere der beiden Gendarmen bemerkte die Geste. Er bedeutete dem Jungen, sich nicht von der Stelle zu rühren, und bahnte sich einen Weg durch die Umstehenden, wobei er den Alten unsanft beiseiteschob. Dieses Mal beschwerte der sich nicht.
»Sie bieten sich als Zeuge an, junger Mann? Oder wie habe ich Ihren Wink zu verstehen?«
Joseph wurde rot.
Der Gendarm war nur ein paar Jahre älter als er, aber in seiner Uniform strahlte er unbestreitbare Autorität aus. »Nun? Wissen Sie etwas über den Toten?«
»Äh, nein. Gar nichts. Ich bin Student des Rechts und würde gern ein Kriminalpraktikum machen und Sie daher bitten, ob ich nicht…«
»Unsinn!« Der Gendarm zwirbelte das rechte Ende seines Oberlippenbarts. »Behindern Sie unsere Arbeit nicht mit Ihren spinnerten Ideen.« Mit einem Schulterblick vergewisserte er sich, dass der Junge immer noch wartete, während sein Kollege den zerschlissenen Rock des Toten untersuchte. »Geht nach Hause, Leute«, befahl er der Menge, die wieder nach vorne drängte. »Hier gibt es nichts mehr zu sehen.«
»Stimmt nicht«, rief der Junge frech.
Gelächter belohnte seinen Mut.
»Wer in einer Minute noch hier herumlungert, wird verhaftet«, drohte der Gendarm, auf dessen Wangen sich rote Flecken bildeten. »Das gilt besonders für Sie, Herr Studiosus. Kriminalpraktikum, nichts als Flausen im Kopf!« Brummend wandte er sich ab und drängte sich zu seinem Kollegen durch, ohne Rücksicht auf die Umstehenden zu nehmen.
Die zerstreuten sich murrend. Auch Joseph und Max leisteten Folge und gesellten sich zu Kamm und Lepique, die im Schutz einer Hauswand auf sie warteten.
»Was ist da los?«, wollte Lepique mit einem neugierigen Blick auf den Fremden an Josephs Seite wissen.
»Wie es aussieht, wurde ein Mann ermordet.«
»Ermordet? Erzähl!«, forderte Kamm.
»Gleich. Erst möchte ich euch Maximilian Fuß vorstellen. Er studiert bei Häusser und Gervinus. Das sind meine beiden alten Freunde Kamm und Lepique. Ich habe gehört, sie studieren auch bisweilen.« Er lächelte unschuldig.
Kamm versetzte ihm einen Stoß. »Fuß? Wirklich Fuß?«
Max verdrehte die Augen. »Glauben Sie mir, ich habe schon alle Witze über meinen Namen gehört, die meisten davon selber gemacht. Wenn Ihnen ein neuer einfällt, gebe ich ein Bier aus.«
»Die Herausforderung nehme ich an.«
»Wir sollten hier nicht rumstehen«, warf Lepique ein und nickte verstohlen in Richtung der Gendarmen. »Der Schnauzbart schaut schon her.«
»Wir wollten sowieso frühstücken«, bemerkte Joseph. »Warum begleiten Sie uns nicht, Fuß?«
Der verzog das Gesicht, als er Kamms Grinsen sah. »Die Einladung nehme ich gerne an, wenn es den Herren recht ist.«
»Einen Moment! Ich habe noch ein paar Fragen!«
Sie erstarrten. Max murmelte etwas, das wie »verdammter Knüppelknecht« klang, und wich in den Schatten der Hauswand.
Joseph fasste sich als Erster und drehte sich um. »Meinen Sie uns?«
»Genau Sie!« Der Gendarm bedeutete Joseph mit gekrümmtem Zeigefinger, näherzukommen. Unter dem buschigen Schnauzbart war Spott zu erahnen. »Sie wünschten Anschauungsunterricht in Sachen Kriminologie? Also bitte!«
Joseph schluckte. Er hatte noch nie einen Toten aus der Nähe gesehen, aber jetzt gab es kein Zurück mehr. Zögernd trat er näher und unterdrückte ein Würgen, als er den Mann inmitten der eingetrockneten Blutlache sah. Das vormals gebräunte Gesicht war verzerrt und von ungesunder grauer Farbe, das rote Halstuch wirkte wie ein makabrer Farbtupfer. Joseph wünschte sich inständig die Dunkelheit zurück.
»Nun, Herr Kriminalpraktikant in spe, was können Sie uns sagen?«
Joseph schluckte mehrmals, bis er seiner Stimme wieder traute. »Nichts.«
»Sie kennen den Mann also nicht?«, fragte der zweite Gendarm.
»Nein!«, krächzte er.
»Was für eine Überraschung! Können Sie sonst noch etwas Hilfreiches beisteuern, Herr Kriminalpraktikant?«
»Nein!«
Das Gesicht des Gendarmen verfinsterte sich plötzlich. »Dann verschwinden Sie und lassen Sie Leute, die etwas von ihrer Arbeit verstehen, arbeiten!«, schnauzte er. »Faules Studentenpack!«
Mit hochrotem Kopf trat Joseph den Rückzug an.
»Wie heißen Sie eigentlich? Nur falls wir Ihre unschätzbaren Dienste weiterhin benötigen?«, rief der jüngere der Gendarmen ihm nach.
»Joseph Scheffel«, antwortete Joseph mit zusammengebissenen Zähnen. »Zu Diensten!«
In diesem Moment befreite ihn ein weiterer Gendarm, der aus der Ingrimstraße kam, aus seiner Verlegenheit. An seiner Seite hinkte ein alter Mann, der mühsam Schritt hielt. Der Polizist musterte die feixenden Gendarmen und Joseph mit einem scharfen Blick. »Lasst den Unfug, Männer. Ich habe hier einen Zeugen.«
Während die beiden Haltung annahmen, nutzten die Studenten die Gelegenheit, um hinter der nächsten Ecke zu verschwinden.
Das ›Stadt Düsseldorf‹ lag in der Kettengasse wenige Meter vom Tatort entfernt. Lachend drängelten sich die vier in die Gaststube, wo sie sofort wohlige Wärme umfing. Der Wirt begrüßte sie mit einem Zwinkern. »Ein kalter Morgen, nicht wahr, die Herren? Wärmen Sie sich ruhig auf. Was darf ich Ihnen bringen?«
»Frühstück für uns alle.« Kamm blies in seine geröteten Hände und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Die anderen folgten seinem Beispiel, während der Wirt in der Küche verschwand. Eine Weile lauschten sie auf das heimelige Klappern von Töpfen und die leisen Stimmen der wenigen Gäste.
Max sah sich um. »Sind Sie öfter hier?«
»Quasi unsere Stammkneipe. Spricht etwas dagegen?« Joseph war das spöttische Funkeln in den Augen seines neuen Bekannten nicht entgangen.
Der junge Mann winkte ab. »Ganz und gar nicht. Es ist sehr…gemütlich.«
»Jedenfalls gibt es hervorragendes Bier.«
Max schwieg, das süffisante Lächeln lauerte immer noch in seinen Mundwinkeln.
Mit einem Stirnrunzeln wandte sich Kamm seinen Freunden zu. »Vielleicht wäre hier sogar ein geeigneter Ort für unser Vorhaben? Ihr wisst schon!«
Lepique räusperte sich. »Willst du das jetzt…wir sind nicht allein.«
»Ich habe das Gefühl, ich sollte mich besser zurückziehen.« Max erhob sich geschmeidig.
»So war das doch nicht gemeint«, beschwichtigte Joseph, indem er ihn am Ärmel fasste und zurückhielt. »Erzählen Sie uns lieber, was Sie von dem Mord wissen. Ich hab ja kaum etwas gesehen.«
»Und das trotz der persönlichen Einladung der Gendarmerie«, tuschelte Kamm Lepique zu. Der prustete. Joseph warf ihnen einen vernichtenden Blick zu.
»Eier die Herren?«, meldete sich der Wirt aus der Küche. »Oder lieber Käse und Wurst?«
Max setzte sich zögernd. »Alles, und Bier. Die Rechnung geht auf mich. Ich möchte mich wenigstens für die freundliche Einladung revanchieren, wenn ich darf. Über den Mord kann ich freilich wenig erzählen. Ich habe kaum mehr als Sie gesehen, einen Toten mit rotem Halstuch.«
»Ha! Ein Kommunist!«, rief Kamm hitzig. »Den hat sicher einer dieser Reaktionäre umgebracht! Und deshalb brauchen wir eine Burschenschaft. Wir brauchen…« Er verstummte und sah Max an.
Der hob die Brauen. »Eine Burschenschaft, soso. Interessant. Leider verboten!«
Kamm machte ein trotziges Gesicht. »Wir müssen uns organisieren in einer Welt, in der die Kräfte der Veränderung mundtot gemacht werden!«
Joseph und Lepique nickten. Schweigend warteten sie, bis der Wirt ihr Bier gebracht hatte, dann hob Joseph seinen Krug. »Obwohl der Tag mit einem Mord begonnen hat, möge es ein guter werden!«
Die anderen stimmten in seinen Trinkspruch ein.
Kurz darauf brachte die Wirtin, eine feiste Frau mit vollem, lockigem Haar, ein Brett mit Brot, Käse und Wurst. Sie stellte die hölzerne Platte auf den Tisch. »Bedienen Sie sich! Das Brot ist selbst gebacken und ganz frisch!«
»Danke!« Joseph brach einen Kanten ab und schnitt den Käse an. »Hervorragend!«, sagte er freundlich. »Das Bier auch!«
Die Wirtin schnaufte zufrieden, und die anderen griffen zu. Für die Dauer des gemütlichen Mahls schienen Morde, Studium und revolutionäre Gedanken weit weg. Sogar Max legte seine distanzierte Haltung ab und tauschte fleißig Studentenklatsch aus. Das Du war nach kurzer Zeit eine Selbstverständlichkeit und ging allen vieren leicht über die Lippen.
»Und?«, fragte Lepique plötzlich. »Welchem Korps gehörst du an?«
Ein Schatten fiel über Max’ Gesicht. »Keinem!«
»Keinem oder keinem mehr?«, hakte Kamm nach.
Max leerte seinen Krug und lehnte sich zurück. »Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich war im Neckarbund.«
Joseph riss die Augen auf. »Im Neckarbund? Ehrlich? Dann kennst du Karl Blind?«
»Ja, und?« Max verschränkte die Arme.
»Nichts und. Ich war sogar mit ihm auf derselben Schule. Er hat die richtigen Ideen, aber er ist mir, ehrlich gesagt, zu radikal. Und ich mag keine Duelle.« Max öffnete überrascht die Lippen. Joseph musterte sein glattes, noch jungenhaftes Gesicht. »Möchtest du etwa ein Gesicht voller Schmisse haben? Es geht um Ideen, nicht darum, seine Gesinnung in Form von Narben in die Welt zu schreien.«
»Und bei den Ideen bleibt es dann?«, fragte Max herausfordernd. »Ihr habt ihn ausgegrenzt, weil ihr ihm nicht folgen wolltet–oder konntet.«
»Man kann es auch so sehen, dass Blind selber schuld war«, erwiderte Joseph. Auch seine Stimme wurde lauter. »Er ist gegangen. Niemand hat ihn vertrieben. Er war der Radikale!«
»Pah! Radikal leitet sich von dem lateinischen Wort ›radix‹, also Wurzel, ab. Wir wollten das Übel an der Wurzel packen und ausrotten. Um Duelle ging es nie!«
»Worum dann?« Kamm verschränkte die Hände im Nacken.
»Um Gerechtigkeit!« Es schien Max nicht zu kümmern, dass die wenigen Gäste herübersahen und der Wirt den Kopf schüttelte. »Was Blind anstrebt, ist eine tief greifende Veränderung der Gesellschaft. Die Arbeiter müssen bessere Bedingungen bekommen. Stattdessen werden sie wie Sklaven gehalten!«
»Sklaven erhalten keinen Lohn«, warf Lepique ein.
Max fuhr mit funkelnden Augen zu ihm herum. »Lohn nennst du das? Die Männer arbeiten sich krumm, und ihre Familien krepieren trotzdem! Dazu kommen die Steuern! Ein Sklave hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf und bekam genug zu essen. Du weißt gar nicht, wovon du redest, wenn du über die Arbeiter sprichst.«
»Aber du?«, fragte Lepique erregt. »Oder ist das die Kleidung eines armen Mannes, die du trägst?«
Max’ Hand fuhr zu dem seidenen Halstuch, das er lässig um den Hals geschlungen hatte.
Lepique lächelte triumphierend. »Und wenn du schon Vergleiche anstellst, nimm passende. Es gab nicht ›den Sklaven‹; da gab es gewaltige Unterschiede. Zum Beispiel…«
»Keine Belehrung in Geschichte. Ich studiere das!«
»Vielleicht nicht eifrig genug!«
Die beiden jungen Männer starrten sich wütend an. Plötzlich begann es um Max’ Lippen zu zucken. Er streckte die Hand nach seinem Bier aus und hob es ins Licht. »Bier und ein gutes Streitgespräch, so wird einem warm. In dir steckt Feuer, Lepique. Ich bin froh, dass ich euch getroffen habe.«
»Du erinnerst mich an Eberstein, diesen Fuchs aus Hamburg. Der ist genauso verrückt wie du«, entfuhr es Kamm belustigt. »Kennst du ihn?«
»Glaub nicht.« Max drehte sich um. »Hallo? Können wir noch eine Lage Bier haben? Denkt daran, ihr sauft auf meine Rechnung«, bemerkte er, als Joseph ablehnen wollte.
Der Wirt brachte die vollen Krüge. Er schien erleichtert, dass der Streit sich verzogen hatte. »Möglicherweise war es gar kein Mord«, begann er, während er die leeren Humpen abräumte. »Meine Frau und ich haben gerade darüber gesprochen.«
»Und was denken Sie?«, erkundigte sich Joseph.
»Na ja, als wir Sie haben streiten hören, haben wir gedacht: Bei dem Mord war es vielleicht genauso. Ich weiß, wovon ich rede, ich muss hier oft Händel schlichten. Die Gemüter erhitzen sich, und dann ist es passiert. Einer ist tot. Kann doch sein, so wie es gestern Nacht zuging.«
Joseph dachte an die Randale, die er vom Fenster aus gehört hatte. »Möglich«, gab er zu. »Haben Sie etwas mitbekommen?«
Der Wirt wischte die Hände an der Schürze ab. »Gegröle und Parolen. Ich misch mich da nicht ein.«
»Grölen gehört zu jeder guten Randale!« Max feixte. »Und das ein oder andere Fenster, das zu Bruch geht!«
»Du warst dabei?«, fragte Joseph rasch.
»Ich doch nicht!«
»Nee, du führst den Haufen lieber an.« Kamm zwinkerte. »Und zeigst auf die Fenster, die zu Bruch gehen sollen!«
»Was soll das jetzt heißen?«, rief Max und schob den Unterkiefer vor.
Die anderen lachten.
Max funkelte sie an. »Wisst ihr was: Ihr könnt mich mal!«
Der Wirt hob beide Hände, als er sah, dass der Streit wieder aufzuflammen drohte. »Meine Herren, denken Sie an den Toten.«
»Sie haben recht!«, warf Joseph ein, während er Max besänftigend auf die Schulter klopfte. »Du brauchst eine ganze Menge Streitgespräche, damit dir warm wird, was?«
Max strich sich die Haare aus der verschwitzten Stirn. »Langweilig wird es mit euch jedenfalls nicht. Die Rechnung bitte. Mich ruft die mahnende Stimme meiner Professoren. Ich würde mich freuen, diese Runde zu wiederholen. Dass ich keinem Korps angehöre, heißt nicht, dass ich abgeneigt wäre, mich einem anzuschließen. Ihr versteht?«
Joseph nickte. »Heidelberg ist nicht groß. Wir laufen uns sicher wieder über den Weg. Danke für das Frühstück.«
Max hob die Hand und ließ sie allein.
Die beiden jungen Gendarmen hatten die Untersuchung des Toten unter den Augen ihres Vorgesetzten zügig erledigt. Der Schnauzbart erstattete Bericht, während sein Kollege den Abtransport organisierte. »Keine Papiere. Keiner der Umstehenden hat ihn gekannt.« Er sah zu der Leiche hinüber, deren Kopf mit einem Schnupftuch bedeckt war. Ein paar Sonnenstrahlen tanzten über den ausgestreckt daliegenden Körper. »Uns hat der Bengel da geholt.« Er deutete auf den Jungen, der an der Hauswand lehnte und sich die Fäuste unter den Achseln wärmte. Er sprang auf, als der Gendarm ihn herbeiwinkte.
»Du hast den Toten gefunden?«
»Ja!«, begann der Junge großspurig. Dann senkte er die Augen. »Nee, eigentlich nicht. Mich hat einer bezahlt, dass ich das melde. Das mit dem Toten.«
Die kühlen Augen des Gendarmen huschten zwischen dem Jungen und seinem Zeugen hin und her. Er deutete auf den alten Mann. »War es dieser Mann, der dich geschickt hat?«
»Nee, meiner war jung. Nicht so alt wie der da. Er hat mir Geld gegeben, nicht viel, und hat gesagt, ich soll da hin. Dann war er weg. Es war ja auch dunkel, ich würd’ ihn eh nicht mehr erkennen.« Trotzig schob er das Kinn vor. »Sie brauchen also gar nicht zu fragen.«
Der Gendarm lächelte dünn. »Natürlich nicht. Jetzt zu Ihnen. Sie erklären ebenfalls«, er gab dem letzten Wort eine vielsagende Betonung, »dass Sie diesen Mann gefunden haben. Aber bevor Sie uns benachrichtigt haben, sind Sie erst gemütlich ins Bett gegangen, Herr…wie war der Name?«
»Weckerle, Johann Weckerle. Ich bin Pedell der Universität.« Johann verlagerte sein Gewicht. Das steife Bein schmerzte in der Kälte, und seine Hände waren durchgefroren.
Der Gendarm sah es, reagierte aber nicht. »Und Sie sagen, dass Sie daran, wie der Mann dalag, erkannt haben, dass er tot ist? Trotz der Dunkelheit? Ist das Ihre Aussage?«
»Ich habe genug Tote gesehen, auch im Dunkeln!«, entgegnete Johann grob. »Ich war Soldat.«
»Soldat, so«, wiederholte der Gendarm eine Spur freundlicher. »Sie haben den Toten nicht untersucht?«
Johanns Rücken spannte sich. »Nicht näher. Ich hab nur seinen Puls gefühlt.«
»Und warum haben Sie uns nicht gleich gerufen?«
Johann blieb die Antwort schuldig.
Der Gendarm wartete einen Moment, dann seufzte er. Eine weiße Atemwolke begleitete den Laut. »Nun gut! Ist Ihnen etwas aufgefallen? Haben Sie etwas gesehen oder gehört?«
»Das Übliche.«
»Und was ist ›das Übliche‹?«
Johann grub die Finger in seinen Oberschenkel und knetete die verkrampften Muskeln. »Gejohle, ein paar Studenten haben mit Steinen geworfen. Das Übliche halt.«
»Sie als Pedell sind dafür verantwortlich, nächtliche Randale zu unterbinden, nicht wahr?« Das Gesicht des Gendarmen war kalt geworden. Um seine Augen erschienen kleine Falten, und mit einem Mal sah er älter aus als die dreißig Jahre, auf die Johann ihn zunächst geschätzt hatte. »Haben Sie als Soldat Ihre Pflicht genauso schlecht erfüllt?«
Johann drückte das Kreuz durch. Er hielt dem bohrenden Blick stand. »Ich habe Schreie gehört. Aber als ich bei dem Toten war, war es zu spät. Ich habe ein steifes Bein, wie Sie vielleicht bemerkt haben, dank Napoleon und seinen vermaledeiten Franzmännern.«
Der Gendarm räusperte sich. »Als Pedell kennen Sie doch sicher die Studenten. Haben Sie unter den Radaubrüdern ein bekanntes Gesicht gesehen?«
Johann schüttelte verbissen den Kopf.
In diesem Moment näherte sich der Schnauzbart. »Das rote Halstuch«, erinnerte er mit gedämpfter Stimme.
Sein Vorgesetzter drehte sich zu ihm um. »Was ist damit?«
Der jüngere Mann zwirbelte nervös seinen Schnurrbart. »Das spricht doch Bände. Das ist sicher einer dieser Radikalen gewesen. Und jetzt ist er eben tot.« Er schloss mit einem Achselzucken.
»Und?« Die Stimme des Vorgesetzten klang scharf in der Morgenluft. »Wollen Sie damit andeuten, dass dieser Mord deswegen nicht wert ist, aufgeklärt zu werden?«
»Nein! Natürlich nicht. Ich dachte bloß…«
»Lassen Sie das! Haben Ihre Befragungen etwas ergeben?«
In dem vor Kälte geröteten Gesicht arbeitete es. »Nichts. Niemand will etwas gesehen haben.« Unter den Blicken des Vorgesetzten schien er zu schrumpfen. Plötzlich hellten seine Züge sich auf. »Einer dieser Studenten ist frech geworden. Ein gewisser…Scheffer…nein, Scheffel war der Name. Ich habe ihn natürlich sofort notiert!«
Johann hob den Kopf.
Der Gendarm fixierte ihn streng. »Kennen Sie ihn?«
»Ja. Ein ruhiger, anständiger junger Mann. Sein Vater ist Major, soweit ich weiß.«
Der andere pfiff leise durch die Zähne. »Nun, darauf werden wir möglicherweise zurückkommen. Sie können gehen, Herr Weckerle. Ich weiß ja, wo ich Sie finde. Und du, Bursche, kommst mit auf die Wache. Da wirst du uns noch einmal ganz genau alles von diesem Mann erzählen, der dich geschickt haben soll. Und keine Widerworte!«
»Und ich?«, fragte der Schnauzbart.
Sein Vorgesetzter maß ihn mit einem langen Blick. »Sie bleiben hier, bis die Leiche abtransportiert ist. Anschließend fahren Sie mit Ihrer Runde fort.« Er wartete den zackigen Salut ebenso wenig ab wie die gemurmelte Verwünschung, packte den Jungen am Ellenbogen und führte ihn in Richtung der Hauptstraße davon.
2
»Gebäck, gnädige Frau?« Lautlos knickste das Dienstmädchen und hielt der Dame das Tablett hin. Auf feinem Leinen lagen Plätzchen aus der besten Konditorei Heidelbergs.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!