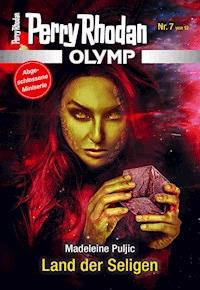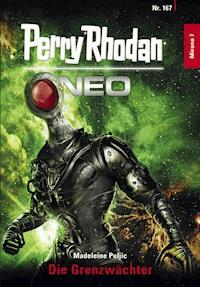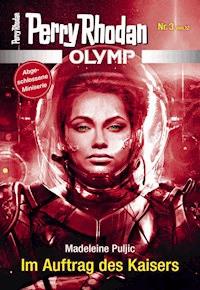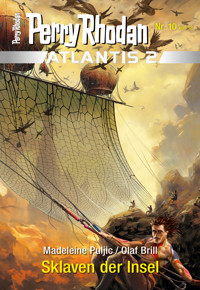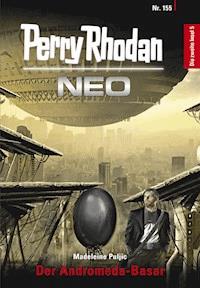1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der Magier Bredanekh nimmt blutige Rache für das Schicksal seiner Familie und findet im Tod grausame Hoffnung. Eine unaussprechliche Bestie harrt im Keller auf ihre tägliche Fütterung. Unerwünschte Besucher verlangen spät nachts Einlass ins traute Heim, die Besatzung einer Raumstation kämpft um das Recht, zu überleben, und für einen Amnesiepatienten entpuppt sich das eigene Zuhause nicht nur als fremd – sondern auch als mörderisch. Dreiundzwanzig düstere Kurzgeschichten werfen ein neues Licht auf Werwölfe, Zombies, Teufel und das schlimmste Ungeheuer von allen: den Menschen. Inklusive „Magie der Nacht“, der Vorgeschichte zu „Herz des Winters“!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Der Pakt
Bestie
Ruhelos
Ungustl
Bis die Hoffnung stirbt
Verwandte der Seele
Der Spiegel meiner Mutter
Der Gast
Schatten im Sommer
Fremdes Selbst
Der Heimkehrer
Schläfer
Eine Glaubensfrage
Dinner für zwei
Teds Abschied
Nacht der geheimen Wünsche
Neue Liebe
Bedlam
Blind Date
Der letzte Mensch
Archeus Z-43
Der Weg des Diebes
Magie der Nacht
Danksagung
Über die Autorin
Impressum
Madeleine Puljic
Für meine Mutter,
die trotz allem nie behauptet hat,
ich wäre im Krankenhaus vertauscht worden.
Der Pakt
1
Der Mond kroch zwischen den abgestorbenen Bäumen des Sumpfes hervor und warf sein blasses Licht auf die kleine Prozession, die sich dort durch das unwegsame Gelände kämpfte. Ein Priester leuchtete den Weg mit einer Fackel aus. Ihm folgten in geringem Abstand zwei grobschlächtige Männer, die eine gefesselte Frau hinter sich herzerrten.
Das Mondlicht war schwach, es ließ kaum etwas von der Umgebung erkennen. Nur wenige Tage trennten die schmale Sichel von der Finsternis der Neumondphase. Die Zeit drängte, denn die Neumondnacht galt ebenso wie die Nächte um die Zeit des Vollmonds als jene Zeit, in der Dämonen und Tiermenschen ihr Unwesen trieben. In solchen Nächten verschloss man die Fensterläden und verstärkte die Gebete. Und jene, die einen Pakt mit dem Bösen geschlossen hatten, mussten bis dahin zu ihren unheiligen Meistern zurückgesandt werden.
Die Gruppe erreichte ihren Zielort: eine kleine, kahle Lichtung, auf der ein starker Pfahl senkrecht in den Boden getrieben worden war. Trockene Äste und Reisig lagen daneben aufgeschichtet. Bereit, ihr Opfer in Empfang zu nehmen.
Die Frau war mittlerweile zusammengebrochen, sie wurde von den Männern nur noch nachgeschliffen. Unter dem Saum ihres schmutzigen Büßerhemds waren getrocknetes Blut und zahlreiche Brandwunden zu sehen. Man führte sie direkt von der Folterbank zur Vollstreckung.
Als man sie auf die Beine zog, um sie an den Pfahl zu binden, verlieh die Todesangst ihr noch einmal die Kraft, gegen ihre Peiniger anzukämpfen. Sie trat und schlug um sich, biss sogar dem Mann zu ihrer Linken in die Schulter, doch schon fesselten die ersten Seile sie an den Pfahl und erstickten ihren Widerstand. Daraufhin verlieh sie ihrem Zorn durch Beleidigungen und Flüche Ausdruck, die sich hauptsächlich gegen den Priester und dessen Gehilfen wandten, von denen aber auch ihr gesamtes Heimatdorf nicht ausgenommen war.
Der Fackelträger musterte die Verurteilte schweigend und ohne jede Spur von Mitleid, während seine Begleiter das Brennmaterial um den Pfahl und die Beine der Unglücklichen häuften. Als diese Arbeit beendet war, trat er vor und sprach die Frau an:
»Marlis Weyer, du wirst angeklagt und verurteilt der Hexerei, Ketzerei und Teufelsbuhlschaft. Bist du dir darüber im Klaren, welche Strafe dich erwartet?«
»Mich würde mehr interessieren, welche Strafe für Diener Gottes vorgesehen ist, wenn sie Unschuldige hinrichten!«
Der Angesprochene zeigte sich wenig beeindruckt. »Erspar uns deine Lügen. Wenn du gestehen würdest, könntest du dir großes Leid ersparen. Bereu deine Sünden, finde zum wahren Glauben zurück! Wir könnten dich erdrosseln und dich so vor dem Verbrennen bei lebendigem Leib bewahren. Also, hast du noch etwas zu sagen?«
»Nur, dass Mörder in der Hölle schmoren!«
»Dann möge Gott deiner Seele gnädig sein, denn wir können dir keine Gnade gewähren.«
Der Geistliche trat einen Schritt vor und senkte die Fackel auf den Scheiterhaufen herab. Plötzlich jedoch griff er sich mit der freien Hand an die Kehle. Röchelnde Laute waren zu vernehmen. Es schien, als versuche er verzweifelt, nach Luft zu schnappen. Sein Gesicht verfärbte sich immer dunkler, seine Augen traten aus ihren Höhlen hervor. Er ließ die Fackel fallen und riss verzweifelt an seinem Kragen, ohne das Feuer zu beachten, das auf das Brennholz der Hinrichtungsstätte übergriff.
Seine Handlanger stürzten vor, um ihm zu Hilfe zu eilen. Sie hielten jedoch augenblicklich inne, als ein trockenes Knacken erklang und der Kopf des Priesters abrupt in eine unnatürliche Stellung rückte. Mit Entsetzen beobachteten sie, wie der tote Körper zu Boden fiel.
Einen Moment lang standen die beiden Helfer unschlüssig da, nicht sicher, ob sie die Leiche untersuchen und wegschaffen oder selbst das Weite suchen sollten. Dann erblickten sie eine dunkle Gestalt, die sich aus dem Schatten der Bäume löste, und entschlossen sich kurzerhand für Letzteres.
Sie kamen nicht weit. Wie aus dem Nichts stand der unheimliche Besucher plötzlich vor ihnen. Die Flammen des Scheiterhaufens erhellten seine Züge und enthüllten seine wahre Natur. Im Licht des Feuers war deutlich sein bösartiges Grinsen zu erkennen. Noch erschreckender wirkten die krummen Hörner, die seinen Kopf zierten, und die ledrigen Flügel, die er auf dem Rücken trug und jetzt langsam und bedrohlich entfaltete. Mit einer einzigen, schnellen Bewegung seiner Krallen zerfetzte er den Hals des ersten Handlangers, sodass dieser zusammenbrach. Der zweite Mann stieß einen Schrei aus. Er wandte sich um und versuchte zu flüchten, doch schon nach wenigen Schritten bohrte sich die Klaue des Monsters in seinen Leib und durch sein Herz.
Langsam hob der Schlächter den Blick von seinem letzten Opfer und ließ ihn auf der Frau ruhen, die verzweifelt an den Stricken riss, um sich vor den immer näher kommenden Flammen in Sicherheit zu bringen. Die Hitze hatte bereits ihre Haut gerötet und mit Ruß überzogen. Es fiel ihr sichtlich immer schwerer, durch den Qualm hindurch zu atmen. Dennoch ließ sie die Augen nicht von dem Neuankömmling, der soeben ihre Peiniger beseitigt hatte. Sie konnte nicht abschätzen, was er als Nächstes tun würde und welche Gefahr akuter war – das Feuer oder der Schlächter.
Eine Zeit lang sah es aus, als wäre er nur erschienen, um seinen Platz als Zuschauer einzunehmen. Dann jedoch hob er die Hand, von der das Blut zweier Männer tropfte, und deutete auf die Verurteilte. Bewusstlos sank sie in sich zusammen.
2
Als Marlis ihre Augen öffnete, war das Feuer samt Brennholz verschwunden. Sie stand immer noch an den Pfahl gebunden. Der Platz war in graues Licht getaucht, der Himmel nicht zu sehen. Erst dachte sie, es wäre dichter Nebel aufgezogen, doch das würde nicht erklären, weshalb die Bäume keinerlei Ähnlichkeit mit jenen Wäldern aufwiesen, die sie kannte. Oder warum sie wirkten, als würden sie sich drohend immer dichter um die kleine Lichtung scharen.
Sie nahm eine Bewegung an ihrer Seite wahr und wandte erschrocken den Kopf. Einen Moment lang erwartete sie, erneut dem Priester und dem Feuer gegenüberzustehen. Stattdessen trat derjenige an sie heran, der eben jenen Diener Gottes und dessen Gefolge niedergemetzelt hatte.
Er war groß, viel größer als ein durchschnittlicher Mensch. Sein Gesicht wirkte derb, seine dunklen Haare und sein Bart waren verfilzt. Die gelb glühenden Augen musterten Marlis, als wäre sie ein Beutetier. Er bewegte sich auf eine seltsam anmutende Art, die wohl ihren Ursprung in seinen Beinen hatte. Von den Knien abwärts ähnelten sie immer mehr Ziegenbeinen, bis sie schließlich in einem Paar Hufe endeten. Eine Weile starrten sie einander wortlos an, als ob beide nicht wüssten, was sie miteinander anfangen sollten.
Dann beschloss Marlis, dass Angriff die beste Verteidigung ist, und fuhr ihr Gegenüber an: »Wer bist du? Wo sind wir hier?«
»Lurdok. In meiner Welt.« Die Stimme des Monsters war tief und brachte die Umgebung auf eine merkwürdige Art zum Vibrieren. Es schien ihm keine Mühe zu machen, wie ein Mensch zu sprechen – es schien einfach keine Lust darauf zu haben.
»Und warum hast du mich hierhergebracht?«
»Du wärst verbrannt.«
»Ja, aber weshalb hast du mich gerettet?« Ihre Stimme zitterte. Die Angst, die sie anfangs verspürt hatte, wandelte sich angesichts dieser absurden Situation in Wut und Verwirrung.
»Du stellst viele Fragen.«
»Vielleicht war das ja der Grund, wieso sie mich verbrennen wollten.«
»Mein Fehler. Ich war der Ansicht, der Grund wäre, dass du gesehen wurdest, als du mit dem Teufel den Beischlaf praktiziert hast.«
Marlis lief rot an. »Ich schwöre bei Gott, ich hatte kein einziges Mal Kontakt in welcher Weise auch immer zu irgendwelchen Dämonen!«
Lurdok fing an zu grinsen. Langsam begann ihm die Sache wohl, Spaß zu machen. »So? Und wofür hältst du mich?«
Sie wurde immer verstörter. Worauf lief dieses Spiel hinaus? »Ich hatte keinen Kontakt zu Dämonen, bevor sie Anklage gegen mich erhoben.«
»Demnach war die Anklage unberechtigt?« Das Grinsen des Ungeheuers wurde breiter, es enthüllte ein Furcht einflößendes Gebiss.
»Natürlich war sie das!«
»Und warum wohl sollten all diese Leute falsches Zeugnis ablegen gegen dich?« Lurdok war nahe an Marlis herangetreten und sah auf sie herab. »Sehen wir einmal … Da wäre der kleine Bauer Clemens, der nachts gerne in fremde Fenster späht und dessen Heiratsanträge du bereits ein dutzend Mal abgewiesen hast. Könnte er eine falsche Aussage machen? Was meinst du?«
Als er keine Antwort erhielt, fuhr er unbeirrt fort.
»Dann wäre da noch deine Nachbarin Anna, die bei jeder Gelegenheit Obst aus deinem Garten stiehlt und die schon lange überlegt, wie sie an deinen Grund kommen kann. Wie hoch schätzt sie das Leben eines Menschen?«
Marlis starrte weiter stumm vor sich hin. Die unsinnigen Vorwürfe des Richters während ihres Prozesses kamen ihr wieder in den Sinn. Und die Zeugen – ihre Mitbürger, die ihren Blicken ausgewichen waren.
Lurdok begann, wild gestikulierend auf und ab zu gehen, während er theatralisch weitersprach.
»Und Elsa, deine Spielgefährtin von Kindertagen an. Leider etwas dümmlich und nicht gerade eine Schönheit. Immer stand sie in deinem Schatten. Ob sie das wohl satthatte? Dorflehrer Gomer, vergessen wir ihn nicht. Ein aufrechter Bürger, und so gottesfürchtig! Noch viel mehr fürchtete er allerdings seine Frau, vor allem, seit sie ihn das Nudelholz spüren ließ, nachdem er auf dem Marktplatz versucht hatte, der hübschen Marlis näherzukommen. Und natürlich die Amme Krumer, die nur zufällig in der Stadt war. Was sie wohl gegen dich vorzubringen hatte? Sie kannte dich doch gar nicht … Vielleicht wollte sie nur noch einmal etwas Aufmerksamkeit, schließlich ist sie auch nicht mehr die Jüngste.«
»Es reicht! Warum erzählst du mir all das? Was willst du von mir?«
Lurdok hielt inne. Einen Augenblick lang sah er sie einfach nur an, die zusammengefalteten Flügel zuckten unentschlossen. Dann kam er wieder näher an sie heran. »Dieviel wichtigere Frage ist: Was ist es, das du willst?« Er bewegte unmerklich seine Hand, und die Stricke, die Marlis banden, fielen zu Boden.
»Sie alle haben zu deiner Verurteilung beigetragen, sie alle vergossen keine einzige Träne, nachdem sie deinen Tod besiegelt hatten. Macht es dich nicht wütend? Willst du sie nicht büßen lassen für deinen Schmerz? Die Folter, der Scheiterhaufen – haben sie nicht eine Strafe verdient?«
Marlis sah ihn an, ihr Blick kalt wie Eis. Sie brachte kein Wort heraus, doch das war scheinbar auch gar nicht nötig.
»Ich biete dir die Möglichkeit zur Rache. Ich habe dir dein Leben geschenkt, und ich werde dir eine Kraft verleihen, die deine Feinde das Fürchten lehren wird.«
»Und was verlangst du dafür? Halte mich nicht für so dumm, dir Großmut als Beweggrund zu glauben.«
»Ich verlange nichts anderes von dir, als dass du die Kraft, die ich dir gebe, für meine Zwecke einsetzt, wenn ich dich dazu auffordere.«
»Was ist, wenn ich mich weigere, nach deinem Sinn zu handeln?«
Lurdok lächelte kalt. »Glaub mir, es wird in deinem eigenen Interesse liegen, das nicht zu tun.«
»Und wenn ich das alles nicht will? Wenn ich den zweiten Teil deines Geschenks ablehne, nimmst du mir dann auch den ersten?«
Sein Lächeln wurde noch grausamer. »Es steht dir frei, zu gehen. Ich bin mir sicher, deine Freunde werden über deine Rückkehr sehr erfreut sein. Vor allem, nachdem drei Männer, darunter ein Priester, durch einen Diener des Teufels ermordet wurden, als sie sich deiner entledigen wollten.«
Er zog eine schwere Doppelaxt hervor und ging auf Marlis zu. Unwillkürlich wich sie zurück.
Doch von hinten legten sich ihr klauenartige Hände auf die Schultern und zwangen sie mit unerbittlicher Macht in die Knie. Den Versuch, sich zu wehren, unterließ sie ganz. Sie hatte sehr wohl noch vor Augen, wie die Fluchtversuche ihrer Henker geendet hatten. Stattdessen bemühte sie sich, ihre Angst nicht zu zeigen, als sie zu der riesigen Klinge aufsah. Diese Genugtuung wollte sie ihrem Mörder nicht geben.
Lurdok holte zum Schlag aus. Das Beil sauste herab – allerdings nicht auf Marlis, sondern auf einen Felsblock, der vor ihren Knien halb aus dem Boden ragte.
Die Klinge blieb im Stein stecken. Aus dem Spalt, den sie geschlagen hatte, quoll eine schwarze, zähe Masse. Tausende winzige Schlangen lösten sich daraus hervor, krochen auf Marlis zu und an ihren Armen hoch. Sie wollte erschrocken hochfahren, doch wer auch immer hinter ihr stand, drückte sie weiterhin nieder. Mit angewidertem Entsetzen musste sie zusehen, wie sich die unheimlichen Tiere unter ihre Kleidung wanden. Bald waren sie über ihren gesamten Körper verteilt.
Als sie glaubte, den Ekel nicht mehr auszuhalten, bohrten die Schlangen sich plötzlich in ihre Haut, verbissen sich in ihre Wunden und verätzten das Fleisch. Marlis schrie auf vor Schmerz. Sie wollte das Getier abstreifen, doch die widerlichen Biester drangen in ihren Körper ein, verschmolzen mit ihr. Es gab kein Entkommen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit ließ die Pein endlich nach. Sie wurde von einem dumpfen Wundschmerz abgelöst. Schwer atmend stürzte Marlis auf ihre Hände. Sie wurde nicht länger gehalten, doch sie hatte keine Kraft, um sich zu erheben.
Lurdok zog die Axt aus dem Stein, schulterte sie und sah zufrieden auf sie herab. »In einer Stunde beginnen wir mit der Vorbereitung.«
3
Prozess gegen Marlis Weyer, es sprechen Richter Andreas Freyburgh und Zeuge Clemens Riller.
Richter: Clemens Riller, Ihr habt den Eid geleistet. Welche Vorwürfe habt Ihr in der Angelegenheit Marlis Weyer zu Protokoll zu geben?
Zeuge: Vor einigen Tagen sah ich die Angeklagte, als sie sich der Unkeuschheit schuldig machte.
Richter: Könnt Ihr den Mann benennen, mit dem sie dies tat?
Zeuge: Es war der Leibhaftige selbst.
Richter: Woran glaubt Ihr, das erkannt zu haben?
Zeuge: Er hatte alle Merkmale an sich, die die Predigt zur Erkennung des Bösen lehrt.
Richter: Und wo beobachtetet Ihr sie dabei?
Zeuge: Ich sah, wie sie dies in ihrem eigenen Schlafzimmer tat.
Richter: Und weshalb befandet Ihr selbst Euch dort?
Zeuge: Ich hörte sie schreien und stöhnen und fürchtete, ihr würde ein Leid angetan.
Marlis stand im Schatten des Torbogens. Ein letztes Mal überprüfte sie ihre Ausrüstung. Die Sonne war gerade erst untergegangen, sie hatte genügend Zeit. Die Nacht hatte erst begonnen – und es würde eine lange Nacht werden.
Sie betrachtete ihre Hände, die jetzt von dünnen, schwarzen Linien übersät waren. Sie zierten beinahe ihre gesamte Haut. Marlis wusste, dass manche davon bis in ihr Gesicht reichten, und auch, dass die Schlangen die Wunden verschlossen hatten, die sie von der Folter davongetragen hatte. Eine fremde Art von Kraft durchströmte sie seit ihrer seltsamen Symbiose. Welchen Vorteil allerdings die Schlangen dabei hatten, war ihr noch nicht klar. Genauso schleierhaft war ihr, was Lurdok sich von ihrem Rachezug erhoffte. Sicher hatte er sie nicht gehen lassen, nur um ihr einen Gefallen zu tun.
Doch im Augenblick spielte das keine Rolle. Wichtig war, diese Verräter büßen zu lassen. Für die Schmerzen, die Schmach. Und das Leben, das sie ihr gestohlen hatten.
Langsam betrat sie den Hof, der vollkommen im Dunkel lag. Der große Wachhund, der sich darin aufhielt, machte ein paar Sätze in ihre Richtung. Als er jedoch ihren Geruch witterte, verkroch er sich winselnd in seiner Hütte. Er würde kein Problem darstellen.
In einem der Fenster nahm sie den flackernden Schein einer Kerze wahr. Sie wandte sich dem Fenster daneben zu und versuchte, es zu öffnen, doch es war von innen verriegelt. Das Fenster einzuschlagen würde den Bewohner erschrecken, und das würde einen großen Teil des Vergnügens zunichtemachen. Was also tun?
Nachdenklich legte sie eine Hand an die Scheibe, fühlte die glatte Kälte des Glases. Dabei verspürte sie ein leichtes Kitzeln an ihrem Handgelenk. Mit Verwunderung beobachtete sie eine der Schlangen, die sich aus ihrem Arm löste. Sie fiel auf das Fensterbrett, schlängelte über das Holz und verschwand in dem Spalt zwischen Fenster und Rahmen. Ein paar Augenblicke später ertönte ein leises Klicken.
Als Marlis mit ihrer Hand einen leichten Druck ausübte, gab das Hindernis nach. Das Fenster war offen. Leise stieg sie durch die Öffnung und hob die Schlange wieder auf, die daraufhin an ihren Platz in der Haut zurückkehrte.
Ohne ein Geräusch zu verursachen, nahm Marlis den Kurzbogen, den sie mitgebracht hatte, und legte einen Pfeil ein. Sie spannte den Bogen leicht und betrat das Nebenzimmer, in dem sie die Kerze hatte brennen sehen. Derjenige, den sie suchte, saß an einem kleinen Tisch. Er nahm sein Nachtmahl zu sich. Eine Henkersmahlzeit war immerhin mehr, als ihr selbst gewährt worden war. Sie schluckte, um ihrer Stimme jede Spur von nervöser Heiserkeit zu nehmen.
»Clemens.«
Wie von der Tarantel gestochen fuhr der Mann hoch und wirbelte herum. Dabei warf er seine kärgliche Mahlzeit zu Boden, Wein tränkte die hölzernen Dielen.
»Marlis!«, stieß er hervor. »Wie kann das sein? Du wurdest verbrannt!«
»Weshalb bist du dir dessen so sicher? Hattest du etwa den Mut, dir wenigstens anzusehen, wozu du mich verdammt hast?« Sie spannte den Bogen und zielte ohne zu zittern auf sein Herz.
»Du wurdest vor Gott gerichtet für deine Taten, du hast dich selbst verdammt. Ich wollte nur deine Seele vor weiteren Sünden bewahren.«
Marlis wurde bewusst, dass sie immer noch im Schatten stand. Bisher hatte er ihre Verwandlung also noch gar nicht bemerkt. Mit einem raschen Schritt in den Lichtkreis der Kerze korrigierte sie diesen Umstand.
Clemens sog hörbar Luft ein und wich zurück.
Angesichts seines erbärmlichen Gehabes verwarf Marlis ihren ursprünglichen Plan. Sie zielte erneut und ließ den Pfeil los. Er bohrte sich in Clemens’ Unterarm, nagelte ihn an die Wand. Lauernd näherte sie sich ihrem Opfer, das sich stöhnend vor ihr wand. Clemens versuchte, den Pfeil herauszuziehen, die Bewegung bereitete ihm zu große Schmerzen, er ließ die Hand wieder sinken. Sein weinerliches Benehmen machte sie rasend, und sie schoss ihm einen zweiten Pfeil in den Oberschenkel. Er schrie auf.
Erneut spannte sie den Bogen.
»Sieh dir gut an, was aus mir geworden ist. Das ist es, was du und deine verfluchten Freunde aus mir gemacht haben.«
»Du Ausgeburt der Hölle, es sind deine eigenen Taten …«
Marlis schoss ihm den Pfeil mitten in die Stirn. Sie hatte genug von seinen selbstgerechten Ausreden.
Eine Weile besah sie sich ihre Tat. Unter anderen Umständen hätte der Anstand ihr geboten, dem Toten wenigstens die Augen zu schließen. Doch den Anstand hatten sie ihr ausgetrieben.
Sie ließ den Bogen und den leeren Köcher zurück. Es gab noch viel zu tun.
4
Prozess gegen Marlis Weyer, es sprechen Richter Andreas Freyburgh und Zeugin Anna Schalke.
Richter: Anna Schalke, was habt Ihr uns in der Angelegenheit Marlis Weyer zu sagen?
Zeugin: Ich beobachtete sie zuweilen nachts, wie sie nackt in ihrem Garten tanzte und dabei satanische Rituale durchführte.
Richter: Welcher Art waren diese Rituale?
Zeugin: Sie zeichnete seltsame Symbole auf den Boden und sprach böse Formeln. Daraufhin wuchsen ihr Haare am ganzen Körper und das Kreuz wurde ihr krumm. Da schrie sie wie ein Tier und lief in den Wald.
Richter: Ihr sagt also, sie verwandelte sich in ein Tier?
Zeugin: Ja, ich sah sie in der Gestalt eines großen Wolfes.
Unschlüssig musterte sie die Silhouette des Hauses, die sich schwarz und tot gegen den Nachthimmel abhob. Das Gebäude strahlte etwas Unwirtliches aus, wie alle verlassenen Wohnstätten. Die Eingangstür stand offen und gab das ausgeweidete Innere der Stube den Blicken preis. Scheinbar hatten die guten Bürger schon lange vor ihrer Verurteilung damit begonnen, das Hab und Gut der Hexe an sich zu nehmen. Das war allerdings nicht weiter verwunderlich, denn sobald jemand der Ketzerei angeklagt wurde, war das Ende des Prozesses so gut wie besiegelt. Und warum warten, bis der Besitz rechtmäßig aufgeteilt wurde und die besten Stücke bereits gestohlen waren?
Sie betrat ihr ehemaliges Heim, das kaum wiederzuerkennen war. Alles, was sich gut vor den neugierigen Blicken der anderen verbergen und heimlich mitnehmen ließ, war verschwunden. Leere Kästen starrten ihr entgegen, Stühle und Tische waren umgeworfen worden, um nicht dem Eifer der Plünderer im Weg zu sein. Marlis schüttelte bedauernd den Kopf. Hier würde sie nichts mehr finden, das sich mitzunehmen lohnte.
Als sie wieder auf die Straße trat, bemerkte sie einen merkwürdigen Schatten neben der Schwelle. Sie sah genauer hin, und der Zorn trieb ihr Tränen in die Augen. Das Fell des unglücklichen Tieres war blutverkrustet und verdreckt, dennoch bestand kein Zweifel an der Identität des jungen Kätzchens. Wer eine Hexe verbrannte, durfte ihren teuflischen Gefährten offensichtlich nicht am Leben lassen. Auch wenn dieser sein Leben lang nichts anderes getan hatte, als hinter Mäusen und Wollknäueln herzujagen. Marlis fragte sich, wer wohl die Heldentat vollbracht hatte, dem unschuldigen Tier den Schädel einzuschlagen. Sie erhob sich und zog ihren Dolch. Egal wer dafür verantwortlich war, sie wusste, wen sie als Nächsten büßen lassen würde.
Nur ein Haus weiter. Sie musste sie sich nicht einmal die Mühe machen, ein Fenster zu öffnen. Sie stieg durch die Wäschekammer ein, in der Laken zum Trocknen hingen, die ihr sehr bekannt vorkamen. Aus dem Nebenraum vernahm Marlis eine Frauenstimme, die gut gelaunt vor sich hinsummte. Wütend stieß sie die Tür zur Kammer auf und sah sich ihrer früheren Nachbarin gegenüber.
Anna saß vor dem Herd und strickte an einem Strumpf. Als Marlis eintrat, blickte sie hoch. Das Summen erstarb ihr auf den Lippen. Sie sprang auf, das Strickzeug fiel ihr aus den Händen. »Herr im Himmel, steh mir bei!«
»Ach, sei still, du dumme Gans. Fällt dir denn nichts Besseres ein?« Mit wenigen Schritten stand sie über die jämmerliche Gestalt gebeugt, die sich ängstlich an die Wand kauerte. Als Anna auch noch begann, das Vater Unser zu beten, blitzte der Dolch auf und fügte ihr eine tiefe Schnittwunde quer über die Wange zu, die sie augenblicklich verstummen ließ. Mit schreckensgeweiteten Augen sah sie zu ihrer Peinigerin auf.
Marlis erwiderte ihren Blick kalt. »Zieh dich aus«, forderte sie.
»Was? Aber ich …« Ein weiterer Schnitt, der von ihrer Handfläche den Unterarm hinauf verlief, ließ Anna ihre Widerworte sofort bereuen. Hastig machte sie sich an den Bändern zu schaffen, die ihre Kleidung zusammenhielt. Dabei besudelte sie den Stoff mit dem Blut, das aus ihren Wunden rann.
»Nimm ein Stück Kohle aus dem Herd. Und jetzt zeichne damit einen Drudenfuß um dich herum.«
Genussvoll beobachtete Marlis, wie sich die Verräterin abmühte, mit ihrer verletzten Hand den fünfzackigen Stern mehr schlecht als recht auf den Boden zu malen. Das Endergebnis war wenig mehr als eine verwackelte Skizze, doch sie würde genügen.
Anna erhob sich, am ganzen Leib zitternd, und wartete auf weitere Anweisungen. Statt eines neuen Befehls empfing sie jedoch einen Schnitt, der sich tief über ihren Unterleib zog. Sie presste die Hände auf den Bauch und krümmte sich, doch dadurch quoll ein Teil ihrer Innereien heraus. Blankes Entsetzten spiegelte sich in ihrem Blick, als sie die Körperteile betrachtete, die bei einem lebendigen Menschen eigentlich nicht zu sehen sein sollten.
Marlis packte die Frau am Schopf, zwang ihren Kopf in den Nacken und schnitt ihr mit einer raschen Bewegung die Kehle durch. Ungehemmt sprudelte das Blut hervor. Anna stieß einen gurgelnden Laut aus und sackte zusammen.
Zufrieden begutachtete Marlis das Blutbad. Jetzt würden diese Dummköpfe schon sehen, was ihnen das Pentagramm gegen den Dämon nutzte, den sie heraufbeschworen hatten.
Sie steckte den Dolch weg und begab sich in das Schlafzimmer der Toten. Im Schrank fand sie ein schlichtes Kleid und einen dunklen Umhang. Beides nahm sie an sich. Endlich konnte sie das Büßerhemd abstreifen.
Ihre Zeit zu büßen war vorbei.
5
Prozess gegen Marlis Weyer, es sprechen Richter Andreas Freyburgh und Zeugin Elsa Kover.
Richter: Elsa Kover, welche Aussage habt Ihr zu Protokoll zu geben?
Zeugin: Meine Ziege wurde von der Angeklagten verhext.
Richter: In welcher Weise?
Zeugin: Sie fasste sie an und von dem Tag an gab sie keine Milch mehr. Kurz darauf verstarb sie.
Richter: Ich hörte, dass Ihr Eure Ziege erst gestern schlachten ließet?
Zeugin: Das musste ich, denn sie war von den Toten zurückgekehrt an dem Tag, an dem die Hexe in Gewahrsam genommen wurde. Doch da ich sie tot gesehen hatte, wollte ich sie nicht länger in meiner Nähe dulden. Ich ließ sie schlachten, um sie von ihrem unnatürlichen Dasein zu erlösen.
Den Weg zu ihrem nächsten Opfer fand sie, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Seit ihrer Kindheit war sie ein regelmäßiger Gast in diesem Haus gewesen. Die knarzenden Dielen, die sie meiden musste, kannte sie ebenso auswendig wie den Trick, unbemerkt die Hintertür zu öffnen. Zielsicher strebte sie dem Zimmer entgegen, in dem ihre einstige Spielgefährtin Stunde um Stunde am Spinnrad verbrachte, um die gefertigten Garne samstags auf dem Markt feilzubieten.
Auch jetzt vernahm sie den gleichmäßigen Rhythmus, mit dem der Fuß das Pedal antrieb. Marlis wusste, dass das Spinnrad zum Fenster stand, sodass sie nicht Gefahr lief, zu früh gesehen zu werden. Sie zog einen dünnen Strick aus grobem Hanf aus der Tasche. Der Strick war rau und kratzte, doch das war ihr nur Recht. Je mehr Ungemach sie verursachte, desto besser.
Marlis trat dicht hinter die junge Frau, ohne dass diese sie bemerkt hätte. Mit einer schwungvollen Bewegung schlang sie ihr den Strick um den Oberkörper und band ihr so zugleich die Hände an den Leib.
Elsa schrie überrascht auf. Sie blickte über ihre Schulter und prallte zurück, als sie ihre nächtliche Besucherin erkannte. Sie war so perplex, dass sie gar nicht erst auf die Idee kam, den Strick abzuwerfen oder sich gegen den Griff zu wehren, der ihre Handgelenke festhielt, als diese an die Stuhllehne gefesselt wurden. Nicht einmal den Fuß nahm sie vom Spinnrad.
Marlis rückte einen zweiten Stuhl zurecht und nahm ihrer Jugendfreundin gegenüber Platz. Im Plauderton fragte sie: »Na, wie laufen die Dinge? Hübsches Kleid, das du da trägst. Seltsam, ich hätte schwören können, dass ich einmal auch so eines hatte.«
Offenbar war Elsa sich mittlerweile ihrer Situation bewusst geworden, denn sie zerrte an ihren Fesseln, ohne den angstvollen Blick von Marlis zu nehmen. Sie versuchte zu lächeln, doch die Furcht verzerrte ihr Gesicht, sodass eine merkwürdige Grimasse daraus wurde.
»Oh, Marlis, was bin ich froh, dich zu sehen! Der Priester kam nicht aus dem Wald zurück, ich hatte so gehofft, du wärst entkommen. Sie haben dich vergebens gesucht.«
Marlis nickte verständnisvoll. »Natürlich, du warst immer so besorgt um mich. Immer wolltest du nur mein Bestes, nicht wahr?«
Die andere nickte so heftig, dass sich einzelne Strähnen aus ihrem Zopf lösten. »Ganz recht, dazu sind Freundinnen schließlich da, ist es nicht so?«
»Ja, dazu sind sie da.« In Marlis’ Augen trat ein Ausdruck des Bedauerns. »Aber weißt du was? Das scheinst du irgendwie einige Tage lang vergessen zu haben. Zum Beispiel, als du vor Gericht gestanden bist und mir hättest helfen können.«
»Marlis, versteh doch …«
»Ja, ich verstehe sehr gut. Aber mach dir keine Gedanken, ich bin dir nicht böse. Und du wirst auch keine Lügen mehr über mich erzählen, oder?« Ihre Hand glitt langsam unter ihren Mantel und berührte den Griff des Dolches.
»Nein, nie wieder! Ich schwöre bei der heiligen Jungfrau …« Ein Hoffnungsschimmer glomm in Elsas Augen auf. In ihrer Panik nahm sie nichts wahr außer dem Gesicht der Frau, die sie ohne Gewissensbisse dem Tod preisgegeben hatte.
»Ach, Elsa. Du musst nicht schwören, denn ich glaube dir. Weißt du, ich bin wirklich davon überzeugt, dass du nie wieder etwas Schlechtes über irgendjemanden sagen wirst.«
Der Dolch glitt mit einem kalten Geräusch aus ihrem Gürtel, und dieses Mal sah Elsa die Bewegung.
»Um Himmels willen, du wirst doch nicht …«
Weiter kam sie nicht, denn Marlis hatte ihr die freie Hand um den Mund gelegt und zwang ihr mit brutalem Druck die Kiefer auseinander. Sie führte den Dolch in die Mundhöhle und durchtrennte etwas ungeschickt den Zungenmuskel.
Elsa schrie auf und zuckte zurück, wodurch der Dolch aus ihrem Mund glitt und ihre linke Wange aufschnitt. Sie wollte schluchzen, doch dabei geriet ihr ein Schwall Blut in die Luftröhre. Hustend spie sie Blut und die abgetrennte Zunge auf den Fußboden.
Marlis lächelte. »Siehst du, ich sagte doch, dass du keine Lügen mehr erzählen wirst.« Sie beugte sich zu der leise weinenden Frau hinab. »Und jetzt sieh mich genau an. Ich will, dass du meinen Anblick dein Leben lang nie vergisst.«
Was mehr Entsetzen in Elsas Blick brachte, war nicht ganz klar – die Schlangen, die sich auf Marlis’ Haut bewegten und nach ihr zu greifen schienen, oder die Klinge des Dolches, der ihr die Augen zerstach.
Marlis durchschnitt die Fesseln und zog Elsa auf die Beine. Als letztes Abschiedsgeschenk schnitt sie ihr ein Kreuz in die bis dahin unversehrte Wange. Dann ließ sie die Geblendete allein zurück.
Das Leben, das sie von nun an führen würde, war eine weitaus angemessenere Strafe als der Tod.
6
Prozess gegen Marlis Weyer, es sprechen Richter Andreas Freyburgh und Zeuge Lukas Gomer.
Richter: Lukas Gomer, Ihr steht vor Gericht in der Sache Marlis Weyer. Welche Vorwürfe habt Ihr in dieser Angelegenheit vorzubringen?
Zeuge: Sie benutzte mich, um zu ihren unheiligen Versammlungen zu fliegen.
Richter: Wie genau tat sie dies?
Zeuge: Sie flog nachts in mein Schlafgemach und zäumte mich auf. Ich wurde in ein Pferd verwandelt und musste sie zu ihrem Sabbat tragen.
Richter: Und zu welcher Zeit benutzte sie Euch derart?
Zeuge: An jedem Neumond gegen Mitternacht kam sie und ließ mich erst gegen Morgen wieder heimkehren. Ihr könnt meine Frau fragen. Sie kann bezeugen, dass ich oft erst in der Dämmerung und sehr erschöpft nach Hause kam.
Nachdenklich sah sie die beiden Schlafenden an. Es war mittlerweile spät geworden, dennoch hatte sie eigentlich nicht erwartet, den Dorflehrer in seinem Bett vorzufinden, noch dazu an der Seite seiner eigenen Frau. Unentschlossen sah sie sich in dem kleinen Raum um. Ihn aufzuwecken und eine Weile zu quälen wäre interessant. Andererseits würde dann auch seine Frau wach werden und so vielleicht der Bestrafung entgehen, die auch sie verdient hatte. Aber einfach im Schlaf zu sterben erschien Marlis ein zu gnädiges Ende.
Letztendlich kam sie zu einem Entschluss. Mit einem kalten Lächeln auf den Lippen durchsuchte sie die Küche. Dabei stieß sie auf etliche Gegenstände, die sie selbst noch vor einiger Zeit so unbedarft benutzt hatte. Es waren Kleinigkeiten – ein paar Schüsseln, die sie selbst in jungen Jahren bemalt hatte, Tücher, ein Krug – doch sie machten ihr bewusst, dass es wohl niemanden gab, der von ihrer Verurteilung nicht profitiert hatte. Zwischen einigen Büscheln mit getrockneten Kräutern fand sie schließlich, wonach sie gesucht hatte. Die dünne Steingutflasche in der Hand ging sie zurück und trat wieder an das Schlaflager. Noch immer waren die beiden nicht aufgewacht, also verriegelte sie das kleine Fenster, entkorkte die Flasche und entleerte den Inhalt in und um das Bett. Das trockene Stroh der Matratze sog das gewöhnliche Öl gierig auf.
Marlis nahm die Kerze vom Tisch und platzierte sie so auf dem Boden, dass die Decke zu glimmen anfing. Das gab ihr einige Minuten, ehe die Flamme die mit Öl getränkten Stellen erreichen und den Raum in ein Inferno aus Hitze und Feuer verwandeln würde. Sie verspürte ein leichtes Bedauern, dass sie nicht dabei sein konnte, wenn die beiden erwachten und bemerkten, dass es für sie keinen Ausweg aus dem Brand gab. Sorgsam verriegelte sie die Zimmertür hinter sich.
7
Prozess gegen Marlis Weyer, es sprechen Richter Andreas Freyburgh und Zeugin Josefine Krumer.
Richter: Josefine Krumer, Ihr seid in dieser Stadt nicht ansässig. Was also habt Ihr Marlis Weyer vorzuwerfen?
Zeugin: Diese Hexe kam zu mir, kaum dass ich die Stadt betrat, und verlangte ein neugeborenes Kind von mir.
Richter: Weshalb sollte sie so etwas verlangen?
Zeugin: Ich glaube, sie wollte es in einem heidnischen Ritual verschlingen. Sie forderte mich auf, bei der nächsten Entbindung die Eltern glauben zu machen, es hätte sich um eine Totgeburt gehandelt. Den Säugling sollte ihr geben. Dafür bot sie mir viel Geld und einen Zaubertrank, der mich verjüngen sollte.
Richter: Weshalb kam sie mit dieser Forderung ausgerechnet zu Euch?
Zeugin: Falls Ihr damit andeuten wollt, ich wäre solchen Geschäften nicht abgeneigt, so irrt Ihr Euch! Sie wandte sich wohl an mich, weil ich nur selten in der Stadt bin. Dem Wort einer umherziehenden Fremden wird eben nur selten Glauben geschenkt.
Das Gasthaus war nicht nur das einzige zweistöckige Gebäude der Stadt, es war auch der einzige Ort, an dem Auswärtige untergebracht wurden. Der vordere Teil des Untergeschosses, den die Schankstube und die Kochstelle ausmachten, war noch immer hell erleuchtet. Durch das Fenster konnte Marlis eine Anzahl von Gästen ausmachen, die in Gruppen zusammensaßen, sich unterhielten und dabei eifrig Bier und Wein konsumierten. Hin und wieder beugte sich ein einsamer Gast über einen dampfenden Teller. Meist waren das Witwer und Ledige, die sich auf diese Art selbst versorgen mussten. Zwischen den Anwesenden entdeckte sie auch die Männer von Anna und Elsa, die mit zwei anderen beim Kartenspiel beisammensaßen. Die beiden würden eine Überraschung erleben, wenn sie nach Hause kamen …
Ihr eigentliches Ziel konnte Marlis jedoch nicht ausmachen. Die Alte war also entweder in einer der Gästekammern im oberen Stockwerk, oder sie hatte die Stadt bereits verlassen. Marlis versuchte ihr Glück, indem sie die Treppe erklomm, die an der Außenwand des Gasthauses hinauf in den oberen Stock führte. Die Tür, welche die Treppe mit dem Korridor im Inneren verband, war abgeschlossen, doch der Riegel an der Innenseite war ihr nicht lange ein Hindernis.
Der Gang war nur schwach erleuchtet. In zu großen Abständen standen einige Kerzen, etwas Licht drang über eine zweite Treppe vom Schankraum herauf. Viele der Türen waren nicht geschlossen, was bedeutete, dass die Räume dahinter zurzeit nicht vermietet waren. Die Auswahl schränkte sich also auf drei Zimmer ein, zwei davon direkt vor ihr, die letzte fast am anderen Ende des Ganges. Kurz entschlossen öffnete sie die Türen der Reihe nach.
Der erste Raum beherbergte einen jungen Wanderer, der laut schnarchend auf seinem Bett lag und dessen Schuhe einen Geruch verströmten, der nicht an der Anstrengung seiner bisherigen Reise zweifeln ließ. Das zweite Zimmer fand Marlis leer vor, also wandte sie sich seufzend dem letzten zu.
Sie wollte gerade die Klinke niederdrücken, als sie hinter sich schlurfende Schritte vernahm. Rasch rückte sie von dem Lichtkreis der nächsten Kerze ab und verbarg sich in den Schatten. Es dauerte nicht lange, dann erblickte sie eine gebückt gehende Gestalt, die die Treppe hochkam und sich nun auf das gegenüberliegende Gangende zubewegte, weshalb sie Marlis den Rücken zugewandt hatte. Dennoch war es nicht schwer, der alten Frau einen Namen und ein Gesicht zuzuordnen.
Mit raschen Schritten folgte sie der Amme, die sich ob des Geräusches umwandte und vor Schreck die Augen weit aufriss. Der Schrei blieb ihr in der Kehle stecken, die Angst hatte sie ihrer Stimme beraubt. Welchen Anblick Marlis bot, als sie so den Korridor entlangstürmte, konnte sie sich selbst nicht genau vorstellen. Doch sie fühlte, wie ihr Zorn die Schlangen in Aufruhr versetzte. Die geisterhaften Tiere wanden sich, strebten dem neuen Opfer entgegen. Ohne ihren Lauf zu bremsen, packte Marlis die Alte an der Gurgel und rammte sie mit der gesamten Wucht ihres Ansturms gegen die nächste Wand. Die Amme hing strampelnd einige Fingerbreit über dem Boden und schnappte nach Luft.
Zu Marlis’ Überraschung begannen die Schlangen selbstständig, an ihrem Arm und ihrer Hand entlangzukriechen. Ohne ihr Zutun bohrten sie sich der alten Frau in die Haut. Die hätte wohl geschrien, hätte ihr die Hand an ihrer Kehle nicht die Luft abgedrückt. So jedoch gelang ihr nur ein heiseres Krächzen. Sie schien immer grauer und faltiger zu werden, ihre Augen und Zähne traten grotesk hervor. Es sah beinahe so aus, als würde sie in Sekunden um Hunderte Jahre altern. Die Schlangen saugten ihrem Opfer den Lebenssaft aus, bis die Amme buchstäblich nur noch aus Haut und Knochen bestand und weniger wog als eine Lumpenpuppe. Dann verschwanden die furchtbaren Tiere wieder in ihrem Wirt.
Marlis sah die vertrocknete Leiche verwundert an, ließ sie angewidert fallen und wischte sich die Hand an ihrer Kleidung ab. Zweifellos war dieser Tod grausam gewesen, aber er hatte ihr keinerlei Genugtuung gebracht. Nicht sie hatte ihn verursacht. Die Schlangen hatten dieses Opfer für sich beansprucht, und sie hatte nichts dagegen tun können.
Jetzt erkannte sie den Tribut, den sie für ihre neue Kraft bezahlen musste.
8
Noch während Marlis die Tote betrachtete, verspürte sie ein merkwürdiges Ziehen am ganzen Körper. Sie kümmerte sich nicht weiter darum. Stattdessen ging sie wieder zurück in Richtung des Seiteneingangs, durch den sie das Gasthaus betreten hatte. Nach ein paar Schritten verwandelte sich dieses Gefühl jedoch in unerträgliche Schmerzen. Es war, als würden die Schlangen in ihrer Haut versuchen, sie zu zerquetschen. Sie würgten Marlis, pressten ihr die Luft aus den Lungen und ließen ihre Knochen bedenklich knacken.
Marlis sank in sich zusammen. Auf dem Boden kauernd schlang sie die Arme um ihren Körper, als könnte sie dadurch die Qual lindern. Sie verkrampfte, das Bewusstsein drohte, sie zu verlassen, bis sie es schließlich nicht mehr aushielt, dem Druck nachgab und einfach losließ.
Von einem Augenblick auf den anderen fielen der Schmerz und die Atemnot von ihr ab. Die Schlangen liebkosten sie unter der Haut. Fast schien es, als wollten sie für das, was sie gerade getan hatten, um Verzeihung bitten.
Es war nicht notwendig, die Augen zu öffnen. Marlis wusste nur zu gut, wo sie sich befand. Der leicht modrige Geruch und das Laub, auf dem sie lag, waren eindeutig. Auch, wen sie vor sich finden würde, war ihr absolut klar.
»Du weißt doch, dass ich nicht gerne warte.«
Lurdok stand breitbeinig vor ihr, auf den Griff seiner Axt gelehnt, und blickte tadelnd auf sie herab. »Ich hoffe deine Verspätung bedeutet, dass du dich gut amüsiert hast.«
Mühsam erhob Marlis sich. Sie funkelte den Dämon wütend an. »Was willst du?«
»Mein Recht einfordern. Du erinnerst dich doch an unsere Vereinbarung?«
»Du hast mir verschwiegen, dass dein Geschenk gleichzeitig eine Fessel ist, die mich an dich bindet!«
Die Antwort war ein belustigter Blick, der ihr einen Schauer über den Rücken jagte. »Habe ich das? Ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass es in deinem Interesse sein würde, meinen Wünschen Folge zu leisten … Wie dem auch sei, ich habe dich nicht zum Vergnügen … hergebeten.« Bei dieser Formulierung musste er selbst schmunzeln. »Ich habe einen Auftrag für dich.«
Vor Marlis’ Augen erschien das Bild eines Mädchens, das nicht älter sein konnte als sieben Jahre. Sie sah das Kind auf einer Wiese sitzen und Blumenkränze flechten, die es dann stolz einer jungen Frau auf den Kopf setzte, vermutlich der Mutter.
»Das Kind. Es muss sterben, noch heute Nacht.«
Marlis sah ihn erschrocken an. »Was? Aber sie ist doch nur ein Kind! Das kannst du nicht von mir verlangen, ich töte keine Unschuldigen!«
In Lurdoks Züge trat wieder dieser selbstgefällige Ausdruck, den sie bereits zu hassen begann. »Und was ist mit denen, deren Leid und Tod du in den letzten Stunden auf dein Gewissen geladen hast?«
»Von Unschuld kann doch keine Rede sein, ihre Lügen haben mein Leben zerstört!«
Lurdok wog wissend den Kopf. »Das entspricht nicht ganz den Tatsachen.«
»Was soll das bedeuten?«
Marlis beobachtete misstrauisch den Nebel, der sich auf einen Wink Lurdoks zusammenballte und eine Gestalt formte. Sie keuchte erstaunt, als sie ihr Ebenbild erkannte, das ihr hämisch entgegenblickte. Es war, als würde sie durch ein Fenster blicken, zurück in eine Zeit, bevor ihre Welt zusammengebrochen war. Die Haut der Frauengestalt trug keine Linien, sie war unversehrt. Das blühende Leben. Doch in ihrem Blick lag etwas, das erst in den letzten Stunden in Marlis’ eigene Augen geraten war: Kälte und erbarmungsloser Spott.
Die Frau trat zu Lurdok, legte ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn leidenschaftlich, rieb ihren Körper lasziv an seinem. Die beiden grinsten Marlis schadenfroh zu, dann wandte die Kopie sich um und zerfiel wieder zu Nebel.
Marlis’ Hände ballten sich zu Fäusten. Was dieses kleine Schauspiel bedeuten sollte, war ihr durchaus bewusst. Und es hatte seine Wirkung nicht verfehlt. »Du warst es! Sie haben nicht mich gesehen, sondern dieses … Etwas! Es war dein Plan, von Anfang an!«
»Natürlich.« Noch immer lag dieser widerliche Ausdruck in seinen Augen. Offenbar weidete er sich an ihrer ohnmächtigen Wut. »Allerdings irrst du dich, was das Ausmaß meiner Bemühungen angeht. Es wäre eine Vergeudung meiner Zeit, mehrere Menschen zu manipulieren, wo doch dein kleiner Freund Clemens ausreicht. Menschen sind so erbärmlich in ihrer Berechenbarkeit.«
Clemens. Er hatte ihr nachspioniert und dabei gesehen, wie Lurdok sich mit dieser Illusion vergnügte. In ihrem Schlafzimmer. Ihr wurde übel vor Zorn.
»Aber wozu das alles? Der Prozess, die Folter, die Schlangen … Warum hast du mich ausgeschickt, um Rache zu nehmen? Und dieses Kind … Wenn es so wichtig ist, wieso erledigst du es nicht selbst? Wozu der ganze Aufwand?«
Lurdoks Lachen hallte von den Bäumen wider. Er wandte den Kopf zum Himmel, spreizte die Arme und Flügel und lachte, tief und laut. Dann brach er schlagartig ab und wandte sich wieder Marlis zu.
»Du hast es immer noch nicht verstanden, nicht wahr? Hass, meine Liebe. Das ist der Sinn hinter allem. Das ist, wovon wir leben. Oh ja, wir, denn du bist jetzt ebenso ein Monster wie ich auch. Dein Schmerz ließ deine Rache Ausmaße annehmen, die weite Kreise zieht. Du hast deine Opfer über ihren Tod hinaus gedemütigt, und das schürt den Hass ihrer Angehörigen. Du willst wissen, warum ich ausgerechnet dich wollte? Liebe kleine Marlis, die immer so stark wirken wollte und doch innerlich bei jedem harschen Wort eine neue Wunde davontrug. In dir war der Schmerz von Jahren angesammelt, er musste nur noch gebündelt werden. Und dir fehlt eine Fähigkeit, die alles hätte zunichtemachen können…«
9
Vergebung.
Das, worum sie von nun an jeden Tag bitten würde, und was sie selbst nicht geben konnte. Sie hatte nie verzeihen können. Auch nicht sich selbst.
Sie hatte das Schwert genommen, das er ihr hingehalten hatte, und hatte es in die Brust des kleinen Mädchens gerammt, ohne eine Sekunde zu zögern. Wie in Trance hatte sie die Waffe aus der Hand gleiten lassen und war gegangen. Die Familie würde trauern. Und dann mit Feuer und Heugabeln den Schuldigen suchen. Vielleicht würden sie ihn in irgendeinem Außenseiter finden.
Sie betrachtete ihre Hände, die heute Nacht so viele Leben genommen hatten. Sie war ein Assassine des Teufels geworden. Mehr noch – sie war selbst zu einem Ungeheuer geworden.
Langsam schritt sie durch das Zwielicht von Lurdoks Reich, das nun ihre neue Heimat war. Die Richtung war egal, und auch, wie weit sie gehen würde. Sie würde merken, wenn nach ihr verlangt wurde. Und sie würde dem Ruf Folge leisten.
***
Der Pakt war meine allererste eigene Kurzgeschichte. Das erste Mal seit der Schulzeit, dass ich mich auf meine vier Buchstaben gesetzt und eine komplette Geschichte erfunden hatte. Insofern ist es nur passend, dass sie nun den Auftakt zu dieser düsteren Kurzgeschichtensammlung bildet. Sie entstand damals unter dem tollen Arbeitstitel Sympathy for the Devil, der aber leider schon vergeben war (diese Stones, tse!).
Das Schreiben dieser Geschichte hat mich vieles gelehrt, vor allem aber eines: Arglose Mitmenschen reagieren äußerst seltsam, wenn man ohne vorhergehende Erklärung fragt: »Hey, ich suche eine ekelhafte Methode, um einen Menschen umzubringen. Hat jemand eine Idee?«
In diesem Sinne: Frohes Gruseln!
Bestie
Stickige Luft schlug ihr in einem heißen Schwall entgegen und trieb ihr den Gestank von Fäkalien in die Nase. Sie musste den Kopf schütteln, um den Brechreiz niederzukämpfen. Erst dann konnte sie den Eimer mit Essensabfällen wieder aufnehmen und die Kellertreppe betreten.
Vorsichtig bewegte sie sich die Stufen hinunter. Am Treppenabsatz blieb sie stehen. Sie zögerte. Den Absatz zu überwinden hieß, um die Ecke zu gehen und sich endgültig dem Keller auszusetzen, aus dem bereits ein leises Scharren und Keuchen drang.
Sie zwang sich weiterzugehen, bis das Gitter sichtbar wurde. Die Eisenstäbe, mit denen sie selbst den hinteren Teil des Kellers abgetrennt hatte, waren rostig und völlig verdreckt. Zwischen ihnen quoll das Stroh hervor, das den Boden des Käfigs bedeckte und dort schichtweise verrottete. Sie wagte schon lange nicht mehr, es zu wechseln, sondern schüttete nur jede Woche ein wenig frisches hinein. Das Ding erledigte den Rest.
Jetzt hatte es sich verkrochen, sodass sie es nicht richtig sehen konnte. Aber sie hörte das Knurren, das lauter wurde, je näher sie dem Gitter kam. So leise wie möglich bewegte sie sich auf den Käfig zu. Sie konnte es auf seinem Lager ausmachen: Ein krummer Rücken und ein struppiger Hinterkopf ragten aus dem Stroh, hie und da gaben die schmutzverkrusteten Haare einen Blick auf die unnatürlich blasse Haut preis. Aus dieser Nähe war der widerwärtige Geruch kaum zu ertragen.
Je schneller sie ihre Sache erledigte, umso besser.
Mühsam hob sie den schweren Eimer an, um den Inhalt durch das Gitter zu schütten, doch plötzlich sprang das Tier auf. Es stieß einen kehligen Laut aus, warf sich mit aller Kraft gegen die Metallstäbe. Erschrocken zuckte sie zurück. Seine wilden Augen verfolgten sie, funkelten sie mordlüstern an. Zwischen den gefletschten Zähnen troff der Geifer hervor. Der Anblick weckte einen Ekel in ihr, der so tief saß, dass er selbst die Furcht überwand.
»Bestie!«
Das Wort füllte sie aus, bestärkte sie und gab ihr die Kraft, ihre Wut zu finden.
»Widerliche Bestie!«
Sie schleuderte den Eimer gegen den Käfig. Er kippte, und der Inhalt ergoss sich über das Tier. Fleischstücke, Knochen und verfaultes Gemüse klebten ihm am Körper, tropften langsam herunter. Einmal noch knurrte das Tier, drohend und voller Hass. Dann ließ es vom Gitter ab. Mit überraschend flinken Bewegungen begann es, sich die Abfälle abzulecken und im Stroh nach mehr zu suchen.
Das laute Schmatzen, das dabei entstand, verstärkte ihren Brechreiz. Als ob der Gestank allein nicht genügt hätte. Schnell schlug sie die Hand vor den Mund und stürzte aus dem Keller.
Sie wusste sofort, was das Kratzen an der Tür bedeutete, doch ihr Körper weigerte sich, dem Fluchtreflex zu folgen. Sie konnte sich nicht bewegen, nicht einmal schreien. Voller Entsetzen beobachtete sie, wie die Tür sich öffnete, um dem Eindringling Zutritt zu gewähren.
Die blutroten Augen blitzten gierig, als das Monstrum ihr sein Wolfsgebiss präsentierte. Selbstbewusst kam es auf sie zu, langsam und lauernd, und weidete sich an ihrer Angst. Sie sah, wie es sich zum Sprung bereit machte. Es kauerte sich hin, spannte seine Beine an, die nicht mehr ausgezehrt, sondern kräftig waren. Nur ein Satz, dann war es bei ihr. Sie fühlte seinen heißen Raubtieratem an ihrem Hals, seine scharfen Klauen …
Nein. Es waren nur ihre eigenen Hände, die verkrampft über ihren Körper gefahren waren. Sie war allein. Und doch, versteckte sich da nicht etwas in den Schatten? Zog nicht etwas die Decke langsam unter das Bett?
Sie sprang auf, eilte zum Lichtschalter, löschte die Schatten aus.
Nichts war bei ihr im Zimmer. Natürlich.
Dennoch verschloss sie lieber Tür und Fenster, ehe sie sich wieder ins Bett begab.
Die ganze Nacht hatte sie keinen Schlaf mehr gefunden. Ständig quälte sie der Gedanke, dass das Tier ausbrechen könnte. Bisher war es eine unerwünschte Last gewesen, doch nun spürte sie zum ersten Mal, seit sie es eingesperrt hatte, wieder die Furcht. Es war gefährlich, eine Bedrohung!
Es hatte versucht, sie anzufallen. Sie hatte es unterschätzt, so wie sie es schon einmal getan hatte. Damals hatte sie es für wehrlos gehalten. Für ihre Nachlässigkeit hatte sie mit Blut gezahlt.
Noch einmal würde sie nicht so glimpflich davonkommen.
Sie hätte es sofort loswerden sollen, damals, nach dem ersten Biss. Jetzt war es viel zu wild, zu kräftig.
Wenn sie es schwächen würde, könnte sie ihr Versäumnis vielleicht nachholen. Doch wenn es bereits zu spät war und es freikam … Panik stieg in ihr auf. Sie wollte fliehen, es zurücklassen und einfach vergessen. Aber was, wenn es ausbrach? Es könnte gesehen werden, oder gar andere Menschen verletzen! Man würde herausfinden, dass sie es freigelassen hatte, dass es ihre Schuld war …
Nein. Sie musste dafür sorgen, dass es den Keller nicht verlassen konnte.
Entschlossen holte sie ihren Werkzeugkasten hervor und begann, den großen Eichentisch auseinanderzunehmen. Es dauerte eine Weile, bis sie die stabile Holzplatte losgeschraubt und zum Keller geschleppt hatte.
Dann öffnete sie die Tür. Nur kurz, um sicherzugehen. Einmal mehr tönte das Knurren herauf. Klang es näher? War es frei?
Schnell warf sie die Tür zurück ins Schloss und lehnte den Rücken dagegen. Sie zitterte. Die Erinnerung an ihren Albtraum war noch zu frisch, zu lebendig. Sie bekam keine Luft. Die Augen geschlossen, blieb sie an die Tür gelehnt stehen. Wartete, bis ihr Herz wieder normal schlug.
Mit einem Ächzen schob sie die Tischplatte quer über die Tür. Sie hämmerte die Platte mit so vielen Nägeln am Rahmen fest, dass zwischen den eisernen Köpfen kaum ein Zentimeter frei blieb.
Erst dann fühlte sie sich sicher.
Zwei Tage lang mied sie den Kellerabgang. Jedes Mal, wenn sie daran vorbeiging, hörte sie das Tier dort unten toben. Zuerst klang es aggressiv, dann panisch. Nach dem ersten Tag schlug es nur noch schwach und sporadisch gegen den Käfig, und schließlich gar nicht mehr.
Deshalb löste sie die Platte von der Tür. Aus dem Keller kam keine Reaktion. Vorsichtig lugte sie hinunter. Sie konnte die Eisenstäbe sehen, genauso unversehrt und verschlossen wie bei ihrer letzten Fütterung.
Natürlich. Wie hätte es auch ausbrechen sollen? Das Gitter war stabil, sie hatte es fest verankert. Ein wenig ärgerte sie sich über ihre eigene Angst. Ihren Esstisch hatte sie völlig umsonst demoliert.
Sie hatte das Ende der Treppe noch nicht erreicht, als sie es bereits im Stroh liegen sah. Zum ersten Mal konnte sie es in Ruhe betrachten. Dürr war es, und armselig anzusehen, von der Größe eines kleinen Schäferhundes. Es hatte nicht die Kraft, sich aufzurichten, doch in seinen Augen glühte ein Hass, der sie schaudern ließ. Vorsichtig schob sie eine Schüssel Wasser durch das Gitter und warf ein Stück Brot daneben. Sein Blick folgte jeder ihrer Bewegungen, aber es rührte sich keinen Millimeter.
Sie ließ es allein. Es würde schon fressen, wenn sie weg war.
Am nächsten Tag waren Wasser und Brot jedoch unberührt. Das Tier lag mit geschlossenen Augen da, sein Atem ging flach und unregelmäßig. So ruhig und erschöpft wirkte es fast menschlich – doch sie würde sich nicht täuschen lassen. Es wollte sie bloß in Sicherheit wiegen, damit sie unvorsichtig wurde und es über sie herfallen konnte! Aber darauf würde sie nicht hereinfallen.
Wütend nahm sie den Eimer mit neuem Futter wieder mit.
Es war tot.
Futter und Wasser hatte es verweigert, es hatte sich zu Tode gehungert.
Eigentlich sollte sie froh sein. Immerhin war sie nun endlich von der Plage befreit, die sie so viele Jahre lang gequält hatte. Nur verstand sie einfach nicht, wie dieses Ding genug Willen besitzen konnte, um sich gegen das Leben zu entscheiden.
Als es kalt und leblos auf dem Stroh gelegen hatte, hatte es so normal gewirkt. Fast wie ein gewöhnliches, schmutziges und etwas ausgemergeltes Kind.
Nein! Es war nicht normal, war es nie gewesen!
Es war nicht ihr Kind. Das war ihr genommen worden. Jemand hatte es durch ein Monstrum ersetzt, das Tag und Nacht nur schrie und sich nicht dem Dasein erfreuen konnte, das sie ihm geschenkt hatte. Sie hätte es gleich merken sollen, aber sie hatte die Augen vor der Wahrheit verschlossen. Erst als es ihr die nährende Brust blutig gebissen hatte, hatte sie die wahre Natur dieses Wechselbalgs erkannt: Kein Menschenkind war das, sondern ein Ungeheuer, eine Bestie!
Sie hatte es verstecken müssen, verschweigen, dass sie jemals ein Kind geboren hatte.
Nun war es endlich vorbei. Keine Geheimnisse mehr und keine Albträume.
Und doch …
Jetzt, wo sie es endlich losgeworden war, fühlte sie mit einem Mal eine drückende Einsamkeit. All die Jahre hatte ihre Furcht sie von den Menschen ferngehalten. Jetzt, wo die Bestie fort war, hatte sie niemanden mehr. Sie war endgültig allein.
Und was, wenn sie sich einen Ersatz besorgte? Natürlich nicht so böswillig, und auch kein eigenes mehr. Ein junges, das sie noch abrichten könnte.
Ein neues Haustier.
***
Einige Zeit lang war ich der finnischen Metalband Lordi sehr zugetan (bis heute sind das die einzigen Eurovision-Teilnehmer, die ich namentlich kenne). Rockige Musik mit dem Charme der alten Universal-Filme – perfekt für mich. Ihre skurrilen Monstertexte zu hören, meist nur unterschwellig während der Autofahrt, hat allerdings eindeutig Spuren hinterlassen. Da gibt es das wunderbar anspruchslose Lied Pet the Destroyer mit der immer wiederkehrenden Zeile: »Would you please feed the beast«.
Diese Idee hat mich ziemlich gefesselt. Was für eine Bestie muss das sein, die man füttert, obwohl man sie fürchtet? Warum wird man sie nicht einfach los? Und »to pet someone« bedeutet schließlich auch, jemanden zu streicheln, meist ist es als Verniedlichung gemeint. Ein Monster also, das man irgendwie trotzdem liebt …
Ruhelos
Tom Kristensen sah sich missmutig um. Naturkunde fand er bereits im Unterricht todlangweilig. Aber dass Professor Larsen dafür auch noch die gesamte Klasse ins Moor schleifte, um die Natur hautnah zu erleben, wie er es nannte … Was sollte es hier schon zu erleben geben? Natur … So ein Blödsinn!
Also stapfte Tom seiner Gruppe hinterher, ein wenig abseits vom Weg. Mit viel Glück fand er vielleicht eine Kröte oder etwas ähnlich Schleimiges, mit dem er den Mädchen einen Schreck einjagen konnte.
Sein Fuß stieß gegen ein knorriges, schwarzes Ding, das aus dem Moor ragte. Bloß eine Wurzel oder ein Ast. Aber irgendwie spannend sah es schon aus.
Kurz entschlossen packte er zu und versuchte, es aus dem Morast zu ziehen. Gar nicht so einfach, es steckte ziemlich fest. Tom zog kräftiger. Es knackte, dann gab das Ding mit einem Ruck plötzlich nach.
Tom taumelte einen Schritt zurück, hob seinen Fund auf Augenhöhe – und warf ihn mit einem spitzen Schrei von sich. Was er da zum Vorschein gebracht hatte, war keine Wurzel.
Es war eine knochige, menschliche Hand.
»Eine junge Frau, den Ergebnissen zufolge etwa zwanzig Jahre alt. Ein paar Kinder haben sie bei einem Schulausflug gefunden.«
Mit einer Taschenlampe leuchtete Dr. Sorensen der Toten in den leicht geöffneten Mund.
»Sehen Sie, Herr Jahn? Das Gebiss scheint noch einwandfrei intakt gewesen zu sein.«
Herr Jahn versuchte, an Dr. Sorensens Kopf vorbei einen Blick auf besagtes Gebiss zu werfen. Der Lichtstrahl der Lampe wanderte inzwischen weiter, die eingefallenen, rissigen Wangen hinab, über das strohige, durch das Moor rotstichig gewordene Haar. Schließlich verweilte das Licht auf dem dünnen Hanfseil, das den Hals umschlang. Der Anblick war Jahn sichtlich unangenehm.
»Ein Mord?«, fragte er.
»Aufgrund der Gegenstände, die ganz in der Nähe der Leiche aus dem Moor geborgen wurden, gehen wir eher von einem Menschenopfer aus. Nicht gerade üblich in der vorrömischen Eisenzeit, aber uns sind bereits ein paar Fälle bekannt.«
Sorensen ließ das Licht langsam weiter über den dürren Körper gleiten, erhellte die verwitterten Überreste der Bekleidung, die pergamentartige Haut, die mit einem Lederriemen gefesselten Fußgelenke. Anschließend lenkte er den Strahl wieder hinauf, streifte das kühle Metall des Rolltisches und fuhr fast zärtlich über den abgebrochenen Arm.
»Wie gut sie erhalten ist. Selbst die Fingernägel sind noch fast vollständig vorhanden.«
Er richtete die Lampe wieder auf das Gesicht der Moorleiche. Die Gesichtszüge waren gut erkennbar. Sie wirkten ruhig, als wäre sie friedlich eingeschlafen – und nicht erdrosselt worden.
Seufzend richtete Sorensen sich auf und rieb seinen schmerzenden Rücken. Er wandte sich seinem Assistenten zu und fragte: »Was haben die Untersuchungen des Mageninhalts ergeben?«
Voller Eifer zog Jahn einen Ausdruck hervor und begann vorzulesen: »Gerstenmehl, Kleie, Weizenkörner, Mistelpollen … Misteln? Sie wurde auch noch vergiftet?«
Sorensen nahm die Papiere an sich und studierte selbst die Zahlen darauf. »Nein. In diesen Mengen sind sie nicht tödlich. Vermutlich haben sie nur Krämpfe verursacht.«
Er ließ die Dokumente sinken und musterte erneut das Gesicht der Toten. Nachdenklich schüttelte er den Kopf. Schließlich legte er die Papiere beiseite und zog die Einweghandschuhe von seinen Fingern.
»Es ist schon spät. Machen wir Schluss für heute. Morgen bereiten wir sie auf die Konservierung vor. Der Direktor will die neuen Funde so bald wie möglich in die Ausstellung einbauen.«
Sorensen löste die Fußbremse des Tisches, packte mit festem Griff die hintere Kante und schob den Tisch durch die Tür, die Jahn für ihn aufhielt.
Mit einem leisen Klirren fiel ein Reagenzglas zu Boden und zerbrach. Der Inhalt ergoss sich über das Linoleum.
Es war Nacht. Im ganzen Gebäude herrschte eine staubige Stille, nur gelegentlich wurde sie vom Klicken der Klimaanlage unterbrochen. Die Straßenlaterne vor dem Fenster tauchte den Raum in ein stumpfes Zwielicht, das alles flach und unwirklich erscheinen ließ.
Leise durchschritt sie den Raum, vorbei an Schaukästen und Wachspuppen, denen sie keine Beachtung schenkte. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf einen großen Glaskasten in der Mitte des Raumes gerichtet, der etwa einen Meter aus dem Boden ragte. Sacht legte sie eine Hand auf das Glas, ohne einen Abdruck darauf zu hinterlassen. Traurig betrachtete sie den Inhalt des Glasblocks.
Der tote Körper war halb in einem hellbraunen, sandartigen Material eingebettet, der abgebrochene Arm an seinen Platz gelegt. Um den Leichnam herum waren die Gegenstände verteilt, die man aus dem Moor geborgen hatte. Keramikschalen, ein kurzes, verrostetes Schwert, das einst mit gravierten Runen verziert gewesen war, ein Trinkhorn, ein paar kleinere Schmuckstücke und Fibeln. In einer sonst leeren Ecke lag eine weiße Tafel, die Fundort und Verwendungszweck der Beigaben erklärte. Dazu kam ein Name: »Sara«.
Sie ließ sich diesen Namen einige Male durch den Kopf gehen. Er klang nicht vertraut. Doch was war schon ein Name? An ihren eigenen konnte sie sich schon lange nicht mehr erinnern. »Sara« war ebenso gut wie jeder andere.
Ihr Blick wanderte wieder über die Gegenstände, die dort so lieblos aufgereiht lagen. Ein leichtes Lächeln huschte über ihre Lippen bei der Erinnerung, die in ihr aufstieg. Wie stolz ihre Familie gewesen war, als ihr dieses Schwert überreicht wurde! Auserkoren war sie, den Segen der Götter für ihren Stamm zu erbitten, ihr eigenes Leben zu geben für das ihres Dorfes.
Sie hatte Angst gehabt, wer hätte das nicht? Es war jedoch nicht so schmerzhaft gewesen, wie sie befürchtet hatte. Eigentlich war der Strick sehr viel sanfter gewesen als das Kind, das sich seinen Weg aus ihrem Leib gekämpft hatte.
Wie hatte sie dieses Kind genannt? Die Worte waren ihr entfallen. Doch sie konnte sich an das warme Lächeln ihres Mannes erinnern, als er es zum ersten Mal auf den Arm nahm. Dieses winzige Wesen, das kennenzulernen ihr nicht mehr vergönnt gewesen war.
Sara blickte in das vertrocknete Gesicht, das ihrem nicht mehr ähnlich sah, und auf den Leib, den sie nicht mehr beseelte. Ihr graute bei dem Gedanken an die Untersuchungen, die Gewebeprobenentnahmen, die gaffenden Museumsbesucher. Sie fühlte sich entblößt, beschmutzt … und nutzlos.
Dies hier war kein Ort, an dem sie ihren Körper lassen durfte.
Wütend schlug sie auf das Glas ein, doch es splitterte nicht. Nicht einmal ein Geräusch verursachte sie.
Sara sah sich um. Es musste eine andere Möglichkeit geben.
»Und niemand hat etwas gemerkt?« Sorensen war fassungslos angesichts der Verwüstung, die ihn im Museum erwartet hatte. Das Chaos beschränkte sich auf einen einzigen Ausstellungsraum, diesen hatte es allerdings umso gründlicher heimgesucht.
Sitzbänke waren umgeworfen, Informationsblätter, die feinsäuberlich in den Ständern einsortiert gewesen waren, lagen überall am Boden verstreut. Dazwischen klebte eine Art bräunlicher Schlamm. Am seltsamsten waren jedoch die Schaukästen. Die Inhalte waren verrutscht, teilweise zerbrochen, manche waren mit den Fundstücken aus anderen Kästen vertauscht worden. Doch die Kästen selbst wiesen keinerlei Schäden auf. Die Schlösser waren noch intakt, keine Spur davon, dass sie gewaltsam geöffnet worden waren. Ebenso gab es keinen Hinweis darauf, wie der Täter überhaupt in das Museum gelangt war.
Sorensen trat auf den Glaskasten zu, der das Zentrum des Raumes und der neuen Ausstellung bildete. Das Innere sah aus, als hätte ein Orkan darin gewütet. Zum Glück schien die Leiche selbst nicht beschädigt zu sein. Während er nachdenklich die neue Anordnung der Artefakte betrachtete, fragte er den Sicherheitsbeamten: »Haben Sie sich schon das Band der Überwachungskamera angesehen?«
»Ja, allerdings bringt uns das Band nicht weiter. Die Kamera scheint defekt gewesen zu sein.«
Als Sorensen fragend aufblickte, fuhr der Mann fort: »Von 21:16 Uhr bis heute Morgen um 05:06 Uhr hat sie nur weißes Flimmern aufgezeichnet. Davor und danach lieferte sie klare Bilder.«
»Merkwürdig.« Dieser Fall von Vandalismus wurde immer rätselhafter. Er wandte sich wieder dem Glasobjekt zu. »Wie lässt sich dieser Kasten öffnen?«