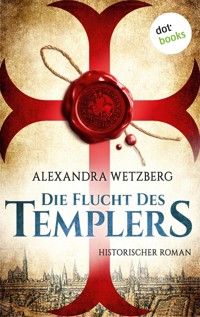
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal der letzten Tempelritter: Der historische Roman "Die Flucht des Templers" von Alexandra Wetzberg jetzt als eBook bei dotbooks. Das 14. Jahrhundert: Von Frankreich her dringen besorgniserregende Berichte zu den deutschen Templern: Ihre Brüder dort werden verfolgt und eingekerkert. Noch wähnt sich der Orden in Deutschland in Sicherheit – doch wie lange noch? In der Süpplingburg beginnt es zu brodeln: Die Auseinandersetzungen zwischen christlichen Rittern und weltlichen Herren, die hier dicht an dicht wohnen, spitzen sich immer weiter zu. Stefan von Losa, ein junger Templer, versucht zu vermitteln, doch die machtgierigen Herren kennen kein Einsehen. Stefan fürchtet um sich und seine Brüder – aber auch um Rena, die hübsche junge Frau, für die er mehr empfindet, als sein darf. Als die Situation eskaliert, sieht er nur einen Weg: die Flucht in die ferne Feste Tempelhof … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Flucht des Templers" von Alexandra Wetzberg. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das 14. Jahrhundert: Von Frankreich her dringen besorgniserregende Berichte zu den deutschen Templern: Ihre Brüder dort werden verfolgt und eingekerkert. Noch wähnt sich der Orden in Deutschland in Sicherheit – doch wie lange noch? In der Süpplingburg beginnt es zu brodeln: Die Auseinandersetzungen zwischen christlichen Rittern und weltlichen Herren, die hier dicht an dicht wohnen, spitzen sich immer weiter zu. Stefan von Losa, ein junger Templer, versucht zu vermitteln, doch die machtgierigen Herren kennen kein Einsehen. Stefan fürchtet um sich und seine Brüder – aber auch um Rena, die hübsche junge Frau, für die er mehr empfindet, als sein darf. Als die Situation eskaliert, sieht er nur einen Weg: die Flucht in die ferne Feste Tempelhof …
Über die Autorin:
Alexandra Wetzberg wurde 1950 in Braunschweig geboren. Nach dem Studium der Germanistik und Historik widmete sie sich der Erforschung der Geschichte ihrer Heimat. Besonderes Interesse weckte dabei der Templerorden, der dem Berliner Stadtteil Tempelhof seinen Namen gab. Diesem hat sie nun ihre ersten drei historischen Romane gewidmet.
Alexandra Wetzberg veröffentlichte bei dotbooks auch die Märchensammlung »Die Frau, die mit der Sonne tanzte«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2018
Dieses Buch erschien bereits 2012 unter dem Titel »Der letzte Ritter vom Tempelhof: Das Mordkomplott« und dem Pseudonym Mattias Gerwald im Sutton Verlag
Copyright © der Originalausgabe 2012 Sutton Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Andrey_Kuzmin, Lukasz Szwai, Oakview Studios
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ml)
ISBN 978-3-96148-029-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »>Der letzte Ritter vom Tempelhof« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra Wetzberg
Die Flucht des Templers
Historischer Roman
dotbooks.
Der ganze Saal schwamm von dampfenden Blut wie ein Teich im herbstlichen Morgen.
Aus der Chronik von Burg Schlanstedt
I. Buch
I. Anfang Juli 1311 Tage des kostbaren Blutes
Es war die Zeit zu Fronleichnam. Da Stefan von Losa dieses Hochfest nicht in seiner Kommende Süpplingburg feiern konnte, hielt er an diesem heißen Nachmittag seine eigene kleine Feier zu Ehren des Leibes und des vergossenen Blutes Jesu am Kreuz ab. Eine schlichte Feldsteinkirche mit einem löchrigen Strohdach, die vor einem namenlosen Dorf an einem Waldstück lag, genügte ihm für sein Ritual. Er legte sich bäuchlings auf den kalten, schmutzigen Lehmboden und breitete die Arme aus. Stefan versank ins Gebet. Von draußen hörte er Vogelstimmen, in seinem Inneren hörte er die Stimme seines Herrn, der ihn mahnte, seine begangenen Sünden inbrünstiger zu büßen und gottesfürchtig zu leben.
Stefan befragte sich ständig darüber, ob sein Tun gottgefällig sei. Und er lauschte so lange, bis er eine Antwort erhielt. Sie fiel nicht immer günstig aus.
Er hob den Kopf und blickte zum schlichten, hölzernen Altar auf, der mit nichts anderem als Feldblumen geschmückt war. Stefan bat den Schmerzensmann am Kruzifix darum, gegen seine Gefährten in der Komturei Milde walten zu lassen. Schicke die Prüfungen zu mir, bat er. Ich bin auf sie vorbereitet.
Stefan beendete nach angemessener Zeit sein Gebet, schlug das Kreuz und erhob sich wieder. Er klopfte seine Kleidung ab, trat hinaus und band sein Pferd los. Die Sonne warf schon lange Schatten. Stefan stieg in den Sattel und ritt ihr nach Westen entgegen, badete im Licht.
Nach einer Weile traf der Weg auf den Fluss Schunter und bog nach Norden ab. Am jenseitigen Ufer erhob sich in diesem Moment ein Schwarm Kraniche. Stefan seufzte bei ihrem Anblick unwillkürlich auf Wie oft hatte er sich als kleiner Junge gewünscht, auf dem Rücken der majestätischen Sonnenvögel bis nach Jerusalem, ins Heilige Land, fliegen zu können. Wenig später war er tatsächlich dorthin gelangt, wenn auch auf dem Seeweg, im Bauch einer klobigen, tief liegenden Hulk, und er musste als blutjunger Knappe der Tempelritter im Jahre des Herrn 1291 den Fall der letzten christlichen Bastion Akkon in Blut und Tränen erleben.
In Gedanken versunken ritt er weiter. Bilder der Schlachtfelder im Kampf gegen die Ungläubigen tauchten vor seinem inneren Auge auf und wichen anderen. Er hatte seinen Teil Mut und Siegeswillen dazugetan. Und er hatte schon als junger Mann getötet.
Der Fluss rauschte, das Sonnenlicht warf seinen Goldregen hinein, äsendes Wild ließ sich von dem Reiter nicht stören. Nach einem weiteren Stücks Weg wurde Stefan aus seinen Erinnerungen gerissen. Mit jedem Schritt begann sich ein süßlicher Geruch in der heißen Luft bemerkbarer zu machen. Stefan nahm einen Schwarm pechschwarzer Kolkraben wahr, die sich auf etwas niederließen. Als er sich vorsichtig näherte, sah er, dass die Vögel auf schweren Wagenrädern hockten, die auf einer Stange in den Ackerboden gerammt waren. Und auf einem der sechssprossigen Räder befanden sich die Überreste eines Hingerichteten.
Rädern war die Strafe für Unbotmäßige. Was mochte der Unglückselige verbrochen haben? Und hatte hier der Graf von Regenstein sein bekannt strenges Gericht gehalten, das er sich anmaßte? Stefans Pferd tänzelte unruhig und warf den Kopf hin und her. Stefan musste es mit leisen Worten beruhigen. Er wusste, dass in diesen Tagen schon ein vager Verdacht genügte, um gerichtet zu werden. Jedes Anschwärzen eines neidischen oder missgünstigen Nachbarn, der ein Auge auf das Hab und Gut oder die Tochter des Besitzers geworfen hatte, konnte ganze Familien in einen Abgrund von Verhaftung, Folter und Tod reißen. Andrerseits blieb die Willkür der Regionalfürsten meist ungesühnt, weil die Krone mit großer Politik beschäftigt war.
Und die Kirchenherren? Stefans Reittier schnaubte, und der Reiter befand, dies sei genau der richtige Kommentar zu dieser Frage. Die Kirchenherren bemühten sich, mit den weltlichen Regionalfürsten Schritt zu halten.
So stand es um Niederdeutschland. Ob es in Oberdeutschland anders war, entzog sich Stefans Kenntnis. Sein Versuch, durch seine Reise den mächtigen Erzbischof von Magdeburg dazu zu bewegen, seine Fürsorge für die Menschen zu verstärken, die unter seiner Obhut lebten, war gescheitert. Stefan hatte es sich schon längst eingestanden, es war ein anmaßendes Unternehmen gewesen. Als er Magdeburg verließ, um nach Süpplingburg zurückzureiten, wusste er auch, dass er Erzbischof Burchard verärgert hatte. Der eitle Kirchenmann wollte sich nicht belehren lassen. Schon gar nicht von einem jungen Templer, der aus niederem Adel stammte. Was erlaubte sich dieser freche Krieger! Mochte er im Heiligen Land nach dem Fall von Akkon noch so viele Schlachten im sträflichen Alleingang geschlagen und noch so viele Wunden davongetragen haben!
Stefan senkte den Kopf. In seinem Inneren entstand unwillkürlich die Epistel des Berichtes der Johannesoffenbarung über den Kampf Michaels und seiner Engel mit dem Drachen. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Der Satz löste ein Bild in seinem Inneren aus. Er sah Satan.
Dann verlöschte das Bild wieder, Stefan schüttelte es ab. Er gab seinem Falben die Fersen, angewidert von dem Schauspiel, das sich ihm an dieser Hinrichtungsstätte bot.
Jetzt hatte er die untergehende Sonne zur Linken. Er passierte die kleine Stadt Helmstedt in gebührendem Abstand, und als er auf einem der Hügel des Gebirges Elm seinen Blick schweifen ließ, sah er das Dorf Süpplingenburg und dahinter die hochfahrende Burg, die alles in der heimischen Kommende, natürlich auch Wohnturm und Kapelle der Komturei, überragte, und weit im Tal die Türme der prachtvollen Kleinstadt Königslutter mit dem Dom. Stefan freute sich, dass er die Kommende noch in der letzten Helligkeit dieses Sommerabends erreichen konnte. Sie war ihm zur Heimat geworden. Seine Tempelbrüder erwarteten ihn dort.
Der junge Templer erblickte plötzlich zur Linken auf dem Fluss, auf dessen Treidelpfad er jetzt ritt, eine Prozession. Geistliche führten auf einem flachen Boot, in seine Richtung fahrend, die Monstranz mit sich, sie nahmen auf diesem Weg die Segnungen vor. Stefan hätte ihren geistlichen Zuspruch gebrauchen können, denn seine Sorgen waren seit Magdeburg nicht geringer geworden. Aber das tief liegende Boot mit vier Ruderern überholte ihn auf der schnellen Strömung des Flusses, ohne dass einer der Priester auch nur in seine Richtung gesehen hätte. Vielleicht lag es daran, dass Stefan von Losa nicht im weißen Habit seines Ordens, mit dem blutroten Tatzenkreuz auf beiden Schultern, Brust und Rücken, ritt, sondern in schlichter, brauner Pilgerkleidung.
Stefan zügelte sein Reittier und blickte der Schiffsprozession hinterher. Der Falbe schnaubte ungeduldig. In der Komturei würde Stefan von Losa noch einmal in der schön ausgemalten Kapelle beten. Sein treuer Beichtvater Peter war dann sicher an seiner Seite. Vielleicht auch die übrigen zwölf Brüder und der Komtur des Templerhauses, Herzog Otto von Braunschweig.
Stefan passierte den Grenzpfahl, der den Besitz der Tempelherren markierte. Der gusseiserne Pfahl war von Farnen bewuchert, aber das Templerkreuz auf seiner quadratischen Oberseite war für jedermann zu erkennen und streng zu beachten. Hier begann die Kommende des geistlichen Ordens Süpplingburg.
Stefan überquerte eine schmale Holzbrücke über den Fluss, der sich hier in viele kleine Arme teilte. Von der Prozession war nichts mehr zu sehen, sie war weitergezogen und in Richtung Braunschweig entschwunden. Fischerhütten säumten das westliche Ufer der Schunter. In einer besonders hübsch von wildem Wein überzogenen Kate lebte Rena. Stefan hätte sie gern begrüßt und wollte sein Pferd schon in Richtung der Kate lenken. Aber er ermahnte sich. Er musste Rena in Ruhe lassen. Die schöne junge Frau hatte gewiss anderes zu tun, als sich ihm zu widmen, sie musste sich nach dem frühen Tod der Mutter um den kranken Vater kümmern, der seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte.
Überall am Ufer waren die Reusen der Fischer zum Trocknen aufgespannt. Boote lagen auf dem flachen Ufer, die Kiele fest in den Boden gedrückt. Reiher flatterten auf, sie verschwanden schnell vor dem nun rasch dunkler werdenden Abendhimmel.
Stefan von Losa spürte seine Müdigkeit. Obwohl das Tal an der Schunter kühl und schattig war, flimmerte überall die Hitze. Als er die Tore der ummauerten und von Wasser umflossenen Kommende erreichte, wurden auf dem Hof des Ordenshauses gerade die Pechfackeln entzündet. In den Fensterhöhlen und auf den Zinnen der Süpplingburg brannten die Feuer schon.
Stefans Blick schweifte über den hoch aufragenden, mit Efeu bewachsenen Bau aus fugenlosen Steinquadern, der alles überragte. Auf dem Bergfried der Wasserburg flatterte das Wappen des Herrn von Regenstein mit Schwert, Burgzinnen und verschlossenem Tor in der aufkommenden Abendbrise, die für die Nacht Kühlung erwarten ließ. Der Graf war also von seiner Stammburg Regenstein bei Blankenburg oder aus Schlanstedt herübergekommen. Wahrscheinlich, um ein weiteres seiner Feste zu feiern.
Stefan hatte erlebt, wie mächtig die Süpplingburg war. Mächtiger als Burg Schlanstedt allemal. Und deshalb versuchte Graf Heinrich, hier immer mehr Einfluss zu gewinnen. Seit Stefan vor einem Jahr in die Kommende gezogen war, um seine Verletzungen zu pflegen und gleichzeitig seinem Orden als Fiskal zu dienen, war kaum ein Tag vergangen, an dem nicht Gesandte aus aller Herren Regionen die Süpplingburg aufgesucht hatten. Sie lag an der Salzstraße und darüber hinaus an einer der wichtigsten Verbindungswege durch die deutschen Lande, der vom Rhein über Königslutter an die Elbe, von dort nach Magdeburg, den Sitz des Erzbischofs, und nach Brandenburg verlief. Durchziehende Heere, Prozessionen, Pilgerströme, Reliquienhändler und reisende Kaufleute mit ihren Geleitsleuten hatten die Burg reich und mächtig gemacht. Stefan hielt es dennoch für richtig, dass die Tempelritter die Süpplingburg auf ihrem angestammten Boden verpachtet hatten. Sie fanden einfach nicht genügend Arbeitskräfte, um Verwaltung und Führung der Burg zu gewährleisten. So waren sie in die kleinere Vorburg mit ihrem Wirtschaftshof umgezogen.
Die Nachbarschaft zu den weltlichen Herren verlief nicht reibungslos. Der Fiskal Stefan verabscheute die großen Ausgaben für die ständigen Feste, die Graf Heinrich von Regenstein von seinen Burgmannen abhalten ließ. Und er verachtete die Prunksucht der aufgestiegenen Hauptleute, die neuerdings sogar Schmuck trugen. Oft genug hatte er gedacht, dass Graf von Regenstein doch auf seiner Stammburg Schlanstedt sein herzogliches Regiment führen sollte, ein Regiment, das aus gnadenloser Machtausübung, gierigem Reichtum und gottesfürchtigen Gesten bestand. In der Komturei sollten andere, wahrhaftige Ideale gelten.
Aber die Templer hatten dem Grafen die Burg freiwillig verpachtet, also hatten sie keinen Einfluss auf sein Tun. Und das rächte sich jetzt.
Zur Süpplingburg gehörte ein Hospital, das die Johanniter führten. Es war weithin berühmt, denn die Ordensleute hielten ihr strenges Gebot, sich dem Kranken mit Sorgfalt und Geduld zu widmen und jedes Mittel zur Heilung bereitzustellen. Deshalb war Stefan vor zwölf Monaten hierhergekommen. Er hatte sich in die Obhut der Hospitaliter begeben, weil er die Ordensleute aus dem Heiligen Land kannte, das nun verloren war. Nach all den Grausamkeiten auf beiden Seiten wohl für alle Zeit.
Stefan ließ die Wasserburg zur Linken und lenkte seinen Falben über die Zugbrücke zur inneren Komturei im nördlichen Bereich, der von einer niederen Umfassungsmauer eingehegt war. Im gepflasterten Innenhof hallten die Geräusche der Hufe. Dennoch begleiteten Stefan die lauten Stimmen aus dem Palas der Burg, dessen spitzbogige Fensteröffnungen in der heißen Jahreszeit nicht verhängt waren. Er lenkte das Pferd zum Stall, der Stallbursche lief herbei und führte es fort. Stefan ermahnte ihn, das Tier sorgsam abzureiben und nicht übermäßig zu füttern. Er wollte später am Abend noch einmal nach ihm sehen.
»Wo sind die Tempelbrüder?«, fragte er den Stalljungen.
»In der Kapelle, Herr. Es ist noch die Stunde des Komplet.«
»Weilt Komtur Otto in unseren Mauern?«
»Ja, Herr, er hält den Gottesdienst mit den anderen.«
Stefan ging mit schwerem Schritt zum Wohnhaus der Komturei und stieg hinauf. Im ersten Stockwerk lag sein geräumiges Zimmer, dessen Fußboden jedoch nur aus lose verlegten Holzplanken bestand. Er legte die braune Pilgerkutte ab, löste den Gürtel mit dem Kurzschwert und zog den Panzersteckdolch aus dem rechten Stiefelschaft, mit dem er unterwegs Fische erlegt und am offenen Feuer gebraten hatte.
Ermattet warf er sich auf sein Strohlager.
Noch immer waren die erregten Stimmen aus dem Palas der Burg zu hören. Stefan erhob sich wieder und trat an die Fensterluke. Er blickte hinüber. Drüben glaubte er im Schein der Kerzen und Kienspanfackeln eine Gesellschaft in den bunten Farben unterschiedlicher Adelsstämme erkennen zu können. Der Graf von Regenstein hielt wohl mehr als eine seiner Audienzen ab, in denen es um die Verteilung von Pfründen und Lehen ging. Um seine Macht zu demonstrieren, tat er dies gewöhnlich in der bedeutenden Süpplingburg und nicht in Schlanstedt. Welches Fest ließ der mächtige Herr heute feiern? Mit dem gottesfürchtigen, einfachen Leben der Templer hatte er sich jedenfalls nie angefreundet. Und seine Burgmannen schon gar nicht.
Hinter sich hörte Stefan ein Geräusch. Als er sich umwandte, sah er Peter durch die niedrige Tür eintreten. Erfreut ging Stefan seinem Beichtvater entgegen. Die beiden ungleichen Männer umarmten sich herzlich. Peter war hager und ungewöhnlich groß, er besaß das Gesicht eines Raubvogels und gütige, warme Augen. Stefan musste seine kleinere aber ungleich kräftigere Gestalt recken, um Peter auf die Wangen zu küssen. Und dieser nahm den Kopf seines Schützlings mit der verschwitzten, blonden Mähne in die Hände und küsste seine Stirn.
»Wie gut, dass du wieder zurück bist, mein Sohn!«, sagte Peter mit seiner dunklen Stimme.
»Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Peter«, erwiderte Stefan.
»Wie geht es deinen Wunden?«
»Ich spürte sie während der Reise nicht. Aber hier in den heimischen Mauern merke ich, dass ich leidlich müde bin. Und jetzt schmerzen sie, vor allem die frischen. Aus einer ist auch wieder Blut ausgetreten. Kein Pfeil der Sarazenen richtet so viel Unheil an wie Morgenstern und Widerhaken eines sächsischen Söldners. Aber ich habe neue Verbände angelegt. Und das Wichtigste ist, ich bin wieder hier, und wir sind wieder zusammen!«
Der Kaplan schaute seinen Schützling aufmerksam an, ein mildes Lächeln umspielte seine Lippen. Er kannte Stefan seit seiner Geburt vor einunddreißig Jahren. Und deshalb kannte er auch seine Sünden. Aber er verzieh ihm alles. Vor allem weil er sah, welch guten Einfluss er selbst auf ihn hatte.
»Was hast du bei Erzbischof Burchard von Magdeburg erreicht?«, wollte er wissen.
Stefan zog Peter am Arm mit sich. Sie setzten sich an den Tisch. Stefan blickte bekümmert.
»Gar nichts«, bekannte er. »Es war naiv von mir, zu glauben, ich könnte Einfluss auf einen der mächtigsten Kirchenfürsten des Landes nehmen. Du hättest es versuchen sollen, Peter, nicht ich. Er hat sich für nicht zuständig erklärt.«
»So bleibt alles beim Alten? Die Ungerechtigkeit, die Bestechlichkeit, die Gewalt? Die Todsünden können in Niederdeutschland in aller Sorglosigkeit ausgelebt werden? Und niemand zügelt die weltliche Macht?«
»Nicht die weltliche und nicht die geistliche. Übrigens sah ich unweit der Kommende einen Hingerichteten. Was weißt du darüber?«
Peter kratzte sich die Hakennase. »Ein angeblicher Aufrührer, der den sich etablierenden Feudaladel anprangerte. Graf Heinrich richtete ihn öffentlich, und alle Einwohner des Ortes mussten das hässliche Schauspiel verfolgen. Damit lenkt er von seinen eigenen Sünden ab.«
»Auch wir Templer prangern mit unseren Idealen den Feudaladel an. Aber an uns traut man sich nicht heran.«
Peter sah bekümmert aus. »Es war ein Fehler, den Gerichtsbann und das Zehntrecht, die Herzog Albrecht von Braunschweig unserer Komturei vor zehn Jahren verkaufte, an den Graf von Regenstein zu verleihen. Daran trägst du keine Schuld, Stefan. Es war dein Vorgänger, Bruno von Gustedt, der in der Zeit darauf bestand, als die Komturei vakant war. Und Bruno ist nun die rechte Hand des Grafen.«
»Der Graf übt den Gerichtsbann willkürlich aus. Wir müssen ein für allemal klären lassen, ob Heinrich von Regenstein sich die Gerichtsbarkeit tatsächlich anmaßen darf, wenn er sie so drastisch auslegt!«
»Bedenke, es gibt den Vertrag. Wir haben uns das Patronatsrecht über die Burg aus der Hand nehmen lassen. Bis Papst Clemens uns seinen Entscheid sendet, falls wir ihn anrufen, kann ein ganzes Jahr vergehen.«
»Bis dahin sollten wir klarstellen, dass wir Templer die Herren in der Kommende Süpplingburg sind, und kein weltlicher Herr, kein Graf, kein Burgmann und kein gekaufter Hauptmann!«
»Das geht nicht auf friedlichem Weg. So gut kenne ich den Graf mittlerweile. Er ist ehrgeizig. Er will die ganze Kommende, nicht nur die Burg. Er sieht ja, wie reich man durch Zölle und Überfälle entlang der großen Straßen werden kann.«
»Wir sollten die Kommende verlassen, Peter. Ich liebe die Mitbrüder, und in unserer Komturei St. Mariae ist weiß Gott viel zu tun, aber die Burg wirft ein unseliges Licht auf uns alle. Man wirft uns mit dem Grafen und seinem Pack in einen Topf, ich habe in Magdeburg einen Vorgeschmack davon bekommen. Und der Pachtvertrag läuft noch elf Jahre.«
Peter DeCella nickte ernst. »Das hatte Herzog Heinrich der Löwe sicher nicht gewollt, als er nach seiner Rückkehr von den Schlachtfeldern des Heiligen Landes aus dem Kollegialstift seines Großvaters Lothar unsere Templer-Kommende gründete.«
»Gewiss nicht!«
»Ich habe gerade jetzt, in der Zeit deiner Abwesenheit, seine Aufzeichnungen gelesen, die er auf seiner Heilig-Land-Fahrt geschrieben hat. Er hatte hochfliegende Ideale.«
»Das ist lange her!«
»Ich weiß. Zu lange. In hundertneununddreißig Jahren ist zu viel geschehen. Zu viel Sünde und Gewalt sind aufgehäuft worden und folgenschwere Irrtümer daraus erwachsen.«
»Nun also, was meinst du? Gehen wir fort? Mich verbindet mit diesem Ort kein Heimatgefühl mehr. Stattdessen zerfrisst mich die Gegenwart dieses Adelspacks, das jede Nacht feiert anstatt zu arbeiten und zu beten und sich um die ihnen Anvertrauten zu kümmern.«
»Schließe deine Geschäfte ab, Stefan, bring die Finanzen unserer Kommende auf den gültigen Stand und dann schließ die Bücher. Wir finden einen Nachfolger für dich. Danach steht unserer Abreise nichts mehr im Wege.«
»Das dauert leider noch eine Weile«, seufzte Stefan. »Die letzten Schenkungen sind noch nicht registriert, ich weiß nicht einmal, wie es um die Güter in Hohenzüplingen steht, mit denen uns die Familie derer von Wenden jüngst bedacht hat. Ich müsste sie aufsuchen. Und ich habe vor, den Ansprüchen der Kreuzfahrer, die uns ihren Besitz anvertrauten, sorgfältigst nachzukommen. Erst dann kann ich die Bücher schließen. Dann sind wohl auch meine Wunden endlich verheilt.«
»Suche das Hospital der Johanniter auf«
»Das hat Zeit, ich mache es morgen.«
»Du musst es wissen. – Wie steht es um unseren Besitz?«
»Ich denke gut. Unsere Kommende ist reich genug, um das Hospital zu unterstützen und den Armen zu spenden. Anderen Kommenden geht es schlechter.«
»Es gehen furchtbare Gerüchte um.«
»Was meinst du, Peter?«
»Nun«, Peter DeCella erhob sich und ging umher. Seine hohe Gestalt wirkte noch gebeugter.
»Sprich doch!«
»Wie du weißt, sind bereits vor geraumer Zeit in Frankreich die Güter und Gelder der Armen Brüder Christi vom Tempel Salomonis eingezogen und viele Brüder eingekerkert worden. Wir haben es lange Zeit für böswilliges Gerede gehalten. Aber nun habe ich gehört, dass einige unserer Obersten Geständnisse abgelegt haben. Sie sollen unseren Heiland verleugnet, die Hostie entweiht und dunkle Praktiken ausgeübt haben. Selbst unser Großmeister Jakob de Molay soll zugegeben haben, auf das Kreuz gespukt zu haben. Der Orden als Ganzes ist in Gefahr.«
»Das ist undenkbar!«
»Und doch hält sich dieses Gerücht hartnäckig.«
»Wer hat die Macht, unseren Orden derart zu bedrohen? Papst Clemens steht doch hinter uns.«
»Ich weiß es nicht. Aber Brüder, die aus Frankreich kommen, behaupten, der französische König stecke dahinter.«
»Philipp der Schöne? Der jeden Morgen vor dem Spiegel posiert?«
Peter nickte grimmig. »Er soll dem Papst die angeblichen Geständnisse vorgelegt und ihn aufgefordert haben, ein Verbotsedikt gegen den Tempelorden zu unterschreiben.«
»Der Heilige Vater kann uns unmöglich fallen lassen. Er muss uns rehabilitieren! Er ist unser Beschützer!«
»Und wir dürfen nichts unternehmen, bis wir seinen Spruch dazu hören. Wir dürften uns nicht einmal verteidigen ohne seine Aufforderung.«
»Herrgott! – Aber nein, ich will das nicht glauben. Was kann man unserem Orden tatsächlich ankreiden?«
»Feinde finden immer etwas.«
»Wir müssen mehr darüber erfahren, Peter!«
»Die Lage ist unsicher. Nachrichten aus Frankreich brauchen derzeit besonders lange.«
»Vielleicht wusste der Erzbischof von Magdeburg mehr darüber und verhielt sich deshalb so hochmütig gegen mich. Seit er vor drei Jahren unseren Präzeptor Friedrich von Alvensleben und einige Mitbrüder gefangen genommen hat und gleich wieder freilassen musste, hegt er einen besonderen Groll gegen uns. Und sagt man nicht, er habe im letzten Jahr eine geheime Bulle des Papstes bekommen?«
»Wie auch immer es sei«, sagte Peter bekümmert. »Wir sollten auf der Hut sein. Wir müssen an Informationen kommen, die uns die Lage erklären.«
»Sollen wir jemanden von den Brüdern nach Paris schicken?«
»Das wäre möglich. Aber es dauert vermutlich zu lange.«
»Wir können uns an unseren Präzeptor wenden. Mit einem solchen Gerücht, das uns in unserer Existenz bedroht, können wir Templer nicht leben.«
»Lass uns abwarten, Stefan. Beim geringsten Anzeichen einer Gefahr handeln wir!«
»Wir können von hier fortgehen. Mit allen Brüdern.«
»Fliehen? Wovor?«
»Nein, nicht fliehen, dafür gibt es doch wohl keinen Grund, oder?«
»Sondern?«
»Dorthin gehen, wo man uns braucht. Wo man uns erwartet und unsere Ideale noch etwas zählen. Wo Aufgaben warten, die nur von uns gelöst werden können. Die Berechtigung unseres Ordens lag immer im Handeln.«
»Gewiss! Aber wohin? Ist es nicht überall so wie hier?«
»Nein«, erwiderte Stefan bestimmt. »Es gibt friedliche Länder, in denen ganz sicher kein französischer König Einfluss nimmt.«
»Das kann er auch in Niederdeutschland nicht.«
Auch Stefan hatte sich jetzt erregt erhoben. »Ich muss mit dem Komtur darüber reden.«
»Immer langsam. Wahrscheinlich ist alles nur ein Gerücht, ausgestreut von Unruhestiftern, das sich längst in Luft aufgelöst hat.«
»Ich gebe nichts auf Gerüchte, das weißt du, aber ...«
»Ich weiß, du bist ein Tatmensch, Stefan«, meinte Peter. »Du kannst nicht dasitzen und auf das Schicksal warten. Und das ist die richtige templerische Tugend!«
»Wenn es Vorwürfe gegen die Templer gibt, dann sollte man sie kennen und sich damit kämpferisch auseinandersetzen. Bist du nicht dieser Meinung?«
»Doch, natürlich ...«
»Ich brauche jedenfalls eine Komturei«, bekannte Stefan, »in der man nach den Regeln der Gemeinschaft unserer armen Brüder Christi lebt, ohne von der weltlichen Gier hoher Herren belästigt zu werden. Das ist durch nichts zu rechtfertigen.«
»Im Osten der Mark Brandenburg ist noch viel zu tun.«
»Dann lass uns dorthin ziehen!«
»Und Rena?«
»Rena ...« Stefan blickte versonnen. »Ich muss sie zurücklassen. Wir haben keine gemeinsame Zukunft.«
»Es wird ihr das Herz brechen.«
»Mir auch, das glaube mir! Aber der Herr hat nun mal unsere Wege vorgezeichnet. Ich habe ein Gelübde geleistet, du weißt es.«
»Wir werden sehen. Lass uns zu den Brüdern in die Kapelle gehen. Und danach ein gemeinsames Nachtmahl einnehmen. Was meinst du?«
»Eine wunderbare Idee! Vor lauter Trübsinn vergisst man das Wichtigste.«
Die beiden Männer verließen den kargen Raum und den Wohnturm, um zur Basilika St. Johannes zu gehen, die am Rand der Komturei lag, umschlossen von einem Garten, einem hortus conclusus, in dem Frieden und Erbauung zu Hause waren.
Sie passierten die beiden flachen Häuser der reisigen Knechte und bewaffneten Donaten, die auf den Eintritt in den Orden vorbereitet wurden, und das Haus des Triftmeisters, der sie beaufsichtigte. Dort herrschte Ruhe. Die Komturei lag im abendlichen Frieden.
In ihrem Rücken war das Fest auf der Burg im vollen Gange.
***
Er war vom Aussatz befallen gewesen. Jahrelang hatte er sich hinter einer goldenen Maske verstecken müssen. Man hatte ihn gemieden, verachtet, bespuckt. Doch der Bittgang nach Emmerstedt hatte ihn geheilt. Seine Dankbarkeit hielt sich in Grenzen, aber immerhin hatte Gerhard von Molde dem Hospital von Süpplingburg eine hohe Spende gewährt. Seitdem hielt man ihn für einen Wohltäter.
An diesem Abend hatte er keinen Sinn für diese Episode seines Lebens. Er spürte seine Lust nach dem Mädchen. Er war unruhig. Das Fest des Grafen war ihm nichts ohne die Gegenwart Renas. Wie hätte er das Fest genießen können, wenn sie ihm willfährig gewesen wäre! Er hätte die Gesellschaft mitsamt den französischen Gesandten bestens unterhalten können, denn er sprach die Sprache der königlichen Abgesandten, und er hatte viel erlebt, das er zum Besten geben konnte. So manche schlüpfrige Geschichte und viele Geschichten von Heldenmut und glorreichen Gefechten. Er hatte eine vierjährige Gefangenschaft in Transjordanien überlebt. Gerhard von Molde blickte aber just in dem Moment aus einem der spitzbogigen Fenster, als Stefan von Losa auf seinem unscheinbaren Pferd in den Innenhof der Burg einritt. Das allein genügte, um Gerhards Ärger aufbrausen zu lassen.
Zur Hölle mit diesem Kerl! Er machte ihm den Platz streitig! Am liebsten hätte er einen Eimer flüssiges Pech auf den Ankömmling gelehrt.
Ritter Gerhard hörte Rufe. Jemand sprach auf dem Gang in herrischem Tonfall. Er musste sich widerstrebend vom Anblick des jungen Templers unten lösen. Gleich darauf trat Graf Heinrich von Regenstein in den mit Teppichen ausgelegten und mit Gobelins behängten Raum.
»Wo bleibst du, Gerhard! Die Gäste warten.«
»Ich komme.«
Der Eintretende, ein schöner Mann mit grauem Haar, der so gerade ging, als hätte er ein Schwert verschluckt, blickte seinen Kampfgefährten an. Er verdrängte die Betroffenheit angesichts des bleichen, von Narben zerfressenen Antlitzes, das umrahmt wurde von strähnigen, schwarzen Haaren. Graf Heinrich konnte sich nicht daran gewöhnen, wie dieser einst blühende, kraftvolle Kerl heruntergekommen war.
»Du solltest nicht allein sein, Gerhard. Es frisst dich auf!«
»Es stimmt, ich dachte an sie. Und dann sah ich gerade diesen blonden Templer einreiten, der sie haben kann und der sie mit einer Handbewegung verstößt. Ahh, das bringt mich um!«
Graf Heinrich legte seinem Burgmannen die Hand auf die Schulter.
»Gerhard, du musst an deine Stärke denken, nicht an deine Schwäche.«
»Ich weiß! Und doch ...«
»Erinnere dich deiner Heldentaten! Du hast Frauen genug gehabt in deinem Leben. Darunter hochgestellte, edle und schöne Damen, um die dich jeder deutsche Mann beneidet. Was willst du mit diesem Fischermädchen?«
»Ihr wisst, mein Graf, dass kein Mann seine Wollust beim Anblick dieses glänzenden, jungen Weibes zügeln kann! Ich kann es auch nicht. Ich bin der Hexe verfallen.«
»Nun, sie ist keine Hexe. Wäre sie es, müsste ich sie richten. Sie besitzt nur ein verführerisches Aussehen, das stimmt allerdings. Und ihre Stimme ist göttlich.«
»Teuflisch ist sie! Teuflisch! Man müsste sie ...«
»Gib acht, Gerhard, dass du nicht absinkst! Du hast im Heiligen Land Großes geleistet! Erinnere dich daran!«
»Jaja, Herr! Aber –«
»Du hast den Rittern die Anregung zu der Rüstung gegeben, mit der sie endlich den verfluchten Bogenschützen der Muslime standhalten konnten. Jedenfalls lange Zeit. Erinnere dich an die Bewunderung der Kreuzfahrer, die dich so hoch schätzten, dass sie dir eine Galeere schenkten! Du warst ihr Ritterkonstabler und wirst es immer sein. Die Rolle des schmachtenden Liebhabers steht dir nicht.«
»Ich kann nicht anders«, ächzte Gerhard. Seine Stirn war von Schweiß benetzt.
»Das Kettenhemd aus tausenden kleinen Eisenringen, geschmiedet an fränkischen Feuern«, versuchte es der Graf noch einmal, »der zylindrische Helm, die Halsplatten – und die Geburt der leichten Reiterei, die nach Türkenart kämpft. Das waren deine Geschenke!«
»Ich weiß es doch! Aber das Mädchen lebt nur wenige Minuten von hier, und die Kreuzfahrer sind in alle Winde verstreut oder tot. Ihnen halfen meine Erfindungen gegen die Wut der Ungläubigen nicht.«
»Lanze, Banner und Batailles! ...«
»Lasst es gut sein, Graf Heinrich, Herr! Ich danke Euch ehrerbietig für Euer Bemühen! Wir gehen zu Eurer Gastgesellschaft, obwohl mein Sinn nicht nach feiern steht, das glaubt mir.«
»Du wirst heute schon noch auf andere Gedanken kommen. Ich habe Hübschlerinnen aus Braunschweig kommen lassen. Darunter sind einige, nach denen sich die französischen Herren schon jetzt die Finger ablecken.«
»Die Finger?«, lachte Gerhard hart auf »Sie lecken doch ganz was anderes.«
»Gehen wir!«
Das Fest, wäre es nach seiner Lautstärke gegangen, befand sich schon auf einem frühen Höhepunkt.
Bei ihrem Eintreten wurde es für einen Moment still. Die beinahe einhundert Gäste starrten den Graf und seinen Ritter neugierig an. Graf Heinrich als Gastgeber, der seine kleine Burg Schlanstedt, den Sommersitz, nur wegen dieses Festes für sechs Tage verlassen hatte, begab sich wieder an die Stirnseite der langen Tafel. Gerhard von Molde saß neben ihm als Erster an ihrer Längsseite. Ihm gegenüber die Ritter Henricus von Schoven, Adrianus von Aderstede und Bruno von Gustedt, Freigeborene aus niederem Adel. Dann klatschte der Graf in die Hände. Die Türen gingen auf, ein Schwarm von Bediensteten trat in endloser Reihe ein. Und alle Gäste redeten wieder durcheinander.
»Monsieur!«, rief einer der Gesandten aus Paris in Gerhards Richtung. »Man sagt, Ihr seid der größte Draufgänger und Abenteurer im Heiligen Land gewesen. Stimmt das?«
Gerhard war stolz, aber kein Prahlhans. »Ich würde mich eher einen fahrenden Ritter nennen, Exzellenz.«
»In Jerusalem seid Ihr als Marschall des Königreichs aufgetreten, was berechtigte Euch dazu?«
»Ich wurde krank und kurierte dies bei den Templern aus, danach legte ich die drei Gelübde ab und trat in den Orden ein. Deshalb konnte ich mich nach meinen militärischen Erfolgen Marschall nennen.«
»Ach, Ihr seid Templer, Monsieur?«
Gerhard blickte den Fragenden scharf an. Er bemerkte wohl das Lauernde in dessen feisten Zügen.
»Und wenn?«
»Nun, die Mönchsritter interessieren uns besonders! Seid Ihr nun einer von ihnen oder nicht?«
»Wie kommt Ihr darauf, mein Herr? Nein, ich bin damals nach meiner Genesung schleunigst wieder ausgetreten, als ich die Schönheit der muslimischen Mädchen sah. Keuschheit, Gehorsam, Armut – das sind nicht meine Tugenden!«
Man lachte. Gerhard lachte nicht mit.
Er wusste, weshalb die französischen Gesandten auf der Süpplingburg waren. Es waren Spione des Königs Philipp. In ihrem Gefolge befand sich ein Inquisitor. Aber Deutschland war nicht Frankreich. Dort hatte man begonnen, die Templer zu verfolgen. In Deutschland konnte davon keine Rede sein. Der Templerorden war hierzulande als Ordnungsfaktor hoch angesehen, jeder Herrscher bediente sich seiner kampferprobten Ritter. Und das würde sich so schnell nicht ändern.
Es sei denn ...
Gerhard dachte den Gedanken nicht zu Ende. Im Augenblick war es ihm einerlei. Er verspürte keinen Hunger und sah der Armada von Bediensteten gelangweilt zu, die hochaufgetürmte Schaugerichte auf die Tafel stellten, die sich bald unter den Platten und Schalen bog. In ihm wütete etwas Stärkeres als ein einfacher Hunger, der durch Speise gestillt werden konnte, aber die aufgetragenen Leckereien auf dem silbernen Prunkgeschirr waren immerhin ein Anfang.
Die ringsum an den Wänden aufmarschierten Musikanten begannen auf Flöten, Zimbeln und Gamben zu spielen. Der gräfliche Mundschenk vollzog das Prozedere des Vorkostens, er berührte alle Speisen mit kleinen Stücken von Brot und verzehrte sie vorsichtig. Dann richtete er sich auf und rief:
»Lasst euch die Köstlichkeiten munden, Ihr Herren!«
»Her mit dem Wildbret, und spart nicht an dicker Soße!«, rief einer der Gesandten.
Roter Wein aus Zypern, nur leicht verdünnt mit Wasser, floss in große Becher. Die Bediensteten reichten Wasserschalen, in denen sich die Tischgesellschaft die Hände reinigte, und Handtücher. Als der Graf seinen Becher hob, mischte sich erneut der Mundschenk ein.
»Halt, Graf Heinrich«, rief er. »Das geht nun wirklich zu schnell. Verzeiht, mein Herr und Gebieter! Aber lieber will ich sterben, als Euch einer Gefahr auszusetzen. Wir sind hier nicht auf Burg Regenstein oder Schlanstedt, sondern durchaus auf fremdem Gebiet. Ohne eine Giftprobe dürft Ihr den Wein nicht trinken!«
»Gut, macht die Probe«, sagte Graf Heinrich milde. Was nehmen wir? Den Bezoar? Natternzungen? Krötensteine, Serpentin, das Einhorn?«
»Ich ziehe den schwarzen Haifischzahn aus Gestein vor, Graf«, sagte der Mundschenk unterwürfig. »Darf ich?«
»Ihr Exzellenzen!«, rief Graf Heinrich in die Runde. »Esst, so viel Ihr vermögt. Aber verzeiht, wenn Ihr noch einen Augenblick lang durstig bleiben müsst! Seht, ich esse und trinke nie, bevor meine Mundschenke und Vorkoster nicht die Giftprobe gemacht haben. Erst wenn mein Truchsess mein Tranchierbesteck küsst, fange ich an. Und was der wackere Mundschenk vorschlägt, das habt Ihr ja gehört. Wisst Ihr, auf Burg Schlanstedt, woher ich gerade komme, wird mein Geschirr auf dem Weg von der Küche zur Tafel mit Tüchern gebunden, auf Reisen sogar in eine eigens dafür angefertigte Truhe gesperrt. Meine Utensilien, Tischtücher, Servietten, Gewürzfässchen und mein Essgerät schützt Tag und Nach mein vertrauenswürdigster Hofbeamter.«
»Schon recht, Herr«, sagte einer seiner Nachbarn. »Man darf nie leichtsinnig sein.«
Man schüttete Wein in eine silberne, henkellose Schale.
»Das dauert nicht allzu lange«, wusste einer der Gäste, der zu seinem Leidwesen neben einer Dame saß, die so gar nicht dem Schönheitsideal der blond gelockten, weißhäutigen, zierlichen Frau entsprach. »Ich mache es immer mit einer Probe aus Bergkristall an einer silbernen Kette. Die Giftprobe hat mehr Menschen gerettet als alle ärztlichen Künste zusammengenommen.«
Ein Diener hatte inzwischen ein silberbeschlagenes Tafelschiff, das Nef, gebracht, an dem schwarze Haifischzähne wie an einem Baum hingen. Er nahm einen mit einer gezackten Silberfassung herunter und hängte ihn an seinem Ring in die tiefe Schale.
Die Gäste in der Nähe vergaßen ihre Speise und beugten sich gespannt vor.
Der redselige Mundschenk erklärte: »Es ist seit der Antike unser bester Giftschutz, und Ihr wisst sicherlich vom Schlangenwunder, das der Heilige Petrus auf Malta wirkte. Wir Christenmenschen vertrauen seiner Kraft.«
»Wenn der Zahn sich verfärbt, wird jemand es ausbaden müssen«, rief eine der Hübschlerinnen, die an einem separaten Tisch auf das Ende des Mahls warteten. Ihre Brüste lagen bis zu den rot angemalten Brustwarzen frei.
»Nicht so keck, Mädchen!«, ermahnte sie der Graf »Also, was ist nun mit der Giftprobe?«
Der Mundschenk zog den Haifischzahn aus dem Wein. Er hatte sich nicht verfärbt.
»Esst und trinkt, Ihr Gäste auf der Süpplingburg!«, rief Graf Heinrich von Regenstein. »Es ist von allem im Überfluss da!«
»Ist es richtig, Gerhard von Molde«, wandte sich ein neugieriger Frager an den Ritter, »dass Euch die Hand der reichsten Erbin des Vorderen Orients versprochen war und dass diese stattdessen der unermesslich reiche Herzog von Tripolis bekommen hat?«
Gerhard sah den Sprecher, einen rothaarigen Ritter aus dem Norden Niederdeutschlands, an. Er spürte, wie Zorn in ihm aufstieg. Wollte man ihn zum Gespött machen?
»Guten Appetit, mein Ritter«, sagte er nur. »Und vergesst nicht, gut zu schlucken. Es verdaut sich besser.«
»Was!? ...«
Der Angesprochene ahnte die beißende Ironie des Ritters, wurde wütend. Er musste von seinen Nachbarn an den Armen festgehalten werden, als er aufspringen wollte. Jemand lachte ungeniert, dann begann die Musik, verstärkt um Trompeten und Trommeln, lauter zu werden.
Ich muss sie haben, dachte Gerhard von Molde. Noch in dieser Nacht werde ich sie mir zu Willen machen. Ich bin Kreuzritter, ich war für kurze und berauschende Zeit sogar der Seneschall des Heiligen Landes, mein Besitz reicht heute von Wolfenbüttel bis Schöppenstedt. Und auch östlich von Schöningen gehört mir ein Zehnt. Niemand widersetzt sich mir, ohne dauerhaft Schaden zu nehmen.
Es schmeckte ihm plötzlich nicht mehr. Er stieß den Zinnteller mit den in Rotwein gedünsteten Hirschzungen zurück. Er nippte am Wein, dann trank er den Pokal in einem Zug aus und winkte einem Lakaien, neu einzuschenken.
»Bleib hier, Kerl! Ich habe Durst!«
Ritter Gerhard trank auch den nächsten Becher ohne abzusetzen aus und ließ nachschenken.
***
Die Brüder bildeten einen Kreis. Im südlichen Querhausarm der dreischiffigen Basilika, dort wo sich die Kapelle der Templer befand, stand der Opferstein, darüber zeigten die niedrigen Gewölberippen das rote Krukenkreuz mit den vier zusammenlaufenden Patriarchalkreuzen. Der Schlussstein in Form von vier Blütenblättern hing dicht über dem hölzernen Altar. Der Komtur vollführte den Ritus sitzend vor dem Altar. Jeder der zwölf Tempelritter verharrte mit gesenktem Kopf
Stefan und Peter hatten sich eingereiht. Sie waren mit warmen Blicken und flüchtigem Lächeln von den Mönchsrittern, die alle aus dem Harzvorland stammten, empfangen worden. Stefan war bei ihnen beliebt wegen seiner oft überbordenden Fröhlichkeit, eine Seltenheit inmitten der meist in sorgenvollem Ernst verharrenden Ordensleute. Peter liebten sie wegen seiner unbedingten Prinzipien: Freundlichkeit und Gerechtigkeit, die er gegen jedermann hochhielt. Und Komtur Otto schätzte beide aus ganz persönlichen Gründen. Sie hatten die besten Einfälle zur Lenkung der Kommende und setzten sie in seinem Namen um, ohne dass er selbst sich anstrengen musste. Denn der Komtur liebte die Einsamkeit, die Bücher und den roten Wein.
Als der Gottesdienst beendet war, wollte der junge Clemens aus Emmerstedt wissen, was Stefan beim Erzbischof von Magdeburg erreicht hatte. Der Komtur ermahnte ihn. Die Kapelle war kein Ort für weltliche Diskussionen. Er beschloss den Ritus mit allen Texten und in aller Feierlichkeit. Dann befand er:
»Heute ist Sonntag. Wir haben mit dem wöchentlichen Konvent gewartet, bis unser Bruder Stefan aus Magdeburg zurück ist. Lasst ihn uns jetzt im Kapitelsaal halten.«
Die Templer verließen den geistlichen Raum hintereinander in einer Reihe und begaben sich in ihren Versammlungsraum, der auf der anderen Seite des Gartens lag. Die Mönchsritter setzten sich auf die kühlen umlaufenden Steinbänke und blickten Stefan neugierig an.
Komtur Otto erteilte dem jungen Fiskal das Wort. Er erzählte von seinem Ritt, von der prächtigen Stadt Magdeburg und vom Erzbischof, der sich Tag und Nacht mit Frauen umgab. Die Templer vernahmen das mit ungläubigem Erstaunen. Stefan berichtete dann von seiner erfolglosen Audienz.
»Erzbischof Burchard ist gleichzeitig Edler von Querfurt und Graf von Schraplau«, endete Stefan. »Er ist also mit weltlichen Dingen beschäftigt und war höchst ungeduldig gegen meine Bitten. Ich hörte, er habe kurz vor meinem Besuch die Salzfabrikation der Magdeburger in den Salzpfannen der Umgebung mit Abgaben belegt und bekämpfe die Stadtbürger von einer Feste aus, die er mitten in die Salinen gebaut hat. Er soll Bürger gefangen genommen und nur gegen hohes Lösegeld wieder in Freiheit gesetzt haben. Was ist von einem solchen geistlichen Herrscher, dessen Gier mit seiner Macht konkurriert und mit seinen geistlichen Aufgaben im Krieg liegt, zu erwarten!«
»Sicher nicht, dass er ein gerechter Hirte gegenüber seinen Schafen ist«, sagte Peter bekümmert.
»Wie geht es weiter?«, wollte Ullrich von Marbeck wissen, der unter den gleichrangigen Templern eine gewisse Führungsrolle einnahm.
»Das liegt in Gottes Hand«, warf Komtur Otto ein.
»Aber wir müssen unsere Möglichkeiten kennen, sonst werden wir aufgerieben zwischen weltlicher und kirchlicher Macht.«
Peter DeCella sagte: »Wir werden uns in der nächsten Zeit nur um das Gedeihen unserer Kommende kümmern. Es gibt genug zu tun in Süpplingburg. Die Menschen in den umliegenden Gemeinden erwarten von uns, dass wir ihnen beistehen und helfen. Aus der Reichspolitik werden wir uns heraushalten.«
»Das meinte ich«, nickte der Komtur.
»Überlassen wir dem Grafen von Regenstein und seinesgleichen die Händel und die Machtpolitik und die Todsünden«, bestätigte auch Stefan. »Ich kann das sagen, weil ich die Mittel kenne, mit denen wir unser eigenes bescheidenes Leben bestreiten können.«
»Was meinst du damit, Stefan?«, wollte der junge Adlige Clemens wissen.
»Ich meine die Verwaltung unseres Geldes«, erwiderte Stefan einfach.
»Sicher, du bist unser Fiskal«, meinte Clemens. »Aber ist das wohlgefällig, immer nur Geld zu zählen?«
»Nicht so frech, Clemens!«, rügte der Komtur.
Aber Stefan lächelte. »Es geht nicht darum, Geld zu zählen, mein Bruder. Aber viele Menschen überlassen uns nun mal vertrauensvoll ihre Reichtümer oder zumindest einen Teil davon. Und wir müssen sie nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Das ist sowohl legal als auch gottesfürchtig. Ich verrate dir, dass wir im Moment sechzig private Donationen führen, die Mitgliedern des Hochadels, Kirchenfürsten, auch Würdenträgern unseres Ordens gehörten.«
»Das ist viel!«, staunte der junge Templer.
»Gerade nach dem Ende der Kreuzzüge ist der Geldhandel wichtiger denn je. Es muss im Land eine unbestechliche Instanz geben, die den Reichtum verwaltet und ohne Eigennutz betreut.«
»Nun ja, wir nehmen Zinsen«, wandte Ullrich ein.
»Richtig, wir sind die einzigen Christen, die bisher jemals Geld gegen Zinsen verliehen haben«, räumte Stefan ein. »Aber unsere Zinsen sind erheblich niedriger als die der weltlichen Bankiers. Und wir haben Hypotheken nur gewährt, damit Pilger die Möglichkeit bekamen, ihre Bittfahrten ins Heilige Land zu bezahlen. Zugegeben, wir haben auch den Wechselbrief erfunden und Konten eingeführt für Fürsten und Edelleute. Das hat man uns vorgeworfen. Aber wir taten das alles nicht aus Eigennutz und persönlicher Gier, das sollte jedem hier klar sein.«
»Ich machte den Einwand auch nur, weil ich vor zwei Tagen unten im Dorf einen Fremden reden hörte«, erklärte Ullrich. »Er schimpfte auf uns, weil wir keine Steuern bezahlen und weil unsere Brüder im Land hohe Posten als Finanzberater bekleiden. Und weil wir angeblich in den Gewölben unserer Komtureien enorme Schätze von Adligen bewahren, darunter auch die Schatztruhen und Kronjuwelen der Landesfürsten. Der Mann behauptete, wir hätten Geldtransporte und Werttransporte begleitet, dafür Steuern eingezogen mit dem Segen der Kirche und den Zehnten kassiert.«
»Wer war dieser Mann?«, wollte Stefan erstaunt wissen.
»Ich weiß es nicht«, bekannte Ullrich. »Ein Fremder, der Unruhe stiften wollte. Er trug die Kleidung der Städter, allerdings keine niederdeutsche Tracht. Als ich ihn zur Rede stellte, ritt er davon.«





























