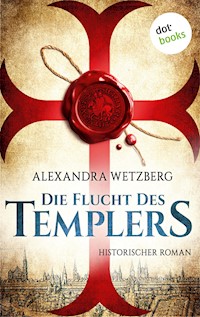3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Märchenhafte Unterhaltung für die Heldin in Ihnen! „Die Frau, die mit der Sonne tanzte“, zusammengestellt von Alexandra Wetzberg jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Amazonenstamm im Urwald, der Männer nur als Liebhaber duldet, eine Schönheit, die das wilde Biest zähmt, und ein Mädchen, das vor nichts Angst hat … Schön, stark, mutig und rebellisch – das sind die Heldinnen dieser 35 faszinierenden Märchen aus aller Welt. Ganz nach dem Motto „Selbst ist die Frau“ wartet hier niemand auf den Ritter in strahlender Rüstung – denn diese außergewöhnlichen Frauen beweisen, dass es sich lohnt, selbst für ihr Glück zu kämpfen! Lassen Sie sich inspirieren, verzaubern und berühren – und wecken Sie die Heldin in sich! Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Die Frau, die mit der Sonne tanzte“, zusammengestellt von Alexandra Wetzberg. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Amazonenstamm im Urwald, der Männer nur als Liebhaber duldet, eine Schönheit, die das wilde Biest zähmt, und ein Mädchen, das vor nichts Angst hat …
Schön, stark, mutig und rebellisch – das sind die Heldinnen dieser 35 faszinierenden Märchen aus aller Welt. Ganz nach dem Motto „Selbst ist die Frau“ wartet hier niemand auf den Ritter in strahlender Rüstung – denn diese außergewöhnlichen Frauen beweisen, dass es sich lohnt, selbst für ihr Glück zu kämpfen!
Lassen Sie sich inspirieren, verzaubern und berühren – und wecken Sie die Heldin in sich!
Über die Herausgeberin:
Alexandra Wetzberg wurde 1950 in Braunschweig geboren. Nach dem Studium der Germanistik und Historik widmete sie sich der Erforschung der Geschichte ihrer Heimat. Besonderes Interesse weckte dabei der Templerorden, der dem Berliner Stadtteil Tempelhof seinen Namen gab. Diesem hat sie ihre ersten drei historischen Romane gewidmet.
***
eBook-Neuausgabe November 2017
Dieses Buch erschien bereits 1983 unter dem Titel Die Schöne und das Tier bei Gustav Lübbe Verlag GmbH
Copyright © der Originalausgabe 1983 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Oleksandr Kolesnyk
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ml)
ISBN 978-3-96148-121-7
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Frau, die mit der Sonne tanzte an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Die Frau, die mit der Sonne tanzte
Erzählungen
Herausgegeben von Alexandra Wetzberg
dotbooks.
Vorwort
In den meisten Volksmärchen ist die Frau das Ziel des männlichen Helden, sie zu gewinnen, reizt ihn zur Tat. Still glänzt sie an seiner Seite; Schönheit und Reinheit, Treue, Opfermut, Selbstlosigkeit machen sie zu einem Ideal, das Mutter, Schwester, Geliebte und Gefährtin umfaßt. Märchen singen das Hohelied der Frauentreue, wie es schon im mittelhochdeutschen Gudrunlied des 13. Jahrhunderts anklang. Aus Treue zu einem Mann nimmt die Märchenfrau alle Prüfungen auf sich, erträgt Haß und Elend, läßt sich in Ketten legen. Erotische Wünsche sind ihr fremd; Märchen, in denen sich Frauen gegen eine über sie verhängte Heirat wehren, gibt es kaum. Selten nehmen ihre Bemühungen um persönliche Unabhängigkeit ein gutes Ende.
Die heute bekannten Märchen sind in einer Zeit entstanden, als die Frauen entschiedener als heute an Häuslichkeit und Familie gebunden waren. Um so bemerkenswerter sind die Zeugnisse des Aufbruchs, der Regel- und Tabuverletzung, des Widerstandes gegen eine patriarchalische Normenwelt. Ein Widerstand, der natürlich nie den Abstraktionen von Staat oder Gesellschaft gilt, sondern immer Personen, die ein Unrecht ganz individuell verkörpern.
Die Frauengestalten in den Märchen dieses Bandes sind auch nicht die »unbekannten Wesen«, die als Geistererscheinungen oder Weiße Frauen den Schlüssel zum Unbewußten in der Hand tragen, mit dem sich ein männlicher Held die Tür zu seiner Innenwelt aufschließt. Sie sind ganz pragmatisch, Praktizierende des Glücks, und sie bemühen sich um einen realistischen Lebensplan. Für ihre Wunscherfüllung fühlen sie sich allein zuständig. Sie wollen auch nicht erlöst, sondern verstanden werden; männlicher Verehrung stehen sie abgeklärt gegenüber, auch dort, wo sie das Eheversprechen billigen. Sie träumen nicht von Luftschlössern, sondern ziehen darin ein. Utopien entwerfen sie nur selten, ihr Handeln selbst ist Utopie, selbstbestimmtes Tun auf einen gleichberechtigten Partner hin.
Aus eigenem Willen handeln alle Frauen der hier versammelten Märchen. Asma ist eine stolze Heldin, die sich durchsetzt und sich mit dem »reinen Bergecho« der Natur verschwistert. In Vom grünen Vogel setzt eine Königstochter Leben und Schönheit aufs Spiel und beschämt den männlichen Egoismus eines Prinzen durch die Tugenden der Frau. Die schöne Schafhirtin schlachtet einen Stein und löst weitere Aufgaben, an denen sich üblicherweise nur Männer bewährten. Die Amazonen gründen eine männerlose Gesellschaft, in der nur Liebhaber vorübergehend geduldet sind; Miniya, die chinesische Kammerzofe einer Königin, befreit im Märchen vom Reis die Sklaven des Landes; als eigensinnige Frau erweist sich Die schlaue Ileane, die aufdringliche Freier zu überlisten versteht. Mehr »als ein Vaterunser« weiß Die vorwitzige Finna, sie befreit den Vater und den Geliebten aus dem Verhängnis. Sim Chung, die gute Tochter, rettet das Augenlicht ihres Vaters; Die Waldfrau belohnt ein Mädchen in einem Märchen ohne Männer, allein weil es eine Frau ist; die irische Göttin Clina muß erfahren, wie stark eine Frau sein kann, die um ihre Liebe trauert; in der Geschichte von dem mutigen Mädchen teilen drei Schwestern Reichtum und Glück solidarisch untereinander. Das Mädchen mit den großen Augen will einen Fisch lieben, die anarchische Kluge Gretel verzehrt gern selbst, was sie für andere kochen mußte; und die Geschichte von der Prinzessin Alu zeigt, daß Frauen ihre Versprechen unter allen Umständen zu halten wissen.
Aus der Fülle der Märchen, die meist im 19. Jahrhundert erstmals aufgeschrieben wurden, sind für diesen Band Frauengestalten ausgewählt worden, die mit mehr oder weniger Realitätsbezug gegen das »Heimchen-am- Herd«-Klischee opponieren. Sicher sind zahlreiche mündliche Überlieferungen, die einen emanzipatorischen Ansatz hatten, durch den Blickwinkel der Märchensammler und durch den Zeitgeist entstellt worden. Andere derartige Märchen wurden erst gar nicht aufgeschrieben, sind also für uns verloren. Um so spannender ist es für den Märchenliebhaber, die unbequemen Stoffe aufzuspüren, um selbstbewußtes Verhalten nachzuvollziehen.
Dabei gilt es, den Fehler zu vermeiden, durch aktuelle Überarbeitung den alten Erzählungen, diesmal im Geist eines emanzipatorischen Zugriffs, etwas ihnen Äußerliches überzustülpen. Die Leserin und der Leser werden also finden, daß die vorliegenden Volkserzählungen in Form und Inhalt das zeitgenössische Kleid ihrer Entstehungszeit tragen. Wir wollten nicht verfälschen, sondern den Blick für das in der Tradition Geringgeschätzte schärfen, das oft nur zwischen den Zeilen liegt.
Alexandra Wetzberg
Kapitel 1 DAS MÄDCHEN, DAS SEINEN BRUDER LIEBTE
Anid war ein junges Mädchen. Sie wuchs mit neun Brüdern auf, und alle liebten sie. Ihr ältester Bruder war Omman, ein sanfter Junge und so schön, wie Anid leidenschaftlich war. Sie lebten irgendwo in den Urwäldern.
Anid war eine blühend junge Frau. Eines Tages sagte sie: »Ich wünschte, jemand würde mit mir gehen.« Omman hörte das. Er verstand, denn sie blickte ihn dabei an. Er erschrak und versteckte sich. Anid vermißte ihren Bruder sehr, suchte nach ihm, aber sie konnte ihn nicht finden.
Eines frühen Morgens badete Omman im See. Dabei verlor er ein langes Haar. Als Anid später zu diesem See kam, sah sie das Haar und hob es auf. Sie verglich es mit ihrem eigenen Haar. Es war schöner und länger. Sie verglich es mit den Haaren ihrer anderen Brüder, aber es stammte nicht von ihrem Kopf.
Sie dachte: »Ich muß wissen, wessen Haar das ist!« Omman, der hinter den Bäumen stand, hörte, was sie sagte. Zeit verging. Ein jüngerer Bruder kam zu Anid und sagte: »Ich will mit dir gehen.« Aber sie antwortete nicht. Ein anderer kam und sagte ebenfalls, er wolle mit ihr gehen. Sie schwieg. Sie suchte nach Omman, denn sie hatte den Verdacht, er sei in der Nähe und bade hin und wieder im See.
Endlich fand sie ihn. Es war ein Tag, an dem er von seinem Aufenthalt bei dem himmlischen Volk zurückkehrte, wo er seine Prüfungen ablegen mußte. Omman, der Schöne, kam ins Haus am See, um zu baden, und sie sprach ihn an. »Du bist der einzige, den ich will«, sagte sie. »Komm mit mir. Wir gehen fort.«
Omman stand auf. Er überlegte. Endlich sah er seine leidenschaftliche, eigensinnige Schwester an und sagte: »Gut, ich werde mit dir gehen.« Er band sich Perlen um den Hals, wickelte sein Haar zu einem Knoten auf der Spitze seines Kopfes und befestigte Federn darauf. Anid liebte ihn. »Gut«, sagte sie. »Laß uns aber gleich aufbrechen.«
Es war Abend, als sie dort ankamen, wo sie hingingen. Der Bruder war sehr müde und schlief nach einer Weile ein. Anid saß an seinem Lager. Sie überlegte. In ihrem Körper brannte das leidenschaftliche Begehren. Sie legte die Arme um den Leib des Bruders und preßte sich an ihn. Er murmelte im Schlaf und glaubte zu träumen. Sie streichelte ihn und schlief mit ihm. Bruder und Schwester schliefen zusammen. Er wußte nichts davon, aber Anid wußte, was sie tat. Sie begehrte ihn.
Am nächsten Morgen gingen sie weiter, und in der Nacht schliefen sie erneut miteinander. Und diesmal wollten es beide.
Nach einigen Tagen sagte Omman zu sich selbst: »Was soll ich tun? Ich habe mich an meiner Schwester vergangen. Ich bin unrein geworden.« Er wartete die Nacht ab, und als Anid fest schlief, stand er auf, legte ein Stück Holz neben sie und ging fort. Er kehrte zu dem Haus zurück, in dem er und seine Brüder gelebt hatten. »Jeder von euch«, sagte er, »muß sich bereit machen. Wir werden fortgehen.«
»Warum?« wollten sie wissen.
»Anid und ich, wir haben geheiratet.«
»Und was wird jetzt geschehen?«
»Wir müssen fort. Anid wird uns verfolgen. Niemand darf verraten, wohin wir gegangen sind.«
Kurz darauf verschwanden alle Brüder himmelwärts, wo die Götter auf sie warteten. Weit, weit vom Haus entfernt, kletterten sie am Seil zu einer höheren Welt empor.
Da kam Anid. Sie fragte alle Dinge, wo ihre Brüder hingegangen seien, aber kein Ding und kein Tier wollte ihr antworten. Stumm vor Zorn und Einsamkeit stocherte Anid im Feuer herum und sah den Funken nach, die nicht einsam waren. Sie sah ihnen nach, und so bemerkte sie die Brüder in der Ferne beim Aufstieg auf dem Himmelsseil. Sie schrie: »Brüder! Wartet! Ich will mit euch kommen!« In diesem Augenblick blickte einer von ihnen zurück, und das Seil riß. Mitten in das Feuer hinein, das Anid angezündet hatte, stürzten die Brüder zurück und verbrannten.
Auch Omman zerbarst im Feuer. Anid fühlte Trauer, aber auch Zorn. Und Freude. Sie hatte sich gerächt für seinen Verrat an ihr. Ommans Herz flog aus seinem Körper und fiel nahe dem Fluß herunter. Anid wurde immer froher. Nach und nach breitete sich das Feuer aus und verbrannte alles, auch das Haus. Von den Brüdern blieben nur Knochen. Sie sammelte die Knochen und bewahrte sie auf.
Am See wurde Omman später gefunden. Enten fanden ihn, das waren verzauberte Frauen. Sie fanden und bargen ihn. Omman, der so seine Seele wiederfand, heiratete die Entenfrauen. Sie bekamen zwei Söhne.
Die Söhne Ommans wurden größer. Eines Tages liefen sie herum und kamen an ein Haus. Eine ältere Frau saß darin und zerstampfte ein Gericht. Die beiden Jungen sahen die Frau an. Sie wußten nicht, daß es Anid war, die allein geblieben war und den Verlust Ommans, den sie geliebt hatte, nicht überwinden konnte. Die altgewordene Anid band sich Knochen ins Haar. Da fragte eines der Kinder sie: »Du hast Pfeil und Bogen an der Wand. Willst du mir die Pfeile schenken?«
Anid schenkte dem Jungen den Bogen. Der andere Junge bettelte: »Und mir gib die anderen Pfeile!« Auch das tat sie.
Darauf gingen die beiden Jungen zu ihrem Vater. »Wir werden diese alte Frau töten, sie bindet sich Knochen ins Haar«, sagten sie. Ihr Vater schwieg. Am nächsten Tag schossen die Kinder mit den Pfeilen auf Anid und rannten fort. Anid wappnete sich, machte sich neue Pfeile und schoß auf die Kinder, als die zurückkamen. Sie wurde von Pfeilen getroffen, starb aber nicht.
In der Nacht sprach eine geheimnisvolle Stimme zu den Jungen. Sie sagte: »Seht ihre Ferse, das ist ihr Herz. Ihr Herz ist wie Feuer!«
Als die Sonne aufging, schossen die Jungen Ommans auf die Ferse Anids und töteten sie. Überall, auf der ganzen Welt, hörte man sie fallen.
Die Kinder gingen zum Haus zurück. Die Entenfrauen waren sehr zufrieden mit ihnen, denn sie hatten gewußt, was geschah. »Wir haben die alte Anid getötet«, sagten die Kinder, und die Entenfrauen nickten. Zu ihrem Vater sagten sie: »Vater, laßt uns gehen und sie begraben.«
»Sehr gut«, antwortete Omman. »Ihr müßt wissen, das ist eure Tante.« Sie begruben Anid. An ihrem Grab fühlte Omman die alte Angst vor seiner Schwester. Er zitterte.
»Warum zitterst du?« wollten die Kinder wissen.
»Eines Tages, wenn ihr größer seid, werde ich euch davon erzählen«, erwiderte Omman.
Kapitel 2 AMSA
Im Gebiet von Achaoti, dort auf den wilden Abhängen, hatte sich der Stamm der Sani niedergelassen. Oberhalb ihrer Siedlung lagen drei unbewohnte Parzellen. Drei Häuser standen dort, von denen nie Rauch aufgestiegen war. Wer aber würde sich auf diesen drei Parzellen niederlassen, wer die Häuser bewohnbar machen? Drei Wasserbehälter gab es in den Bergen, deren Wasser klar war. Wer würde sich über diesen Behälter niederbeugen, wer als erster das Wasser trinken? Es würden Menschen sein, die einander lieben.
Die Sippe der Ge Lu Chi Ming schlug sich eines Tages bis zu den Wasserbehältern durch. Sie ließen sich in einem der Häuser nieder, das leer an einem Abhang stand. Und nun lebten sie dort – eine glückliche Familie. Bienen summten über den Blumen, wohlduftende Bäume wuchsen im Garten neben dem Haus. Als die Zeit kam, wurde in der Familie eine Tochter geboren, die der duftenden Blüte der Lorbeerbäume glich. Und ein Sohn wurde der Familie geboren, der wie eine blaue Kiefer war.
Doch es gab in Achaoti auch eine andere Siedlung, in der sich die Sippe des Chebubal niedergelassen hatte. Böse waren diese Menschen, nicht einmal die Ameisen wagten es, in ihren Hof hineinzukriechen. Reich und mächtig waren die Chebubal. Vergebens blühten jedoch die Blumen in ihrem Garten – die Bienen flogen an ihnen vorbei und sammelten dort keinen Nektar. Im Garten dieser bösen Menschen wuchsen nur Bäume mit verkrümmten Stämmen. Eines Tages wurde auch dort ein Sohn geboren, doch war er klein von Wuchs und abstoßend und sah wie ein Affe aus. Er erhielt den Namen A Chi, und A Chi wurde er auch gerufen.
Nun wuchs auch der Sohn der Ge Lu Chi Ming heran, und man nannte ihn A Khei. Er lebte auf der Bergspitze und war wie eine blaue Kiefer. Eine Kiefer kann man fällen, verbiegen aber kann sie niemand. Der größte unter den Menschen war A Khei, der größte, der tapferste und der stärkste. Er ritt gerne ohne Sattel. Spannte er seinen Bogen, so wurde dieser rund wie der Mond. Alle im Volke Sani liebten ihn, alle waren des Lobes voll: ›Wer wächst da unter uns Sani heran? O du furchtloser A Khei, du mutiger A Khei! Du bist ein Vorbild allen, die jung sind. Nur auf den Bergen baut der Adler seinen Horst, nur neben sauberen Wasserbehältern wächst der Lotos!‹
Und es wuchs die Schwester A Kheis neben ihrem Bruder heran. Zehn Monate trug die Mutter die Frucht der Liebe in ihrem Leib, und zehn Monate trug sie zugleich der Vater{i}.
Dann kam der Tag: Der Donner grollte, am Himmel erblühte die wunderschöne Blume des Blitzes, und die Blätter der himmlischen Blume fielen auf die Erde. So wurde unter uns Asma geboren, und alle liebten sie, das Kind des Himmels. Im saubersten Wasserbehälter wurde sie gewaschen und wurde weiß und weich. Weißer als die Eierschale war ihr Leib, die Hände waren weiß wie der Rettich und die Beine wie aus dem weißen Kohl, ihr Gesicht aber war weißer als der Mond.
Sie wuchs heran, und die Mutter kämmte ihre langen Haare, und die Haare von Asma lagen über ihrem Gesicht wie die Schatten in jener Stunde, da die Sonne untergeht.
Dreißig Tage waren seit ihrer Geburt vergangen, da sagte der Vater: »Es ist Zeit, zu Ehren unserer Tochter Gäste zu versammeln.«
Die Mutter sagte: »Einen Namen müssen wir für unsere Tochter wählen.«
Der Bruder sagte: »Zeit ist es, einen Tag der Freude für meine Schwester zu veranstalten.«
Und es kamen unzählige Gäste, besetzten unzählige Tafeln – neunundneunzig Krüge Wein wurden auf die Tafeln gestellt, und wo der Wein nicht reichte, wurde neuer Wein in die Krüge gegossen.
Mitten im feierlichen Schmaus fragte die Mutter die Gäste: »Wie sollen wir unsere Tochter nennen?«
Und da sagten die Ältesten des Dorfes: »Eure Tochter soll Asma heißen, Asma soll sie gerufen werden. Asma ist ja die Bezeichnung der duftenden Gräser.«
So waren sie es, die zum ersten Mal diesen Namen aussprachen, und seitdem wiederholten die Menschen überall den lieblichen Namen Asma.
Asma war die beste Hilfe für ihre Mutter. Ob zu Hause oder auf dem Feld, ob auf dem Feld oder im Wald, überall war sie tätig, und immer war auf sie Verlaß. Deshalb freuten sich die Eltern über die Entwicklung ihrer Tochter. Sie nahm einen Korb und eine Sense und ging, das Gras auf den Bergpfaden zu schneiden. Sie legte einen Umhang aus Bambus an, nahm den Hirtenstab und ging mit ihren Freundinnen, die Hammel in den tiefen Schluchten weiden zu lassen.
Die Freundinnen waren des Lobes voll und sagten: »Die Blumen, die du gewebt hast, sind herrlicher als Bergkamelien. Die Hammel, die du auf die Abhänge treibst, sind wie die weißen Wolken. Unter Hunderten von den Tausenden Kamelienblüten bist du die schönste Blume. Unter Hunderten von tausend Mädchen des Volkes Sani bist du das schönste Mädchen!«
Die Eltern überließen sie, da sie so arbeitsfreudig war, sich selbst. Wollte sie, so nähte sie, wollte sie, so stopfte sie die alten Kleider. In allem gaben die Eltern ihr Freiheit. Sie konnte lieben, wen sie wollte. »Gründe eine Familie mit deinem Geliebten, deine Eltern werden dir nie im Wege sein«, sagten sie.
Doch Asma machte sich ihre eigenen Gedanken. Wie ein Fluß sich mit den Wellen eines anderen vereinigt, wie der Kiefernbaum unverbrüchlich neben seiner Freundin, der Kiefer verharrt, so konnten für Asma nur die ein Paar werden, die im Frühling und im Sommer aussäten und im Herbst und Winter die Ernte einholten. Nur der konnte dem Herzen Asmas lieb und teuer sein, dessen Herz gerade wie der Stamm eines Baumes war. Beim Tanz mußte er zärtlich sein, zärtlich wie die Blume eines Baumwollstrauchs. Er mußte mit seinem Flötenspiel die Vögel verzaubern. Nur einen solchen wird Asma lieben, nur er wird ihr Herz erobern können.
Kaum daß eine junge Stute in die Freiheit rennt, so hört man schon Dutzende von Kilometern im Umkreis ihr Gewieher. Asma wurde siebzehn Jahre, und alle Jungen in Achaoti verliebten sich in sie. Ohne daß jemand sie zwang, suchten sie sie dreimal am Tag auf. Wenn sie sie aber sehen mußten, so gingen sie gleich neunmal am Tag zu ihr. Und wenn Asma zu Hause saß, so klirrten auf ihren Händen die Armbänder aus Silber, stand sie auf, so wurde der Tag heller. In der ganzen großen Welt erklang der Name Asma. O vielgerühmte Asma, du bist schöner als alle anderen unter dem Himmel!
Auch zum Hause der Chebubal drang der Name Asmas. Der Schatten der Schönen erschien allen im Traum. Und so beschloß der Sohn der Chebubal, das Mädchen Asma zur Frau zu nehmen. Einen ganzen Tag lang hielt man Rat im Hause der Chebubal, und die Sippe beschloß, sich an den schlauen Hai Che zu wenden – der sollte ihr Heiratsvermittler sein. »Alle rühmen den Namen Asmas, und du, Hai Che, der du mächtig und berühmt bist, sollst unser Heiratsvermittler sein.«
Hai Che tat aber so, als wäre er erschrocken, er sagte scheinheilig: »Nur ein Dummkopf würde sich bereit erklären, für Euch diese Sache in Ordnung zu bringen, nur ein Geizkragen würde Euer Heiratsvermittler sein. Mache ich mich zu Eurem Heiratsvermittler, so werden alle mich beschimpfen!«
Doch da sagte der Sohn der Chebubal: »Du hast die Zunge einer Schlange, eine Drossel hat dir deinen Mund geschenkt. Wenn nicht du dazu bereit bist, wer soll dann Asmas Heiratsvermittler sein? Schaffst du es aber, so werde ich dir zeitlebens dankbar sein. Du kannst Gold haben, soviel du tragen kannst, du kannst Korn haben, soviel dein Karren faßt. Auch von den dichtbehaarten Hammeln kannst du wegtreiben, soviel dein Herz begehrt. Und Anfang des Jahres komme ich zu dir mit einem Geschenk. Ich bringe Schweinefüße und Schweineköpfe mit, auch zwei Paar Hosen, zwei Kleider und zwei Paar Stiefel wirst du von mir bekommen. Sei also freundlich und erkläre dich bereit!«
Der Wein floß in den Bauch und erzeugte Dankbarkeit, die Schlangenzunge rauschte, der Mund öffnete sich, wie der Schnabel einer Drossel – Hai Che erklärte sich bereit, als Heiratsvermittler der Chebubal aufzutreten, und sagte: »Auch wenn ihr Vater und ihre Mutter nicht bereit sein werden, Asma zu verheiraten, wenn sie alle meine Fragen mit ›Nein‹ beantworten, so werde ich sie doch überzeugen. Wäre der ältere Bruder von Asma doppelt so stark und gewandt, wir werden mit ihm eine Schlacht schlagen und ihn bezwingen.«
Von den Bergen herunter kletterte der Affe – die Früchte der Aussaat zu stehlen. Zu den Achaoti kam der Heiratsvermittler Hai Che, um Asma, die Tochter der Ge Lu Chi Ming, zu verheiraten.
»Kaum daß der Mais reif ist, sammeln die Menschen die Körner. Asma ist zu einer Schönheit herangewachsen, und es ist Zeit, das Mädchen zu verheiraten«, so sagte Hai Che, als er angekommen war.
Doch die, die Asma geboren hatte, erwiderte: »Nichts ist süßer als der Honig, nichts ist enger miteinander verbunden als Mutter und Tochter. Das Essen ohne Salz ist ungenießbar, ein Mädchen kann ohne Verwandte nicht leben: Sie braucht stets eine Mutter. Nein, der Gedanke, mich von meiner Tochter trennen zu müssen, ist für mich unerträglich.«
Der Heiratsvermittler Hai Che erwiderte darauf: »Eine Tochter ist wie eine Lieblingsblume: Man wirft einen Blick auf sie, und das reicht. Ob in ihrem Hause Mangel herrscht oder ob es reich ist, auf jeden Fall heiratet eine Tochter und verläßt das Haus ihrer Eltern. Fällt der Tau herab, so kräht der Schreihals Hahn. Und wenn die Zeit reif ist, wegzugeben, was man an sich gerissen hatte, gebe man es ohne Qual und Leiden. Und wenn die Zeit kommt, deine Tochter zu verheiraten, so tue es schnell.«
Doch da sagte der Vater: »Verheirate ich meine Tochter, so bekomme ich Wein. Für die restlichen Jahre aber reicht der Wein nicht aus. Man kann ein Bambusrohr in zwei Teile spalten, doch nicht einen Menschen. Meine Tochter gebe ich nicht her.«
Und die, die Asma geboren hatte, sagte: »Wenn ich meine Tochter verheirate, bekomme ich einen Korb voll mit Eßbarem, doch für das restliche Leben reicht er nicht aus. Meine Tochter aber wird mir zur Fremden werden, und im Herzen bleibt der Schmerz.«
Darauf erwiderte Hai Che: »Nicht nur Asma allein heiratet einen Mann, nicht nur in Eurem Haus wird Hochzeit gefeiert, nicht nur Eure ausgewachsene Tochter verläßt die Hütte. Hunderttausende von Mädchen verlassen ihr Zuhause und überall beeilen sich die Eltern, ihre Töchter zu verheiraten. Nur Ihr bringt es nicht fertig, Euch von Eurer geliebten Asma zu trennen. Es geht aber nicht, daß Asma älter wird als ihre eigene Schwägerin. Wollt Ihr wirklich, daß sie für immer hier zu Hause bleibt, daß ihre Haare hier weiß werden? Wenn die Bäume auf dem Gipfel der Berge ewig wachsen, so ist das keine Schande, eine Schande aber ist es, wenn ein erwachsenes Mädchen bei seinen Eltern lebt. Und bedenkt: Wird sie zwanzig, so wird sich kein Freier mehr um sie bewerben, und kein Heiratsvermittler mehr wird um sie geschickt!«
Die Mutter hörte diese Worte und wurde nachdenklich. Der Vater hörte diese Worte, und sie rührten sein Herz: Schließlich geht es nicht, daß eine geliebte Tochter sich nicht verheiratet.
Da sagte die Mutter nach langem Zögern: »Ja, sie muß sich verheiraten, und wir werden ihr nicht im Wege sein. Nur soll sie eben einen heiraten, der gut aussieht, der schön singen und fleißig arbeiten kann, der sie abends im Bett mit einem Lächeln begrüßen wird. Lasse ich sie aber einen schlechten Menschen heiraten, wird der Vater des Ehemannes sie in den Wald schicken, Brennholz zu holen, aber er wird ihr kein Messer geben. So wird sie aus dem Wald drei Bündel Reisig bringen – eines der Bündel wird aber feucht sein. Zwar wird das feuchte Holz dennoch brennen, alle Familienmitglieder werden aber trotzdem schimpfen. Wenn ich sie mit einem schlechten Mann verheirate, so wird der Vater des Ehemannes sie aufs Feld schicken, Gemüse zu ernten, wird ihr aber keinen Korb geben. Zwar wird sie drei Bündel zurückbringen, doch eins davon wird aus überreifem Gemüse bestehen. Und wieder werden alle im Hause schimpfen. Die Tochter ist aber ein Teil vom Herzen der Mutter. Nein, wenn solche Erniedrigungen sie erwarten, kann ich meine Tochter nicht verheiraten.«
Darauf antwortete Hai Che: »Dort, weit von Eurem Acker im reichen Haus von Chebubal, sind die Tische mit Silber gedeckt, das Dach und die Wände sind aus Gold, auf den Toren links ist ein böser Drache, auf den Toren rechts ist mit Silber ein Phönix gemalt. Dort sind die Speicher voller Korn. Um den Berg traben gewaltige Büffel. In den neun wilden Wäldern weiden die Ziegen. Wo findet man noch einen solchen Menschen auf der ganzen Welt? Und für diesen Menschen will ich Asma zur Frau haben.«
Da erschien Asma zu Hause – Asma, die nur Freude kannte, die nie traurig war. Die Wolken am Himmel sind weiß, und nie werden sie schwarz werden. Sind am Himmel aber keine schwarzen Wolken, so wird es auch keinen Regen geben. Asma, du mit deiner weichen Seele, niemanden hast du je beschimpft! Hättest du die Worte von Hai Che nie gehört, nie wären aus deinen Augen Blitze geschossen, nie hätte deine Stimme wie der Donner gegrollt!
»Ja, ich weiß, daß die Chebubal böse Leute sind«, sagte sie. »Ich weiß auch, daß sie umsonst ihre Blumen pflanzen, denn die Bienen lassen sich nicht darauf nieder. Mag sein, daß sie viel Gold in ihrem Hause haben, mich wird das nicht verlocken. Einen Reichen heirate ich nie. Trübes Wasser fließt nie aus klarer Quelle. Ein Hammel geht keine Freundschaft mit dem grauen Wolf und einem Schakal ein. Um nichts auf der Welt heirate ich den Sohn der Chebubal.«
Da erwiderte Hai Che zornig: »Die Vögel im Himmel lassen sich dort nieder, wo es Eßbares gibt. Heiratest du keinen Reichen, so wirst du dein Leben mit einem Armen fristen müssen. Er lebt in einer armseligen Hütte. Vielleicht ist fürs Frühstück gesorgt, aber abends wirst du hungrig zu Bett gehen müssen. Und wenn du dir abends eine Mahlzeit leistest, so wirst du morgens aufstehen und im ganzen Haus ist kein Krümel. So wirst du dein Leben lang hungrig sein.«
Die liebliche Asma erwiderte ihm aber stolz: »Ich habe weder vor der Armut Angst – noch vor Hunger und Kälte. Aber so wie es keine Wolke gibt, aus der es nicht regnet, so gibt es kein wildes Tier im Wald, das nie einen Menschen überfällt. Niemals geschieht es, daß nicht eine böse Seele den anderen Böses tut, daß einer, der Böses denkt, nicht einem anderen Bosheiten sagt.«
»Chebubals Wort ist unverrückbar«, erwiderte Hai Che, »es ist wie ein Felsen, der einen Baum nach unten biegt. Hat er sich einmal entschlossen, so wirst du seine Frau werden müssen.«
»Ich will nicht heiraten!« fuhr Asma zornig fort. »Und schon gar nicht den Sohn Chebubals. Könnt Ihr mich aber mit Gewalt nehmen, dann führt mich eben fort!«
Die Tage vergingen, und es geschah, daß sehr viele in einer Staubwolke den Bergabhang hinaufritten. Die ganze Sippe der Chebubal war zum Hause Asmas aufgebrochen. Nein, die Sippe von Ge Lu Chi Ming hatte sie nicht als Gäste geladen – von alleine war Hai Che bei ihnen erschienen. Kein Wein war für die Frauen da, ihn trank Hai Che mit seinen Freunden. Seine Lippen waren mit Öl beschmiert, aus seinem Mund stank es wie aus einem ungewaschenen Tiegel, und er sagte schadenfroh: »Du wolltest also nicht heiraten, schöne Asma. Nun gut, wir werden dich dazu zwingen. Wenn ein Felsen umkippt und herunterfällt, wird das kleine Haus aus Ried ihn nicht aufhalten können.«
Die Chebubals packten Asma und schleppten sie gewaltsam in die Gefangenschaft.
So verschwand aus Achaoti die, die alle geliebt hatten. Im Herbst blühen Pflanzen und Blumen nicht. Dem Vater liefen die Tränen ohne Ende die Wangen hinunter, er wurde dünner und immer magerer ohne Asma. Die Haare der Mutter wurden weiß vor Qual. Was sie auch taten, immer stand ihnen Asma vor Augen. O daß A Khei bald nach Hause käme, o daß er seine Schwester aus der Gefangenschaft befreite! O du, himmlische Taube, trage dem A Khei die böse Nachricht zu, Asma weilt nicht mehr hier!
A Khei aber ließ zu jener Zeit auf den weit abgelegenen Abhängen seine Herde weiden. Schon sieben Monate war er dort und dachte nicht daran, nach Hause zurückzukehren. Er schlug sich durch zu den entferntesten Winkeln, wo der menschliche Fuß noch nie gewesen war. Über zwölf hohe Berge trieb er seine Herde und erreichte schließlich den Yangtse. Breit lag der große Fluß vor ihm und freudig pochte sein Herz. Doch in der gleichen Nacht noch hatte er einen furchtbaren Traum. Es träumte ihm, der Hof von Ge Lu Chi Ming sei von Wasser überflutet. Vor dem Haus aber wand sich eine riesige Schlange – ein Symbol, das Kummer verhieß. Böse Ahnungen im Herzen eilte A Khei nach Hause zurück. Drei Tage und drei Nächte trieb er seine Herde zur Eile an. Endlich erreichte er sein Haus und traf vor der Tür seine Mutter. Er fragte: »Warum stehen leere Weinfässer vor dem Eingang? Wer war bei Euch zu Gast, und warum habt Ihr jemanden eingeladen? Im Hof kämpfen die Hunde um die Knochen – was für Gäste habt Ihr gehabt, und warum habt Ihr sie eingeladen?«
Weinend sagte ihm die Mutter: »O A Khei, mein lieber Sohn! Die bösen Chebubals waren hier, und sie haben unsere Tochter entführt, damit sie den jüngsten Sohn Chebubals heiratet.«
»Sag mir, wann haben sie sie entführt?«
»Dreimal hat seit jenem Tag die Sonne hoch am Himmel gestanden. Wenn du ein schnelles Pferd nimmst, wirst du sie noch einholen.«
»Wo ist die Stute mit der gelben Schnauze? Wo ist mein Bogen, und wo sind meine Pfeile?«
»Hier ist die Stute. Hier sind Bogen und Pfeile.«
Alle Bewohner des Dorfes freuten sich – sie freuten sich, daß A Khei nach Hause zurückgekommen war. Und sie sagten zu A Khei: »Eine Blume verwelkt und stirbt, wenn man sie aus der Erde reißt. Für Asma muß es unerträglich sein, im Hause der bösen Chebubals zu weilen. Reite so schnell du kannst, Asma zu helfen!«
A Khei sattelte die Stute, nahm den Bogen und die Pfeile und ritt Asma nach.
Der Wind heulte in den Schluchten, Wolken bedeckten den Himmel, Asma wurde zum Hause der Chebubals geschleppt. Die Berge wurden immer gefährlicher, immer steiler die Abgründe. Der Heiratsvermittler Hai Che prahlte unentwegt vor Asma: »Siehst du die Felsen, die wie die Krallen eines grausamen Tigers aussehen? Auf diesen Felsen errichteten die Chebubals ihre Ahnentafeln.«
Asma aber erwiderte: »Ich weiß nicht, was geschehen wird, ich weiß aber, was geschehen ist. Und deshalb weiß ich: Sie verstecken in diesen Felsen das gestohlene Gut. Mich kannst du nicht an der Nase herumführen.«
Die Berge wurden immer steiler, die Wälder immer dichter … Hai Che versuchte, Asma mit Lügen zu umgarnen: »Siehst du den Teich mit dem klaren Wasser? Es ist deshalb so durchsichtig, weil die Chebubals hier ihren Zierat waschen.«
Doch Asma erwiderte tapfer: »Ich weiß nicht, was jetzt geschehen ist, ich weiß aber, was früher war. Und deshalb weiß ich: Dies ist ein Teich, in dem die Chebubals nach einer Rauferei ihre blutigen Hände waschen. Mich wirst du nicht auf den Arm nehmen.«
Und wieder versuchte Hai Che, Asma hereinzulegen: »Siehst du das Dickicht, den unzugänglichen Bergwald? Es ist ein Garten, wo die Chebubals die Früchte von den Ästen pflücken.«
Doch Asma erwiderte tapfer: »Ich weiß nicht, was geschehen wird, ich weiß aber, was geschehen ist. Und deshalb weiß ich: dies ist der Wald, wo die Chebubals die wütenden Tiger heranzüchten. Und mich wirst du nicht auf den Arm nehmen.«
Lange Zeit ritten sie so, und endlich kamen sie zu dem grausigen Ort, dem Haus der bösen Chebubals. Furchtbar war diese Stelle. Rundherum standen dichte Wälder – und dort waren die Schakale und die Wölfe, die Leoparden und die bösen Tiger heimisch. Wagte ein Mensch sich hinein, so wurde er von ihnen zerrissen.
A Chi, der Sohn Chebubals, blickte mit seinen Affenaugen auf Asma. Er schleppte einen Haufen Silber und einen Haufen Gold heran. Er lachte und führte sie zu den Kornspeichern und zu den unzähligen Herden. Doch Asma schaute sich die Reichtümer nicht einmal an.
»O ruhmreiche Asma, warum willst du nicht hier leben? Warum sind dir meine Reichtümer nicht teuer?«
»Viele Reichtümer besitzest du: Die Speicher sind voll Korn, und unter deinen Herden sieht man die Berge nicht. Doch ich brauche keine Reichtümer. Nur mit dem werde ich unzertrennlich sein, der meinem Herzen lieb ist. Nur ihn nehme ich zum Manne. Und niemand wird mich davon abhalten können. Zu Euch, Chebubals, kommen aber gute Leute nicht, in Eurem Hof scheint die Sonne nicht, und die Vögel meiden eure Häuser!«
Da brüllte A Chi zornig: »Wenn du dich nicht fügst, stolzes Mädchen, vertreibe ich die Ge Lu Chi Mins für ewig aus Achaoti.«
Asma stand vor ihm gerade wie ein Bambus, ihre Augen schleuderten Blitze, und sie kannte keine Angst: »Mit deinem Geld kaufst du dir kein Herz, mit deiner Prahlerei wirst du niemandem Angst einjagen. Dieses Land gehört uns, dieser Boden ist nicht dein.«
Wie ein junger Frosch sprang A Chi vor Wut. Er warf Asma zu Boden und schlug mit einer Riemenpeitsche auf sie ein.
»Du bist meiner Familie beigetreten, also gehörst du von nun an mir, und ich werde dich in ein Verließ einsperren. Willst du nicht im Himmel leben, so jage ich dich unter die Erde. Du verzichtest selber auf dein Glück und hast selber dein Schicksal gewählt.«
»Nie werde ich deine Frau sein, nie!«
Da warf A Chi die Blume des Volkes Sani in ein tiefes Verließ.
Dort schien die Sonne nicht, die Vögel mieden es, sie flogen um den Wald herum, wo Asma von den Chebubals Folter und Qualen erdulden mußte.
»Ach du dunkles Verließ! Kein Strahl der Sonne scheint hier herab! Ihr feuchten Steine meines Gefängnisses, ihr seid kalt wie Eis im Winter! Wind! Werde ich nie mehr hören, wie du über breite Ebenen pfeifst? Vögel, werde ich nie mehr sehen, wie ihr in den hohen Himmel fliegt? Sonne, wirst du mich nie mehr mit dem Frühlingsstrahle erwärmen? Mond, wirst du mir nie die Grüße meines Heimatdorfes überbringen? Was sind das für Schreie hinter der Mauer? – Sie klingen wie die Stimme meiner Mutter. Doch nein, es ist nur eine Grille unter dem Stein. Was ist das für ein Lärm hinter der Mauer? – Es klingt als wären meine Freundinnen gekommen, mich zu besuchen. Doch nein, das habe ich nur geträumt. Es ist mein eigener Herzschlag – er erzeugt diesen Lärm. Was ist das für ein Licht hinter der Mauer, als wäre ein Drache vorbeigeflogen? Nein, auch das habe ich nur geträumt – es war ein Glühwürmchen, das aufglühte und wieder verschwand. Fest sind die Mauern des Gefängnisses, doch für ein Herz gibt es keine Schranke. Zwar ist das Gefängnis kalt wie Eis, doch das Herz Asmas wird das Eis zum Schmelzen bringen.«
Am klaren Himmel drehten die Vögel ihre Runden, hoch am Himmel erstrahlte hell die Sonne. Ganz verschwitzt, mit brennendem Herzen jagte A Khei durch die Berge. An einem Tag legte er die Strecke zweier Tage zurück. Unzählig die Schluchten, die er hinter sich ließ. Da war ein Dorf, und ein Alter arbeitete auf dem Feld.
»Sag, ehrbarer Greis, hast du zufällig unsere Asma gesehen?«
»Ich habe eure Asma nicht gesehen, gesehen habe ich aber die, die das Mädchen entführt haben. Sie waren in schwarze Seide gekleidet und glichen einer schwarzen Wolke.«
»Wie viele Tage sind seitdem vergangen?«
»Vor zwei Tagen habe ich sie gesehen.«
»Werde ich sie einholen können?«
»Wenn dein Pferd stark ist, schaffst du es.«
Wieder schlug A Khei das Pferd in die Flanken und ritt weiter – zu Asma, zu Asma! Atmete er einmal ein, so flog er einen Berg hinauf, atmete er zweimal ein, schon lagen fünf Berge hinter ihm. Der Wald auf den Bergen bebte vom Wiehern seines Pferdes, über die Erde flogen die Hufe. Da war ein Dorf, eine Alte weidete eine Herde.
»O liebe Alte, liebe Alte! Hast du zufällig unsere Asma gesehen?«
»Nein, ich habe Asma nicht gesehen, doch ich habe die gesehen, die das Mädchen entführt haben. Sie waren in schwarze Seide gekleidet und glichen einer schwarzen Wolke.«
»Wie viele Tage ist es her?«
»Erst gestern waren sie hier.«
»Werde ich sie einholen können?«
»Wenn dein Pferd stark ist, wirst du sie einholen.«
Durch die Wälder, die von den Menschen in ihrer Angst gemieden werden, ritt der tapfere A Khei. Und so kam er zu dem Haus, in dem sich die Chebubals versteckt hatten. Er stellte sich vor dem Haus auf und rief dreimal: »Asma, Asma, wo bist du, Asma?«
So laut erschallte dieser Ruf, daß er Asma erreichte. Wie ein Sonnenstrahl schlug er in das dunkle Verließ. Und mit Wärme umgab die Stimme des Bruders den frierenden Leib des Mädchens. Sie antwortete mit einem Pfeifen, das durch die Mauer drang.
Die Chebubals erzitterten, als sie die Stimme A Kheis vernahmen, die wie das Heulen des Windes und das Krachen des Donners war.
Die eisernen Tore schlossen die Chebubals und ließen A Khei nicht herein.
A Chi versteckte sich hinter der Mauer, und von dort ertönte seine Stimme: »Wir wollen mit dir einen Kampf austragen, wir wollen einen Wettbewerb im Singen veranstalten. Wirst du aus diesem Wettbewerb als Sieger hervorgehen, so lasse ich dich in den Hof hinein. Werde ich aber Sieger sein, so öffne ich die Tore nicht.«
Und sie sangen und sangen, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein, und von der späten Nacht bis zum frühen Morgen. Vor Anstrengung schwollen dem A Chi die Sehnen im Gesicht und am Hals an. Mit jedem Lied verlor er an Kraft, und seine Stimme glich dem Gequake des ekelhaften Frosches im Moor. Den ganzen Tag und die ganze Nacht und noch einmal einen ganzen Tag sangen sie so. A Khei verging immer noch vor Freude und lachte immer noch voll Seligkeit. Mit jedem Lied flössen ihm neue Kräfte zu, seine Stimme war wie das abendliche Zirpen der wunderschönen Zykladen.
Da aber konnte A Chi kein einziges Lied mehr singen, seine Kräfte gingen zu Ende. Und nun mußten die Chebubals die Tore öffnen.
A Khei betrat den Hof und rief laut: »Asma, Asma, wo bist du, Asma? Antworte schnell deinem Bruder!«
Doch die Chebubals hatten sich schon einen neuen Kampf ausgedacht.
»Wetze deine Axt am Stein, wetze sie, bis sie glänzt. Wir wollen einen Wettbewerb veranstalten, wer am schnellsten das Gesträuch am Wald abholzen kann. Wirst du siegen, so wirst du auch Asma zu Gesicht bekommen.«
»Vor uns liegen alle Wege«, sagte der mächtige A Khei.
»Ein Dutzend breite Wege liegen vor uns, und dreizehn kleine Pfade. Wähle du als erster, wo du hingehen willst. Beginne du den Wettbewerb. Ich werde die Regeln des Wettbewerbes nicht verletzen und dich ehrlich bezwingen. Wirst du mich aber betrügen, so zerhaue ich dein Herz.«
Seinen Vater holte sich der feige A Chi zu Hilfe. Sohn und Vater gemeinsam schafften es gerade, eine kleine Fläche abzuholzen. A Khei säuberte aber in der gleichen Zeit die dreifache Fläche.
Nun hatten die Chebubals keine Kraft mehr, die Sträucher abzuholzen, also wandten sie eine List an: »Der heutige Tag ist für einen solchen Wettbewerb nicht gerade günstig. Besser, daß jeder auf der abgeholzten Fläche Obstbäume anpflanzt.«
Da dachte A Khei: ›Bäume anpflanzen kann ich auch, keine Arbeit ist mir fremd. Jetzt werde ich sehen, welche List sie sich ausgedacht haben.‹
Sohn und Vater hatten es kaum geschafft, eine kleine Fläche zu bepflanzen, da war A Khei mit seiner Fläche schon fertig.
Die Chebubals hatten keine Kraft mehr, weiter Bäume zu pflanzen und griffen wieder zu einer List.
»Der heutige Tag ist für einen solchen Wettbewerb nicht günstig. Am besten säen wir jetzt Reis.«
Da dachte A Khei: ›Auch das kann ich, keine Arbeit ist mir fremd. Ich werde sehen, welche List sie sich diesmal ausgedacht haben.‹
Sohn und Vatter schafften es kaum, eine kleine Fläche zu besäen, da hatte A Khei schon die dreifache Fläche besät.
Die Chebubals hatten keine Kraft mehr, mit der Arbeit fortzufahren. Und wieder griffen sie zur List: »Der heutige Tag ist für einen solchen Wettbewerb nicht günstig. Am besten ernten wir den Reis auf dem Feld.«
Da dachte A Khei: ›Auch das kann ich, keine Arbeit ist mir fremd. Ich werde sehen, welche List sie sich nun ausgedacht haben.‹
Sohn und Vater schafften es mit knapper Not, den Reis von einem Teil des Feldes zu ernten, da hatte A Khei schon alle Körner des ganzen Feldes eingebracht.
Doch Sohn und Vater fragten mit scheinheiligem Lachen: »Drei Körner fehlen noch. Warum hast du sie nicht aufgehoben?«
»Der blauen Kiefer ist das Heulen des bösen Windes nicht gefährlich. Diese Körner finde ich schon. Für A Khei gibt es schwierige Aufgaben nicht.«
Abends, als es dunkel wurde, als die Lerchen aufhörten zu singen, als das Heulen der wilden Hunde verstummte, in dieser Stunde machte sich A Khei auf die Suche nach den verschwundenen drei Körnchen. Die Nacht verging, der Tag brach an, und auf einem abgelegenen Feld erblickte A Khei einen Greis, der mit dem Hakenpflug das Feld pflügte.
»Lieber Alter, sage mir, wo soll ich die Körner suchen, die gestern von meinem Feld verschwunden sind?«
Der pflügende Alte erwiderte: »Geht eine Hacke verloren, so findet man sie auf einem Feld. Verschwindet ein Büffel, findet man ihn in den Bergen. Die verschwundenen Körner findest du aber auch auf den Bergen. Ich höre Gesang, hier unter dem Berg höre ich Gesang. Auf einem Bergpaß steht ein Baum mit üppiger Krone. Auf dieser Krone sehe ich drei Fasanen. Die beiden am Rande blicken nach Osten, der in der Mitte blickt nach Westen. Erschieße den, der in der Mitte ist, und in seinem Kropf findest du die verschwundenen Körner.«
A Khei näherte sich dem Baum und schoß seinen Pfeil genau ins Ziel. Der Vogel fiel herunter, und im Kropf des toten Fasanen fand A Khei die Körner.
A Khei steckte die Körner ein und eilte zurück. Noch war er weit von dem Haus der grausamen Chebubals entfernt, da schoß er schon drei Pfeile auf dieses Haus ab. Tief bohrten sich die Pfeile in die Türe des Hauses, in den Opfertisch und in die Wand des am weitesten gelegenen Gemachs. Das ganze Haus erbebte von ihrem Einschlag, und vor Angst erzitterten die bösen Leute der Chebubals, die nun auf die Stunde der Abrechnung warteten.
Guten Menschen, Menschen mit Herz gelingt es leicht, solche Pfeile herauszuziehen, umsonst jedoch versuchen die Bösen es. Die ganze Familie Chebubals zog an den Pfeilen, doch vergeblich – es war, als ob die Pfeile Wurzeln schlügen und für immer da steckten, wo sie waren. Schande über das Haus der Chebubals, Schande! Fünf Stiere zogen an den Pfeilen und konnten sie nicht einmal verbiegen. Schande über das Haus der Chebubals, Schande!
Da mußten sie das feuchte Verließ öffnen und sich mit einer Bitte an Asma wenden: »Asma, flehe A Khei an, uns von dieser Schande zu befreien, seine Pfeile zurückzunehmen! Wir bekennen, daß die Familie der Ge Lu Chi Ming uns besiegt hat, und schwören, uns nie mehr in das Leben deiner Familie einzumischen.«
Zuvor schon hatte Asma keine Angst vor den bösen Chebubals gehabt, nun, da ihr Bruder erschienen war, hatte sie vor nichts und niemandem mehr Angst.
»Ihr habt Böses verrichtet, also zieht selbst die Pfeile, die mein Bruder abgeschossen hat, heraus.«
Da versprachen die Chebubals: »Wenn du diese Pfeile herausziehst, lassen wir dich nach Hause zurück. Denn die Pfeile, die dein Bruder abgeschossen hat, werden auf dich hören!«
Da streckte Asma die Hand aus, und die wunderschöne Hand Asmas genügte, wo fünf gewaltige Stiere sich erfolglos bemüht hatten. Und nun mußte Asma nach Hause gelassen werden.
Also gelang es den Chebubals nicht, A Khei im Kampf zu besiegen. Vergeblich waren alle ihre Kniffe, sie vermochten Asma nicht in ihrem Haus zurückzuhalten. Da beschlossen die Chebubals, A Khei heimlich zu vernichten. Sie taten so, als freute sie sein Erscheinen. Sie spielten die freundlichen Gastgeber, sie lächelten A Khei zu und sagten: »Ein gewaltiger Recke, der du bist, bist du wohl vom langen Reiten trotzdem müde geworden. Übernachte in unserem Haus, und morgen kannst du nach Hause aufbrechen.«
Asma gelang es aber, die heimliche Besprechung der tückischen und schlauen Chebubals zu belauschen. Sie weckte ihren Bruder: »Lieber Bruder, wache schnell auf! Im ehrlichen Kampf konnten sie dich nicht bezwingen, also wollen sie heute nacht die wütenden Tiger auf dich hetzen!«
A Khei erwiderte mit einem Lied:
»Hab keine Angst, du meine Schwester!
Ich werde schon wissen, die Tiger zu empfangen.
Mein Bogen und meine Pfeile sind bereit.«
Des Nachts brüllten die Tiger, daß die Berge erschauderten. Ein Erdbeben setzte ein. Die Mäuler der Tiger waren breiter als Fässer, jedes Schnurrbarthärchen war wie ein Fächer. Doch die Sanis liebten die Jagd. Tiger, Geparden und Schakale, alle wurden sie von A Khei erschlagen – so viele erschlug er, daß man sie nicht einmal zählen konnte.
Drei Tiger sprangen in das Gemach, wo A Khei mit Asma übernachtete. Doch wie ein Blitz schlugen die Pfeile A Kheis zu, und die wilden Tiere wälzten sich in ihrem Blut auf dem Boden. Der furchtlose A Khei trat mit dem Fuß auf einen Tiger und riß ihm mit einer Hand das Fell ab, dann steckte er einen anderen der von ihm getöteten Tiger in das Fell hinein. Mit seinen Zehen packte er den Schweif des Tigers und legte sich neben einen anderen. Dann schlief er ein.
Vater und Sohn der Chebubals konnten die ganze Nacht nicht schlafen, und kaum ging die Sonne auf, da riefen sie A Khei zu: »Lieber Gast, es ist Zeit, sich zu waschen, zu essen und sich auf den Weg zu machen.«
Doch niemand antwortete ihnen. Die Chebubals sahen aber, wie am Eingang zum Gemach hin ein Tiger mit seinem Schweif wedelte. Da lachten sie und sagten zueinander: »Sowohl die Schwester als auch den Bruder haben unsere Tiger gefressen. Siehst du, wie der satte Tiger an der Schwelle schläft.«
Plötzlich kam Lärm von oben, und die Kadaver dreier getöteter Tiger rollten die Treppe herunter. Darauf erschien A Khei in der Tür, gähnte und sagte: »Ich bin viel zu spät aufgewacht und muß Euch um Verzeihung bitten. Nachts störten mich Eure Tiger mit ihrem Gebrüll. Ich wußte nicht, daß in Eurem Haus diese Tiger heranwachsen.«
Da erblaßte A Chi vor Angst, vor Angst wurde das Gesicht seines Vaters grün.
»Sei uns gnädig, lieber Gast, und verzeihe uns, daß wir dir vor dem Schlaf nichts von diesen Tigern gesagt haben. Wir ziehen ihnen gleich die Felle ab, und du wirst dich an Tigerfleisch sattessen können.«
Der mutige A Khei aber sagte: »Wir müssen den Tigern die Felle abziehen. Es gibt unter den Tigern, die ich erlegt habe, einen großen und ein paar kleinere. Wählt selber, wem ihr das Fell abziehen wollt.«
Sohn und Vater strengten alle Kräfte an und schafften in der Zeit, die man fürs Essen benötigt, nicht einmal die Hälfte des Tigerfells. A Khei packte aber seinen Tiger beim Schweif, warf ihn nach links und warf ihn nach rechts, und das ganze Fell war abgezogen.
»Dicht ist das Fell eines Tigers; doch ihr habt mehr giftige Gedanken als ein Tiger Haare hat. Das Tigerfleisch werde ich nicht essen. Umgehend verschwinde ich mit Asma von hier.«
Bei diesen Worten brach Vater und Sohn der kalte Schweiß aus, und sie wagten es nicht, A Khei daran zu hindern, Asma wegzubringen.
In ohnmächtiger Wut sannen die Chebubals zu Hause auf Rache. Da erinnerten sie sich der zwölf Klippen und lachten auf. An ihnen mußten A Khei und Asma unbedingt vorbeireiten. Neben den zwölf Klippen floß ein kleiner Bach. Die Chebubals brachen auf zum Bach und wandten sich dort an den Geist der großen Überschwemmungen. Sie, die Bösen, baten um ein Wunder am Fuße der Klippen – das Bergwasser sollte alle Pfade neben den Klippen überschwemmen. Und sie baten den Geist der Überschwemmungen, ein weiteres großes Wunder zu vollbringen: A Khei und Asma zu trennen.
Die Vögel schwirrten am Himmel hin und her und sangen und sangen, nach Hause ritten Asma und ihr Bruder. Weit weg ist das Haus der Chebubals. Freude und das Gelächter würden im Elternhaus Asmas wieder einkehren. So kamen sie zu den zwölf Klippen. Da ergoß sich der Regen vom Himmel mit dem Gebrüll eines grimmigen Tigers. Er verwandelte den Bach in einen gewaltigen Strom. Der Bruder ging voran, doch Asma konnte ihm nicht folgen, der Bruder ging hinten, doch Asma konnte mit ihm nicht Schritt halten. Da packte Asma fest die Hand des A Khei, und beide gingen dem Sturm entgegen, beide stiegen in die Wellen des Bergstromes. Doch wild rasten die Wellen. Sie erfaßten Asma und trugen sie fort.
Über der wildgewordenen, rasenden Naturkraft ertönte ihre Stimme: »O mein lieber Bruder, rette mich, schnell, rette mich!«
Auf den zwölf Klippen, zwischen den Ausläufern der Berge lebte im Nebel ein Mädchen, das man Skaduleima rief. Ihr Schicksal ähnelte dem Schicksal von Asma. Ihre Schönheit glich der Asmas. Wie Asma liebte sie die Arbeit, und wie Asma liebten alle in der Heimat der Sani Skaduleima. Doch der böse Schwiegervater und die Schwiegermutter hatten die Schwiegertochter gequält, und so war sie vor ihnen auf die Klippe geflohen. Diese Klippe wurde vom Himmel erschaffen und war ihr fortan Heimat und Zuhause. Wandten sich aber ihre Verwandten in der Ebene an sie, so antwortete sie von der Bergspitze mit einem Lied. Deshalb nannten die Sanis sie das »Antwortlied der Berge«.