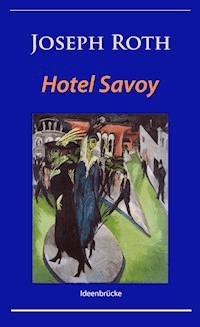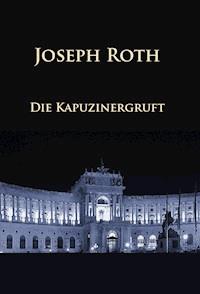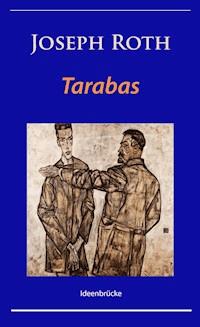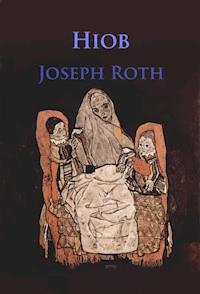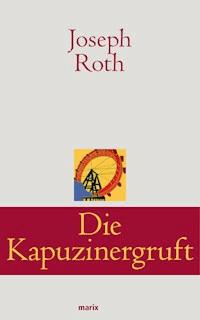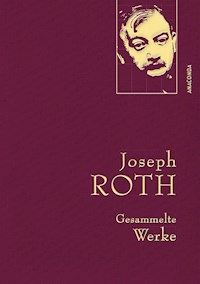Tunda
wollte nach der Ukraine gelangen, von Shmerinka, wo er in
Gefangenschaft geraten war, nach der österreichischen Grenzstation
Podwoloczyska und dann nach Wien. Er hatte keinen bestimmten Plan,
der Weg lag unsicher vor ihm, lauter Windungen. Er wußte, daß es
lange dauern würde. Er hatte nur den einen Vorsatz: weder den
weißen noch den roten Truppen nahe zu kommen und sich um die
Revolution nicht zu kümmern. Die österreichisch-ungarische
Monarchie war zerfallen. Er hatte keine Heimat mehr. Sein Vater war
als Oberst gestorben, seine Mutter schon lange tot. Ein Bruder war
Kapellmeister in einer mittelgroßen deutschen Stadt.
In Wien erwartete ihn seine
Braut, Tochter des Bleistiftfabrikanten Hartmann. Von ihr wußte der
Oberleutnant nichts mehr, als daß sie schön, klug, reich und blond
war. Diese vier Eigenschaften hatten sie befähigt, seine Braut zu
werden.
Sie schickte ihm Briefe und
Leberpasteten ins Feld, manchmal eine gepreßte Blume aus
Heiligenkreuz. Er schrieb ihr jede Woche auf dunkelblauem
Feldpostpapier mit angefeuchtetem Tintenstift kurze Briefe, knappe
Situationsberichte, Meldungen.
Seitdem er aus dem Lager geflohen
war, hatte er nichts von ihr gehört.
Daß sie ihm treu war und auf ihn
wartete, daran zweifelte er nicht.
Daß sie auf ihn wartete, bis zu
seiner Ankunft, daran zweifelte er nicht.
Daß sie aber aufhören würde, ihn
zu lieben, wenn er einmal da war und vor ihr stand, schien ihm
ebenso gewiß. Denn als sie sich verlobt hatten, war er ein Offizier
gewesen. Die große Trauer der Welt verschönte ihn damals, die Nähe
des Todes vergrößerte ihn damals, die Weihe eines Begrabenen lag um
den Lebendigen, das Kreuz auf der Brust gemahnte an das Kreuz auf
einem Hügel. Rechnete man auf ein glückliches Ende, so warteten
nach dem triumphalen Marsch der siegreichen Truppen über die
Ringstraße der goldene Kragen des Majors, die Stabsschule und
schließlich der Generalsrang, alles umweht von dem weichen
Trommelklang des Radetzkymarsches.
Jetzt aber war Franz Tunda ein
junger Mann ohne Namen, ohne Bedeutung, ohne Rang, ohne Titel, ohne
Geld und ohne Beruf, heimatlos und rechtlos.
Er hatte seine alten Papiere und
ein Bild seiner Braut im Rock eingenäht. Es schien ihm günstiger,
mit dem fremden Namen, der ihm geläufig war wie sein eigener, durch
Rußland zu wandern. Erst jenseits der Grenze wollte er seine alten
Papiere wieder verwenden.
Den Pappendeckel, auf dem seine
schöne Braut abgebildet war, fühlte Tunda hart und beruhigend auf
der Brust. Die Photographie stammte von dem Hofphotographen, der
den Modezeitungen Bilder von Damen der Gesellschaft lieferte. In
einer Serie »Bräute unserer Helden« hatte sich auch Fräulein
Hartmann als die Braut des tapferen Oberleutnants Franz Tunda
befunden; eine Woche vor der Gefangennahme noch hatte ihn die
Zeitung erreicht.
Den Ausschnitt mit dem Bild
konnte Tunda bequem der Rocktasche entnehmen, sooft ihn die Lust
befiel, seine Braut zu betrachten. Er betrauerte sie schon, noch
ehe er sie gesehen hatte. Er liebte sie doppelt: als ein Ziel und
als eine Verlorene. Er liebte das Heldentum seiner weiten und
gefährlichen Wanderung. Er liebte die Opfer, die nötig waren, die
Braut zu erreichen, und die Vergeblichkeit dieser Opfer. Der ganze
Heroismus seiner Kriegsjahre erschien ihm kindisch im Vergleich zu
dem Unternehmen, das er jetzt wagte. Neben seiner Trostlosigkeit
wuchs die Hoffnung, daß er allein durch diese gefährliche Rückkehr
wieder ein begehrenswerter Mann wurde. Er war den ganzen Weg über
glücklich. Hätte man ihn gefragt, ob ihn die Hoffnung oder die
Wehmut glücklich machten, er hätte es nicht gewußt. In den Seelen
mancher Menschen richtet die Trauer einen größeren Jubel an als die
Freude. Von allen Tränen, die man verschluckt, sind jene die
köstlichsten, die man über sich selbst geweint hätte.
Es gelang Tunda, den weißen und
roten Truppen aus dem Weg zu gehen. Er durchquerte in einigen
Monaten Sibirien und einen großen Teil des europäischen Rußlands,
mit der Bahn, mit Pferden und zu Fuß. Er gelangte in die Ukraine.
Er kümmerte sich nicht um den Sieg oder die Niederlage der
Revolution. Mit dem Klang dieses Wortes verband er schwache
Vorstellungen von Barrikaden, Pöbel und dem Geschichtslehrer an der
Kadettenschule, Major Horwath. Unter »Barrikaden« stellte er sich
übereinandergeschichtete schwarze Schulbänke vor, mit aufwärts
ragenden Füßen. »Pöbel« war ungefähr das Volk, das sich am
Gründonnerstag bei der Parade hinter dem Kordon der Landwehr
staute. Von diesen Menschen sah man nur verschwitzte Gesichter und
zerbeulte Hüte. In den Händen hielten sie wahrscheinlich Steine.
Dieses Volk erzeugte die Anarchie und liebte die Faulheit.
Manchmal entsann sich Tunda auch
der Guillotine, die der Major Horwath immer Guillotin, ohne Endung,
aussprach, ebenso wie er Pari sagte statt Paris. Die Guillotine,
deren Konstruktion der Major genau kannte und bewunderte, stand
wahrscheinlich jetzt auf dem Stephansplatz, der Verkehr für Wagen
und Automobile war eingestellt (wie in der Silvesternacht), und die
Häupter der besten Familien des Reiches kollerten bis zur
Peterskirche und in die Jasomirgottstraße. Ebenso ging es in
Petersburg zu und in Berlin. Eine Revolution ohne Guillotine war
ebensowenig möglich wie ohne rote Fahne. Man sang die
Internationale, ein Lied, das der Kadettenschüler Mohr an den
Sonntagnachmittagen vorgetragen hatte, den sogenannten
»Schweinereien«. Mohr zeigte damals pornographische Ansichtskarten
und sang sozialistische Lieder. Der Hof war leer, man sah zum
Fenster hinunter, leer und still war er, man hörte das Gras
zwischen den großen Quadersteinen wachsen. – Eine »Guillotin« mit
dem abgehackten, gleichsam von ihr selbst abgeschnittenen »e« war
etwas Heroisches, Stahlblaues und Blutbetropftes. Rein als
Instrument betrachtet, schien sie Tunda heroischer als ein
Maschinengewehr.
Tunda nahm also persönlich keine
Partei. Die Revolution war ihm unsympathisch, sie hatte ihm die
Karriere und das Leben verdorben. Aber er war nicht im Dienst,
sobald er sich der Weltgeschichte gegenüberstellte, und glücklich,
daß ihn keine Vorschrift zwang, eine Partei zu ergreifen. Er war
ein Österreicher. Er marschierte nach Wien.
Im September erreichte er
Shmerinka. Er ging am Abend durch die Stadt, kaufte teures Brot für
eine seiner letzten Silbermünzen und hütete sich vor politischen
Gesprächen. Er wollte nicht verraten, daß er über die Lage nicht
orientiert war und daß er von weither kam.
Er beschloß, die Nacht zu
durchwandern.
Sie war klar, kühl, fast
winterlich; noch war die Erde nicht gefroren, aber der Himmel war
es schon. Gegen Mitternacht hörte er plötzlich Gewehrschüsse. Eine
Kugel schlug ihm den Stock aus der Hand. Er warf sich zu Boden, ein
Hufschlag traf ihn in den Rücken, er wurde ergriffen, hochgezogen,
quer über einen Sattel gelegt, über ein Pferd gehängt, wie ein
Wäschestück über eine Leine. Der Rücken schmerzte ihn, vom Galopp
vergingen ihm die Sinne, sein Kopf war mit Blut gefüllt, es drohte
ihm aus den Augen zu schießen. Er erwachte aus der Ohnmacht und
schlief gleich ein – so, wie er hing. Am nächsten Morgen band man
ihn ab, er schlief noch, gab ihm Essig zu riechen, er schlug die
Augen auf, fand sich auf einem Sack in einer Hütte liegen, ein
Offizier saß hinter einem Tisch. Pferde wieherten hell und
tröstlich vor dem Haus, auf dem Fenster saß eine Katze. Man hielt
Tunda für einen bolschewistischen Spion. Roter Hund! nannte ihn der
Offizier. Sehr schnell begriff der Oberleutnant, daß es nicht gut
war, russisch zu sprechen. Er sagte die Wahrheit, nannte sich Franz
Tunda, gestand, daß er auf dem Heimweg begriffen war und daß er ein
falsches Dokument besaß. Man glaubte ihm nicht. Schon machte er
eine Bewegung nach der Brust, wollte sein richtiges Papier
vorzeigen. Aber er empfand den Druck der Photographie wie eine
Warnung oder wie eine Mahnung. Er legitimierte sich nicht, es hätte
ihm übrigens gar nicht geholfen. Er wurde gefesselt, in einen Stall
geschlossen, sah den Tag durch eine Lücke, sah eine kleine Gruppe
von Sternen, sie waren hingestreut wie weißer Mohn – – Tunda dachte
an frisches Gebäck – – er war ein Österreicher. Nachdem er zweimal
die Sterne gesehen hatte, wurde er wieder ohnmächtig. Er erwachte
in einem Meer von Sonne, bekam Wasser, Brot und Schnaps,
Rotgardisten standen um ihn, ein Mädchen in Hosen war unter ihnen,
ihre Brust ahnte man hinter zwei großen, mit Papieren gefüllten
Blusentaschen.
»Wer sind Sie?« fragte das
Mädchen.
Sie schrieb alles auf, was Tunda
sagte.
Sie reichte ihm ihre Hand. Die
Rotgardisten gingen hinaus, sie ließen die Tür weit offen,
plötzlich fühlte man die glühende Sonne, obwohl sie weiß und ohne
Lust zu brennen war. Das Mädchen war kräftig, sie wollte Tunda
emporziehen und fiel selbst nieder.
Bei strahlender Sonne schlief er
ein. Dann blieb er bei den Roten.