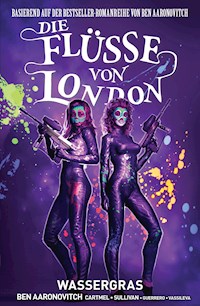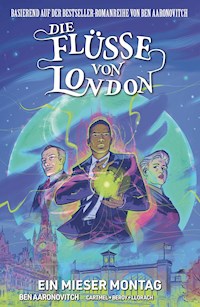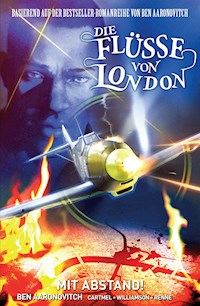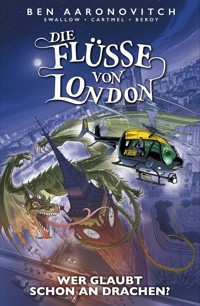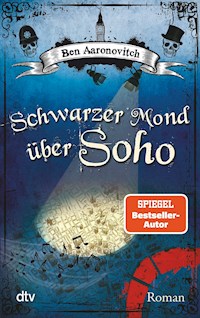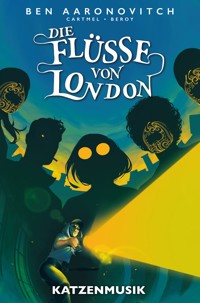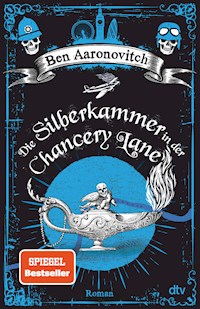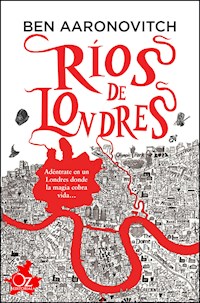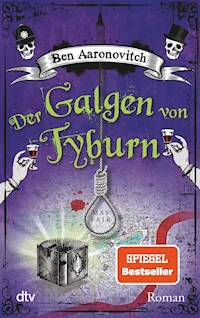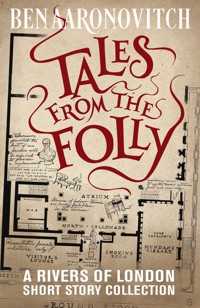9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
»Können Sie beweisen, dass Sie tot sind?« Peter Grant ist Police Constable in London mit einer ausgeprägten Begabung fürs Magische. Was seinen Vorgesetzten nicht entgeht. Auftritt Thomas Nightingale, Polizeiinspektor und außerdem der letzte Zauberer Englands. Er wird Peter in den Grundlagen der Magie ausbilden. Ein Mord in Covent Garden führt den frischgebackenen Zauberlehrling Peter auf die Spur eines Schauspielers, der vor 200 Jahren an dieser Stelle den Tod fand. »Mein Name ist Peter Grant. Ich bin seit Neuestem Police Constable und Zauberlehrling, der erste seit fünfzig Jahren. Mein Leben ist dadurch um einiges komplizierter geworden. Jetzt muss ich mich mit einem Nest von Vampiren in Purley herumschlagen, einen Waffenstillstand zwischen Themsegott und Themsegöttin herbeiführen, Leichen in Covent Garden ausgraben. Ziemlich anstrengend, kann ich Ihnen sagen – und der Papierkram!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Peter Grant ist Police Constable in London mit einer ausgeprägten Begabung fürs Magische. Was seinen Vorgesetzten nicht entgeht. Auftritt Thomas Nightingale, Polizeiinspektor und außerdem der letzte Zauberer Englands: Er wird Peter in den Grundlagen der Magie ausbilden. Ein grausiger Mord in Covent Garden führt den frischgebackenen Zauberlehrling Peter auf die Spur eines Schauspielers, der vor 200 Jahren an dieser Stelle den Tod fand. Und er stellt fest, dass es mehr Dinge in London gibt, als seine Polizeischulweisheit sich träumen ließ. Wer hätte zum Beispiel geahnt, dass der Themsegott und die Themsegöttin einander spinnefeind sind, was gravierende Auswirkungen auf alle Flüsse Londons hat? Peter soll vermitteln – keine leichte Aufgabe, wenn man sowieso anfällig für Magie ist und insbesondere eine der Flusstöchter unwiderstehliche Reize besitzt ...
Ben Aaronovitch
Die Flüsse von London
Roman
Deutsch von Karlheinz Dürr
Zum Gedenken an Colin Ravey,
denn manche Menschen sind zu groß, als dass sie
Platz in nur einem Universum hätten.
1 Ein fragwürdiger Zeuge
Alles begann an einem kalten Dienstag im Januar, morgens um halb zwei, als Martin Turner, Straßenkünstler und nach eigenen Worten Gigolo in Ausbildung, vor der Säulenvorhalle von St. Paul’s am Covent Garden über eine Leiche stolperte. Martin war selbst nicht mehr allzu nüchtern und glaubte zuerst, über einen der Nachtschwärmer gestolpert zu sein, die manchmal die Winkel der Piazza als Toilette oder vorübergehenden Schlafplatz benutzten. Er streifte die Gestalt auf dem Boden mit dem typischen Londoner Blick – einem schnellen Seitenblick, mit dem man im Vorbeigehen feststellt, ob es sich um einen Betrunkenen, einen Bekloppten oder um einen Menschen handelt, der Hilfe braucht. Die Tatsache, dass durchaus auch jemand alle drei Zustände gleichzeitig aufweisen kann, ist einer der Gründe, warum in London gute Samariter für Extremsportler gehalten werden – so ungefähr wie Basejumper oder Krokodilringer. Martin, dem zunächst nur der Markenmantel und die guten Schuhe aufgefallen waren, hatte die Gestalt gerade in die Kategorie Besoffene eingestuft, als er noch etwas anderes bemerkte: Dem Mann fehlte der Kopf.
Wie Martin den Ermittlern bei seiner Vernehmung erklärte, sei es doch ein Glück gewesen, dass er eine ganze Menge Alkohol intus gehabt habe, weil er nämlich sonst ziemlich viel Zeit mit Schreien oder panischem Herumrennen vergeudet hätte – vor allem, als ihm klar wurde, dass er mitten in einer riesigen Blutlache stand. Stattdessen wählte er mit der Bedächtigkeit, die Betrunkenen wie auch vor Entsetzen fast gelähmten Menschen eigen ist, die Notrufnummer 999 und informierte die Polizei.
Die Notrufzentrale alarmierte den nächsten Einsatzwagen, und die ersten Polizisten erreichten den Schauplatz sechs Minuten später. Ein Beamter widmete sich dem schlagartig nüchtern gewordenen Martin, während sein Kollege über Funk bestätigte, dass da, jawohl, eine Leiche liege und dass man unter den gegebenen Umständen wohl nicht davon ausgehen könne, dass es sich um einen Unfall mit Todesfolge handle. Den Kopf fanden sie sechs Meter entfernt; er war hinter eine der klassizistischen Säulen gerollt, die die Vorhalle der Kirche stützten. Die Beamten in der Polizeizentrale setzten nunmehr das Mordermittlungsteam des Bezirks in Kenntnis, dessen diensthabender Beamter, ausgerechnet der jüngste und unerfahrenste Detective Constable des Teams, eine halbe Stunde später eintraf. Er warf einen einzigen Blick auf Mister Kopflos und riss dann telefonisch seinen Chef aus dem Schlaf. Danach rollte die Mordkommission der Metropolitan Police in ihrer gesamten Pracht und Herrlichkeit an und ergoss sich über die fünfundzwanzig Meter Kopfsteinpflaster, die sich vom Portikus der Kirche bis zur Markthalle erstrecken. Der Gerichtsmediziner kam und bescheinigte den Tod, gab eine vorläufige Einschätzung der Todesursache und veranlasste den Abtransport der Leiche, um eine Autopsie durchzuführen. (Dabei kam es zu einer kleinen Verzögerung, weil man erst noch einen Beweisbeutel beschaffen musste, der groß genug für den Kopf war.) Die Spurensicherung rückte wie immer als geschlossene Gruppe an und verlangte – um zu beweisen, dass sie die Wichtigsten waren –, dass die Absperrung des Leichenfundorts erweitert werden und den gesamten Westteil der Piazza umfassen müsse. Dafür wurden noch mehr Uniformierte benötigt, weshalb der Detective Chief Inspector, der als Ermittlungsleiter fungierte, das Polizeirevier Charing Cross anrief und darum bat, ihm ein paar Beamte auszuleihen. Der Beamte vom Dienst hörte das magische Wort »Überstunden«, marschierte ins Wohnheim und bellte lautstark Freiwillige aus ihren warmen, gemütlichen Betten. So wurde die Absperrung erweitert, die Spurensuche lief an und die Jungpolizisten wurden zu diversen Botengängen mit unklarem Ziel abkommandiert, bis kurz nach fünf Uhr alles zum Stillstand kam. Die Leiche war abtransportiert, die Ermittler waren fort und die Forensiker waren einhellig der Meinung, dass man vor der Morgendämmerung nichts mehr tun könne – und die würde erst in drei Stunden einsetzen. Bis dahin wurden nur ein paar Uniformierte benötigt, die den Tatort bis zum nächsten Schichtwechsel bewachten.
So kam es, dass ich um sechs Uhr morgens im eiskalten Wind am Covent Garden herumhing. Und dass ich es war, der dem Geist begegnete.
Manchmal denke ich, dass mein Leben viel weniger interessant und ganz bestimmt sehr viel weniger gefährlich verlaufen wäre, wenn nicht Lesley, sondern ich Kaffee holen gegangen wäre. Hätte das jedem passieren können oder war es mir vom Schicksal vorbestimmt? Wann immer ich mir solche Fragen stelle, hilft es mir, an einen weisen Spruch meines Vaters zu denken: »Verflixt, wer weiß schon, warum dies oder jenes passiert?«
Covent Garden ist eine große Piazza mitten in London. Am Ostende des Platzes steht das Royal Opera House, in der Mitte eine überdachte Markthalle und am Westende befindet sich die kleine St. Paul’s Church. Der Platz war früher einmal der wichtigste Obst- und Gemüsemarkt Londons, doch wurde der Markt schon ungefähr zehn Jahre vor meiner Geburt an einen größeren Platz südlich der Themse verlegt. Covent Garden hat eine lange und vielfältige Geschichte, in der es hauptsächlich um Verbrechen, Prostitution und Theater ging, aber heute sind der Platz und die Markthalle Touristenattraktionen. St. Paul’s ist auch als »Schauspielerkirche« bekannt und ist nicht mit der gewaltigen St. Paul’s Cathedral zu verwechseln. Erbaut wurde die Kirche 1638 von Inigo Jones. Dass ich das alles weiß, hat einen einfachen Grund: Wenn man stundenlang im eiskalten Wind herumstehen muss, ist man für jede Art von Abwechslung dankbar, die man finden kann – und an der Seitenwand der Kirche befand sich eine große und bemerkenswert ausführliche Informationstafel. Wussten Sie zum Beispiel, dass das erste amtlich registrierte Opfer der Pestepidemie von 1665, an deren Ende London in Flammen aufging, auf dem Friedhof von St. Paul’s begraben liegt? Das und noch viel mehr lernte ich schon in den ersten zehn Minuten, als ich Schutz vor dem eisigen Wind suchte.
Das Mordermittlungsteam hatte den westlichen Teil der Piazza mit einem Band abgesperrt, das sich über die Einmündungen der King Street und der Henrietta Street sowie über die gesamte Vorderseite des Markthallengebäudes spannte. Ich bewachte das eine Ende vor der Kirche, wo mir die Säulenvorhalle ein wenig Schutz bot. Police Constable Lesley May, ebenso wie ich noch in der Probezeit, bewachte die Piazza-Seite, wo sie sich im Markteingang unterstellen konnte.
Lesley war klein, blond und sehr attraktiv, selbst wenn sie eine Stichschutzweste trug. Wir hatten gemeinsam die Grundausbildung in Hendon durchlaufen und wurden dann für die Probezeit nach Westminster versetzt. Unsere Beziehung war rein beruflicher Natur, obwohl ich nicht selten eine gewisse Sehnsucht verspürte, ihr ein wenig an die Uniformwäsche zu gehen.
Weil wir beide Polizeianwärter waren, hatte man uns einen erfahrenen Constable als Aufpasser zugeteilt – der dieser verantwortungsvollen Aufgabe in einem durchgehend geöffneten Café im St. Martin’s Close nachging.
Mein Handy klingelte. Ich brauchte eine Weile, bis ich es unter Schutzweste, Einsatzgürtel, Schlagstock, Handschellen, digitalem Funkgerät und der lästigen, aber glücklicherweise wasserdichten Warnweste herausgefischt hatte. Lesley meldete sich.
»Ich hole mir einen Kaffee«, sagte sie. »Willst du auch einen?«
Ich schaute zur Markthalle hinüber und sah sie winken.
»Damit rettest du mir das Leben«, sagte ich, und schon lief sie in Richtung James Street davon.
Sie war noch keine Minute weg, als ich in der Säulenvorhalle eine Gestalt wahrnahm. Ein klein gewachsener Mann in einem Anzug drückte sich im Schatten hinter einer der Säulen herum.
Ich sprach ihn an, wie es die Vorschriften der Metropolitan Police vorsahen, mehr oder weniger.
»He!«, rief ich, »was machen Sie da?«
Die Gestalt fuhr herum und ich sah kurz ein bleiches, erschrecktes Gesicht im Dunkeln schimmern. Der Mann trug einen schäbigen, altmodischen Anzug mit Weste und Uhrenkette sowie einen reichlich lädierten Zylinder. Mit diesen Klamotten konnte er nur einer der Straßenkünstler sein, die eine Lizenz hatten, auf der Piazza aufzutreten. Für einen Auftritt schien es mir allerdings ein bisschen früh am Tag zu sein.
»Kommt einmal hier rüber«, sagte er und winkte mir mit dem Zeigefinger.
Ich vergewisserte mich, dass mein ausziehbarer Schlagstock griffbereit war, und ging hinüber. Wir Polizisten sollten die Bürger immer überragen, selbst dann, wenn sie uns tatsächlich nur mal helfen wollen, deshalb tragen wir klobige Schuhe und hohe Helme. Aber als ich mich dem Mann näherte, sah ich, dass er nicht nur klein, sondern ausgesprochen winzig war, höchstens einsfünfzig. Ich widerstand dem Impuls, in die Hocke zu gehen, um auf Augenhöhe mit ihm zu kommen.
»Ich habe alles gesehen, Wachtmeister«, raunte mir der Mann zu. »Furchtbar war es.«
In Hendon wird dir eingetrichtert, erst mal Name und Adresse aufzunehmen, bevor du irgendetwas unternimmst. Ich zog meinen Notizblock und Kuli heraus. »Darf ich zunächst einmal Ihren Namen notieren, Sir?«
»Dürft Ihr natürlich. Mein Name ist Nicholas Wallpenny, aber fragt mich nicht, wie das buchstabiert wird, denn mit dem Schreiben habe ich es nicht so.«
»Sind Sie Straßenkünstler?«, fragte ich weiter.
»Könnte man sagen«, erwiderte Nicholas. »Auf jeden Fall waren meine Vorführungen bislang auf die Straße begrenzt. Obwohl ich in einer kalten Nacht wie dieser nicht abgeneigt wäre, meinen Unternehmungen eine gewisse Innerlichkeit zu verleihen. Wenn Ihr versteht, was ich meine, Wachtmeister.«
Am Kragen seines Jacketts war ein Abzeichen befestigt: ein Zinnskelett, dargestellt mitten im Luftsprung oder Freudentanz. Das kam mir ein bisschen gruftig vor, besonders für einen zu kurz geratenen Cockney-Opa, aber London ist schließlich die bunt zusammengewürfelte Multikultihauptstadt der Welt. Also notierte ich: Straßenkünstler.
»Und nun, Sir«, fuhr ich fort, »schildern Sie mir bitte kurz, was Sie gesehen haben.«
»Mehr als genug, Wachtmeister.«
»Sie waren also schon früher heute Morgen hier?« In den Kursen hatten meine Ausbilder immer betont, dass man einem Zeugen keinerlei Hinweise liefern dürfe. Die Informationen sollten stets nur in einer Richtung fließen.
»Bin immer hier, des Morgens wie des Abends.« Nicholas hatte offenbar nicht die gleichen Kurse besucht wie ich.
»Wenn Sie etwas beobachtet haben«, erklärte ich streng, »sollten Sie mit mir zum Polizeirevier kommen, damit wir Ihre Aussage aufnehmen können.«
»Wäre ein bisschen schwierig«, meinte Nicholas. »Da ich tot bin.«
Ich glaubte mich verhört zu haben. »Wenn Sie sich um Ihre Sicherheit sorgen ...«
»Ich sorge mich um gar nichts mehr, Wachtmeister«, entgegnete er. »Alldieweil ich nämlich schon seit einhundertzwanzig Jahren tot bin.«
»Wenn Sie tot sind«, fuhr es mir unwillkürlich heraus, »wie kommt es dann, dass wir miteinander sprechen können?«
»Wahrscheinlich habt Ihr einen Schimmer vom Zweiten Gesicht abbekommen«, sagte Nicholas. »Bisschen was von der alten Eusapia Palladino vielleicht.« Er betrachtete mich genauer. »Oder eher von Eurem Vater? War Dockarbeiter, nicht wahr, Matrose oder so was, und hat Euch das Kraushaar und die dicken Lippen vererbt?«
»Können Sie beweisen, dass Sie tot sind?«, fragte ich.
»Wenn Euch daran liegt«, sagte er gleichmütig und trat aus dem Schatten der Säule.
Er war transparent, ungefähr so wie ein Hologramm in einem Film. Dreidimensional, wirklich und wahrhaftig vorhanden, aber eben doch durchsichtig, verdammt noch mal. Ich konnte tatsächlich durch ihn hindurch das weiße Zelt sehen, das von der Spurensicherung als Schutz über dem Fundort der Leiche aufgestellt worden war.
Okay, sagte ich mir, auch wenn du gerade mal kurz durchgeknallt bist, heißt das noch lange nicht, dass du deine Ausbildung als Polizist vergessen darfst.
»Bitte schildern Sie mir, was Sie beobachtet haben«, sagte ich formell.
»Tja, also, ich sah den ersten Gentleman, der wo ermordet wurde, von der James Street herunterkommen. Stattlicher Mann, machte große Schritte, militärische Haltung, auf diese komische moderne Weise gekleidet. Hätte ihn als prächtig gewachsen bezeichnet, in meinen körperlichen Tagen.« Nicholas hielt inne, um kräftig auszuspucken. Nichts klatschte auf den Boden. »Dann kam da noch ein zweiter Herr, der wo den Mord ausführte, der spazierte also von der anderen Seite herauf, von der Henrietta Street her. Nicht so nett gekleidet. Trug eine blaue Arbeiterhose und Ölzeug wie ein Fischer. Genau dort gingen sie aneinander vorbei.« Nicholas wies auf eine Stelle, die ungefähr zehn Meter vom Kirchenportal entfernt war. »Schätze, sie kannten einander, weil sie sich zunickten. Blieben aber nicht auf ein Schwätzchen stehen oder so. War ja auch verständlich, nicht wahr, ist ja nun nicht gerade eine Nacht, in der man gerne draußen herumsteht.«
»Sie gingen also aneinander vorbei?«, fragte ich, hauptsächlich deshalb, weil ich mit dem Schreiben nicht nachgekommen war, und weniger, um diesen Punkt weiter aufzuklären. »Und Sie hatten den Eindruck, dass sie einander kannten?«
»Wie flüchtige Bekannte«, meinte Nicholas, »nicht wie Busenfreunde. Schon wegen dem nicht, was sich dann zutrug.«
Ich fragte ihn, was sich dann zutrug.
»Na, der zweite, der mörderische Gentleman, der setzt sich eine Mütze auf, schlüpft in eine rote Jacke, zieht einen Stock oder Prügel heraus und schleicht sich so still und leise, wie sich ein Zechpreller davonschleicht, von hinten an den ersten Herrn heran und schlägt ihm säuberlich den Kopf ab.«
»Sie machen sich wohl über mich lustig«, sagte ich.
»Nein, aber nein, nicht doch, niemals!«, versicherte Nicholas und bekreuzigte sich. »Ich schwöre es bei meinem eigenen Tod, und das ist der heiligste Eid, den ein Geist ablegen kann! War ein entsetzlicher Anblick, der Kopf flog runter und das Blut sprudelte oben raus.«
»Was machte der Mörder dann?«
»Nun, nachdem er sein Geschäft erledigt hatte, machte er sich davon, die New Row runter, schneller als ein Köter hinter einer läufigen Hündin herrennt.«
Ich dachte kurz nach. New Row führte zur Charing Cross Road hinunter, ideal, um ein Taxi oder einen Minibus oder sogar einen der Nachtbusse zu nehmen. So hätte der Killer innerhalb einer Viertelstunde aus dem Zentrum von London verschwinden können.
»Aber das war noch nicht das Schlimmste«, fuhr Nicholas jetzt etwas lauter fort. Anscheinend legte er großen Wert darauf, dass man ihm aufmerksam zuhörte. »Der mörderische Gentleman, der hatte was ... Unheimliches.«
»Unheimlich?«, fragte ich. »Dabei sind Sie doch selber ein Geist.«
»Nun, ich mag ein Geist sein«, erklärte Nicholas würdevoll, »aber das bedeutet eben auch, dass ich etwas Unheimliches erkenne, wenn ich es sehe.«
»Und was genau haben Sie gesehen?«
»Der mörderische Herr wechselte nicht einfach nur Hut und Mantel, sondern auch sein Gesicht«, sagte Nicholas. »Jetzt sagt bloß, das ist nicht unheimlich!«
Jemand rief meinen Namen. Lesley war mit dem Kaffee zurück.
Während ich kurz zu ihr hinüberblickte, verschwand Nicholas.
Ich stand da und starrte wie ein Idiot ins Leere, bis Lesley noch einmal rief: »Willst du nun einen Kaffee oder nicht?«
Ich trabte über das Kopfsteinpflaster hinüber, wo Lesley, der Engel, mit dem Styroporbecher auf mich wartete. »War irgendwas los, während ich weg war?«, fragte sie. Ich schüttelte stumm den Kopf und nippte an meinem Kaffeebecher. Die Worte Ich habe gerade mit einem Geist gesprochen, der alles beobachtet hat kamen mir nicht mal ansatzweise über die Lippen.
Am nächsten Tag wachte ich gegen elf Uhr auf – viel früher, als ich geplant hatte. Lesley und ich waren um acht Uhr abgelöst worden, waren zum Wohnheim zurückgetrottet und sofort ins Bett gesunken. In getrennte Betten, leider.
Ein Zimmer im Wohnheim eines Polizeireviers hat einige Vorteile: Es ist billig, nahe am Arbeitsplatz und befindet sich nicht im Haus meiner Eltern. Es hat aber auch ein paar Nachteile: Man muss sich die Unterkunft mit Leuten teilen, deren Fähigkeit zum Zusammenleben mit anderen, normalen Menschen ziemlich schwach entwickelt ist und die gewohnheitsmäßig schwere Schuhe tragen; jeder Schichtwechsel klingt wie eine niedergehende Gerölllawine. Und wenn man den Kühlschrank öffnet, findet man so viele Hinterlassenschaften, dass jeder Mikrobiologe vor Neid grün anlaufen würde.
Ich blieb noch eine Weile in meinem standardmäßig schmalen Wohnheimbett liegen und starrte das Poster von Estelle an, das ich an der gegenüberliegenden Wand aufgehängt hatte. Ist mir egal, was die Leute sagen, man ist doch nie zu alt, um mit dem Anblick einer schönen Frau aufzuwachen.
Ich lag zehn Minuten lang so da, in der Hoffnung, dass die Erinnerung daran, dass ich mit einem Geist gesprochen hatte, allmählich wie ein Traum verblassen würde. Das geschah aber nicht, deshalb stand ich auf und ging unter die Dusche. Heute war ein wichtiger Tag, und ich musste auf Zack sein.
Entgegen der verbreiteten Meinung ist die Metropolitan Police von London immer noch eine Organisation der Arbeiterklasse und lehnt als solche jede andeutungsweise Manifestation einer Offizierskaste ab. Das ist der Grund, warum jeder neu ausgebildete Constable ohne Rücksicht auf seinen Bildungsgrad erst mal eine zweijährige Probe- oder Anwärterzeit als gewöhnlicher Streifenpolizist absolvieren muss. Schon deshalb, weil nichts den Charakter besser festigt, als von den Mitbürgern beschimpft, bespuckt oder angekotzt zu werden.
Gegen Ende der Anwärterzeit beginnt man dann, sich auf eine Stelle in den verschiedenen Abteilungen und Direktoraten zu bewerben, in die die Metropolitan Police gegliedert ist. Die meisten Anwärter bleiben als uniformierte Constables in einem der Polizeireviere Londons. Die Met betont immer wieder, wie ausgesprochen positiv es zu bewerten sei, wenn sich die frischgebackenen Constables für den wichtigen Dienst als uniformierter Bobby in den Straßen Londons entschieden. Natürlich, es muss schließlich auch Leute geben, die bereit sind, sich beleidigen, bespucken und ankotzen zu lassen, und deshalb zolle ich jedem tapferen Kollegen meine höchste Anerkennung, der sich zu diesem wichtigen Dienst meldet.
Genau dies war auch die noble Berufung, die mein Ausbildungsleiter, Inspector Francis Neblett, einst verspürt hatte. Neblett war im Zeitalter der Dinosaurier in die Met eingetreten, schnell zum Inspector aufgestiegen und hatte dann die nächsten dreißig Jahre in diesem Rang der Met glücklich und insgesamt zufrieden gedient. Er war ein stämmiger Mann mit strähnigem braunem Haar und einem Gesicht, das aussah, als habe jemand es einst mit der flachen Seite einer Schaufel platt geklopft. Neblett war so altmodisch, dass er ständig eine Uniformjacke über dem vorschriftsmäßigen weißen Hemd trug, sogar dann, wenn er mit »seinen Jungs« auf Patrouille ging.
Heute war ich bei ihm zu einem Dienstgespräch angemeldet, bei dem er mit mir meine zukünftigen beruflichen Aussichten »diskutieren« wollte. Theoretisch war das Teil eines strukturierten Prozesses zur Karriereentwicklung, der sowohl für die Met als auch für mich selbst zu positiven Ergebnissen führen sollte. Nach diesem Gespräch würde eine endgültige Entscheidung über mein zukünftiges Einsatzfeld getroffen werden – und wie ich stark vermutete, würden meine eigenen Wünsche dabei keine große Rolle spielen.
Lesley wirkte unerhört frisch und aufgeweckt, als ich sie in der schmuddeligen Kleinküche antraf, die von allen Bewohnern des Stockwerks benutzt wurde. In einem der Küchenschränke wurde Aspirin aufbewahrt. Wenn es etwas gab, das in jedem Polizeiwohnheim immer vorhanden war, dann war es Aspirin. Ich nahm zwei Tabletten und spülte sie mit Leitungswasser hinunter.
»Mister Kopflos hat einen Namen«, sagte sie, während ich Kaffeewasser aufsetzte. »William Skirmish, ein Medientyp, wohnt oben in Highgate.«
»Was haben sie sonst noch herausgefunden?«
»Das Übliche. Offenbar sinnloser Totschlag, bla bla bla. Zunehmende Gewalt in der Innenstadt, was soll aus London werden, bla bla.«
»Bla«, nickte ich.
»Was hast du heute vor?«, wollte sie wissen.
»Hab um zwölf mein Karrieregespräch mit Neblett.«
»Na, viel Glück«, sagte Lesley.
Als mich Inspector Neblett mit dem Vornamen anredete, war mir sofort klar, dass die Sache voll danebengehen würde.
»Nun erklären Sie mir mal, Peter«, begann er, »wie Sie sich Ihre weitere Laufbahn vorstellen.«
Ich rutschte auf meinem Stuhl hin und her.
»Nun ja, Sir, ich dachte an die Kriminalabteilung.«
»Sie wollen ein Detective beim CID werden?« Neblett war ein eingefleischter Uniformträger und hielt von Kriminalbeamten in Zivil ungefähr so viel wie der Normalbürger von Steuerfahndern. Unter Druck würde man vielleicht eingestehen, dass sie ein notwendiges Übel sind, aber niemals würde man dem Töchterchen erlauben, so einen zu heiraten.
»Jawohl, Sir.«
»Warum wollen Sie sich mit dem CID zufriedengeben?«, fragte er. »Warum nicht gleich eine der Spezialabteilungen?«
Weil es keine so gute Idee ist, wenn man als Anwärter überall verkündet, man wolle in der legendären Einheit Sweeney oder in einer Mordkommission eingesetzt werden und in einem schicken Untersatz durch die Stadt brausen und handgemachte Schuhe tragen, aber das sagte ich natürlich nicht.
»Ich dachte, ich starte erst mal von unten und arbeite mich hoch, Sir«, erklärte ich bescheiden.
»Das ist eine sehr vernünftige Einstellung«, sagte Neblett.
Mir kam plötzlich ein furchtbarer Verdacht: Wollten sie mich am Ende ins Trident stecken? Das war die Operative Einheit, die sich mit bewaffneten Gewaltverbrechen in der schwarzen Gemeinschaft befasste. Trident suchte ständig nach farbigen Beamten, die man für entsetzlich gefährliche verdeckte Ermittlungen einsetzen konnte. Ich mit meinem gemischten ethnischen Hintergrund kam dafür durchaus in Frage. Ich meine ja nicht, dass die Arbeit dort nicht wichtig wäre, aber es war eben eine Arbeit, für die ich, wie ich fand, nicht besonders gut geeignet war. Schließlich muss man seine eigenen Grenzen erkennen, und meine Grenzen begannen dort, wo es nötig wäre, nach Peckham umzuziehen und mit Straßengangs, Sozialhilfeschwindlern und abgedrehten weißen Kids herumzuhängen, die nichts von Eminems Ironie kapieren.
»Ich stehe nicht auf Rap, Sir«, erklärte ich.
Neblett nickte mit hochgezogenen Augenbrauen. »Gut zu wissen«, sagte er, und ich beschloss, künftig mein vorlautes Mundwerk besser zu beherrschen.
»Peter«, fuhr er fort, »in den vergangenen zwei Jahren konnte ich mir ein sehr positives Bild von Ihrer Intelligenz und Ihrer Fähigkeit zu harter Arbeit machen.«
»Danke, Sir.«
»Und außerdem haben Sie ja auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund.«
Ich habe mein Abitur in Mathe, Physik und Chemie gemacht, aber die Noten waren nicht berauschend. Kein Wissenschaftler würde einen dermaßen mittelmäßigen Abschluss als »naturwissenschaftlichen Hintergrund« bezeichnen. Er hatte jedenfalls nicht ausgereicht, um mir den erhofften Studienplatz zu sichern.
»Und Sie sind sehr gut darin, Ihre Überlegungen zu Papier zu bringen«, fuhr Neblett fort.
In meinem Magen ballte sich ein Klumpen der Enttäuschung zusammen. Ich wusste jetzt genau, für welchen scheußlichen Einsatzbereich mich die Met auserkoren hatte.
»Wir schlagen Ihnen die Case Progression Unit vor«, sagte Neblett.
Theoretisch ist die CPU als Hilfseinrichtung eine sehr vernünftige Sache. Nach verbreiteter Auffassung ertrinken Polizisten normalerweise im Papierkram: Verdächtige müssen registriert werden, die Beweiskette muss lückenlos sein und die Vorgaben der Politiker und die gesetzlichen Regeln für die Polizei- und Ermittlungsarbeit müssen bis auf den letzten Buchstaben befolgt werden. Die Hauptaufgabe des CPU besteht deshalb darin, die armen überlasteten Constables von diesem Papierkram zu befreien, damit sie mehr Zeit haben, sich draußen auf der Straße von den Mitbürgern beleidigen, bespucken und ankotzen zu lassen. So kann immer ein Bobby auf der Straße präsent sein, das Verbrechen wird endgültig besiegt und die braven Leser der Boulevardpresse unserer ruhmreichen Nation können sich beschützt und sicher fühlen.
In Wahrheit ist es mit dem Papierkram halb so wild – jede halbwegs kompetente Aushilfe könnte das Zeug in kaum einer halben Stunde erledigen und hätte trotzdem noch massenhaft Zeit, sich die Nägel zu feilen. Das Problem ist, dass es bei der Polizeiarbeit vor allem um Autorität und Präsenz geht, und darum, dass man sich daran erinnert, was ein Verdächtiger an einem Tag sagte, damit man ihn am nächsten Tag bei einer Lüge festnageln kann. Es geht darum, in einer Gefahrensituation nicht weg-, sondern hinzulaufen, immer ruhig zu bleiben und schließlich derjenige zu sein, der das verdächtige Päckchen öffnet. Das heißt nicht, dass man nicht beides tun könnte, nur ist das nicht gerade die Regel. Im Grunde wollte mir Neblett sagen, dass ich eigentlich kein richtiger Polizist war, also keiner, der die Bösewichte fängt, sondern nur einer, der einen wertvollen Beitrag leistet, damit die echten Bullen mehr Zeit für die wichtigeren Aufgaben bekommen. Ich konnte mit übelerregender Gewissheit voraussagen, dass er jeden Augenblick die Worte »wertvoller Beitrag« ins Gespräch werfen würde.
»Ich hatte eigentlich gehofft, eine aktivere Rolle zu übernehmen, Sir«, sagte ich.
»Aber das ist doch eine aktive Rolle!«, erwiderte Neblett. »Bei der CPU werden Sie einen wertvollen Beitrag leisten können.«
Normalerweise brauchen Polizisten keine Ausrede, wenn sie ins Pub gehen wollen, aber eine der vielen Nicht-Ausreden ist die Tradition, am Ende der Probezeit ein richtiges Besäufnis zu veranstalten. Dabei sorgen die Beamten der jeweiligen Schicht dafür, dass sich die soeben neu ernannten Constables total volllaufen lassen. Zu diesem Zweck wurden auch Lesley und ich über den Strand zum Pub »Roosevelt Toad« geschleppt. Der Plan war, uns mit Bier abzufüllen, bis wir uns nur noch in der Horizontalen fortbewegen konnten.
»Wie ist es gelaufen?«, rief Lesley, um das Stimmengewirr im Pub zu übertönen.
»Beschissen«, schrie ich zurück. »CPU.«
Lesley verzog das Gesicht.
»Und bei dir?«, wollte ich wissen.
»Sag ich dir lieber nicht. Würde dir doch nur die Laune verhageln.«
»Nur zu«, sagte ich. »Ich werd’s schon aushalten.«
»Ich bin befristet der Mordkommission Skirmish zugeordnet worden.«
Das war, soweit ich wusste, noch nie vorgekommen. »Etwa als Detective?«
»Vorerst noch als normaler Constable, aber in Zivil«, sagte sie. »Es ist ein wichtiger Fall und sie brauchen noch mehr Leute.«
Sie behielt natürlich recht. Es verhagelte mir die Laune. Gründlich.
Damit war der Abend für mich gelaufen. Ich hing zwar noch ein oder zwei Stunden im Pub herum, aber weil ich Selbstmitleid hasse, vor allem bei mir selbst, ging ich schließlich hinaus, um das zu tun, was einen Eimer Wasser über meinen Kopf zu gießen am nächsten kam: Ich stellte mich in den Regen.
Leider hatte es aber inzwischen aufgehört zu regnen, also setzte ich meine Hoffnung darauf, dass mich die eiskalte Luft nüchtern machen würde.
Lesley ließ sich volle zwanzig Minuten Zeit, bis sie mich suchen kam.
»Zieh verdammt noch mal deinen Mantel an«, sagte sie. »Du holst dir sonst noch den Tod.«
»Warum? Ist es denn kalt?«
»Dachte ich mir doch, dass du sauer wirst.«
Ich zog meinen Mantel an. »Hast du es schon deiner Sippe erzählt?«, fragte ich. Lesley hatte nicht nur ihre Eltern und eine Großmutter, sondern auch noch fünf ältere Schwestern, die alle im Umkreis von hundert Metern um ihr Elternhaus in Brightlingsea wohnten. Ich war ihnen schon ein paarmal begegnet, wenn der gesamte Stamm zu einem Einkaufsbummel in London eingefallen war. Sie machten ein dermaßenes Getöse, dass es an Landfriedensbruch grenzte, und hätten wahrscheinlich die Polizei auf den Plan gerufen, wenn die nicht schon da gewesen wäre, in Gestalt von mir und Lesley.
»Schon heute Nachmittag«, antwortete Lesley. »Alle haben sich gefreut. Sogar Tanya, obwohl sie keinen blassen Schimmer hat, was es bedeutet. Und du – hast du es schon deinen Leuten erzählt?«
»Was hätte ich ihnen erzählen sollen?«, fragte ich. »Dass ich einen Schreibtischjob gekriegt habe?«
»Nichts spricht gegen Schreibtischjobs.«
»Ich will Polizist sein!«, sagte ich.
»Weiß ich doch«, nickte Lesley. »Aber warum eigentlich?«
»Ich will der Gemeinschaft dienen«, erklärte ich. »Und böse Jungs fangen.«
»Also nicht wegen der glänzenden Uniformknöpfe? Und der Möglichkeit, einem Typ lässig die Handschellen anzulegen und zu verkünden: ›Das war’s, mein Junge!‹«
»Nein, ich will für ein friedliches Zusammenleben sorgen. Ordnung ins Chaos bringen ...«
Sie schüttelte betrübt den Kopf. »Wie kommst du bloß auf die Idee, dass es so etwas wie Ordnung gibt? Du warst doch schon mal Samstagnacht auf Patrouille – kam dir das wie friedliches Zusammenleben vor?«
Ich wollte mich nonchalant gegen einen Lampenpfosten lehnen, aber es ging schief und ich kippte knapp daran vorbei und geriet ins Stolpern. Lesley fand das viel komischer, als es meiner Ansicht nach war. Sie musste sich auf die Treppe vor der Waterstone’s-Buchhandlung setzen, um wieder zu Atem zu kommen.
»Okay«, sagte ich schließlich. »Warum haben sie dir den Job gegeben?«
»Weil ich verdammt gut bin.«
»Na, so gut auch wieder nicht.«
»Oh doch! Seien wir mal ehrlich: Als Polizistin bin ich echt super.«
»Und was bin ich dann?«
»Zu leicht ablenkbar.«
»Bin ich nicht!«
»Silvesternacht, Trafalgar Square, riesige Menschenmenge, Bande von Schwachköpfen pisst in den Brunnen – schon vergessen? Wir rücken an, die Kerle werden pampig, und wo warst du?«
»Ich war nur ein paar Sekunden lang weg«, verteidigte ich mich.
»Du musstest unbedingt erst noch die Aufschrift auf dem Arsch des Löwen am Brunnen entziffern«, sagte Lesley vorwurfsvoll. »Ich kämpfe allein gegen eine ganze Bande von sturzbesoffenen Knallköpfen, während du mit historischen Nachforschungen beschäftigt bist.«
»Willst du nicht wissen, was auf dem Arsch des Löwen stand?«, fragte ich.
»Nein«, antwortete sie, »ich will nicht wissen, was auf dem Arsch des Löwen stand, ich will auch nicht wissen, wie die Abwasserkanäle funktionieren oder warum die eine Seite der Floral Street hundert Jahre älter ist als die andere.«
»Aber findest du das denn nicht interessant?«
»Nicht solange ich mit durchgeknallten Wichsern im Clinch liege, Autodiebe jage oder einen Unfall mit Todesfolge aufnehme«, sagte Lesley. »Ich mag dich echt gern, Peter, du bist ein guter Junge, aber irgendwie scheinst du die Welt nicht so zu sehen, wie ein Polizist sie sehen muss. Kommt mir manchmal so vor, als würdest du Dinge sehen, die gar nicht da sind.«
»Zum Beispiel?«
»Keine Ahnung. Ich kann ja nichts sehen, was nicht da ist.«
»Dinge zu sehen, die nicht da sind, kann doch für einen Polizisten recht nützlich sein«, bemerkte ich.
Lesley schnaubte verächtlich.
»Stimmt aber«, sagte ich. »Gestern Nacht, während du dich von deiner Koffeinsucht hast ablenken lassen, traf ich einen Augenzeugen, der eigentlich nicht da war.«
»Der eigentlich nicht da war«, echote Lesley.
»Wie kannst du einen Augenzeugen vernehmen, der eigentlich nicht da ist, fragst du jetzt.«
»Das frage ich allerdings«, sagte Lesley.
»Das geht, wenn dein Augenzeuge ein Geist ist«, verkündete ich triumphierend.
Lesley starrte mich einen ziemlich langen Moment sprachlos an. »Ich hätte eher auf den Kontrolleur einer Überwachungskamera getippt«, sagte sie schließlich.
»Was?«
»Der hätte den Mord auf dem Bildschirm beobachten können«, erklärte Lesley. »Dann wäre er Augenzeuge, obwohl er eigentlich nicht da war. Aber die Story mit dem Geist gefällt mir auch ganz gut.«
»Ich hab einen Geist befragt!«, sagte ich.
»Quatsch.«
Also erzählte ich ihr von Nicholas Wallpenny und dem mörderischen Gentleman, der wieder umkehrte, die Klamotten wechselte und dann dem armen ... »Wie hieß er noch mal?«, unterbrach ich mich.
»William Skirmish«, antwortete Lesley. »Kam schon in den Nachrichten.«
»... dem armen William Skirmish sauber den Kopf abschlug, direkt über den Schultern.«
»Das kam nicht in den Nachrichten«, sagte Lesley.
»Das will die Mordkommission wahrscheinlich zurückhalten«, meinte ich, »um die Glaubwürdigkeit des Zeugen zu überprüfen.«
»Und der fragliche Zeuge wäre also ein ... Geist?«
»Genau.«
Lesley stand auf, schwankte ein wenig, schaffte es aber irgendwie, ihren Blick wieder auf mich zu fokussieren. »Meinst du, er ist noch da?«
Die kalte Luft machte mich allmählich wieder nüchtern. »Wer?«
»Dein Geist. Nicholas Nickleby, oder wie er heißt. Meinst du, er könnte noch am Tatort sein?«
»Woher soll ich das wissen?«, fragte ich. »Ich glaube nicht mal an Geister.«
»Komm, wir schauen nach«, befahl sie. »Wenn ich ihn auch sehe, ist das ein Inti... Indi... Beweis.«
»Na gut.«
Wir spazierten Arm in Arm die King Street entlang bis Covent Garden.
Nicholas der Geist glänzte durch überwältigend klare Abwesenheit. Wir begannen unsere Suche am Kirchenportikus, wo ich ihm begegnet war, und weil Lesley selbst in besoffenem Zustand eine gründliche Ermittlerin war, führten wir eine methodische Suche rund um das gesamte Absperrgebiet durch.
»Pommes«, forderte Lesley nach dem zweiten Rundgang, »oder ein Kebab.«
»Vielleicht traut er sich nicht zu erscheinen, wenn ich jemand bei mir habe«, überlegte ich laut.
»Vielleicht ist er Schichtarbeiter.«
»Verdammt, was soll’s«, sagte ich. »Holen wir uns ein Kebab.«
»Du bist super geeignet für die CPU«, meinte Lesley. »Und du wirst dort sicherlich ...«
»Wenn du jetzt sagst, einen wertvollen Beitrag leisten, kann ich für die Folgen nicht garantieren.«
»Ich wollte eigentlich sagen, dass du dort sicherlich etwas bewirken kannst«, sagte sie. »Außerdem kannst du jederzeit in die Staaten auswandern, ich wette, das FBI würde dich sofort nehmen.«
»Warum sollte mich das FBI nehmen?«
»Sie könnten dich als Obama-Double einsetzen.«
»Dafür«, sagte ich, »musst du jetzt die Kebabs bezahlen.«
Am Ende waren wir doch zu geschafft, um Kebabs zu kaufen, und schleppten uns stattdessen zum Wohnheim zurück, wo es Lesley vollkommen versäumte, mich in ihr Zimmer einzuladen. Ich hatte inzwischen jenen Zustand der Trunkenheit erreicht, in dem, sobald du im Bett liegst, das Zimmer um dich zu kreisen beginnt – während du über die Beschaffenheit des Universums im Allgemeinen und über die Frage im Besonderen nachdenkst, ob du es noch bis zur Toilette schaffst, bevor sich dein Magen umdreht.
Morgen war mein letzter freier Tag. Wenn es mir nicht sehr bald gelang zu beweisen, dass die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die es nicht gab, zu den entscheidenden Fertigkeiten eines modernen Polizisten gehörte, würde ich mich wohl oder übel als neuer Mitarbeiter bei der CPU vorstellen müssen.
»Tut mir leid wegen gestern Nacht«, sagte Lesley.
An diesem Morgen hatten wir uns beide nicht dem Horror der Wohnheimküche stellen können und deshalb Zuflucht in der Polizeikantine gesucht. Obwohl das Kantinenpersonal aus einem Haufen kompakter Polinnen und magerer Somalis bestand, gab es in Bezug auf das Essen keine fremdländischen Experimente – es war von klassisch englischer Fettigkeit, der Kaffee war miserabel und der Tee heiß, süß und wurde in Bechern ausgeschenkt. Lesley gönnte sich ein englisches Frühstück, und zwar das ganze Programm. Ich gönnte mir einen Tee.
»Schon okay«, sagte ich. »Schließlich hast du was verpasst und nicht ich.«
»Das meine ich nicht«, sagte sie und schlug mir leicht auf den Handrücken. »Sondern was ich über dich als Polizist gesagt habe.«
»Mach dir nichts draus. Ich habe dein wertvolles Feedback zur Kenntnis genommen und heute Morgen gründlich analysiert und beschlossen, dass ich die Ziele meines Karriereentwicklungsprogramms innovativ, proaktiv und vor allem kreativ anstreben werde.«
»Was hast du vor?«
»Ich werde mich in HOLMES einhacken und mal nachschauen, ob mein Geist recht hatte«, sagte ich.
Jedes Polizeirevier im Land hat mindestens einen HOLMES-Raum. Die Abkürzung steht für Home Office Large Major Enquiry System; es handelt sich dabei um die umfassende Recherchedatenbank des britischen Innenministeriums, die es auch Polizisten, die von Computern keine Ahnung haben, ermöglicht, Anschluss an das späte 20. Jahrhundert zu bekommen. Anschluss ans 21. Jahrhundert wäre wahrscheinlich zu viel verlangt gewesen.
Das System erfasst alles, was mit größeren polizeilichen Ermittlungen zu tun hat, so dass die Detectives ihre Daten mit allen möglichen anderen Daten abgleichen können und es so vermeiden, eine Untersuchung derart katastrophal zu vermasseln, wie es zum Beispiel beim Yorkshire Ripper der Fall war. Die neue Version auf der Basis des Vorläufersystems HOLMES sollte eigentlich SHERLOCK heißen, aber niemandem fielen passende Wörter für diese Abkürzung ein, also entschied man sich schlicht für HOLMES-2.
Rein theoretisch könnte man sich auch von einem Laptop in H2 einloggen, aber die Met zieht es vor, ihre Beamten hübsch kontrollierbar an festen Workstations sitzen zu lassen – die Geräte kann man zumindest nicht im Zug liegen lassen oder im Pfandhaus verhökern. Steht eine größere Ermittlung an, kann man die Workstations auch in die verschiedenen für diese Fälle eingerichteten Ermittlungszentren auslagern. Lesley und ich hätten uns auch direkt in den H2-Raum schleichen können, aber dann hätten wir riskiert, ertappt zu werden. Ich zog es deshalb vor, meinen Laptop in einem der unbenutzten Ermittlungsräume an die LAN-Buchse zu hängen. Hier konnten wir einigermaßen sicher und bequem arbeiten.
Vor drei Monaten hatte man mich zu einem H2-Einführungskurs geschickt. Damals war ich begeistert gewesen, aber da hatte ich mir eben noch eingebildet, dass man mich auf den Einsatz bei einer größeren Ermittlung vorbereiten wollte. Jetzt war mir natürlich klar, dass sie mich nur für die stupide Datenerfassung hatten abrichten wollen. Ich brauchte nicht mal eine halbe Stunde, um den Covent-Garden-Fall aufzurufen. Die meisten Leute machen sich über ihre Passwörter nicht allzu viele Gedanken. Inspector Neblett hatte den Vornamen seiner Tochter und ihr Geburtsjahr verwendet, was geradezu kriminell war, aber das machte es mir leicht, den schreibgeschützten Zugriff auf die Dateiordner zu bekommen, die wir benötigten.
Das alte System hatte große Dateien nicht verkraftet. Aber die neue Version H2 lag nun höchstens noch zehn Jahre hinter dem neuesten Stand der Technik zurück; die Detectives konnten deshalb auch schon Beweis- und Tatortfotos, eingescannte Dokumente und sogar die Aufzeichnungen von Überwachungskameras an die Ermittlungsakte, die sogenannte »Nominaldatei«, anhängen. Eine Art Youtube für uns Bullen.
Die Mordkommission für den Fall William Skirmish hatte sich unverzüglich die Aufzeichnungen der Überwachungskamera beschafft. Es war eine ziemlich große Datei, und ich klickte sie sofort an.
Im Bericht stand, dass die Kamera an der Ecke der James Street installiert war und nach Westen blickte. Die Aufnahmen waren schlecht und sehr dunkel und die Bilder wechselten einmal pro Sekunde. Aber trotz der schlechten Qualität war William Skirmish deutlich zu sehen. Er kam unter der Kamera hervor und ging in Richtung Henrietta Street.
»Und da kommt auch schon unsere Verdachtsperson«, sagte Lesley und tippte auf den Monitor.
Eine weitere Person war aufgetaucht. Bestenfalls konnte man sagen, dass es sich wahrscheinlich um einen Mann handelte, vermutlich in Jeans und Lederjacke gekleidet. Er ging an William Skirmish vorbei und verschwand unter der Kamera. Im Bericht wurde diese Person als »Zeuge A« bezeichnet.
Eine dritte Person erschien, die sich von der Kamera entfernte. Ich drückte auf Pause.
»Sieht nicht wie derselbe Bursche aus«, kommentierte Lesley.
Definitiv nicht. Dieser Mann trug nämlich eine Art Schlumpfmütze und ein edwardianisches Smokingjackett. Fragen Sie mich bitte nicht, woher ich weiß, wie ein Smokingjackett aus der Zeit König Edwards aussieht – sagen wir einfach, dass es etwas mit Doctor Who aus der TV-Serie zu tun hat, und belassen wir es dabei. Nicholas hatte behauptet, das Jackett sei rot gewesen, aber der Film war nur schwarz-weiß. Ich ließ den Film ein paar Bilder zurück- und dann wieder vorlaufen. Die erste Gestalt, Zeuge A, verschwand in Bild 1, zwei Bilder später erschien der Mann mit der Schlumpfmütze.
»Macht zwei Sekunden, um sich umzuziehen«, bemerkte Lesley. »Menschenunmöglich.«
Ich klickte wieder auf Vorwärts. Schlumpfmütze hielt plötzlich so etwas wie einen Baseballschläger in der Hand und trat geschmeidig von hinten an William Skirmish heran. Dann kam die Aufzeichnungspause bis zum nächsten Bild, aber der Schlag war klar zu sehen. Das folgende Bild zeigte Skirmish mitten im Sturz – und einen kleinen dunklen Fleck, den wir für seinen Kopf hielten, vor dem Portikus der Kirche.
»Mein Gott. Er hat ihm tatsächlich den Kopf sauber abgeschlagen«, stöhnte Lesley.
Genau wie Nicholas es geschildert hatte.
»Und das«, sagte ich, »ist menschenunmöglich.«
»Warum? Du hast doch selbst schon mal erlebt, wie ein Kopf abgetrennt wurde«, sagte Lesley. »Ich war auch dabei, schon vergessen?«
»Das war ein Autounfall«, widersprach ich. »Zwei Tonnen Metall, nicht ein Baseballschläger.«
»Ja, okay.« Lesley tippte auf den Monitor. »Aber du hast es ja gesehen.«
»Daran ist was faul.«
»Mit faul meinst du was anderes als nur den Mord?«
Ich klickte noch einmal zu dem Bild zurück, auf dem die Schlumpfmütze auftrat. »Siehst du hier einen Baseballschläger?«
»Nein, obwohl man beide Hände sieht. Vielleicht trägt er ihn auf dem Rücken.«
Ich klickte vorwärts. Auf dem dritten Bild erschien der Schläger wie durch Hexerei in seinen Händen, aber dieser Zaubereffekt konnte auch durch die Sekundenpause zwischen den Bildern erzeugt worden sein. Nein, etwas anderes stimmte nicht mit dem Schläger.
»Er ist viel zu lang für einen Baseballschläger«, sagte ich.
Der Schläger hätte dem Mann sicherlich vom Boden bis etwa zur Brust gereicht. Ich klickte ein paar Bilder zurück und dann wieder vor, konnte aber nicht entdecken, wo er dieses Riesending versteckt gehalten haben könnte.
»Wo kriegt man überhaupt einen Schläger von dieser Länge?«, fragte ich.
»In einem Laden für Baseballschläger in Übergrößen. Oder bei Bats R Us?«
»Schauen wir mal, ob wir nicht sein Gesicht erkennen können«, murmelte ich vor mich hin.
»Ich hab’s: im Superschlägershop«, sagte Lesley.
Ich achtete nicht auf sie und klickte wieder vorwärts. Der eigentliche Mord dauerte weniger als drei Sekunden: eine Sekunde, um mit dem Schläger auszuholen, eine zweite, um zuzuschlagen, und eine dritte, während der Williams Rumpf zu Boden stürzte. Das vierte Bild zeigte Schlumpfmütze, der sich gerade abwandte; das Gesicht war im Dreiviertelprofil zu erkennen – ein weit vorspringendes Kinn und eine ausgeprägte Hakennase. Auf dem fünften Foto war er auf dem Rückweg. Er ging langsamer als vor der Tat; soweit man das bei der ruckenden Abfolge von Bildern erkennen konnte, schlenderte er sogar recht gelassen davon. Der Baseballschläger verschwand zwei Fotos nach dem Mord – und wieder konnte ich nicht erkennen, wohin er verschwand.
Ich überlegte, ob wir die Gesichter vielleicht vergrößern könnten, und suchte nach einem geeigneten Grafik-Bearbeitungsprogramm.
»Idiot«, sagte Lesley. »Das hat das Ermittlungsteam bestimmt als Allererstes gemacht.«
Sie hatte recht, der Datei mit dem Film waren Vergrößerungen der Standbilder von William Skirmish, Zeuge A und dem mörderischen Gentleman mit der Schlumpfmütze angehängt. Im Gegensatz zu den Krimisendungen im Fernsehen muss hier festgestellt werden, dass es eine Grenze für die Qualität von Vergrößerungen gibt, die man von den Aufzeichnungen einer technisch veralteten Videokamera anfertigen kann. Egal ob digital oder nicht – eine Information, die nicht da ist, ist eben nicht da, Punkt. Trotzdem hatten die Kollegen im Labor ihr Bestes getan, und obwohl alle drei Gesichter ziemlich unscharf waren, konnte man doch klar sehen, dass es sich um drei verschiedene Personen handelte.
»Er trägt eine Maske«, sagte ich.
»Jetzt wirst du aber wirklich absurd«, meinte Lesley.
»Schau dir doch mal seine Nase an!«, sagte ich. »Niemand hat so ein Gesicht.«
Lesley deutete auf eine Anmerkung neben dem Foto. »Sieht so aus, als wäre das Ermittlungsteam derselben Meinung.« Die Indiziendatei enthielt auch eine Liste von »Weiteren Maßnahmen«, dazu gehörte unter anderem, in nahe gelegenen Kostümverleihen und Theatern nachzufragen, ob dort Masken verkauft oder verliehen wurden. Das hatte allerdings sehr geringe Priorität.
»Aha!«, sagte ich. »Es könnte also dieselbe Person sein.«
»Die ihre Klamotten in zwei Sekunden wechseln kann?«, erwiderte Lesley. »Wohl kaum.«
Alle Dateien der Ermittlungsakte sind miteinander verknüpft; deshalb schaute ich noch schnell nach, ob es dem Ermittlungsteam gelungen war, Zeuge A weiter zu verfolgen, als er vom Tatort wegging. Das war nicht der Fall, und auf der Maßnahmenliste hatte die Fahndung nach ihm hohe Priorität. Vermutlich würde es eine Pressekonferenz geben, bei der man erklären würde, dass die Polizei sehr daran interessiert sei, mit diesem speziellen Zeugen zu sprechen.
Die Schlumpfmütze war weiter unten in der New Row verschwunden, genau so, wie Nicholas behauptet hatte; ein Stück weiter in der St. Martin’s Lane war sie aus dem Überwachungsraster verschwunden. Der »Maßnahmenliste« zufolge war derzeit das halbe Ermittlungsteam damit beschäftigt, die Straßen in der Umgebung des Tatorts nach potentiellen Zeugen und Hinweisen abzusuchen.
»Nein«, sagte Lesley, die meine Gedanken erraten hatte.
»Nicholas ...«
»Nicholas der Geist«, sagte sie.
»Nicholas mit der fragwürdigen Gestalt«, sagte ich, »hat in allen Punkten recht behalten: wie sich der Mörder nähert, die Angriffsmethode, die Todesursache. Außerdem hat er den Rückzugsweg richtig beschrieben. Wir haben nicht eine einzige Sekunde, in der Zeuge A gleichzeitig mit Schlumpfmütze zu sehen ist.«
»Schlumpfmütze?«
»Der Tatverdächtige«, sagte ich. »Das muss ich unbedingt dem Ermittlungsteam erzählen.«
»Ach ja? Und was genau erzählst du denen? Hört mal zu, Leute, ich hab da zufällig einen Geist getroffen, der behauptet, Zeuge A hätte eine Maske aufgesetzt und dann das Opfer kaltgemacht.«
»Nein, ich werde sagen, dass ich von einem potentiellen Zeugen angesprochen worden sei, der potentiell sehr interessante Hinweise habe, die für die weitere Ermittlungsarbeit von potentiell größtem Interesse sein könnten.«
Wenigstens darüber dachte Lesley kurz nach. »Und damit willst du dich aus der CPU herausreden?«
»Ist jedenfalls einen Versuch wert.«
»Aber das reicht nicht. Erstens: Sie gehen bereits allen möglichen Hinweisen auf Zeuge A nach, dazu gehört auch die Möglichkeit, dass er eine Maske getragen haben könnte. Zweitens: Deine sämtlichen Informationen hättest du dir auch vom Video beschaffen können.«
»Sie wissen doch gar nicht, dass ich Zugang zum Video hatte.«
»Peter«, seufzte Lesley, »es zeigt, wie jemandem der Kopf abgeschlagen wird. Spätestens heute Abend steht das Video im Internet, wenn es nicht schon in den Abendnachrichten ausgestrahlt wird.«
»Dann muss ich eben noch mehr Hinweise beischaffen.«
»Heißt das, du willst wieder nach deinem Geist suchen?«
»Kommst du mit?«
»Nein«, antwortete Lesley, »denn morgen ist der wichtigste Tag meiner ganzen restlichen Laufbahn, deshalb gehe ich früh ins Bett, mit einer Tasse Kakao und Blackstones Lehrbuch der Polizeilichen Ermittlungsarbeit.«
»Auch gut«, sagte ich. »Ich denke sowieso, dass du ihn gestern verscheucht hast.«
Feldausrüstung für Gespensterjäger: warme Jacke; Thermounterwäsche (extrem wichtig); Thermosflasche; Geduld; Gespenst.
Schon nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass das so ziemlich das Absurdeste war, was ich je getan hatte. Zuerst bezog ich ungefähr um zehn Uhr abends an einem Tisch eines Straßencafés Stellung und wartete darauf, dass sich die Menge allmählich verlief. Als das Café schloss, schlenderte ich zu den Säulen vor dem Kirchenportal hinüber und wartete dort auf den Geist.
Es war wieder mal einer dieser eiskalten Abende. Selbst den Betrunkenen, die aus den Pubs torkelten, war es für halbwegs ordentliche Prügeleien zu kalt. Einmal kam eine Frauengruppe vorbei, die offensichtlich einen Junggesellinnenabschied feierte, ein rundes Dutzend Frauen, die sich mit überdimensionalen rosa T-Shirts, Häschenohren und hochhackigen Schuhen verkleidet hatten. Ihre bleichen Beine waren mit Kälteflecken übersät. Natürlich erblickte mich eine von ihnen.
»Geh nach Hause, Süßer«, rief sie herüber. »Er kommt heute nicht mehr.«
Ihre Freundinnen lachten kreischend. Eine hörte ich sagen: »Dass die gut aussehenden Typen immer schwul sein müssen ...«
Daran musste ich denken, als ich einen Mann von der anderen Seite der Piazza herüberkommen sah. Heutzutage gibt es so viele Pubs, Clubs und Chatrooms für Schwule, dass sich keiner mehr in eiskalten Nächten in öffentlichen Toiletten oder auf Friedhöfen herumtreiben muss, um den richtigen Mann für seine momentan dringlichsten Bedürfnisse zu finden. Trotzdem riskieren manche Leute immer noch Erfrierungen an den unteren Körperzonen – fragen Sie mich nicht, warum.
Der Mann war ungefähr einsachtzig groß, also rund sechs Fuß nach unserem guten alten britischen System, und trug einen wunderbar geschnittenen Maßanzug, der seine breiten Schultern und die schmalen Hüften betonte. Ich schätzte ihn auf Anfang vierzig. Er hatte ein längliches, fein geschnittenes Gesicht und braunes Haar mit einem altmodischen Seitenscheitel. Im Licht der Natriumdampflaternen war seine Augenfarbe schwer zu erkennen, aber ich hielt sie für grau. Er hatte einen Stock mit silbernem Knauf dabei; ohne hinzusehen wusste ich, dass seine Schuhe Handarbeit waren. Es fehlte nur noch ein hübscher Boyfriend mit leicht ethnischem Einschlag an seiner Seite, dann hätte ich ihn glatt wegen Auf-die-Spitze-Treibens des klassischen Schwulenklischees einbuchten müssen.
Als er auf mich zuschlenderte, offenbar in der Absicht, mich anzusprechen, war ich überzeugt, dass er tatsächlich nach einem Boyfriend mit leicht ethnischem Einschlag suchte.
»Hallo«, sagte er mit einem Oxfordakzent wie ein klassischer englischer Bösewicht in einem Hollywoodstreifen. »Was treiben Sie hier denn so?«
Ich überlegte, ob ich es nicht zur Abwechslung mal mit der reinen Wahrheit versuchen sollte. »Ich bin auf Geisterjagd«, sagte ich.
»Interessant«, bemerkte er. »Jagen Sie irgendeinen spezifischen Geist?«
»Nicholas Wallpenny.«
»Sagen Sie mir bitte Ihren Namen und Ihre Adresse?«
Kein Londoner würde diese Frage jemals widerspruchslos beantworten. »Wie bitte?«
Er griff in sein Jackett und holte die Brieftasche heraus. »Detective Chief Inspector Thomas Nightingale«, sagte er und zeigte mir seinen Dienstausweis.
»Constable Peter Grant«, sagte ich.
»Von der Charing-Cross-Wache?«, fragte er.
»Jawohl, Sir.«
Er schenkte mir ein eigenartiges Lächeln. »Na, dann jagen Sie Ihren Geist mal weiter, Constable.« Damit drehte er sich um und schlenderte die James Street hinauf.
Das hatte ich ja sauber hingekriegt – soeben hatte ich einem Detective Chief Inspector erzählt, dass ich Geister jagte. Wenn er mir das abnahm, bedeutete es, dass er mich für total durchgeknallt hielt. Und wenn er es nicht glaubte, musste er annehmen, dass ich darauf aus war, mich der Erregung öffentlichen Ärgernisses schuldig zu machen.
Und der Geist, den ich suchte, hatte sich auch nicht blicken lassen.
Sind Sie jemals von zu Hause weggelaufen? Ich schon, zweimal sogar. Beim ersten Mal war ich neun und kam bis zum Argos-Supermarkt in der High Street von Camden Town. Beim zweiten Mal war ich vierzehn und schaffte es bis zum Bahnhof Euston. Dort stand ich schon vor der Abfahrtstafel, als ich es mir dann noch einmal überlegte. Bei beiden Gelegenheiten wurde ich weder gerettet noch entdeckt oder zurückgebracht. Ich glaube, meine Mutter hatte meine Abwesenheit gar nicht bemerkt, und bei meinem Vater bin ich absolut sicher, dass er sie nicht bemerkte.
Beide Abenteuer endeten auf die gleiche Weise – ich merkte irgendwann, dass ich wieder nach Hause zurückkehren musste. Für mein neunjähriges Ich war es wohl die Erkenntnis, dass der Argos-Supermarkt die absolute Grenze meiner Welterfahrung darstellte. Jenseits dieser Grenze gab es noch eine U-Bahn-Station und ein großes Gebäude mit Statuen von Katzen, und noch weiter draußen gab es noch mehr Straßen und Buslinien, die vor irgendwelchen trostlosen, leeren Kellerlokalen endeten, in denen es nach Bier stank.
Als Vierzehnjähriger dachte ich schon rationaler. In den Städten, die auf der Abfahrtstafel standen, kannte ich keine einzige Menschenseele; außerdem bezweifelte ich, dass mich diese Städte sehr viel freundlicher aufnehmen würden als London. Wahrscheinlich würde mein Geld sowieso höchstens für eine Fahrkarte bis Potters Bar reichen, und selbst wenn ich es schaffte, mich als Blinder Passagier in einen Zug zu schleichen, brauchte ich auch was zu essen. Nüchtern betrachtet, hatte ich Bargeld für ungefähr drei Mahlzeiten, dann würde ich wohl zu meinen Eltern zurückkehren müssen. Folglich war alles, was ich jetzt tat, nur ein Aufschieben des unvermeidlichen Augenblicks, in dem ich umkehren musste.
Die gleiche Erkenntnis überkam mich auch jetzt, um drei Uhr morgens am Covent Garden. Derselbe Zusammenbruch meiner potentiellen Zukunftsaussichten, von denen eine einzige Variante übrig blieb, die unentrinnbare Zukunft. Nie würde ich einen schnellen Sportwagen fahren und lässig verkünden: »Sie sind verhaftet.« Sondern ich würde in der CPU arbeiten müssen und mein Leben lang einen »wertvollen Beitrag« leisten.
Ich stand auf und machte mich auf den Rückweg zum Revier.
Aus der Ferne glaubte ich Gelächter zu hören. Da lachte mich jemand definitiv aus.
2 Der Geisterjagdhund
Am nächsten Morgen erkundigte sich Lesley, wie die Geisterjagd gelaufen war. Wir hingen vor Nebletts Büro herum, denn hier sollte mir heute der Todesstoß versetzt werden. Wir mussten eigentlich nicht hier sein, aber weder Lesley noch ich konnten die leidige Warterei noch länger ertragen.
»Es gibt Schlimmeres als die CPU«, sagte ich.
Darüber dachten wir eine Weile nach.
»Verkehr«, sagte Lesley. »Das ist viel schlimmer.«
»Aber man darf dann in Superschlitten herumfahren, 5er BMW, Mercedes M-Klasse.«
»Weißt du was, Peter?«, fragte Lesley. »Du bist eigentlich ein sehr oberflächlicher Mensch.«
Ich wollte gerade widersprechen, als Neblett seine Bürotür öffnete. Er schien keineswegs überrascht, uns hier zu sehen, und reichte Lesley einen Brief, die ihn seltsamerweise nur zögernd öffnete.
»Sie werden in Belgravia erwartet«, sagte Neblett. »Also los, beeilen Sie sich.« In Belgravia befindet sich das Quartier der Mordkommission von Westminster. Lesley winkte mir kurz zu, drehte sich um und hüpfte tatsächlich den Korridor entlang.
Neblett blickte ihr nach. »Die hätte es bei der Diebesjagd weit gebracht«, sagte er. Dann fasste er mich ins Auge und runzelte die Stirn. »Sie dagegen ... ich weiß wirklich nicht, was aus Ihnen werden soll.«
»Ein Polizist, der einen aktiven und wertvollen Beitrag leistet, Sir«, sagte ich.
»Ein frecher Hund, das sind Sie«, knurrte Neblett. Und reichte mir nicht einen Briefumschlag, sondern einen kleinen Zettel. »Sie werden für Chief Inspector Thomas Nightingale arbeiten.« Auf dem Zettel waren Name und Adresse eines japanischen Restaurants an der New Row notiert.
»Welcher Bereich?«, fragte ich.
»Wirtschaftskriminalität und Spezialermittlungen, soweit ich wei߫, sagte Neblett. »Man will Sie in Zivil sehen, also beeilen Sie sich gefälligst.«
»Wirtschaftskriminalität und Spezialermittlungen« war eigentlich eher ein Sammelbegriff für eine Unmenge spezialisierter Einheiten, alles von Kunst und Antiquitäten über Einwanderung bis hin zur Computerkriminalität. Für mich war nur wichtig: Die CPU gehörte nicht dazu. Ich beeilte mich wegzukommen, bevor er es sich noch anders überlegte, aber ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich im Flur keinen Moment lang hüpfte.
New Row ist eine schmale Fußgängerstraße zwischen Covent Garden und St. Martin’s Lane, mit einem Tesco-Supermarkt am einen Ende und verschiedenen Theatern am anderen. Tokyo A Go Go war ein Bento-Restaurant ungefähr in der Mitte der Straße, eingeklemmt zwischen einer Privatgalerie und einem Sportgeschäft für Mädchen. Das Restaurant war lang, aber kaum breit genug für zwei Tischreihen, und war nach der minimalistischen japanischen Art kaum dekoriert – glatt gewienerte Holzböden, Tische und Stühle aus lackiertem Holz und jede Menge rechte Winkel und Reispapier.
Nightingale saß an einem Tisch am anderen Ende; er aß Bento aus einer schwarz lackierten Pappschachtel. Als ich an seinen Tisch trat, erhob er sich und schüttelte mir die Hand. Ich setzte mich ihm gegenüber und er fragte, ob ich etwas essen wolle. Ich lehnte dankend ab, denn ich war ziemlich nervös und habe es mir zur Gewohnheit gemacht, meinem Magen in diesem Zustand niemals kalten Reis zuzumuten. Nightingale bestellte Tee und erkundigte sich, ob es mir etwas ausmache, wenn er weiteraß.
Artig verneinte ich und schaute zu, wie er geschickt mit den Essstäbchen hantierte.
»Ist er zurückgekommen?«, fragte Nightingale.
»Wer?«
»Ihr Geist. Nicholas Wallpenny: Schnüffler, Kammerjäger, Gelegenheitsdieb. Bis zu seinem Tod wohnhaft in der Gemeinde St. Giles. Haben Sie eine Ahnung, wo er beerdigt sein könnte?«
»Auf dem Friedhof der Schauspielerkirche?«
»Sehr gut«, nickte Nightingale und holte mit den Stäbchen schnell und geübt ein kleines Stück Ente aus der Schachtel. »Also: Ist er zurückgekommen?«
»Nein, ist er nicht«, gab ich zu.
»Geister sind kapriziös«, sagte er. »Als Zeugen sind sie ziemlich unzuverlässig.«
»Wollen Sie damit sagen, dass es wirklich Geister gibt?«
Nightingale wischte sich die Lippen sorgfältig mit der Serviette ab. »Sie haben doch mit einem gesprochen. Was glauben Sie?«
»Ich warte auf eine Bestätigung durch einen Vorgesetzten«, antwortete ich. »Sir.«
Er legte die Serviette weg und griff gelassen nach der Teetasse. »Geister gibt es wirklich.« Er trank einen Schluck.
Ich starrte ihn sprachlos an. Ich persönlich glaube nicht an Geister, auch nicht an Feen oder Götter, und während der letzten paar Tage hatte ich mich wie ein Zuschauer einer Zaubershow gefühlt – eigentlich hatte ich nur darauf gewartet, dass der Zauberer vor den Vorhang treten und mich auffordern würde, eine Karte auszuwählen, irgendeine Karte. Ich war nicht bereit, an Geister zu glauben, aber so ist das mit empirischen Erfahrungen – sie sind real.
Und wenn es also wirklich Geister gab?
»Lassen Sie mich raten, Sir: Gleich werden Sie mir erzählen, dass es eine geheime Einheit der Met gibt, deren Aufgabe darin besteht, Geistern nachzuspüren, oder Gespenstern, Dämonen, Feen, Hexen, Hexenmeistern, Elfen, Trollen ...« Ich hob beide Hände. »Sie dürfen mich ruhig unterbrechen, mir fallen sowieso gerade keine übernatürlichen Wesen mehr ein.«
»Sie haben nicht mal einen Bruchteil von dem aufgezählt, was es gibt«, sagte Nightingale gelassen.
»Außerirdische?« Das musste ich einfach fragen.
»Noch nicht.«
»Und die geheime Einheit der Met?«
»Besteht nur aus mir, fürchte ich.«
»Und Sie wollen, dass ich in ... äh ... in Ihre Einheit eintrete?«
»Dass Sie mich unterstützen«, sagte Nightingale, »bei dieser Ermittlung.«
»Sie glauben also, dass sich bei diesem Mord etwas Übernatürliches ereignete?«
»Warum schildern Sie mir nicht zuerst einmal, was Ihr Zeuge zu erzählen hatte?«, schlug er vor. »Dann sehen wir vielleicht ein wenig klarer, wohin das alles führt.«
Also schilderte ich ihm mein Gespräch mit Nicholas und die Sache mit dem Kleiderwechsel des mörderischen Gentleman. Und die Aufzeichnungen der Überwachungskamera und die Annahme der Mordkommission, dass zwei verschiedene Personen auf dem Video zu sehen waren. Als ich geendet hatte, winkte er die Kellnerin herbei, um zu zahlen.
»Ich wünschte, ich hätte das alles schon gestern erfahren«, murmelte er. »Aber vielleicht finden wir trotzdem noch eine Spur.«
»Eine Spur wovon, Sir?«, fragte ich.
»Vom Unheimlichen«, sagte Nightingale. »Es hinterlässt immer eine Spur.«
Nightingales Wagen war ein Jaguar, ein echter Mark II mit dem XK6-Motor und 3,8 Litern Hubraum. In den Sechzigern hätte mein Dad glatt seine Trompete verkauft, wenn er dafür ein solches Auto hätte besitzen dürfen, und das hieß damals eine Menge. Der Wagen war nicht in makellosem Zustand, sondern hatte ein paar kleine Dellen in der Karosserie und die Ledersitze zeigten erste Risse, aber als Nightingale den Zündschlüssel drehte und der Sechszylinder zu brummen anfing, war alles perfekt, worauf es wirklich ankam.
»Sie haben die Oberstufe in naturwissenschaftlichen Fächern abgeschlossen«, sagte Nightingale, als er den Wagen in den Verkehr einfädelte. »Warum haben Sie dann nicht ein Studium in einem davon aufgenommen?«
»Ich habe mich ablenken lassen, Sir«, antwortete ich. »Meine Abschlussnoten waren nicht gerade berauschend, es reichte nicht für die Studiengänge, die ich wollte.«
»Aha. Und worin bestand die Ablenkung? Musik vielleicht? Haben Sie eine Band gegründet?«
»Nein, Sir. Nichts, was so interessant gewesen wäre.«
Wir fuhren über den Trafalgar Square und nutzten das diskrete Blaulicht der Metropolitan Police an der Windschutzscheibe, um schneller durch Pall Mall zu kommen, dann am Buckingham-Palast vorbei und nach Victoria. Ich konnte mir nur zwei Orte denken, zu denen wir unterwegs sein konnten: die Polizeistation in Belgravia, wo die Mordkommission ihr Einsatzzentrum eingerichtet hatte, oder das Pathologische Institut von Westminster, wo Skirmishs Leiche aufbewahrt wurde. Ich hoffte, dass es das Einsatzzentrum sein würde, aber natürlich war es das Leichenschauhaus.
»Aber Sie kennen sich mit naturwissenschaftlichen Methoden aus?«, fragte Nightingale nach einer Weile.
»Jawohl, Sir«, antwortete ich und beschloss, gelegentlich mein Wissen über Bacon, Descartes und Newton aufzufrischen. Beobachtung, Hypothese, Experiment und ... den Rest würde ich nachlesen, wenn ich wieder vor meinem Laptop saß.
»Gut«, sagte Nightingale, »denn ich brauche jemanden mit einer gewissen Objektivität.«
Ganz klar das Leichenschauhaus, dachte ich.
Die offizielle Bezeichnung lautet Iain West Forensic Suite. Es ist einer der gelungeneren Versuche des Innenministeriums, seine Pathologie-Institute so cool wirken zu lassen wie die in den amerikanischen TV-Serien. Damit schmutzige Polizisten die Leichen nicht mit den geringsten Verunreinigungen besudeln konnten, hatte man einen besonderen Beobachterraum eingerichtet, in den Live-Autopsien über Videokameras übertragen werden konnten. Dadurch wurde selbst die grausigste Obduktion auf nichts weiter als ein paar schauerliche Bilder reduziert, so ähnlich wie in einer TV-Doku. Ich war sehr dafür, die Sache vom Beobachtungsraum aus zu verfolgen, aber Nightingale erklärte, wir müssten so nahe wie möglich an die Leiche heran.
»Warum?«, wollte ich wissen.
»Weil es außer Sehen und Hören auch noch andere Sinne gibt.«
»Reden wir hier von außersinnlicher Wahrnehmung?«
»Gehen Sie einfach unvoreingenommen an die Sache heran«, sagte Nightingale.
Wir mussten saubere Schutzanzüge und Gesichtsmasken überziehen, bevor man uns erlaubte, uns dem Autopsietisch zu nähern. Wir waren keine Angehörigen, daher hatte sich niemand die Mühe gemacht, den Spalt zwischen den Schultern und dem Kopf abzudecken. Ich beglückwünschte mich, dass ich vorhin kein Bento gegessen hatte.
Vermutlich war William Skirmish im Leben ein recht unauffälliger Mann gewesen. Mittleres Alter, Größe knapp über dem Durchschnitt, körperlicher Zustand leicht schwabbelig, aber nicht dick. Es fiel mir überraschend leicht, den abgetrennten Kopf mit dem ungleichmäßig gezackten Rand an der Stelle zu betrachten, wo er eigentlich auf dem Hals hätte sitzen sollen. Die meisten Leute denken, ein junger Polizist bekommt als ersten Toten immer ein Mordopfer zu sehen, aber die Wahrheit ist weniger spannend: Gewöhnlich handelt es sich um das Opfer eines Autounfalls. Meinen ersten Toten hatte ich am zweiten Tag meiner Ausbildung zu Gesicht bekommen – ein Fahrradkurier, dem ein Kleintransporter den Kopf abgetrennt hatte. Zwar gewöhnt man sich nicht unbedingt an den Anblick, aber zumindest lernt man dabei, dass es noch viel schlimmer sein könnte. Es war nicht gerade angenehm, Mister Kopflos genauer zu betrachten, aber ich gebe zu, dass es weniger schrecklich war, als ich mir vorgestellt hatte.
Nightingale trat nahe an den Autopsietisch und steckte praktisch die Nase in den Spalt zwischen Kopf und Körper. Nach kurzer Zeit trat er zurück, schüttelte den Kopf und wandte sich zu mir um. »Helfen Sie mir mal, ihn umzudrehen.«
Ich verspürte kein großes Verlangen, die Leiche anzufassen, nicht mal mit den Schutzhandschuhen, aber natürlich durfte ich jetzt nicht die Nerven verlieren. Der Körper war schwerer, als ich erwartet hatte, kalt und starr kippte er auf den Bauch. Ich trat schnell ein paar Schritte zurück, aber Nightingale winkte mich wieder näher.
»Ich möchte, dass Sie Ihr Gesicht so nahe wie möglich an seinen Nacken bringen, die Augen schließen und mir sagen, was Sie spüren«, befahl er.
Ich zögerte.
»Ich versichere Ihnen, dass Ihnen der Grund dafür gleich klar wird«, sagte er.
Gesichtsmaske und Augenschutz halfen ein bisschen, denn so war die Gefahr gering, dass ich den Toten versehentlich küsste. Ich folgte Nightingales Anweisung und schloss die Augen. Zuerst nahm ich nur den Geruch von Desinfektionsmittel, rostfreiem Stahl und frisch gewaschener Haut wahr, doch nach ein paar Augenblicken sickerte noch etwas anderes in meine Wahrnehmung, ein Kratzen und Hecheln, eine feuchte Schnauze, ein wedelnder Schwanz.