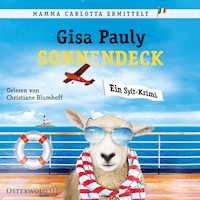Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau kämpft gegen ein Weltreich. Thusnelda, die Tochter des mächtigen Germanenfürsten Segestes, weiß, wie ihr Leben verlaufen wird. Sie wird den Mann heiraten, den ihr Vater ihr ausgesucht hat, und viele Kinder großziehen. Dann jedoch begegnet sie Arminius, dem germanischen Heerführer in den Diensten Roms. Sie verliebt sich Hals über Kopf und heiratet ihn, auch wenn sie sich dadurch ihren Vater zum Feind macht ... Die faszinierende Geschichte einer Frau, die geliebt, entführt und verraten wurde. Das Buch erschien 2010 unter dem Titel "Die Frau des Germanen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gisa Pauly
Die Frau des Germanen
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0036-5
Aufbau Digital,unter dem Namen "Die Frau des Germanen" veröffentlicht 2010 im Aufbau Verlag aktualiserte Version vom April 2020 © Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010 / 2020
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertungist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesonderefür Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemensowie für das öffentliche Zugänglichmachen z. B. über das Internet.
Umschlaggestaltung www.buerosued.deunter Verwendung mehrerer Motive von Arcangel Images/ Abigail Miles; mauritius images / Antonia Gros / Alamy und www.buerosued.de
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, 2010 KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
PROLOG
I. BUCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
II. BUCH
16.
17.
18.
19.
III. BUCH
20.
21.
22.
23.
24.
Epilog
Anhang
Historische Figuren
Für meinen Vater,
der mir viel von Arminius erzählt hat
PROLOG
Platz für meine Herrin!«
Der Sklave in der weißen Tunika wedelte mit einem Palmenzweig alles aus dem Weg, was der Sänfte zu nahe kommen konnte: das Pferd eines römischen Offiziers, einen Händler, der tropische Früchte feilbot, andere Sklaven, die ihren Herren den Weg bahnten. Der dreibeinige Hund erhielt einen wütenden Tritt, dem Bauern, der sich mit einem Korb voller Kräuter näherte, fuhr der Palmenzweig durchs Gesicht.
»Platz für meine Herrin!«
Sie beugte sich über ihren Obstkarren, als die Sänfte sich näherte. Von vier Sklaven wurde diese getragen, kräftige, tief gebräunte Kerle, deren Muskeln unter der Sonne glänzten. Blau bestickte Vorhänge verschlossen die Sänfte, nur für wenige Augenblicke war die zarte Hand zu sehen, mit den kunstvoll bemalten Nägeln, wie es zurzeit unter den Damen der römischen Gesellschaft Mode war. Sie riskierte einen schnellen Blick, dann zog sie ihren Umhang über den Kopf, so dass ihr Gesicht nicht zu erkennen war. Ja, das war die Sänfte der edlen Severina. Jetzt nur nicht aufblicken!
So lange blieb sie gebeugt stehen, bis sie sicher sein konnte, dass niemand ihr Beachtung schenkte – die Sklaven nicht, die die Sänfte trugen, und erst recht nicht die Römerin, die sich hinter den Vorhängen verbarg. Wer sie kannte, wusste, dass es winzige Schlitze darin gab, durch die sie ihre Umgebung genau beobachtete.
Die Sänfte verlor sich in der Menschenmenge. Eine Weile noch war der schwankende Baldachin auszumachen, denn die Mitglieder der kaiserlichen Familie besaßen die größten und stärksten Sklaven, damit ihre Sänften alle anderen überragten. Dann aber konnte sie aufatmen. Die Gefahr war vorüber!
Mit bebenden Händen griff sie zu dem wackeligen Holzkarren und schob ihn weiter. Die Früchte, mit denen er beladen war, würden unverkäuflich sein. Braun gefleckt waren die Pfirsiche, überreif die Melonen, deren Saft in den Sand tropfte. Wer sich mit dem Gedanken trug, erfrischendes Obst mit ins Amphitheater zu nehmen, lächelte verächtlich, nachdem er ihr Warenangebot in Augenschein genommen hatte.
Die Sonne stand hoch über dem Platz, ein gleißendes Silber, das die oberen Ränge des Theaters berührte und auf das Rund hinabbrannte, das vermutlich längst mit frischem weißen Sand bestreut worden war. Was heute in der Arena zu sehen sein würde, zog viele Römer an. Das Theater würde bis auf den letzten Platz gefüllt sein.
Schritt für Schritt tastete sie sich auf die Arkaden zu, mit denen sich der Rundbau des Amphitheaters öffnete. Ihr war, als schlüge ihr der Geruch des Blutes entgegen, dumpf und schwer, manchmal süßlich, dann wieder bitter wie versengtes Tuch. Fest eingeschlossen war er in den Rundbau, dennoch erfasste sie hier, vor den Toren des Theaters, bereits der Ekel. Zu oft war sie von dem Geruch gequält worden, wenn die Gladiatorenkämpfe vorbei waren und die Sklaven gerufen wurden, um ihren Besitzern den Weg über die Treppen zu bahnen, die zu den Ausgängen führten. Es half nichts, dass die blutbefleckte Arena schleunigst mit weißem Sand frisch angerichtet wurde. Der Geruch verging nicht. Was dort vor sich ging, geschah zwar immer wieder aufs Neue, aber jeder weitere Tod war doch immer auch ein Teil aller vorangegangenen Leiden. Und wer einmal unter dem Geruch des Blutes gelitten hatte, wurde ihn nie wieder los.
Vorsichtig sah sie sich um. Beobachtete sie jemand? Wurde das Wachpersonal auf sie aufmerksam? Nein, die Tore waren noch geschlossen, die Arbeit der Wärter hatte noch nicht begonnen. Die Männer saßen im Schatten, aßen und tranken und betrachteten das Treiben auf dem Platz. Für eine Obstverkäuferin, die verdorbene Waren anbot, hatte niemand einen Blick.
Während sie sich den Arkadengängen näherte, spürte sie die gespenstische Stille hinter den dicken Gemäuern. Noch hatten das Lachen und Plaudern das Innere des Theaters nicht erreicht, das Gekicher der Frauen, das Prahlen der Männer und das Rascheln der Kleidung waren noch nicht in das stille Warten eingedrungen, auch das sanfte Rauschen der Fächer nicht, mit denen die Sklaven für kühle Luft sorgten. Das Summen der Gespräche und dann die plötzlich einsetzende Stille, wenn in der kaiserlichen Loge ein Zeichen gegeben wurde, wenn ein Wort vernommen oder eine Geste entdeckt wurde – das alles wartete noch vor den Toren des Theaters. Hunderte von Sklaven hatten gerade erst die Holzmasten in die Konsolen gesteckt, die am oberen Abschlussrand der Sitzränge angebracht waren, und die Segel befestigt, welche die Zuschauer vor der Sonne schützen sollten. Zwei dieser Sklaven waren vor einer halben Stunde abgestürzt. Nun mussten sich die anderen beeilen, ihre zerschmetterten Körper beiseitezuschaffen, ehe das Publikum auf die Ränge drängte.
Sie beschirmte die Augen mit der Hand und blickte nach oben. Alles war vorbereitet. Aber noch waren die Gladiatoren und die zum Tode Verurteilten ganz allein mit ihrer Angst, verbargen sich in der Stille, in der Angst der anderen, in den Erinnerungen. Ein Schauer lief über ihren Rücken. Bei Wodan, diese schreckliche Angst!
Sie machte einen zaghaften Schritt, dann noch einen und einen weiteren. Als sie sich umsah, hatte die Angst Gestalt bekommen. Bisher war sie ein junger Krieger gewesen, der sich mit wildem Geschrei selber Mut machte. Jetzt war aus der Angst ein Römer geworden, ein schwer bewaffneter, rachedurstiger, unbarmherziger Römer. Jeder von denen, die sich an den Gladiatorenkämpfen ergötzen wollten, konnte ihre Angst sein.
Die Tore öffneten sich nun, die Wärter erhoben sich vom Boden, richteten sich auf, klopften sich den gefüllten Leib. Ihre Waffen klirrten, sie hörte sie lachen. Ob auch die Todgeweihten in den Katakomben es hörten? Dann wussten sie: Ihr erster Schritt war getan. Das Entsetzen war nicht mehr aufzuhalten.
Sie sah, wie ein vornehmer Römer, der zu Fuß unterwegs war, einen Händler grob zur Seite schlug, der ihm Feigen anbieten wollte. Während der arme Kerl noch damit beschäftigt war, die Früchte aus dem Staub aufzusammeln, schlug der Mann noch einmal zu.
«Zur Seite, elendes Weib!«, schrie er sie an. Aber zum Glück traf er sie nicht mit aller Härte, seine flache Hand prallte an ihrer Schulter ab.«Dein Obst interessiert nur die Maden.«
Erschrocken wich sie zurück. Sie hatte ihm nichts anbieten wollen. Hermut hatte ihr mit voller Absicht Früchte auf den Karren geladen, die schon seit Tagen nicht mehr frisch waren. Sie durfte nicht Gefahr laufen, das Interesse von Käufern zu wecken. Nein, sie wollte nur hier sein, ohne gefragt zu werden, warum sie sich vor dem Amphitheater herumtrieb.
»Er wird gegen einen weißen Löwen kämpfen!«, hörte sie einen Mann rufen, der einen dicken Bauch unter seiner weißen Tunika verbarg. Er versetzte einem mageren Jungen, der sich vor ihm in den Staub warf, einen Tritt. »Dein Vater soll seine Schulden bezahlen, wenn er ein freier Mann bleiben will.«
Er beachtete nicht das Gestammel des Jungen, der versuchte, den Saum der weißen Tunika zu küssen, sondern trat auf einen eleganten Römer zu, um ihn zu begrüßen. »Salve, edler Marcus!«
Sie drückte sich in den Schatten der Arkaden, als wollte sie ihr Obstangebot vor der Sonne schützen. Die beiden Männer, die an ihr vorübergingen, beachteten sie zum Glück nicht.
»Glauben Sie, dass er eine Chance hat gegen den weißen Löwen?«, fragte der eine.
Der andere schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht. Die Frage ist nur, ob der Daumen des Kaisers nach oben oder nach unten zeigen wird.«
»Nach unten!«, bekräftigte der erste. »Dieser blonde Hüne wird von allen gehasst. Vom Kaiser und ganz besonders von der kaiserlichen Familie. Man wird dafür sorgen, dass er keine Chance hat.«
In diesem Moment erblickte sie ihn. Er trug einen wollenen Umhang wie sie. Beide sahen sie aus wie Bauersleute, die bei Sonnenaufgang auf ihren Feldern geerntet hatten.
Sie griff nach ihrem Karren und machte Anstalten, sich ihm unauffällig zu nähern. Aber seine Augen warnten sie. Sofort blieb sie stehen, beugte sich über ihre Melonen und betastete sie, als wollte sie prüfen, welche von ihnen noch frisch genug war, um sie anzubieten.
Zwei Männer blieben in ihrer Nähe stehen. Die Wärter, die gern den Gesprächen lauschten, die von Mitgliedern der römischen Gesellschaft geführt wurden, traten ein paar Schritte näher. Für eine armselige Obstverkäuferin hatten sie zum Glück keinen Blick. Sie sahen nicht, dass sie die Gelegenheit nutzte, sich mit ein paar vorsichtigen Schritten dem Eingang der Katakomben zu nähern.
Die beiden Römer verschränkten die Arme vor der Brust und schienen sich auf eine ausgedehnte Plauderei einzustellen. Beide trugen sie Tuniken, die mit vielen Perlen und feinen blauen Fäden bestickt waren, und Schuhe aus Ziegenleder.
»Wir brauchen uns nicht zu beeilen. Zuerst finden die Hinrichtungen statt.« Der eine zog verächtlich die Mundwinkel herab. »Das ist ein Spaß für das einfache Volk.«
Der andere stimmte ihm lachend zu. »Wen interessieren schon ein paar ungehorsame Sklaven, die den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen werden!«
Sie machte ein paar weitere Schritte auf den Eingang der Katakomben zu und stellte fest, dass Hermut es ihr gleichtat. Seine Augen warnten nicht mehr, sie lockten sie jetzt. Vorsichtig löste sie sich von ihrem Obstkarren und trat ein paar Schritte zur Seite. Niemand wurde auf sie aufmerksam. Immer tiefer zog sie sich in die Dunkelheit der Arkaden zurück. Die Wachmänner hatten noch immer keinen Blick für sie, erst recht nicht die beiden vornehmen Römer.
»Sehen wir nach, ob Flavus schon in seiner Loge angekommen ist. Er wird uns einen guten Tropfen spendieren!«
»Flavus wird heute nicht erscheinen. Seine Gemahlin auch nicht. Ich habe es von Vergilius gehört.«
Die Stimme des Älteren klang erstaunt. »Flavus versäumt sonst keinen Gladiatorenkampf. Und Salvia auch nicht.«
»Ich weiß zufällig, dass eine seiner Sklavinnen heute hingerichtet wird. Salvia selbst hat sie zum Tode verurteilen lassen.«
Beide lachten sie nun. »Zwei Barbaren, die nicht das Blut ihrer Sklavin sehen wollen?«
Da mischte sich eine dritte Stimme ein. »Ihr sprecht von einem römischen Offizier. Dass Flavus in Germanien geboren wurde, ist ohne Belang.«
Nun war sie an der Stelle angekommen, wo Hermut auf sie wartete. Ein fragender Blick empfing sie, sie antwortete mit einem kurzen Nicken. Es war so weit. Die nächste Gelegenheit würden sie nutzen. Und dann … dann gab es kein Zurück mehr.
Hermuts Augen wanderten zu ihrem Umhang, der mit einer geflochtenen Kordel fest umgürtet war. Sie führte beide Fäuste an ihre Brust und klopfte sanft mit den Knöcheln darauf. Ein feiner metallischer Klang war zu hören.
Hermut nickte zufrieden. Ja, sie waren gut vorbereitet.
»Ihr seid sicher, dass Ihr es tun wollt?«, flüsterte er.
Sie nickte tapfer. »Es ist das Einzige, was ich für ihn tun kann. Wahrscheinlich das Letzte.«
Die Sänften der kaiserlichen Familie lockten die Wärter noch ein paar Schritte weiter auf den Platz hinaus. Die Gelegenheit war günstig. Hermut nickte zu der niedrigen Tür, die aussah wie eine schadhafte Stelle im Gewand des Amphitheaters. Ein ausgefranstes Loch, dahinter die Schwärze der Katakomben.
Hermut blieb neben ihrem Obstkarren stehen, als sie auf das Loch zuhuschte. Er folgte ihr erst, nachdem er sich ein letztes Mal versichert hatte, dass niemand sie beachtete.
Die Kälte, die das dicke Gemäuer einschloss, tat ihr gut. Die Sonnenglut hatte sie an die Hitze des Kampfes erinnert, der den Gladiatoren bevorstand, an das heiße Blut, das vergossen werden musste, an den heißen Atem aus den Nüstern der Löwen – und an die heiße, alles versengende Angst.
Der Gang, den sie betraten, führte an den Höhlen vorbei, in denen der Tod wartete. Hinter jedem Gitter starrten ihnen Augen entgegen, verzweifelte und stumpfe, kämpferische und müde Blicke folgten ihnen. Von den zum Tode Verurteilten klammerten sich manche ans Gitter, als wollten sie sich am Leben festhalten, andere hatten sich in die dunkelste Ecke ihrer Höhle zurückgezogen, als könnten sie sich vor ihrem Ende verstecken.
Hermut war nun an ihrer Seite. Gemeinsam schlichen sie von Verlies zu Verlies, von Gitter zu Gitter, spähten hindurch, huschten weiter. Aus keiner der finsteren Höhlen drang ein Laut. Keine Stimme, kein Flüstern, kein Stöhnen, nichts! Totenstille herrschte. Nur die Umhänge raschelten, ihre Füße scharrten, kaum hörbar.
Dann plötzlich schwere Schritte! Entsetzt griff sie nach Hermuts Arm, ihr Atem stockte, die Augen weiteten sich. Wohin? Waffengeklirr, eine tiefe, brummende Stimme! Wohin? Die Angst lähmte sie, der Aufruhr in ihrem Innern nagelte sie auf die Stelle.
Erst der Griff Hermuts nach ihrem Arm befreite sie. »Schnell!«
Ein Mauervorsprung! In der Dunkelheit kaum zu erkennen! Schon zerrte er sie einen Schritt darauf zu, stieß sie in die finstere Ecke, presste sie an die kalte, feuchte Wand. »Still! Nicht bewegen!«
Nicht zittern! Nicht atmen! Sterben, nur für ein paar Augenblicke!
Das Licht der Fackeln an den Wänden zuckte über den Gang. Nun sah sie, wie der Wärter mit großen, langsamen Schritten an ihnen vorbeiging. Er blieb stehen, sah den Gang hinauf und hinab, so, als hätte ihn das Anhalten des Atems aufmerksam gemacht, als wäre ihre Angst laut und verräterisch. Aber die aufgeschreckte Wachsamkeit des Wärters schlief schnell wieder ein. Sie sah, wie er die Schultern zuckte und weiterging. So langsam, als hielte er es für möglich, dass sich in seinem Rücken die Erleichterung frühzeitig verriet.
Es war unnötig, dass Hermut sie daran hinderte, zu früh ins Leben zurückzukehren, zu früh auszuatmen und den ersten Schritt zu tun. Sie nickte unmerklich und wartete. Darauf, dass die Schritte des Wärters endgültig verklangen oder aber zurückkehrten.
Dem Versteck gegenüber befand sich das Verlies einer Frau. Schmutzige Hände klammerten sich ans Gitter, ihr Gesicht war deutlich zu erkennen. Kein junges Gesicht, mit Augen, die doppelt so alt waren wie ihr Körper. Helle Augen, hell noch im Dunkel der Katakomben. Sie berührten etwas in ihr, etwas, was vor langer, langer Zeit von Bedeutung gewesen war. In einem anderen Leben …
Sie legte die Hände auf ihre Brust, fühlte den harten Stahl, der dort verborgen war, spürte nun auch die Kraft, die von ihm ausging, und machte einen Schritt auf den Gang zurück.
«Komm!«, flüsterte sie und schlich weiter zum nächsten Verlies, starrte hinein, schlich weiter. »Schnell!«
Schon nach wenigen Schritten begriff sie, dass Hermut nicht mehr an ihrer Seite war. Erschrocken drehte sie sich um und sah, dass er vor dem Verlies der Frau stand. Sie hörte ihn einen Namen flüstern. Verstehen konnte sie ihn nicht, dennoch berührte sein Klang etwas in ihr. Ein heller spitzer Laut, auf den sich ein weiter Vokal öffnete. Es war, als würde sie diesen Namen gut kennen. Wieder hörte sie Hermut flüstern. Und diesmal verstand sie den Namen genau.
»Inaja!«
Sie starrte ihn an, sah das Zittern seiner Lippen, sah, dass seine Augen in einem Tränenteich schwammen. Die Falten schienen sich tiefer in sein Gesicht gegraben zu haben. Er bewegte sich nicht, auch hinter dem Gitter gab es keine Regung. In der Ferne war das Brüllen eines Löwen zu hören, Wasser tropfte von der Gewölbedecke, der Lärm von den Zuschauerrängen rückte näher, die Stille begann sich zu füllen.
Sie spürte, dass sie den Kopf schüttelte. Nein, der Name durfte keine Bedeutung haben. Sie hatten ein Ziel, ein großes Ziel. Nur darauf kam es jetzt an.
»Komm, wir müssen uns beeilen!«, zischte sie.
Aber Hermut beachtete sie nicht. Nun streichelte er die Hände der Gefangenen, die sich noch immer ans Gitter klammerten, und legte seine Stirn auf ihre Fingerknöchel.
Noch einmal versuchte sie es. »Das ist nicht Inaja! Sie kann es nicht sein. Inaja ist verschwunden. Schon lange! Seit über zwanzig Jahren!«
Die Verzweiflung würgte sie, ein Schluchzen stieg in ihre Kehle, das sie schwach und hilflos machte. Sie durften nicht von ihrem Plan abweichen, sie mussten weiter.
»Sie hat dich betrogen«, rief sie – viel zu laut, viel zu schrill! »Sie wird längst für ihren Verrat bezahlt haben!«
Aber aus Hermut war alle Kraft gewichen. Und als sie ihn weinen hörte, begriff sie, dass er sie allein gelassen hatte. Es war keine Zeit mehr, ihn zurück an ihre Seite zu holen.
Der Gang, der von einem Verlies vor das nächste Gitter führte, wurde enger, aber auch heller, weil an seinem Ende ein paar Stufen ins Leben hinaufführten, wo die Sonne schien. Zögernd ging sie dem Lichtschein entgegen. Dann endlich war sie angekommen. Hinter dem nächsten Gitter sah sie seine blonden Haare, seine helle Haut. Der Hüne, der bald gegen den weißen Löwen kämpfen musste, erhob sich vom Boden, als sie ans Gitter trat. Sehr aufrecht stand er da, als fürchtete er kein wildes Tier. Sein Körper war kräftig, der Brustkorb breit, die Muskulatur seiner Arme stark ausgeprägt. Er verlor seine aufrechte Haltung auch dann nicht, als er begriff, wer vor ihm stand.
»Ich bin deine Mutter, Thumelicus. Sieh mich an! Deine Mutter!« Sie wiederholte diese Worte ein ums andere Mal, bis es endlich einen Widerhall in seinen Augen gab.
»Mutter?«
Sein Blick irrte über ihr Gesicht, als suchte er etwas, eine Erinnerung, einen Beweis. Sie hielt den Atem an. Als sie ihren Plan fasste, hatte sie nicht bedacht, dass er scheitern konnte, weil er ihr nicht glaubte.
Dann jedoch ging endlich ein Lächeln über sein Gesicht. »Wie hast du mich gefunden?«
Sie schüttelte den Kopf, es war keine Zeit für Erklärungen.
Hastig öffnete sie ihren Umhang und ließ ihren Sohn sehen, was sie darunter verbarg.
Seine Augen weiteten sich. »Was ist das?«
»Das Schwert deines Vaters«, antwortete sie. »Hermut hat es mir gegeben. Er war Arminius’ bester Freund. Auf dem Sterbebett hat dein Vater ihm das Versprechen abgenommen, dir sein Schwert auszuhändigen. Hermut hat es nach Rom gebracht, und ich bin nun hier, um Arminius’ letzten Wunsch zu erfüllen.« Sie zog das Schwert vorsichtig hervor, ein Kurzschwert, das aufblitzte in dem Licht, das die Treppe herunterfiel, mit einem Schaft, der mit Edelsteinen besetzt war. »Wenn du eine Chance hast, den Kampf gegen den weißen Löwen zu gewinnen, dann mit diesem Schwert.«
Es beunruhigte sie, dass er keinen Blick dafür hatte, dass seine Augen an ihrem Gesicht hängenblieben. Es war keine Zeit! Keine Zeit für Mutter und Sohn. Nur diese winzige Chance, sein Leben zu retten, mehr nicht.
»Nimm es, Thumelicus!«, drängte sie. »Und kämpfe, wie dein Vater gekämpft hat.«
Diesmal hörte sie die schweren Schritte zu spät. Sie konnte den Wärtern nur noch aus weit aufgerissenen Augen entgegenblicken. Keine Möglichkeit zur Flucht, kein Versteck. Es war zu spät! Auch ihr Versuch scheiterte, das Schwert durch die Gitterstäbe zu drängen und ihrem Sohn heimlich in die Hände zu geben. Zu spät!
Schon wurde es ihr aus den Fingern gewunden. »Was ist das? Was willst du hier einschmuggeln? Willst du diesem Kerl etwa einen Vorteil verschaffen?«
»Thumelicus!« Ihre Stimme gellte durch die Katakomben.
Er aber antwortete nicht. Sie sah, wie er in seine Höhle zurückwich. Ihre Hilflosigkeit war zu seiner geworden. Die Angst vor dem weißen Löwen hatte ihm seinen Mut nicht rauben können, die Niederlage seiner Mutter jedoch hatte ihn schon besiegt, bevor er in die Arena gehen musste.
Grobe Hände griffen nach ihr. Einer der beiden Wärter steckte das Schwert hinter seinen Gürtel. »Soll der Kaiser sich diese Waffe ansehen! Soll er entscheiden, was mit dem Weib zu tun ist!«
Die Wärter zogen sie mit sich, zerrten sie den Gang entlang, scherten sich nicht darum, dass sie strauchelte, schleiften sie weiter, grob, gnadenlos. Das Letzte, was sie sah, war ein Zipfel von Hermuts Umhang. Wieder hatte er sich rechtzeitig hinter dem Mauervorsprung verbergen können. Und dann sah sie, ehe sie ohnmächtig wurde, noch das Gesicht der Frau. Ja, es war tatsächlich Inaja …
I. BUCH
1.
Die Sonne stand hoch über der Eresburg, der Himmel war wolkenlos und klar. Aber das Licht, das auf die niedrigen Dächer fiel, wärmte nicht, es beschien nur die Kälte des ersten Frühlingstages. Hoffnung schenkte es, aber noch keine Erlösung. Der Wind, der über die Wiesen und Felder gegen die Eresburg anstürmte, war immer noch eisig. Die schmalen Windaugen der Burg waren sorgsam verhängt worden.
»Segimund hat erzählt, dass es in Rom Fenster gibt«, sagte Thusnelda und sah ihrer Dienstmagd zu, wie sie den Holzbottich mit dem Wasser füllte, das sie kurz vorher vom Brunnen geholt hatte.
Inaja richtete sich auf, ließ die Arbeit im Stich und sah ihre Herrin mit großen Augen an. Wie immer, wenn von Rom die Rede war. »Fenster? Was soll das sein?«
»Windaugen aus Glas. Das Licht dringt hindurch, aber Kälte und Wind nicht.«
Inaja schüttelte ungläubig den Kopf. »Seid Ihr sicher, dass Euer Bruder die Wahrheit gesagt hat?«
»Ganz sicher!« Thusnelda lachte und löste die Kordel ihres Nachtgewandes.
»Dann wird’s wohl stimmen«, seufzte Inaja. »So was Verrücktes kann man sich nicht ausdenken. Windaugen aus Glas!« Sie schüttelte den Kopf, als habe man ihr eine dreiste Lüge aufgetischt, aber Thusnelda schien es, als lächelte sie. »Da der Herr Segimundus schon seit Jahren als hoher Priester in Rom ist, wird man ihm wohl glauben dürfen.« Sie wies mit einladender Geste zu dem Holzbottich. »Nun stellt Euch hinein, damit ich Euch abwaschen kann.«
Thusnelda löste die Fibel auf ihrer linken Schulter und ließ ihr Nachtgewand zu Boden fallen. Die langen blonden Haare fielen über ihren Rücken. Sie griff in ihren Nacken und ließ die Fingerspitzen durch die Locken gleiten. Mit geschlossenen Augen stand sie da, als müsste sie sich auf ihre Morgentoilette konzentrieren, auf die sie großen Wert legte. Egal, zu welcher Jahreszeit, gleichgültig, ob es kalt oder warm in ihrer Kammer war. Sie ließ sich von ihrer Dienstmagd sogar von Kopf bis Fuß abwaschen, wenn die Eiszapfen von den Bäumen hingen.
Thusnelda hatte ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen und einem energischen Kinn, das durch ein Grübchen geteilt wurde. Wenn sie lachte, dann strahlten ihre Augen besonders blau unter den dunklen Brauen, die all dem Hellen, was sie umgab, einen Teil des Lieblichen nahm, das durch ihre blasse Haut und ihre blonden Locken entstand. Ihre kräftigen Brauen verrieten dem aufmerksamen Betrachter, dass hinter der anmutigen Gestalt der jungen Frau viel Energie und Kraft steckte.
Schaudernd stieg sie in den Waschbottich. »Segimund sagt, in Rom wird in warmem Wasser gebadet.«
Wieder seufzte Inaja. »Warmes Wasser! Herrlich muss das sein!« Dann aber schien ihr einzufallen, dass etwas anderes von ihr erwartet wurde: »Was für ein verweichlichtes Volk! Und was Euren Bruder Segimundus angeht, Herrin – wisst Ihr, was er mich bei seinem letzten Besuch in der Heimat gefragt hat?«
»Ja, ich weiß es, Inaja!« Lachend unterbrach Thusnelda ihre Dienstmagd. »Er hat dich gefragt, ob unsere Gänse auch mit Feigen gemästet werden. Du hast dich oft genug darüber gewundert.« Sie schlug die Arme um den Oberkörper, um das Frieren zu unterdrücken.
»Und seine Mahlzeiten in Rom würden mit sanftem Flötenspiel untermalt, hat er erzählt.« Inaja griff nach einem Stück Leinen und tauchte es ins Wasser.
»Und die Römer halten uns für schmutzige, ungepflegte Barbaren«, ergänzte Thusnelda. »Fang endlich mit deiner Arbeit an, Inaja, sonst wünschte ich mir, sie hätten recht.«
Gehorsam begann die Dienstmagd, ihre Herrin abzuwaschen, wie sie es jeden Morgen tat. Und wie jeden Morgen beklagte sie ausgiebig Thusneldas schlanken Körper. »Wie soll Euer Verlobter Gefallen an Euch finden, wenn so wenig an Euch dran ist? Der Bauch, die Brüste, die Hinterbacken – nichts ist so, wie es einem Semnonenfürst gefällt.«
»Woher weißt du, was ein Semnonenfürst von einer Frau erwartet?«, fragte Thusnelda.
»Das, was allen Männern gefällt«, erklärte Inaja mit großer Bestimmtheit. »Viel weißes Fleisch!«
Sie selbst hatte all das zu bieten, was angeblich eine Frau für einen Mann begehrenswert machte. Inaja besaß üppige Brüste, eine schmale Taille und ausladende Hüften. Große Augen, von dichten langen Wimpern bekränzt, funkelten in ihrem runden, pausbäckigen Gesicht, darüber kringelten sich rote Locken. Die Knechte im Hause waren allesamt in Inaja vernarrt. Sie jedoch hatte ihre Gunst noch nicht verschenkt. Wenn Thusnelda sie fragte, wann sie heiraten und einen eigenen Hausstand gründen wolle, gab Inaja zur Antwort: »Ich kann Euch doch nicht allein lassen, Herrin. Niemand kann Euch die Haare so flechten wie ich.«
Tatsächlich war die Dienstmagd der Fürstentochter treu ergeben. Ihre große Hoffung war, nach Thusneldas Hochzeit in ihren Diensten bleiben zu dürfen. Erst dann wollte sie sich in Thusneldas neuem Haushalt nach einem Ehemann umsehen.
Sorgfältig mischte Inaja die Seife aus Talg und Asche. »Die sorgt dafür, dass Eure Haut weiß bleibt. Das wird Eurem Verlobten gefallen.«
»Mir ist es egal, ob ich Aristan gefalle. Ich will ihn ja nicht heiraten. Mein Vater will es.«
»Der Fürst weiß, was gut für Euch ist.« Inaja war elternlos und beneidete alle Frauen, die unter dem Schutz eines starken Vaters standen. »Für eine Fürstentochter ist nur ein Fürst der richtige Gemahl.«
Thusnelda antwortete nicht. Schweigend ließ sie sich von Inaja waschen und in wollene Tücher hüllen. Dann setzte sie sich auf einen hölzernen Schemel, damit Inaja ihr die langen blonden Haare kämmen und flechten konnte. Sie hielt die Augen geschlossen, um der Dienstmagd zu zeigen, dass sie nun keine Unterhaltung mehr führen wollte.
Inaja, die ihre Herrin beinahe so gut kannte wie sich selbst, verstand sofort. Schweigend erledigte sie ihre Arbeit, obwohl die Stille sie bedrückte. In germanischen Häusern gab es normalerweise keine Räume, in die man sich zurückziehen konnte, keine Stille, kein Alleinsein. Inaja war in einer winzigen Kate aufgewachsen, die aus einem einzigen Raum bestand, den sich Menschen und Vieh teilten. Die Häuser wohlhabender Bauern bestanden aus zwei Teilen – dem Wohn- und Schlafbereich aller Menschen, die in diesem Haushalt lebten, und von ihm abgetrennt der Stall für das Vieh. Im Hause des Germanenfürsten Segestes, Thusneldas Vater, jedoch gab es mehrere Räume. Seine Tochter Thusnelda schlief in ihrer winzigen Kammer, die ihr allein gehörte, auf einem Podest, das mit Fellen bedeckt war. Inaja verbrachte die Nacht zu ihren Füßen auf dem Steinboden, in ihren wollenen Umhang gehüllt. Das Haus des Fürsten hatte auch keine Wände aus lehmbeworfenem Flechtwerk wie die anderen Häuser der Eresburg, sondern bestand zur Gänze aus Holz. Jeder Raum hatte schmale Windaugen, die im Sommer Licht und Wärme hereinließen und im Winter verhängt wurden. Nur in der Küche war darauf verzichtet worden, denn sie hatte eine offene Feuerstelle in der Mitte, die nicht nur Wärme-, sondern auch Lichtquelle war. In der gesamten Eresburg war das Haus des Fürsten das größte, schönste und komfortabelste.
Thusnelda öffnete die Augen, als Inaja die geflochtenen Zöpfe um ihren Kopf legte und mit hölzernen Nadeln feststeckte.
»Segimer ist krank«, sagte Thusnelda unvermittelt. »Es sieht so aus, als warteten die Walküren bereits in Walhalla auf ihn.«
Thusnelda merkte gleich, dass sie Inaja keine Neuigkeit erzählte. Wie so oft erfuhren die Mägde und Knechte während ihrer Arbeit in Haus und Garten eher, was auf den benachbarten Burgen geschah, als ihre Herrschaften.
»Es heißt, man habe bereits nach Arminius und Flavus rufen lassen«, wusste Inaja zu berichten.
»Dann scheint es wirklich schlecht um ihn zu stehen.« Thusnelda legte die wollenen Tücher ab und ließ sich von Inaja ihren Rock, ihre Bluse und das Umschlagtuch reichen. »Segimer wird seine Nachfolge regeln wollen. Auf den Fürstenthron wollen ihm viele folgen – nicht nur seine Söhne.« Sie wehrte ab, als Inaja ihr helfen wollte, und schlang eigenhändig den Gürtel über den Rock und die Bluse. »Auch andere Fürstensöhne drängen nach. Vor allem Segimers Bruder streckt schon die Hände aus.«
Inaja nickte. »Das habe ich kürzlich auch Euren Vater erzählen hören.«
Thusnelda lächelte, als würde ihr wieder einmal klar, wie viel das Gesinde von seinen Herren wusste. »Für Segimer jedoch ist nie ein anderer Nachfolger als sein ältester Sohn in Frage gekommen«, sagte sie. »Hoffentlich bleibt ihm noch Zeit genug, ihn als zukünftigen Fürsten auszurufen.«
Sie war die Schönste von allen. Ihre schwarzen Locken umrahmten ihr schmales, mit Kreide aufgehelltes Gesicht, große schwarze Augen glühten darin, ihre mit Weinhefe geröteten Lippen lächelten, sie trug den Kopf hocherhoben. In eine weißseidene bodenlange Tunika war sie gehüllt, die in der Taille und unter den Brüsten gegürtet war. Eine edelsteinbesetzte Fibel funkelte auf ihrer linken Schulter. Wenn sie sich bewegte, veränderte sich der Faltenwurf ihrer Tunika, warf Schatten auf ihre Hüften, glänzte hell über ihren vollen Brüsten. Tief atmete sie nun ein, und die Spitzen ihrer Brüste lösten den Faltenwurf der Seide für Augenblicke auf. Dann war es, als hielten die anwesenden Männer den Atem an, so lange, bis die Form ihrer Brüste wieder nur eine Ahnung war und keine beunruhigende Gewissheit. Das Feuer der Fackeln an den Wänden ließ ihr Haar glänzen und ihre Haut schimmern.
Sie schlug die Hand ihrer Sklavin zur Seite, deren Aufgabe es war, ihrer Herrin kühle Luft zuzufächern. Aber Severina legte auf Abkühlung keinen Wert. Sie genoss die Hitze des Feuers, das auf ihrer Haut flackerte, ebenso wie die Hitze, die in ihrem Körper aufstieg.
Sie machte ein paar Schritte und bemerkte voller Genugtuung, dass Arminius ihr einen Blick zuwarf. Noch ein Schritt, und wieder irrte sein Blick zu ihr. Beim dritten Mal, als sie nur noch wenige Schritte von ihm entfernt war, sah sogar der Kaiser auf. Er runzelte ungehalten die Stirn, als er Severinas herausfordernden Blick bemerkte, während Arminius voller Verlegenheit auf seine Füße sah.
Severina war zufrieden. Arminius hatte angebissen, daran bestand kein Zweifel. Es schien ihm sogar schwerzufallen, sich in ihrer Gegenwart auf die Worte des Kaisers zu konzentrieren und auf die Zeremonie, deren Mittelpunkt er war. Severina platzierte sich vor ein Wandgemälde, das mit den goldenen Borten ihrer Tunika harmonierte. Als sie merkte, dass sich viele aufmerksame Blicke auf sie gerichtet hatten, setzte sie einen ihrer zarten Füße vor, die in bestickten Ledersandalen steckten, und fuhr mit der Spitze den Mosaiken des Fußbodens nach. So, als wäre sie in Gedanken, als nähme sie nicht wahr, was um sie herum passierte.
Aber ihr Ablenkungsmanöver gelang nicht. Severina spürte, dass sich jemand an ihre Seite schob. »Du benimmst dich wie eine läufige Hündin«, zischte ihr eine Stimme zu.
Severina hob den Blick nicht. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, Germanicus«, entgegnete sie ruhig. »Im Übrigen hinkt der Vergleich. Eine läufige Hündin lässt jeden zu sich, wenn er nur Hund ist. Ich bin wählerisch.«
Die Worte, mit denen der Kaiser Arminius dafür dankte, dass er seinem Adoptivsohn Tiberius in der Schlacht das Leben gerettet hatte, rauschten an ihr vorbei. Sie blickte wieder auf und sah nur das ernste Gesicht des jungen Germanen, die blonden Locken, die hellen Augen, das kantige Kinn, die vollen Lippen und seinen kräftigen Körper, die Muskeln seiner nackten Oberarme.
»Du weißt nichts von den germanischen Frauen«, raunte Germanicus ihr ins Ohr. »Arminius ist es nicht gewöhnt, sich von einer Frau erobern zu lassen. In seiner Heimat sind die Frauen sittsam und keusch. Sie gehen als Jungfrauen in die Ehe.«
Severina lachte so glockenhell, dass der Kaiser erneut die Stirn runzelte und Arminius’ Hand, die er Augustus entgegenhielt, zu zittern begann. Während der Kaiser ihm einen goldenen Ring als sichtbares Zeichen seiner Ritterwürde ansteckte, flüsterte Severina ihrem Bruder zu: »Umso mehr wird es ihm gefallen, dass die römischen Frauen anders sind.«
»Sind sie das?«, fragte Germanicus zornig zurück. »Du bist anders, so viel steht fest. Ich hätte niemals eine Frau geheiratet, die vor der Ehe herumhurt.«
Severina winkte ab. »Arminius ist als Kind nach Rom gekommen, er ist mehr Römer als Germane.«
Sie selbst war als Jungfrau in die Ehe gegangen, ein junges Mädchen von fünfzehn Jahren. Aber ihre Ehe hatte nur vier Wochen gehalten, dann war ihr Mann in einem unwürdigen Zweikampf gefallen. Seitdem war Severina frei in ihren Entscheidungen. Ihrem Bruder gefiel es zwar nicht, dass sie sich die gleichen Rechte herausnahm wie ein römischer Adliger, aber wer wollte ihr etwas anhaben? Germanicus war von Tiberius adoptiert worden, nachdem der selbst zum Adoptivsohn des Kaisers geworden war. Sie war Germanicus’ Schwester, nach dessen Adoption also die Enkelin des Kaisers! Sie gehörte zur kaiserlichen Familie, niemand würde es wagen, ihren Lebensstil zu kritisieren, der sich im Übrigen gar nicht so sehr von dem der anderen Damen der römischen Gesellschaft unterschied. Keuschheit und Sittsamkeit waren Inbegriffe, die Germanicus noch so oft wiederholen konnte – das würde eine Römerin nicht keusch und sittsam machen. Sollte Germanicus jemals Kaiser werden, was Severina nicht hoffte, dann würde es sicherlich bald ein Gesetz geben, mit dem eine leichtlebige Römerin im Kerker landete. Vielleicht sogar auf dem weißen Sand eines Amphitheaters. Seine Frau Agrippina, die beinahe jedes Jahr ein Kind von ihm bekam, hatte es vermutlich nicht leicht mit ihm.
»Denk gelegentlich an die Lex Julia«, flüsterte Germanicus seiner Schwester zu.
Severina lachte leise. »Die Sittengesetze? Die gelten fürs Volk, nicht für die kaiserliche Familie.«
»Hast du Augustus’ Tochter vergessen? Sie ist verbannt worden wegen ihres unsittlichen Lebenswandels.«
Severina zog die Mundwinkel herab. »Der Kaiser musste ein Exempel statuieren. Und seine Tochter hatte es wohl zu toll getrieben. Das ist alles. Mich geht das nichts an!«
Germanicus wandte sich ungehalten ab, und Severina beobachtete, wie Arminius von einem Adeligen zum anderen geschoben wurde, von einer Hand zur anderen, von einem Glückwunsch zum nächsten. Tiberius’ Lebensretter wollte jeder zum Freund haben. Besonders die Frauen! Severina lächelte, als Agrippina die Gelegenheit nutzte, mit einer flüchtigen Geste, die zufällig aussehen sollte, Arminius’ Haar zu berühren. Sie wusste, wie sehr ihre Schwägerin das blonde Haar der Germanen bewunderte. Ob Germanicus das auch wusste?
Severina hielt nach ihrem Bruder Ausschau, dabei streifte ihr Blick den zweiten blonden Offizier, der sich in diesem Raum aufhielt. Genauso groß und kräftig wie Arminius, aber bei weitem nicht so charismatisch. Während Arminius von den Römerinnen unverhohlen bewundert wurde, gönnte seinem Bruder Flavus niemand einen Blick. Auch Severinas Augen wanderten gleichmütig weiter. Sie erwiderte seinen Gruß nicht, übersah seinen intensiven Blick, ging mit keinem Wimpernschlag auf das Werben ein, mit dem er sie schon seit Wochen verfolgte. Nein, Flavus war es nicht, den sie begehrte. Sie wollte seinen Bruder.
Thusnelda saß an ihrem übermannshohen Webstuhl und arbeitete an ihrer Aussteuer. Feines weißes Leinen entstand unter ihren Händen. Der Semnonenfürst Aristan sollte zufrieden sein, wenn sie demnächst mit ihrem Hab und Gut in seine Burg zog.
Thusnelda seufzte auf. Sie hatte ihren Verlobten bisher nur zweimal zu Gesicht bekommen. Einmal, als er bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hatte, und dann, als das Heiratsversprechen feierlich bekräftigt worden war. Aristan war ein vierschrötiger Mann, kaum größer als Thusnelda, von breiter Statur, grobknochig und mit einem finsteren Blick, der ihr Angst machte. Zwar hatte er freundliche Worte an sie gerichtet, mit einer sanften Stimme, die ihr einen Teil der Angst genommen hatte, trotzdem hatte sie während der Verlobungsfeierlichkeiten den Blick kaum von seinen groben Händen nehmen können. Und der Gedanke, demnächst von ihnen berührt zu werden, verursachte ihr eine Gänsehaut.
Ja, sie hatte Angst. Große Angst! Der Stamm der Semnonen lebte östlich der Elbe. Würde sie jemals in das Haus ihres Vaters zurückkehren können, wenn sie in Fürst Aristans Burg eingezogen war? Oder würde der Abschied von zu Hause ein Abschied für immer sein? Und was, wenn sie im Semnonenland unglücklich wurde? Niemandem würde sie ihr Herz ausschütten, niemand würde ihr helfen können.
Nein, das stimmte nicht. Thusnelda lächelte, während sie sich insgeheim korrigierte. Inaja würde bei ihr bleiben. Zum Glück! Solange Inaja ihr Leben mit ihr teilte, würde sie nie ganz allein sein. Inaja war längst viel mehr als eine Dienstmagd für Thusnelda.
Der Webstuhl stand in der Küche, in die genug Licht einfiel, in der Nähe der Kochgelegenheit. Zwar wusste Thusnelda, dass es dem Stoff nicht gut tat, in der Wärme gewebt zu werden, aber sie hatte sich geweigert, in eins der Grubenhäuser zu gehen, die in die Erde eingelassen worden waren. Durch aufgeworfenen Mist schützten sie vor Frost, dienten als Vorratskeller und im Winter als warme Arbeitsräume. In ihnen ließen sich Wolle und Flachs leichter verarbeiten, weil in diesen feuchten Räumen die Fäden nicht zu trocken wurden. Doch sie hatte ihrem Vater abgetrotzt, ihre Aussteuer in der Küche weben zu dürfen. Und der hatte schließlich nachgegeben, weil er meinte, dass der fürstliche Haushalt von Aristan, der bereits zweimal verheiratet gewesen war, über ausreichend Leinen verfügte. Auf Thusneldas Aussteuer kam es im Grunde nicht an.
Segestes war zweimal in der Küche erschienen, hatte einen Blick auf Thusneldas Webarbeit geworfen, den Kopf geschüttelt, seine verstorbene Frau verwünscht, der es nicht gelungen war, aus der Tochter eine gute Hausfrau zu machen, und war dann wortlos gegangen. Thusnelda war froh gewesen, dass er auf den sonst üblichen scharfen Tadel verzichtete. Sie wusste ja, dass es um ihre Fähigkeiten am Webstuhl nicht gut bestellt war.
Sie legte die Spindel zur Seite und sah der Küchenmagd eine Weile beim Zubereiten der nächsten Mahlzeit zu. Amma mischte gerade Mehl mit Wasser und begann dann, den Teig für die Brote zu kneten. Sie wurden später unter der Asche des Herdes zwischen heißen Steinen zu großen Fladen gebacken.
Thusnelda wollte wieder zu ihrer Spindel greifen, um die ungeliebte Arbeit fortzusetzen, da erschien ihre Dienstmagd in der Küche. Inaja warf ihr einen besorgten Blick zu. Sie fand es nicht richtig, dass Thusnelda, die Tochter eines Fürsten, ihre Aussteuer eigenhändig herstellen musste. Aber Fürst Segestes hatte gesagt, so sei es der Brauch für jede Germanen-Braut, und seine Tochter solle keine Ausnahme darstellen.
Inaja ging zur Kochstelle, wo ein Krug stand, den sie kurz zuvor mit frischem Wasser gefüllt hatte. Mit einem Becher in der Hand ging sie zu ihrer Herrin. »Das wird Euch guttun.«
Thusnelda betrachtete sie nachdenklich, während sie trank.
Zu gerne hätte sie Inaja um Rat gefragt. Die Dienstmagd hatte ihr einiges voraus, das wusste Thusnelda. Wenn es um Männer und um die Liebe zu einem Mann ging, hatte Inaja bereits Erfahrungen. Sie war leichtfertig, das war allgemein bekannt. Thusnelda selbst hatte sie schon im Heu liegen sehen, wo sie einen Knecht geküsst und geduldet hatte, dass seine Hand unter ihr wollenes Gewand tastete. Thusnelda war sicher, dass Inaja keine Jungfrau mehr war. Aber sollte sie sich die Blöße geben, ihre Dienstmagd zu bitten, sie auf das vorzubereiten, was eine Frau erwartete, die sich einem Mann hingab? Die sich ihm hingeben musste? Nein, Thusnelda reichte Inaja den Becher und schüttelte unmerklich den Kopf. Das war unter ihrer Würde!
»Geht es Euch nicht gut?«, fragte Inaja leise. »Soll ich Euch die Arbeit abnehmen? Euer Vater reitet gerade über die Felder, um die Bauern bei ihrer Arbeit zu kontrollieren. Er wird so schnell nicht zurückkehren.«
Thusnelda zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. Nein, auch das musste unter ihrer Würde sein. Fürst Segestes’ Tochter durfte nicht zu erkennen geben, dass sie ungeschickter war als eine Dienstmagd. Genauso wenig, wie sie zu erkennen geben durfte, dass ihr die zukünftigen Pflichten als Ehefrau Angst machten. Wenn doch ihre Mutter noch lebte! Oder wenn es in der Eresburg eine Frau gäbe, die von gleichem Stande war! Der hätte sie sich anvertrauen und ihrem Rat folgen können!
Inaja zog einen Schemel heran und setzte sich zu Thusnelda. »Gerade war ein Händler da, der Stoffe und Bernstein anbot.« Sie nahm Thusnelda unauffällig die Spindel aus der Hand und rückte ihren Schemel näher an den Webstuhl heran. Thusnelda tat so, als bemerkte sie nicht, dass Inaja ihre Webarbeit fortsetzte, während Inaja vorgab, nur ein wenig mit Spindel und Faden zu spielen. »Der Händler hat erzählt«, fuhr sie fort, »dass Segimers Zustand sich verschlechtert hat.«
»Es geht mit ihm zu Ende?«, fragte Thusnelda erschrocken.
Inaja nickte. »Seine Tochter ist bereits gekommen, um die Mutter bei der Pflege des Vaters zu unterstützen.«
»Wiete!« Thusnelda lächelte, als sie an die Hochzeit auf der Teutoburg dachte. Die einzige Tochter Fürst Segimers hatte einen Stammesfürsten der Brukterer geheiratet, die westlich der Cherusker lebten. Das Gebiet der Brukterer dehnte sich bis zum Rhein aus. Wiete war ein paar Jahre älter als Thusnelda, und als sie heiratete, waren sämtliche Gaufürsten der Umgebung mit ihren Familien zugegen gewesen. Nur Arminius und Flavus, Wietes Brüder, waren im römischen Heer unabkömmlich gewesen. Für den Bräutigam war es bereits die zweite Ehe, seine erste Frau war im Kindbett gestorben. Das Baby jedoch hatte überlebt, und Wiete hatte es schon bei ihrer Hochzeit ins Herz geschlossen. Sie war dem kleinen Mädchen eine gute Mutter geworden. Ein eigenes Kind hatte sie bisher nicht zur Welt gebracht.
Inaja unterbrach Thusneldas Gedanken. »Ich habe gehört, dass Hermut sich bereitmacht, um Arminius und Flavus zurückzuholen.«
»Hermut?« Thusnelda runzelte die Stirn und dachte nach.
»Arminius’ Freund«, erklärte Inaja. »Sein bester Freund seit Kindertagen! Obwohl er Arminius nicht ebenbürtig ist. Hermut ist der Sohn eines Bauern, der vor der Teutoburg lebt.«
Thusnelda sah ihre Magd erstaunt an. »Woher weißt du das?«
Inaja zuckte die Achseln und webte plötzlich so emsig, dass sie ihre Herrin nicht ansehen konnte. Ein feines Rot überzog ihre Wangen, und Thusnelda begriff plötzlich. »Macht er dir den Hof?«, fragte sie leise.
Inaja nickte, ohne aufzublicken. »Aber ich will nicht in die Teutoburg wechseln. Ohne Euch!«
Thusnelda erhob sich, griff nach ihrem wollenen Umhang und verließ ohne ein weiteres Wort das Haus. Draußen blieb sie stehen und atmete tief ein. Dann ging sie zu der Stelle, wo ein Teil der Einfriedung zu erkennen war, der die Teutoburg umgab. Zwischen der väterlichen Burg und der des Germanenfürsten Segimer lagen morastige Wiesen, hier und da von niedrigen Wäldchen durchsetzt. Von der höchsten Stelle der Eresburg konnte Thusnelda den höchsten Punkt der Teutoburg erahnen. Ob sie das Glück haben würde, Arminius und Flavus vorbeireiten zu sehen, wenn sie ans Sterbebett ihres Vaters eilten? Viele Jahre waren vergangen, seit sie den Brüdern zum letzten Mal begegnet war. Und viel war darüber geredet worden, wie schön, edel und siegreich Arminius in Rom geworden war.
Der Morgen stieg hinter den gläsernen Windaugen auf. Als Severina die Augen öffnete, bemerkte sie gleich, dass die Schwärze hinter den Fenstern sich gelichtet hatte. Zu einem hellen Grau war sie geworden, das sich mit winzigen Lichtpunkten sprenkelte. Bald würde die Sonne über den Bäumen stehen, gleißend und hell, dann sollte sie den kaiserlichen Palast verlassen haben. Besser, sie ließ es nicht auf einen weiteren Streit mit Germanicus ankommen und erst recht nicht auf eine Missstimmung des Kaisers. Große Sorgen machte sie sich zwar nicht, aber es konnte nicht schaden, die Beziehung zu Arminius mit aller Vorsicht anzugehen. Er selbst hatte sie sogar darum gebeten. Severina lächelte bei dem Gedanken daran, wie besorgt Arminius um ihren guten Ruf gewesen war, als sie ihm in das Gästezimmer folgte, das der Kaiser dem neuen Ritter seines Reiches zur Verfügung gestellt hatte. Tief in seinem Herzen war Arminius eben doch ein sittenstrenger Germane.
Severina stützte sich auf und betrachtete sein Gesicht. Noch im Schlaf war es das Gesicht eines Kriegers. Der entschlossene Ausdruck, die Härte in seinen Zügen verließ es auch im Schlaf nicht.
Severina lächelte, sie liebte starke Männer. Fast war sie enttäuscht gewesen, als sich herausstellte, dass Arminius in der Liebe empfindsam, zärtlich und schwach war.
Im Grau des frühen Morgens entstand nun ein goldener Schimmer. Die Sonne war auf dem besten Wege, den Tag zu erobern. Es wurde Zeit, sich zu erheben. Ihre Sklaven, die bei den Haussklaven des Kaisers übernachtet hatten, sollten beim ersten Tageslicht hinter dem Gästehaus auf sie warten. So war es ihnen befohlen worden. Severina wollte ungesehen nach Hause kommen.
Sie lauschte in den Morgen hinein. Noch war er ohne Geräusche. Die Sklaven, die den Garten zu versorgen hatten, schliefen anscheinend noch.
»Faules Pack!«, murmelte Severina. Sollten es ihre eigenen Sklaven ebenso halten, dann würden sie die Peitsche zu spüren bekommen.
Sie beugte sich ein letztes Mal über Arminius, blies ihm sanft eine Locke aus der Stirn, streichelte ihre rechte Wange mit seinem weichen Brusthaar und ließ ihre Lippen auf seiner kräftigen Armmuskulatur tanzen. Arminius regte sich, aber er erwachte nicht. Schade! Severina hätte sich gern von ihm verabschiedet, sich gern vergewissert, dass die vergangene Nacht für ihn die gleiche Bedeutung hatte wie für sie. Sie wollte sich seine Liebe beteuern lassen, wollte hören, wie sehr er sie begehrte, dass sein Begehren nie ein Ende haben würde.
Aber Arminius erwachte nicht. Sie würde ihn verlassen müssen, ohne mehr zurückzulassen als eine süße Erinnerung und die Hoffnung auf ein Versprechen. Severinas Lächeln vertiefte sich. Ja, so war es richtig. Eine Frau wie sie weckte einen Mann nicht für einen Abschiedskuss. Arminius sollte sich, wenn er erwachte, fragen, ob er die Frau, die er in der letzten Nacht besessen hatte, erobert oder schon wieder verloren hatte. Ungewissheit machte aus der Liebe ein spannendes Spiel.
Sie erhob sich, ohne Arminius aus den Augen zu lassen. Ihre seidene Tunika raschelte, als sie sie zur Hand nahm, trotzdem blieben Arminius’ Atemzüge ruhig und gleichmäßig. Erstaunlich, dass ein Krieger wie er, der immer damit rechnen musste, vom Feind im Schlaf überfallen zu werden, so sorglos schlummern konnte! Das erste Vogelzwitschern, Severinas Bewegungen, das Geräusch ihre nackten Füße auf dem Bodenmosaik, das alles konnte sein Vertrauen in die Sicherheit nicht erschüttern, in der er sich zurzeit befand. Er, der Günstling des Kaisers, Tiberius’ Lebensretter, der Held, der soeben zum Ritter geschlagen worden war, der blonde Schönling, dem die Enkelin des Kaisers ihre Gunst gewährt hatte. Nein, ein Krieger wurde von anderen Geräuschen aufgeschreckt …
Severina blieb keine Zeit, ihre Blöße zu bedecken. Der Griff zu ihrer Scham, mehr gelang ihr nicht, als die Schritte auf dem Gang ertönten. Herrische Schritte, eilige, die keine Angst hatten, gehört zu werden. Severina starrte noch mit weit aufgerissenen Augen auf die Tür, während Arminius bereits neben dem Bett stand und nach seinem Schwert griff.
Schon wurde die Tür aufgerissen, ein blonder Offizier stand im Raum. »Aufwachen!«
Arminius ließ sein Schwert sinken. »Flavus! Was ist geschehen?«
Severinas Schreck verging schnell in der Glut von Flavus’ Augen. Aufreizend langsam nahm sie ihre Tunika vom Boden auf, die ihr aus den Händen geglitten war, und hielt sie vor ihren nackten Körper. Herausfordernd lächelte sie in Flavus’ Augen, die dunkel geworden waren vor Enttäuschung, Zorn und Verzweiflung. Severinas Lächeln vertiefte sich, während sie wieder unter die seidene Decke kroch und sich dorthin legte, wo es noch warm war von Arminius’ Körper. Sie wusste, dass ihre Haut im ersten Morgenlicht bronzen schimmerte und die Knospen ihrer Brüste aussahen wie Oliven an einem verbotenen Baum.
»Was ist geschehen?«, wiederholte Arminius.
Flavus riss seinen Blick von Severina los. Aus seiner grellen Gier wurde im Nu finsterer Hass, als er seinen Bruder ansah. »Aufstände in Pannonien«, stieß er mühsam hervor. »Schon wieder! Wir müssen in unsere Einheit zurück. Tiberius wartet auf uns.«
Arminius nickte und griff nach seiner Kleidung. Als er mit Severina sprach, begriff sie erschrocken, dass sie nun wieder nichts anderes war als irgendein Mitglied der kaiserlichen Familie.
»Ich hoffe, Eure Sklaven werden Euch sicher nach Hause bringen. Ihr versteht, dass der Ruf des Kaisers Vorrang hat?«
Er ließ Severina keine Zeit zu antworten. In diesen wenigen Augenblicken hatte er sich angekleidet und schob nun seinen Bruder aus dem Raum, der sich offenbar schwerer von Severinas Anblick lösen konnte als Arminius.
Eine halbe Stunde später stand Severina hinter dem Gästehaus, wo ihre Sklaven mit der Sänfte bereits auf sie warteten. Trotzdem ordnete sie fünf Peitschenhiebe für jeden von ihnen an. Sklaven waren dafür da, aus der schlechten Laune ihrer Herrin ein Gefühl zu machen, das erträglich war.
Wieder saß Thusnelda an ihrem Webstuhl. Ihre Augen wanderten zum Tuchbaum hoch, der kaum mehr als ein paar Handbreit fertiggewebtes Leinen hielt. Sie kam einfach nicht voran mit ihrer Arbeit. Mehr als zwei Leinentücher hatte sie noch nicht zuwege gebracht.
Sie legte die Hände in den Schoß und beobachtete, wie Amma die beiden Stoffe aus einem Holztrog hob und kritisch betrachtete. Im warmen Wasser, dem fettlösende Mittel beigesetzt worden waren, hatte Amma sie eingeweicht, nun sollten sie gestampft und getreten werden, damit das Gewebe gereinigt wurde und sich verdichtete. Thusnelda war froh, dass ihr Vater nicht von ihr verlangte, auch dieses Walken selber zu erledigen.
Sie spürte, dass er hinter sie trat. Eilig nahm sie die Hände aus dem Schoß und griff nach der Spindel.
»Nur gut, dass Aristan ein reicher Mann ist«, brummte Segestes hinter ihr. »Dem ist es nicht wichtig, was du in die Ehe einbringst.«
Thusnelda wandte sich nicht um. »Warum erlaubt Ihr nicht, dass Inaja mir hilft, Vater? Sie ist sehr geschickt am Webstuhl.«
Sie spürte, dass ihr Vater zögerte. Würde er ihren Bitten endlich nachgeben? Tapfer schob sie ihre Spindel, auf den der Schussfaden gewickelt war, in das sogenannte Fach, wodurch der Schussfaden und der Kettfaden sich kreuzten und zu einem festen Gewebe verbanden. Vielleicht würde es ihren Vater gnädig stimmen, wenn er sah, dass sie sich bemühte?
Tatsächlich hörte sie ihn etwas brummen, was sich anhörte wie: »Also gut!«
Thusnelda drehte sich um und sah ihren Vater mit großen fragenden Augen an. Er wich ihrem Blick aus. Seinem bärtigen Gesicht war nicht anzusehen, ob er zornig war oder milde gestimmt. Seine Feinde wussten nie, mit welcher Reaktion sie rechnen mussten. Auch seine Knechte und Mägde erhielten einen Schlag mit dem Stock oft völlig unerwartet, nicht einmal seine Familie konnte an seiner Miene ablesen, was sie vom Fürsten zu erwarten hatten. Seine kühlen grauen Augen versteckten sich unter seinen buschigen Brauen, seine Lippen öffneten sich selten zu einem Lächeln und wenn, dann verbarg es sich in seinem Vollbart, so dass niemand ganz sicher sein konnte, dass Segestes wirklich gelächelt hatte.
»Ich müsste mich ja schämen, wenn ich dich nach der Hochzeit zu Aristan in seine Burg bringe.«
Bald darauf saß Inaja vor dem Webstuhl und Thusnelda neben ihr, die vorgab, von Inajas Fähigkeiten lernen zu wollen. Amma, die junge Küchenmagd, blickte immer wieder ängstlich zu den beiden hin, während sie das Küchenfeuer schürte. Anscheinend hatte sie die Worte ihres Herrn nicht als Zustimmung verstanden und fürchtete nun, bei einer Bestrafung ebenfalls den Stock zu spüren zu bekommen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Segestes die Schläge, die er seiner Tochter verabreichen wollte, dem Gesinde verpasste.
Thusnelda jedoch war guter Dinge. Sie kannte ihren Vater am besten von allen und wusste, wie seine verblümte Rede zu verstehen war. Seit ihre Mutter nicht mehr lebte, war sie die Einzige, die ein warmes Gefühl in Fürst Segestes erzeugen konnte. Aber sie war auch die Einzige, die es bemerkte.
»Fürst Segimer geht es schlechter«, flüsterte Inaja mit einem Blick auf Amma, die sie an ihren Geheimnissen nicht teilhaben lassen wollte. »Hermut ist nun aufgebrochen, um die Söhne aus Pannonien zurückzuholen.«
Thusnelda sah ihre Magd erstaunt an. »Von wem hast du das erfahren?«
Inaja sah nicht auf, als sie antwortete: »Von Hermut selbst.«
»Du kennst ihn?«
Inaja nickte. »Sein Weg führt oft an der Eresburg vorbei. Und Ihr wisst ja, Herrin, dass Euer Vater mich gelegentlich zur Arbeit aufs Feld schickt.«
Über Thusneldas Gesicht ging ein Lächeln. »Und dann hat Hermut angehalten, um mit dir zu plaudern?«
Inaja wurde rot. »Nur, wenn die Fürstensöhne nicht bei ihm waren.«
»Die hast du auch gelegentlich gesehen?«
Inajas Hände wurden immer flinker, immer hastiger, trotzdem webte sie wesentlich akkurater als ihre Herrin. »Nachdem sie römische Offiziere geworden waren, sind sie zwei- oder dreimal in der Heimat zu Besuch gewesen.«
»Ja, davon habe ich gehört.« Thusneldas Augen blickten verträumt. »Aber begegnet bin ich ihnen nie. Arminius und Flavus waren noch Kinder, als ich sie zum letzten Mal sah. Damals hießen sie noch Irmin und Sigwulf.« Thusnelda lachte. »Und ich war ein kleines Mädchen, dem sie keine Beachtung schenkten.«
Inaja warf ihrer Herrin einen anerkennenden Blick zu. »Das dürfte sich ändern, wenn Ihr die Brüder bei Segimers Beisetzung wiederseht.«
Thusnelda hielt es plötzlich nicht mehr auf ihrem Schemel. Sie ging zur Feuerstelle und wies Amma an, Wasser vom Brunnen zu holen. Als sie weitersprach, blieb sie dort stehen, schloss die Distanz zu Inaja nicht wieder, die ihr plötzlich zu einem Bedürfnis geworden war. Sie war Inajas Herrin, es ging nicht an, dass ihre Dienstmagd etwas wusste, auf das sie, die Tochter des Fürsten Segestes, neugierig war.
»Dieser Hermut gefällt dir wohl?«, fragte Thusnelda, griff nach einem Schürhaken und stocherte in der Glut des Herdes herum.
»Ich gefalle ihm«, korrigierte Inaja und warf ihrer Herrin einen unsicheren Blick zu. »Aber Ihr wisst ja – ich will keinen Mann, der nicht dort lebt, wo Ihr lebt.«
Dieser Satz war Thusnelda genug, um die Distanz zu ihrer Magd wieder aufzugeben. »Ist Hermut ein Bauer?«, fragte sie, nachdem sie sich wieder an Inajas Seite vor dem Webstuhl niedergelassen hatte.
Inaja schüttelte den Kopf. »Der Sohn eines Bauern ist er und eben auch Arminius’ bester Freund. Er wurde Arminius mitgegeben nach Rom, als die beiden Fürstensöhne zu römischen Offizieren ausgebildet werden sollten. Hermut war Arminius’ Diener, aber auch ein Krieger wie Arminius selbst. Er hat an seiner Seite manches Gefecht überstanden. Und die beiden haben sich gegenseitig mehr als einmal das Leben gerettet.«
»Und wie kommt es«, fragte Thusnelda spöttisch, »dass Hermut so viel Zeit hatte, dir seine Lebensgeschichte zu erzählen?«
Aber Inaja ließ sich nicht einschüchtern. »Weil er beim ersten Pannonienaufstand schwer verletzt wurde. Arminius hat ihn nach Hause geschickt. Mit einem Händler ist er heimgekommen und in der Teutoburg gesundgepflegt worden. Es ist ein großes Glück, dass Hermut nach Pannonien reiten kann, um Arminius und Flavus ans Sterbebett ihres Vaters zu rufen.«
»Wird der Kaiser die beiden überhaupt gehen lassen?«, überlegte Thusnelda.
Inaja legte die Spindel zu Seite. »Wie es scheint, hat Arminius am römischen Hofe einen guten Ruf.«
»Sagt das Hermut?«, fragte Thusnelda spöttisch.
»Ja!«, kam es trotzig von Inaja zurück. »Und er sagt auch, dass die edelsten Römerinnen ganz verrückt auf Arminius’ blonde Locken sind.« Inaja nahm wieder die Spindel zur Hand. »Ich habe die Brüder dreimal von weitem gesehen. Zwei wirkliche Helden! Ich glaube, sie sind schöner als alle anderen Fürsten im Cheruskerland.«
»Schöner als Aristan, willst du mir sagen?« Thusnelda fühlte plötzlich eine tiefe Traurigkeit in sich aufsteigen, die sie im Nu ausfüllte und ihr das Herz abdrückte.
»Arminius wäre Euch ebenbürtig«, flüsterte Inaja. »Nicht weniger als Fürst Aristan.«
Thusnelda schüttelte die Traurigkeit aus ihrem Körper, indem sie zu lachen begann. »Ich weiß schon, was du willst, Inaja! Du möchtest, dass mein Vater es sich anders überlegt und mich Arminius zur Frau gibt, damit du mit mir in die Teutoburg ziehen darfst. Dann kannst du Hermut heiraten und trotzdem meine Dienstmagd bleiben. Habe ich dich durchschaut?«
Thusnelda lachte und wartete darauf, dass Inaja endlich schuldbewusst nickte und mitlachte. Aber sie wurde bald wieder ernst, weil Inaja einfach keine Zustimmung abzuringen war. Unbewegt sah die Magd auf ihre Arbeit und schien mit ihren Gedanken weit weg zu sein.
2.
Severina ließ sich vor ihrem Schminktisch nieder, auf dem eine große hölzerne Schmuck- und Schminkschatulle stand, in deren Deckel ein Perlmutt-Mosaik eingelassen war. Mehrere Öl- und Parfümflaschen standen daneben, ein breiter Kamm lag bereit, bronzene Geräte zur Nagelpflege waren exakt nebeneinander angeordnet. Severina lehnte sich zurück und schloss die Augen. Noch immer wollte sich nicht die Befriedigung einstellen, die Sättigung nach einer langen Liebesnacht, die süße Schwäche in den Gliedern und die Kraft in der Nähe des Herzens. Als sie Arminius über sich gezogen hatte, war sie sich wie eine Siegerin vorgekommen, aber schon als er neben ihr einschlief, entstand die Ahnung in ihr, dass sie einen Sieg errungen hatte, für den sich kein Kampf lohnte. Eine Kapitulation, weil es auf den Sieg nicht ankam, ein Strecken der Waffen, die sowieso nichts taugten. Und als Arminius seinem Bruder gefolgt war, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen, hatte sie sich wie eine Verliererin gefühlt – zum ersten Mal in ihrem Leben.
Sie schlug einer Sklavin den Kamm aus der Hand. »Die Frisur hat Zeit. Kümmere dich um meine Zähne!«
Die Sklavin verbeugte sich ängstlich und holte eilig zwei weitere Sklavinnen herbei, die alles zusammentrugen, was für die Zahnpflege ihrer Herrin benötigt wurde. Obwohl Severina verlangte, dass das Mundwasser vor ihren Augen angerührt wurde, sah sie nicht zu, als die Sklavinnen den Urin ihrer Herrin, von dem Gaviana täglich etwas für Severinas Mundwasser abzuschöpfen hatte, mit zerstoßenem Horn, Natron, Eselsmilch, Hasenkopfasche und Bimsstein verrührten. Eine Küchensklavin brachte das wohlschmeckende Harz des Mastixbaums herbei, das Severina nach dem Gurgeln gern kaute, um einen frischen Atem zu bekommen. Eine andere kam mit Zahnstochern, die aus Mastixholz gefertigt waren, weil Severina die silbernen Zahnstocher ablehnte, die in vornehmen Häusern üblich waren. Die Sklavinnen beobachteten die Reaktionen ihrer Herrin genau, während sie Severinas Zähne mit einem Zahnpulver einrieben, das auf der Basis von Natron hergestellt worden war. Oft wurde Severina die Pflege ihrer Zähne, die sie selbst angeordnet hatte, schnell lästig, und sie schlug unvermittelt die Hände weg, die sich um sie bemühten.
Von ihrer Hauptsklavin Gaviana ließ sie sich Kissen in den Rücken schieben und das Haar zurückkämmen, und immer noch öffnete sie ihre Augen nicht. Gut ein Dutzend Sklavinnen waren es mittlerweile, die um sie herumstanden, bemüht, ihre Wünsche zu erahnen. Als kein einziger über Severinas Lippen kam, fragte Gaviana, die sich am wenigsten vor ihrer Herrin fürchtete: »Soll ich Eure Fingernägel neu bemalen?«
Severina streckte Gaviana als Antwort die Hände hin. Aber bevor ihre Hauptsklavin sie ergreifen konnte, ertönte von der Tür eine Stimme: »Lasst mich mit eurer Herrin allein.«
Severina öffnete die Augen nicht. »Schickt dich mein Bruder, Agrippina? Dann sag ihm, er soll sich aus meinen Angelegenheiten heraushalten.«
Sie hörte, dass ihre Schwägerin sich auf einem der niedrigen Diwane niederließ, von denen es mehrere in ihrem Schlafzimmer gab. Agrippina war eine leibliche Enkelin von Kaiser Augustus, während Severina sich nur so nennen durfte, weil ihr verstorbener Vater Drusus der Bruder von Tiberius war, den Augustus adoptiert hatte, damit er einmal sein Nachfolger wurde. Agrippina aber war das Kind von Augustus’ Tochter Julia, die er in die Verbannung geschickt hatte, weil sie angeblich einen liederlichen Lebenswandel geführt hatte. Vielleicht war Agrippina deswegen so sehr um die Schwester ihres Mannes besorgt? Fürchtete sie, Severina blühte ein ähnliches Schicksal wie ihrer Mutter?
Agrippinas Tunika raschelte, ihre Armreifen klirrten, sie schien nervös zu sein. »Ich mache mir genauso große Sorgen wie Germanicus«, sagte sie.
Severina lachte, ohne die Augen zu öffnen. »Darf ich fragen, warum?«
»Du warst in der vergangenen Nacht nicht zu Hause.«
Severina fuhr hoch und spuckte das Mundwasser von sich, mit dem sie gerade zu gurgeln begonnen hatte.
Die Sklavinnen stürzten herbei, um es von ihren Füßen und vom Boden zu wischen. Gaviana hielt feuchte, warme Tücher in den Händen und erkundigte sich besorgt, ob nach den Anstrengungen der Zahnpflege zunächst Severinas Teint erfrischt werden solle, ehe sie die Unterhaltung mit ihrer Schwägerin fortsetzte.
Aber Severina winkte ab. »Verschwinde!« Ihre Stimme klang nur unwesentlich freundlicher, als sie sich an ihre Schwägerin wandte. »Oder soll ich Gaviana anweisen, für dich eine Gesichtsmaske anzurühren? Oder auch ein Mundwasser? Wir können uns auch gemeinsam die Körperhaare entfernen lassen.«
Agrippina jedoch lehnte dankend ab. »Ich habe mir soeben das Gesicht mit lauwarmer Eselsmilch waschen lassen. Das reicht.«
Damit war der Höflichkeit genug getan. Severina gab sich keine Mühe, ihren Ärger zu unterdrücken, als sie fragte: »Woher weißt du, dass ich die Nacht woanders verbracht habe? Hat mein Bruder dich etwa beauftragt, mein Bett zu kontrollieren?«
»Niemand kontrolliert dich, du bist eine freie Römerin.«
»Genau! Was machst du dir also Sorgen?«
»Du gehörst zur kaiserlichen Familie, Severina, du bist Witwe. Der Kaiser möchte, dass du dich wieder vermählst. Mit einem angesehenen Römer. Germanicus möchte das auch.«
Severina lachte, ohne die Augen zu öffnen. »Das kann ich mir vorstellen! Aber ihm zuliebe werde ich bestimmt nicht noch einmal heiraten. Nur dann, wenn ich es will!«
»Wenn sich herumspricht, dass du die Nacht bei dem neuen Ritter des römischen Reiches verbracht hast …«
»Er ist verrückt nach mir, und er ist ein schöner Mann. Warum also sollte ich ihn zurückweisen? Weil mein Bruder es will? Sicherlich nicht! Und wenn Arminius zurückkommt, werde ich so viele Nächte mit ihm verbringen, wie es mir gefällt.« Sie bemühte sich um ihr herrisches Lachen, das ihr jedoch nicht recht gelingen wollte, und hoffte nur, dass es nicht verzagt auf Agrippina wirkte. »Du hättest sehen sollen, wie verzweifelt er war, als er schon in den frühen Morgenstunden nach Pannonien gerufen wurde. Wie gern wäre er bei mir geblieben!«