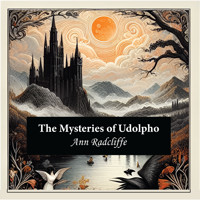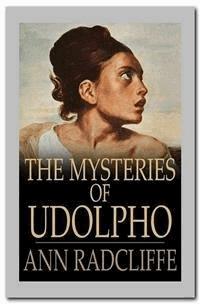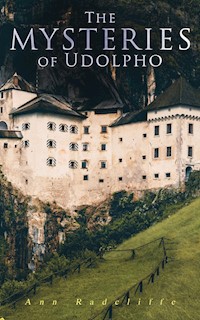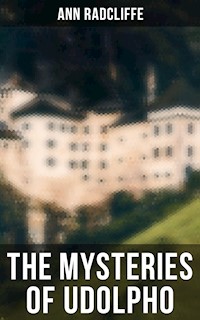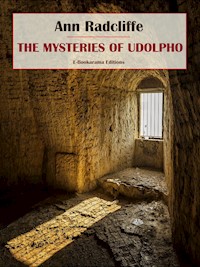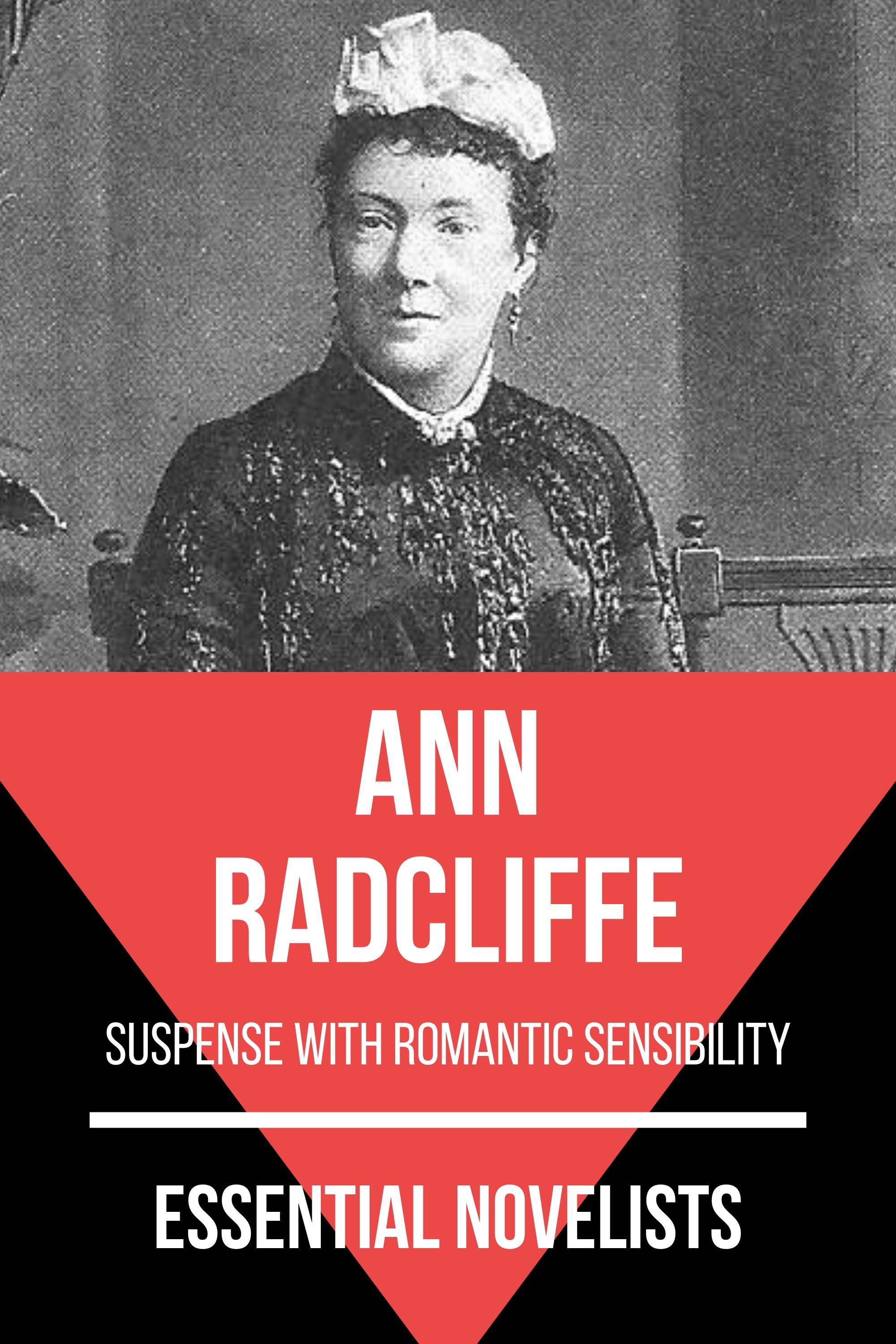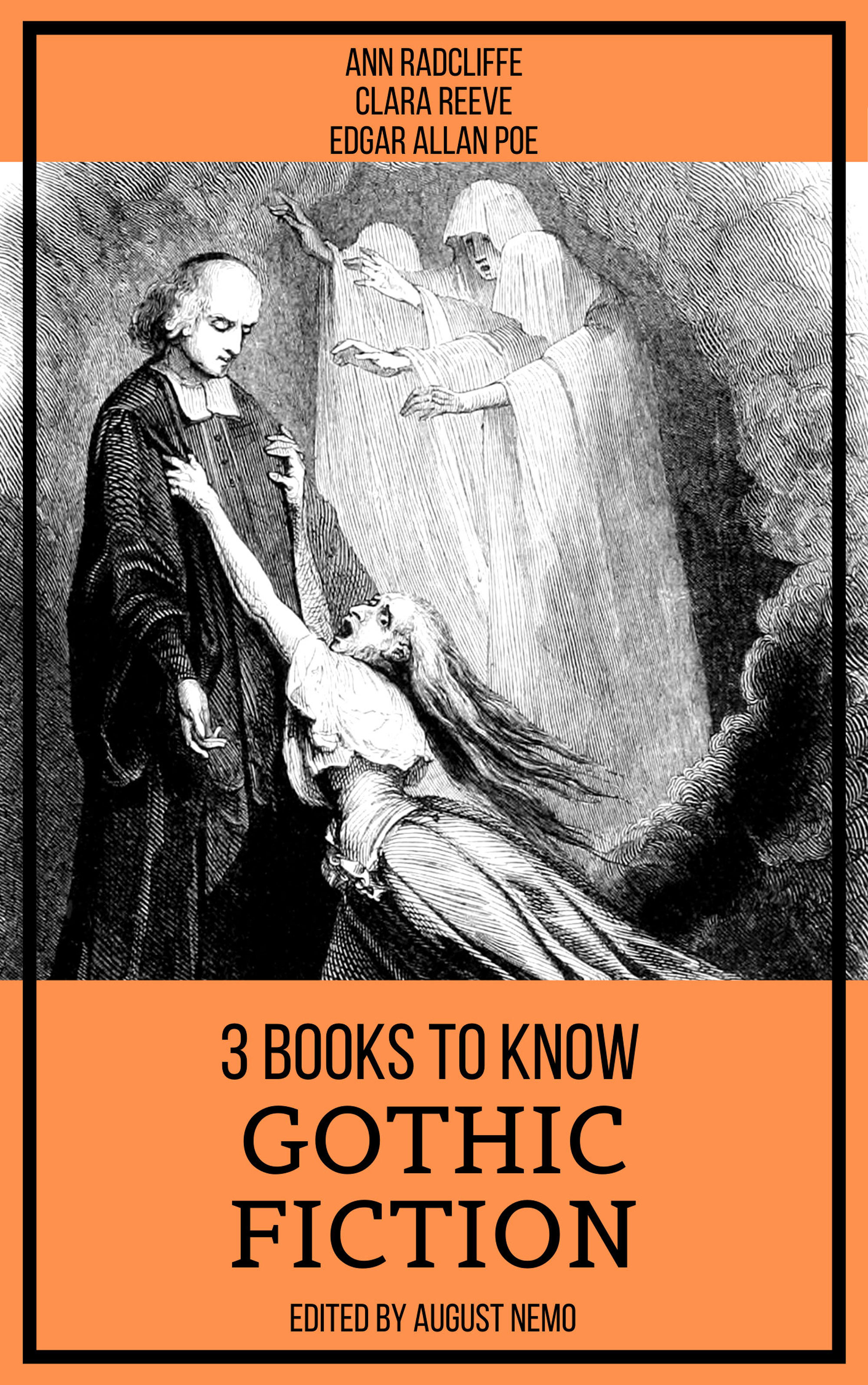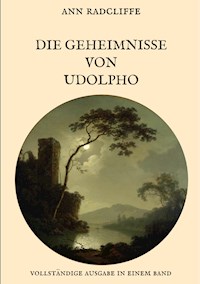
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Band 4 der ersten deutschsprachigen Ann-Radcliffe-Gesamtausgabe. Gefangen im düsteren Schloss Udolpho kämpft die junge Waise Emily St. Aubert gegen die hinterhältigen Pläne ihres Vormunds Montoni, gegen unheimlichen Geisterspuk und ihre eigenen melancholischen Phantasien. Von ihrem Geliebten getrennt und der Außenwelt isoliert, muss sie sich der Avancen eines hartnäckigen Verehrers erwehren, während der lasterhafte Montoni nach ihrem Erbe giert und in seinem Rachedurst sogar ihr Leben bedroht. Als außerdem unerklärliche Spukerscheinungen hinzukommen, droht Emily unter dem auf ihr lastenden Druck zu zerbrechen ... The Mysteries of Udolpho war seinerzeit einer der populärsten Romane der Schauerromantik und hob durch Radcliffes faszinierende psychologische Darstellung seiner Figuren die "Gothic Romance" auf ein neues Niveau. Heute gilt der Roman als eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der europäischen Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1388
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Schicksal sitzt ergrimmt auf diesen dunklen Zinnen, Und als die Portale sich mir öffnen, Hallt seine Stimme in düstrem Tone durch die Höfe, Und spricht von einer unnennbaren Tat.
Inhaltsverzeichnis
Die Geheimnisse von Udolpho
1. Band
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Die Geheimnisse von Udolpho
2. Band
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Die Geheimnisse von Udolpho
3. Band
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Die Geheimnisse von Udolpho
4. Band
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Die Geheimnisse von Udolpho
1. Band.
1. Kapitel.
Heimat ist der Ort
Der Liebe, Fröhlichkeit, des Friedens und des Überflusses,
Wo, einander unterstützend, gesittete Freunde
Und sich liebende Anverwandte beseligt sich vermischen.
Thomson.
AN den reizenden Ufern der Garonne, in der Provinz Gascogne, stand im Jahre 1584 das Chateau des Monsieur St. Aubert. Von seinen Fenstern gewährte es eine Aussicht auf die Landschaften von Guyenne und Gascogne, die sich im Schmucke dichter Gehölze, Weinberge und Olivenwäldchen längs dem Flusse hinzogen. Nach Süden wurde der Blick durch die majestätischen Pyrenäen begrenzt, deren Gipfel, bis an die Wolken ragend, bald in schauerlichen Formen dastanden, bald von den herabrollenden Dünsten zum Teil verhüllt, kahl und öde durch den blauen Lufthauch schimmerten, oder von düsteren Fichtenwäldern eingefaßt, sich in schwarzen Schatten herabsenkten. In sanftem Gegensatz zu diesen schrecklichen Gebirgen lagen zu ihren Füßen Fluren, von kleinem Gehölze begrenzt, wo sie unter weidenden Herden und einfachen Hütten das Auge zur Rast verlockten, wenn es die schwebenden Klüfte über sich ausgemessen hatte. Nach Norden und Osten verloren sich im fernen Nebel die Ebenen Guyennes und Languedocs; nach Westen begrenzten die Gewässer der Biscaya das gascognische Gebiet.
Monsieur St. Aubert liebte es, mit seiner Frau und Tochter am Ufer der Garonne wandeln, und der Musik zu lauschen, die auf den Wellen schwebte. Im geschäftigen Getümmel der Welt hatte er das Leben in anderen Gestalten als der ländlichen Form kennengelernt; aber nur zu schmerzhaft hatte Erfahrung das schmeichelhafte Gemälde berichtigt, das sich sein Herz in früher Jugend von der Menschheit schuf. Doch waren bei allem Wechsel des Schicksals, bei allen sonderbaren Lagen, worin er geriet, seine Grundsätze unerschüttert, seine wohlwollenden Gefühle ungeschwächt geblieben; und sein Herz fühlte mehr Mitleid als Erbitterung über die Torheiten der Menge, als er sich aus der Welt zu dem reineren Genusse zurückzog, den einfache Natur, Lektüre und die Ausübung häuslicher Tugenden gewähren.
Er war der jüngere Sproß einer vornehmen Familie, nach deren Wunsche eine reiche Heirat, oder der Erfolg im Ränkespiel der Politik den Mangel väterlichen Vermögens bei ihm ersetzen sollte. St. Aubert jedoch besaß ein zu zartes Ehrgefühl, um das erste zu suchen, und zu wenig Ehrgeiz, um das, was er Glückseligkeit nannte, dem Streben nach Glanz und Reichtum aufzuopfern. Nach dem Tode seines Vaters heiratete er eine sehr liebenswürdige Frau, die ihm an Geburt gleich, und dabei nicht reicher war als er. Der verstorbene Monsieur St. Aubert hatte durch seine Freigebigkeit oder vielmehr Verschwendung, seine Angelegenheiten in solche Verwirrung gebracht, daß sein Sohn es notwendig fand, einen Teil der Familiengüter zu verkaufen, und wirklich veräußerte er auch wenige Jahre nach seiner Heirat den größten Teil davon an den Bruder seiner Frau, Monsieur Quesnel, und begab sich auf ein kleines Gut in der Gascogne, wo er seine Zeit zwischen dem Genusse ehelicher Glückseligkeit, der Ausübung väterlicher Pflichten und der Beschäftigung mit den Schätzen der Gelehrsamkeit und den Erleuchtungen des Geistes teilte.
Er hatte von Kindheit auf an diesem Plätzchen gehangen. Oft machte er als Knabe kleine Ausflüge dahin, und nichts hatte die frühen Eindrücke vertilgen können, welche die Gutmütigkeit des freundlichen, grauköpfigen Pächters auf ihn machte, der nie unterließ, seinen jungen Gast mit Sahne und Früchten, und allem, was seine kleine Hütte hergab, zu bewirten. Nie dachte St. Aubert ohne wehmütige Schwärmerei zurück an die grünen Wiesen, auf welchen er so oft im Wohlgefühl der Gesundheit und jugendlicher Freiheit umhersprang – an die Wälder, unter deren erfrischenden Schatten er erstmals der sinnenden Melancholie Raum gab, die späterhin einen Hauptzug seines Charakters ausmachte – an die wilden Spaziergänge auf den Bergen; an den Fluß, auf dessen Wellen er sich wogte, an die fernen Fluren, die sich ebenso grenzenlos ausdehnten wie seine frühen Hoffnungen. Es war ihm unbeschreiblich wohl, als er sich endlich von der Welt losmachen und sich hierher zurückziehen konnte, um die Wünsche so mancher Jahre in Erfüllung zu bringen.
Das Gebäude war damals nur eine Sommerhütte, die bloß durch reinliche Einfachheit und angenehme Lage dem Fremden gefiel, und sehr erweitert werden mußte, um einer Familie bequemen Raum zu bieten. St. Aubert fühlte eine gewisse Anhänglichkeit für jeden Teil des Gebäudes, welchem irgendeine Erinnerung aus seiner Jugend anhaftete, und konnte sich nicht entschließen, einen Stein von seiner Stelle zu rücken. Der neue Anbau wurde folglich nur dem alten angepaßt und machte mit ihm zusammen nunmehr ein einfaches und elegantes Domizil aus. Der Geschmack von Madame St. Aubert hatte sich an der inneren Einrichtung gezeigt, wo dieselbe klare Einfachheit, welche die Sitten der Einwohner bezeichnete, sich auch in der Möblierung und dem wenigen Zierat der Zimmer zeigte.
Die Bibliothek, die mit einer Sammlung der besten Schriften aus den alten und neuen Sprachen angereichert war, nahm die westliche Seite des Chateaus ein. Von diesem Zimmer aus blickte man auf ein Wäldchen an der Spitze eines kleinen Berges, der sich zum Flusse hinabsenkte. Die schlanken Bäume gaben ihm einen melancholischen, angenehmen Schatten, während das Auge aus dem Fenster die reiche, lachende Landschaft erblickte, die sich nach Westen hinzog und zur Linken von den kühnen Spitzen der Pyrenäen beschattet wurde. Angrenzend an die Bibliothek lag ein mit schönen und seltenen Pflanzen angefülltes Gewächshaus, denn die Botanik war ein Lieblingsstudium des Monsieur St. Aubert; und oft brachte er den Tag mit der Verfolgung seiner Lieblingsleidenschaft zwischen den benachbarten Gebirgen hin, die dem Naturforscher eine reiche Ernte für seinen Geschmack darboten. Zuweilen begleitete ihn seine Gemahlin auf diesen kleinen Wanderungen, öfter aber seine Tochter. Mit einem kleinen Körbchen zum Einsammeln der Pflanzen an einem, und einem anderen Körbchen voll kalten Erfrischungen, die man in der Schäferhütte nicht fand, am anderen Arm, durchstrich sie an seiner Seite die romantischen, prächtigen Gegenden, ohne sich durch die Reize der niederen Kinder der Natur von der Betrachtung ihrer bestaunenswerten Werke abziehen zu lassen.
Waren sie es müde, auf Klippen umherzuklettern, die nur den Fußtritten des Schwärmers zugänglich schienen, und wo nur die Spur der wilden Gemse auf dem Grase das Dasein eines lebendigen Geschöpfes verriet, so suchten sie sich eine der grünen Höhlen, die so schön den Busen dieser Berge schmücken, und verzehrten unter dem Schatten der Lärche oder Zeder ihr einfaches Mahl, versüßt durch das Wasser des klaren Stroms und durch den Duft der wilden Blumen und aromatischen Pflanzen, welche rund um die Felsen wuchsen und aus dem Grase hervorschimmerten.
An die östliche Seite des Gewächshauses grenzte ein Zimmer an, welches Emily das ihrige nannte, und worin sie ihre Bücher, Zeichnungen und musikalischen Instrumente nebst einigen ihrer liebsten Vögel und Pflanzen um sich versammelt hatte. Hier beschäftigte sie sich gewöhnlich mit den schönen Künsten, die sie bloß aus Neigung trieb, und in welchen ihr angeborenes Talent, durch die Anweisung ihrer Eltern unterstützt, sie früh Fortschritte machen lehrte. Die Fenster dieses Zimmers, die bis zur Erde herabgingen, hatten eine vorzüglich angenehme Aussicht auf einen kleinen Rasen, der rings das Haus umgab. Hier wurde das Auge zwischen Hainen von Mandeln, Palmen, Blumeneschen und Myrten hin auf die ferne Landschaft geleitet, wo die Garonne sich ergoß.
Oft sah man die ländlichen Bewohner dieses glücklichen Himmelsstrichs abends nach vollendeter Arbeit in Gruppen am Ufer des Flusses tanzen. Ihre fröhlichen Melodien, ihr leichter Schritt, die phantasievolle Darstellung ihrer Tänze, mit der geschmackvollen, schalkhaften Weise, wie die Mädchen ihre einfachen Kleider zurechtrückten, zusammengenommen, gaben der Szene ein durchaus französisches Ansehen.
Die Vorderseite des Chateaus, dessen südliche Aussicht auf die erhabenen Berge blickte, enthielt im Untergeschoß eine schlichte Eingangshalle und zwei treffliche Wohnzimmer. Der erste Stock – einen zweiten hatte die Hütte nicht – war zu Schlafzimmern eingerichtet, ein einziges Zimmer ausgenommen, das sich auf einen Balkon öffnete, und wo gewöhnlich gefrühstückt wurde.
Auf dem umliegenden Grunde hatte St. Aubert sehr geschmackvolle Verbesserungen angebracht. Doch hing er so sehr an den Eindrücken seiner Knabenjahre, daß er oft den Geschmack zugunsten der Empfindung opferte. So hatte er von zwei alten Lärchen, die das Gebäude beschatteten und die Aussicht hinderten, oft gesagt, daß er schwach genug sein würde, über ihren Fall zu weinen; und statt sie abzuhauen, pflanzte er lieber noch ein kleines Wäldchen von Buchen, Kiefern und Bergeschen dazu an. Von einer durch das schwellende Ufer des Flusses gebildeten hohen Terrasse erhob sich ein Wäldchen von Orangen-, Zitronen- und Palmbäumen, deren Früchte in der Abendkühle balsamischen Wohlgeruch ausströmten. In einzelne Gruppen verstreut, standen noch hier und da Bäume anderer Art. Hier, unter dem großen Schatten eines Ahornbaumes, der seinen majestätischen Wipfel nach dem Flusse hinstreckte, liebte St. Aubert es, in den schönen Sommerabenden mit seiner Frau und Kindern zu sitzen, und unter dem Laubwerk hervor die untergehende Sonne, den milden Glanz ihres von der Landschaft hinwegschwindenden Lichtes betrachten, bis der Schatten der Dämmerung die mannigfaltigen Formen in ein bleiches Grau zusammenschmolz. Auf diesem Plätzchen las er gerne, sprach mit seiner Frau, oder spielte mit seinen Kindern, und gab sich ganz dem Eindruck der süßen Gefühle hin, die Natur und Einfachheit stets begleiten. Oft sagte er, während Tränen der Freude in seinen Augen zitterten, daß diese Augenblicke unendlich süßer wären, als alle anderen, die man in den glänzenden und turbulenten Schauplätzen, wonach die Welt strebt, zubringen könnte. Sein Herz war ausgefüllt; es kannte, was selten gesagt werden kann, keinen Wunsch nach höherer Glückseligkeit, als er bereits empfand. Das Bewußtsein, recht zu handeln, verbreitete eine Heiterkeit über sein Wesen, welche nur dies Bewußtsein bei einem Manne von so feinem moralischen Gefühl hervorbringen konnte, und die den Genuß jeder ihn umgebenden Freude erhöhte.
Der tiefste Schatten der Dämmerung konnte ihn nicht von seinem liebsten Platanenbaum vertreiben. Er liebte die süße Stunde, wo die letzten Farben des Lichts erstarben, wo die dicht gesäten Sterne durch den Äther zittern, und aus der dunklen Fläche des Wassers wiederstrahlen; die Stunde, welche vor allen anderen die Seele in wehmütig süßes Nachdenken versenkt, und sie erst zu erhabenen Betrachtungen emporhebt. Oft verweilte er noch hier, wenn schon der Mond seine sanften Strahlen durch das Laub hingoß, und oft wurde sein einfaches Mahl von Rahm und Früchten unter seinem Schatten ausgebreitet, bis durch die Stille der Nacht der harmonische Gesang der Nachtigall drang, und die Seele in schwermütig süße Gefühle einwiegte.
Der Tod seiner beiden Söhne war die erste Unterbrechung des Glücks, das er in seiner ländlichen Einsamkeit genoß. Er verlor sie in einem Alter, wo die kindliche Unbefangenheit so sehr fesseln kann, und wenn er gleich um Madame St. Aubert willen, den Ausdruck seines Kummers zu unterdrücken, und alle Philosophie aufzubieten suchte, so fühlte er doch nur zu gut, daß es keine Philosophie gibt, die bei einem solchen Verluste beruhigen kann. Eine Tochter war nunmehr sein einziges überlebendes Kind, und während er mit sorgsamer Zärtlichkeit die Entfaltung ihrer jungen Geisteskräfte beobachtete, bemühte er sich mit unablässiger Sorgfalt, den Zügen in ihrem Charakter entgegenzuarbeiten, die in der Folge ihre Glückseligkeit stören konnten. Sie verriet in ihrem frühesten Alter ungewöhnliche Zartheit des Gefühls, warme Zuneigungen und eine gütige Reife; nur war mit diesen Eigenschaften ein für ihre künftige Ruhe zu feiner Grad von Zärtlichkeit verbunden. So wie sie an Jahren zunahm, gab diese Empfindsamkeit ihrem Geist einen Hang zum Nachdenken und ihrem Wesen eine Sanftheit, die den Reiz ihrer Schönheit erhöhte, und sie unendlich liebenswürdig für Personen von ähnlicher Veranlagung machte. St. Aubert besaß jedoch zu viel gesunde Vernunft, um einen Schmuck einer Tugend vorzuziehen, und war scharfsinnig genug einzusehen, daß dieser Schmuck zu gefährlich für die Besitzerin war, um ein Glück genannt zu werden. Er bemühte sich daher, ihre Seele zu stärken, und sie an Selbstbeherrschung zu gewöhnen; er lehrte sie, dem ersten Antriebe ihrer Gefühle zu widerstehen, und mit kaltem Blute die Enttäuschungen zu betrachten, die er selbst ihr oft in den Weg zu legen wußte. Indem er sie unterrichtete, dem ersten Eindrucke zu widerstehen, und sich die standhafte Seelenwürde zu erwerben, die allein den Leidenschaften das Gegengewicht zu halten, und uns über die Gewalt der Umstände emporzuheben vermag, gab er sich selbst eine Lehre der Stärke; denn oft mußte er mit anscheinender Gleichgültigkeit die Tränen und Kämpfe ansehen, welche seine Sorgfalt sie kostete.
Äußerlich glich Emily ihrer Mutter; sie hatte ihr feines Ebenmaß der Gestalt, ihre Feinheit der Züge und ihre blauen Augen, voll süßer Zärtlichkeit. Aber so liebenswürdig auch ihr Aussehen war, so war es doch der abwechslungsreiche Ausdruck ihres Gesichts, das mit zarter Beweglichkeit alle Gefühle ihrer Seele verriet, sobald Gespräch und Unterhaltung sie belebten, und sie mit einer so fesselnden Anmut umgab:
Jene zarteren Töne, die dem achtlosen Blick entgehen,
Und die im bunten Zirkel der Welt verblassen.
St. Aubert kultivierte ihren Verstand mit der sorgfältigsten Pflege: Er brachte ihr eine allgemeine Übersicht von den Wissenschaften, und eine genaue Bekanntschaft mit allen Teilen der schönen Literatur bei. Er lehrte sie Latein und Englisch, hauptsächlich, damit sie die Schönheiten der besten und erhabensten Dichter verstehen konnte. Sie zeigte von Kindheit an besonderen Geschmack für Werke des Genies, und es war St. Auberts Grundsatz, sowohl als es seiner Neigung gemäß war, jedes harmlose Mittel der Glückseligkeit bei ihr zu befördern. „Ein wohl angebauter Geist“, sagte er oft, „ist die beste Sicherheit gegen die Seuche der Torheit und des Lasters. Die leere Seele hascht immer nach Zeitvertreib, und stürzt sich lieber in Verirrungen, um nur der Langeweile zu entgehen. Man bereichere sie mit Ideen, man lehre sie das Vergnügen des Denkens kosten, und gewiß wird die Befriedigung, die sie in ihrer inneren Welt findet, die Versuchungen der äußeren aufwiegen. Eine geübte Denkkraft, ausgebildete Seelenkräfte sind gleich notwendig zum Glück eines ländlichen und städtischen Lebens; beim ersteren verhindern sie die unangenehme Empfindung der Untätigkeit und gewähren ein veredeltes Vergnügen durch den Geschmack, den sie am Großen und Schönen erzeugen; beim letzteren machen sie Zerstreuung weniger zu einem Gegenstande des Bedürfnisses und folglich des Bestrebens für uns.“
Es war eine der frühesten Freuden Emilys, in der schönen Natur zu spazieren; mehr noch als die sanfte und glühende Landschaft liebte sie jedoch die wilden Pfade durch die Wälder, die das Gebirge einfaßten, vorzüglich aber die ungeheuren Klüfte und Berghöhlen, wo die Stille und Größe der Einsamkeit dem Ganzen eine schauerliche Ehrfurcht einflößte, und ihre Gedanken zum Gott des Himmels und der Erde emporhoben. Oft wandelte sie hier einsam umher, in melancholischen Zauber gewiegt, bis der letzte Schimmer des Tages vom Westen verschwand; bis nichts mehr, als der einsame Laut einer Schäferglocke, oder das ferne Bellen eines Wachhundes die Abendstille unterbrach. Dann weckte die Dunkelheit der Wälder, das Zittern des Laubes in der Brise, die Fledermaus, die durch die Dämmerung schwirrte, das einzelne, bald verschwindende, bald wiederkehrende Licht in den Hütten, die Kräfte ihrer Seele zur Begeisterung und Poesie.
Ihr liebster Spaziergang war der zu einer kleinen Fischerhütte, die St. Aubert in einer Waldhöhle am Rande eines Flüßchens angelegt hatte, das von den Pyrenäen herabströmte, und nachdem es schäumend die Klippen herabgestürzt war, seinen stillen Lauf unter den Schatten hinwand, die sich in seinen klaren Fluten spiegelten. Über den Wäldern, die diese Höhle umrahmten, erhoben sich die hohen Gipfel der Pyrenäen, welche oft kühn durch die Lichtungen ins Auge sprangen. Oft sah man nur das zertrümmerte Haupt eines Felsens, mit wildem Gesträuch gekrönt, oder eine Schäferhütte, die von dunklen Zypressen, oder wallenden Eschen beschattet, an einer Klippe hing. Aus den Tiefen der Wälder hervorgehend öffnete sich die Aussicht auf die ferne Landschaft, wo die üppigen Weiden und die mit Wein bedeckten Hügel der Gascogne sich allmählich zu den Ebenen herabneigten, bis endlich an den sich windenden Ufern der Garonne, Haine und Weiler und Landhäuser, die Schärfe ihrer Formen in der weiten Ferne verlierend, vor dem Auge in eine reiche harmonische Tönung zusammenschmolzen.
Dies war auch St. Auberts Lieblingsaufenthalt, wohin er sich oft von der Mittagshitze mit seiner Frau, seiner Tochter und seinen Büchern zurückzog; oft kam er in der süßen Abendstunde, um die schweigende Dämmerung zu begrüßen, oder der Musik der Nachtigall zu lauschen. Oft auch brachte er sich selbst Musik mit, und weckte das schlafende Echo durch den sanften Laut seiner Oboe, sofern nicht Emilys Stimme neue Süße aus den Wellen zog, über welchen sie zitterte.
Es war bei einem jener Ausflüge an diesen Ort, daß sie die folgenden mit einem Bleistift auf einen Teil der Wand geschriebenen Zeilen bemerkte:
SONETT.
Auf, Bleistift! getreu zu deines Meisters Seufzen!
Auf – erzähle der Göttin von der Feenszene,
Wenn bald ihre leichten Schritte diesen grünen Pfaden folgen,
Wo all seine Tränen, seine zärtlichen Leiden sich erheben;
Ach! male ihre Gestalt, ihre beseelten Augen,
Den süßen Ausdruck ihres versonnenen Gesichts,
Das strahlende Lächeln, die lebhafte Anmut, —
Das Portrait versorgt gut die Stimme des Liebenden;
Spricht alles aus, was sein Herz fühlt, seine Zunge sagen würde:
Aber ach! sein Herz muß sich nicht traurig fühlen!
Wie oft verbergen die seidigen Blätter der Rose
Die Droge, die den Lebensfunken stiehlt!
Und der, der auf das Engelslächeln blickt,
Fürchtet seinen Zauber, oder glaubt, es kann betören!
Die Zeilen waren nicht unterschrieben. Emily konnte sie darum nicht auf sich deuten, obgleich unzweifelhaft sie die Nymphe dieser Schatten war. Ebensowenig aber hatte sie, nachdem sie den kleinen Zirkel ihrer Bekannten durchlaufen hatte, einen Verdacht, an wen sie gerichtet sein könnten, und blieb also in Ungewißheit; einer Ungewißheit, die einem müßigeren Geist quälender gewesen sein würde, als sie es ihr war. Sie hatte nicht Muße, diesen zuerst unbedeutenden Umstand durch öfteres Erinnern wichtiger für sie werden zu lassen. Die kleine Eitelkeit, die vielleicht dadurch erregt worden war – denn dieselbe Ungewißheit welche ihr verbot, sich für die Person zu halten, die den unbekannten Dichter zu diesem Sonett könnte begeistert haben, verbot ihr auch, bestimmt das Gegenteil zu glauben – ging wieder vorüber; und unter ihren Studien, Büchern und der Ausübung geselliger Tugenden verschwand der Vorfall bald aus ihren Gedanken. Bald nachher erweckte eine Unpäßlichkeit ihres Vaters, der von einem Fieber befallen wurde, ängstliche Besorgnisse in ihrem Herzen. Wenngleich seine Krankheit nicht eigentlich gefährlich war, erlitt doch seine Gesundheit dadurch einen harten Schlag. Madame St. Aubert und Emily pflegten ihn mit unermüdlicher Sorgfalt, aber er erholte sich nur langsam; und im selben Maße, wie seine Kräfte wiederkehrten, schienen die seiner Gattin abzunehmen.
Seine liebe Fischerhütte war der erste Ort, den er besuchte, sobald er sich wieder stark genug fühlte, die freie Luft zu genießen. Ein Körbchen mit Eßwaren, mit Büchern und Emilys Laute wurde vorausgeschickt; Fischergerät bedurfte er nicht, denn er konnte nie Freude daran finden zu quälen oder zu zerstören.
Nachdem er sich wohl eine Stunde mit Botanisieren beschäftigt hatte, wurde die Mittagsmahlzeit aufgetragen. Es war ein Mahl, das durch das Dankgefühl, diesen Ort wieder besuchen zu können, gesüßt war, und noch einmal lächelte reines Familienglück unter diesen Schatten. Monsieur St. Aubert sprach mit ungewöhnlicher Heiterkeit; jeder Gegenstand labte seine Sinne. Die erquickende Freude, welche der erste Anblick der Natur nach dem Schmerz der Krankheit und der Fesselung ans Krankenzimmer gewährt, übersteigt alle Beschreibung, sowie die Vorstellung des Gesunden. Die grünen Wälder und Weiden, der blumige Rasen, das blaue Gewölbe des Himmels, die balsamische Luft, das Murmeln des hellen Stroms und selbst das Gesumme jedes kleinen Insekts im Schatten schienen die Seele zu beleben und schon das bloße Dasein zum Segen zu machen.
Madame St. Aubert, neu belebt durch die Heiterkeit und Wiedergenesung ihres Gatten, fühlte die Unpäßlichkeit nicht mehr, die sie vor kurzem noch beschwert hatte; sie wandelte an der Seite ihres Mannes und ihrer Tochter über die Pfade dieses romantischen Waldes, und oft wenn sie mit ihnen sprach, und sie abwechselnd ansah, bemächtigte sich ihrer eine wehmütige Zärtlichkeit, die ihre Augen mit Tränen füllte. St. Aubert bemerkte dies mehr als einmal und machte ihr einen sanften Vorwurf darüber; doch sie konnte nur lächeln, seine und Emilys Hand ergreifen und um so stärker weinen. Er selbst fühlte sich bis zum schmerzhaften von gleich zärtlicher Wehmut durchdrungen, und konnte sich nicht enthalten, insgeheim zu seufzen: „Vielleicht werde ich einst auf diese Augenblicke als auf dem Gipfel meines Glücks mit hoffnungsloser Trauer zurückblicken. Aber ich will sie nicht durch voreiliges Grämen trüben; ich will hoffen, daß ich nicht erleben werde, den Verlust derer zu beweinen, die mir teurer sind, als das Leben selbst.“
Um seine nachdenkliche Stimmung zu zerstreuen, oder vielleicht ihr ungestört nachzuhängen, bat er Emily, ihre Laute zu holen, die sie mit so süßem Ausdruck zu spielen wußte. Als sie sich der Fischerhütte näherte, erstaunte sie, die Töne des Instruments zu hören, das von der Hand des Geschmacks berührt, eine klagende Melodie hören ließ, die ihre ganze Aufmerksamkeit anzog. Sie hörte in tiefer Stille zu, und fürchtete, sich von der Stelle zu bewegen, damit nicht das Geräusch ihrer Schritte sie um eine Note der Musik brächte, oder den Musiker störte. Außerhalb des Gebäudes war alles still und niemand ließ sich sehen. Sie horchte weiter, bis Überraschung und Freude durch Furchtsamkeit verdrängt wurden. Diese Furchtsamkeit stieg höher, wenn sie an die Zeilen an der Wand zurückdachte, und sie besann sich, ob sie weitergehen oder umkehren sollte.
Während sie noch zögerte, verstummte die Musik, und nach einem kurzen Besinnen faßte sie Mut, zur Fischerhütte zu gehen, die sie mit schwankenden Schritten betrat und – leer fand! Ihre Laute lag auf dem Tuch, alles schien ruhig, und fast glaubte sie schon, ein anderes Instrument gehört zu haben, bis sie sich erinnerte, daß ihre Laute auf einer Fensterbank liegengeblieben war, als sie mit ihren Eltern in den Wald ging. Sie fühlte sich beunruhigt, ohne zu wissen warum; die melancholische Dunkelheit des Abends, die tiefe Stille des Orts, nur durch das leise Zittern des Laubes unterbrochen, erhöhte ihre phantasievollen Befürchtungen, und sie wünschte die Hütte zu verlassen, als eine Schwäche sie überkam und sie nötigte, sich niederzusetzen. Indem sie sich wieder aufzuraffen suchte, fielen ihr die an die Wand geschriebenen Zeilen ins Auge; sie fuhr zusammen, als hätte sie einen Fremden gesehen; doch überwand sie endlich ihre Angst und ging ans Fenster hin; sie sah, daß zu den bereits geschriebenen Zeilen noch andere hinzugesetzt waren, in welchen ihr Name stand.
Sie konnte nun nicht länger daran zweifeln, daß sie damit gemeint sei, doch blieb es ihr noch ebenso unerklärlich wie zuvor, wer der Verfasser sein könne. Während sie darüber nachsann, glaubte sie einen Fußtritt außerhalb des Gebäudes zu hören, und aufs neue erschreckt, ergriff sie schnell ihre Laute und eilte davon. Ihre Eltern fand sie auf einem kleinen Fußpfade, der sich längs der Schlucht hinzog.
Sie setzten sich auf einen grünen von Palmbäumen beschatteten Hügel, von wo man die Täler und Fluren der Gascogne übersah, und während ihre Augen über die prächtige Szene hinirrten, und sie den süßen Duft der Blumen und Kräuter genossen, spielte und sang Emily einige ihrer Lieblingsarien mit der Zartheit des Ausdrucks, worin sie so ganz Meisterin war.
Musik und Gespräche hielten sie auf diesem bezaubernden Plätzchen fest, bis der letzte Strahl der Sonne auf die Fluren sank; bis die weißen Segel, die unter den Bergen auf der Garonne hinglitten, sich verdunkelten, und die Abenddämmerung sich über die Landschaft senkte. Es war eine melancholische, aber nicht unangenehme Dämmerung. St. Aubert und seine Familie standen auf und verließen mit Bedauern den Ort; – ach! Madame St. Aubert wußte nicht, daß sie ihn auf immer verließ.
Als sie die Fischerhütte erreichten, vermißte ihre Mutter ihr Armband und besann sich, daß sie es nach der Mahlzeit vom Arm genommen und auf dem Tisch hatte liegen lassen. Nach langem Suchen, wobei Emily sehr tätig war, mußte sie sich endlich in den Verlust ergeben. Dies Armband hatte doppelten Wert für sie, weil ein Miniaturgemälde ihrer Tochter, das erst vor einigen Monaten gemalt und ihr sehr ähnlich war, sich daran befand. Emily errötete, und wurde nachdenklich; ihre Laute und die neugeschriebenen Zeilen hatten sie bereits überzeugt, daß in ihrer Abwesenheit ein Fremder in der Hütte gewesen sein mußte und der Inhalt dieser Zeilen machte es nicht unwahrscheinlich, daß der Dichter, der Musiker und der Dieb eine Person waren. Doch obgleich diese Umstände so ziemlich ein Ganzes ausmachten, hielt doch ein gewisses Gefühl sie unwiderstehlich zurück, etwas davon zu erwähnen, nur nahm sie sich insgeheim vor, nie wieder ohne Begleitung ihrer Eltern die Hütte zu besuchen.
Schweigend kehrten sie zum Chateau zurück: Emily über den sonderbaren Vorfall nachsinnend; St. Aubert in stiller Dankbarkeit das Glück bedenkend, welches er genoß, und Madame St. Aubert unruhig und bestürzt über den Verlust des Gemäldes. Als sie dem Hause nahekamen, bemerkten sie ein ungewöhnliches Geräusch; sie hörten deutlich Stimmen, sahen Diener und Pferde zwischen den Bäumen und endlich auch die Räder eines Wagens, der schnell nach dem Chateau hinrollte. Als er in Sichtweite auf die Vorderseite des Chateaus gekommen war, erschien ein Landauer mit dampfenden Pferden auf dem kleinen Rasen davor. St. Aubert erkannte die Livree seines Schwagers und fand Monsieur und Madame Quesnel bereits im Besuchszimmer. Sie hatten einige Tage zuvor Paris verlassen, und waren auf dem Wege nach ihrem Gute, das nur zehn Meilen von La Vallée lag, und das Monsieur Quesnel einige Jahre zuvor von St. Aubert gekauft hatte. Es war Madame St. Auberts einziger Bruder; doch da die Bande der Verwandtschaft nie durch eine Verwandtschaft des Geistes gestärkt worden waren, pflegten sie keinen häufigen Umgang. Monsieur Quesnel hatte immer in der großen Welt gelebt: Glanz und Bedeutung war sein Wunsch, und seine Gewandtheit und Menschenkenntnis hatte ihm den Besitz beinahe von allem, was er suchte, verschafft. Es war wohl nicht zu verwundern, daß ein Mann von solchem Charakter St. Auberts Tugenden nicht würdigen konnte, und seinen reinen Geschmack, seine Einfachheit und gemäßigten Wünsche für Zeichen eines schwachen Geistes und eingeschränkter Ansichten hielt. Die Heirat seiner Schwester mit St. Aubert war für seinen Stolz kränkend gewesen, denn er hatte immer gehofft eine Verbindung für sie zu knüpfen, die ihm zu der Wichtigkeit verhelfen könnte, die sein höchster Wunsch war; und wirklich hatte sie auch Anträge von Personen gehabt, deren Rang und Vermögen seinen Hoffnungen schmeichelte. Doch seine Schwester glaubte bei der Bewerbung des Monsieur St. Aubert zu finden, daß Glanz und Glückseligkeit verschiedene Dinge wären, und besann sich nicht, die letztere dem ersten vorzuziehen. Monsieur Quesnel, wenn er auch die Wahrheit dieser Bemerkung nicht leugnen konnte, würde dennoch gern das Glück seiner Schwester der Befriedigung seines Ehrgeizes aufgeopfert haben, und äußerte bei ihrer Heirat mit St. Aubert insgeheim seine Verachtung über ihre einfältige Wahl. Madame St. Aubert war zwar klug genug, diese Beleidigung vor ihrem Manne zu verbergen, doch fühlte sie eine geheime Erbitterung in ihrem Herzen aufsteigen, und wenngleich Achtung für ihre eigene Würde und Rücksichten der Klugheit sie verhinderten, ihren Unwillen merken zu lassen, so behielt sie doch stets eine gewisse Zurückhaltung gegen ihren Bruder bei, deren Ursache er sehr wohl verstand.
Er selbst folgte bei seiner Heirat dem Beispiele seiner Schwester nicht. Seine Frau war eine Italienerin, von Geburt eine reiche Erbin, durch Natur und Erziehung aber eine eitle und frivole Frau.
Sie beschlossen nun, die Nacht bei St. Aubert hinzubringen, und weil das Chateau nicht groß genug war, ihre Diener zu beherbergen, wurden diese in das benachbarte Dorf geschickt. Nachdem man sich gehörig begrüßt, und die Einrichtungen für die Nacht getroffen hatte, fing Monsieur Quesnel an, seinen Verstand und seine Wichtigkeit auszukramen, während St. Aubert, der lange genug in der Einsamkeit gelebt hatte, um diese Gegenstände wenigstens neu zu finden, ihm mit einer Geduld und Aufmerksamkeit zuhörte, die sein Gast fälschlich für demütige Verwunderung hielt. Er beschrieb die wenigen Festivitäten, welche die Unruhe der Zeit damals am Hofe Heinrich III. zuließ, mit einer Genauigkeit, welche die Zuhörer einigermaßen für seine Prahlerei entschädigte; als er aber auf den Charakter des Herzogs von Joyeuse, auf einen geheimen Vertrag, der, wie er wissen wollte, mit der Porte ausgehandelt sei, und auf die Art, wie man Heinrich von Navarra empfangen hatte, zu sprechen kam, erinnerte sich Monsieur St. Aubert seiner vormaligen Erfahrung genug, um zu merken, daß sein Gast nur zu einer untergeordneten Klasse von Politikern gehörte, und daß er unmöglich die Wichtigkeit, die er vorgab, wirklich besitzen konnte, da er so viel Wert auf kleine Gegenstände legte. Die von Monsieur Quesnel gelieferten Meinungen waren solcher Natur, daß St. Aubert sich einer Antwort enthielt, denn er wußte, daß sein Gast weder über die Menschlichkeit zu fühlen, noch zu unterscheiden verfügte, was gerecht ist.
Madame Quesnel äußerte indessen gegenüber Madame St. Aubert ihre Verwunderung, daß sie es aushalten könnte, ihr Leben in diesem entlegenen Winkel der Welt hinzubringen, und beschrieb, wahrscheinlich um Neid zu erregen, den Glanz der Bälle, Bankette und Prozessionen, die eben zur Hochzeitsfeier des Herzogs von Joyeuse mit Marguerite von Lothringen, der Schwester der Königin veranstaltet worden waren. Sie beschrieb mit gleicher Ausführlichkeit sowohl die Pracht, die sie mit angesehen hatte, als die, von welcher sie ausgeschlossen blieb; indes erhöhte Emilys lebhafte Phantasie, während sie mit der heißen Neugier der Jugend lauschte, sich die Szenen, die sie beschreiben hörte. Madame St. Aubert aber dachte, indem sie mit einer Träne im Auge ihre Familie ansah, daß, wenn auch Glanz die Glückseligkeit schmücken, doch Tugend allein sie geben kann.
„Es werden nun zwölf Jahre sein, St. Aubert“, sagte Monsieur Quesnel, „daß ich ihr Familiengut kaufte.“
„So ungefähr“, erwiderte St. Aubert, indem er einen Seufzer unterdrückte.
„Ich bin nun seit fünf Jahren nicht dort gewesen“, fuhr Monsieur Quesnel fort; „Paris und seine Umgebung ist doch in der Tat der einzige Ort, wo man leben kann, und ich bin nun einmal so tief in politische Angelegenheiten verwickelt, und habe alle Hände so voll zu tun, daß es mir schwer wird, mich nur auf ein oder ein paar Monate fortzustehlen. St. Aubert schwieg und Monsieur Quesnel fuhr fort: „Ich habe mich oft gewundert, wie ein Mann, der in der Hauptstadt gelebt hat, und an Gesellschaft gewöhnt gewesen ist, wie Sie, es auf dem Lande aushalten kann – besonders in einem so entlegenen Winkel wie hier, wo Sie nichts sehen und hören, und sich kaum bewußt sein können, daß Sie leben.“
„Ich lebe für meine Familie und für mich selbst, und bin zufrieden, jetzt nur das Glück zu kennen; vormals kannte ich das Leben.“
„Ich bin willens, dreißig- oder vierzigtausend Livres für Verbesserungen aufzuwenden“, sagte Monsieur Quesnel, ohne daß er St. Auberts Worte zu bemerken schien, „denn ich habe mir vorgenommen, im nächsten Sommer meine Freunde, den Herzog von Durefort und den Marquis Ramont auf ein oder ein paar Monate mit mir hierher zu bringen.“
Auf St. Auberts Frage, worin diese beabsichtigten Veränderungen bestehen sollten, antwortete er, daß er den alten östlichen Flügel des Gebäudes niederreißen und stattdessen eine Reihe von Ställen hinsetzen wolle. „Dann“, sagte er, „werde ich einen Speisesaal, einen Salon, einen Gesellschaftssaal und eine Reihe von Zimmer für die Bediensteten anlegen lassen, denn gegenwärtig kann ich kaum den dritten Teil meiner Leute darin unterbringen.“
„Für unseres Vaters Haushalt war das Gebäude groß genug“, sagte St. Aubert, dem es weh tat, daß das alte Haus so verändert werden sollte – „und der war doch wahrlich nicht klein.“
„Unsere Begriffe haben sich seitdem erweitert“, sagte Monsieur Quesnel, „was damals auf anständigen Fuß leben hieß, wäre jetzt nicht zum Aushalten.“
Sogar dem ruhigen St. Aubert stieg bei diesen Worten das Blut ins Gesicht, doch sein Zorn wich bald der Verachtung.
„Der Platz um das Chateau ist mit Bäumen überladen; ich gedenke einige davon umzuhauen.“
„Auch die Bäume umhauen!“, sagte St. Aubert.
„Gewiß. Warum sollte ich das nicht tun, da sie doch die Aussicht hindern? Da steht eine Kastanie, die ihre Zweige vor der ganzen Südseite des Chateaus ausbreitet, und so alt ist, daß der hohle Stamm, wie ich höre, ein ganzes Dutzend Menschen in sich fassen kann. Bei all Ihrer Schwärmerei, werden Sie mir doch nicht bestreiten wollen, daß ein so saftloser alter Baum wie dieser, weder zum Nutzen noch zur Schönheit gereichen kann.“
„Um Gotteswillen!“, rief St. Aubert, „Sie werden doch diese edle Kastanie nicht zerstören, die schon seit Jahrhunderten der Stolz der Gegend gewesen ist! Sie stand schon in ihrer Reife, als das jetzige Gebäude errichtet wurde. Wie oft kletterte ich in meiner Jugend auf ihren breiten Zweigen umher, und saß, wie in einer Laube unter einer Welt von Blättern, wenn es dick über mir regnete, und doch kein Tropfen bis zu mir drang! Wie oft habe ich mit meinem Buche in der Hand da gesessen, bald gelesen, bald zwischen den Zweigen hinauf die weite Landschaft und die untergehende Sonne betrachtet, bis die Dämmerung einfiel und die Vögel zu ihren kleinen Nestern zwischen dem Laube nach Haus trieb. Wie oft – aber verzeihen Sie“, setzte er hinzu, indem er sich schnell besann, daß er mit einem Manne sprach, der seine Gefühle weder fassen, noch ihnen Nachsicht einräumen konnte; „ich spreche von Zeiten und Empfindungen, die ebenso altmodisch sind wie der Geschmack, der diesen ehrwürdigen Baum verschonen wollte.“
„Er wird gewiß abgehauen werden“, sagte Monsieur Quesnel, „ich werde vermutlich einige Pappeln zwischen die dicken Kastanienbäume setzen, die ich vor dem Chateau stehenlassen will. Meine Frau hat eine besondere Vorliebe für Pappeln und hat mir oft gesagt, wie sehr ein Landhaus ihres Onkels, nicht weit von Venedig, dadurch verschönert wird.“
„An den Ufern des Brenta“, fuhr St. Aubert fort, „wo sich die hochgewachsene Pappel mit Pinien und Zypressen vermengt, und wo ihre Zweige über lichte Vorhallen und Säulengänge wehen, verziert sie unstreitig die Gegend; doch unter den Riesen des Waldes und neben einem schwerfälligen, gotischen Gebäude – “
„Gut, gut“, unterbrach ihn Monsieur Quesnel – „ich will nicht mit Ihnen streiten, Sie müßten wieder nach Paris gehen, wenn wir in unseren Ideen übereinkommen wollten. Aber – wo wir schon einmal von Venedig sprechen, ich bin willens, nächsten Sommer dort hinzugehen. Vielleicht werden sich die Umstände so fügen, daß ich von dieser Villa Besitz nehme, die über alle Beschreibung schön sein soll. In dem Falle werde ich mich eine Zeitlang in Italien aufhalten, und die Verbesserungen, wovon wir sprachen, einem anderen überlassen.“
Emily wunderte sich, ihn von einem Aufenthalt in Italien reden zu hören, da er kurz zuvor geäußert hatte, daß seine Gegenwart in Paris so notwendig wäre, daß es ihm schwer würde, sich nur ein paar Monate von dort wegzustehlen: doch St. Aubert durchschaute die Wichtigtuerei des Mannes zu gut, um sich über so etwas zu wundern; und die Möglichkeit, daß die Verbesserungen, woran er so ungern dachte, verschoben werden könnten, ließ ihn hoffen, daß sie vielleicht ganz unterbleiben würden.
Ehe sie einander gute Nacht sagten, wünschte Monsieur Quesnel mit St. Aubert alleine zu sprechen, und sie verfügten sich in ein Nebenzimmer, wo sie lange Zeit verweilten. Der Inhalt dieses Gespräches blieb verschwiegen, doch es war offenkundig, daß St. Aubert, als sie zum Abendessen zurückkamen, ganz außer Fassung war, und daß zuweilen ein geheimer Kummer seine Züge beschattete. Seine Frau wurde unruhig, und geriet in Versuchung, ihn zu befragen, sobald sie allein waren, aber ein gewisses Taktgefühl hielt sie zurück, da sie bedachte, daß St. Aubert nicht auf ihr Fragen warten würde, wenn er sie mit dem Gegenstand seiner Bekümmernis bekanntzumachen wünschte.
Am nächsten Tage hatte Monsieur Quesnel vor seiner Abreise noch eine zweite Konferenz mit St. Aubert.
Nachdem die Gäste im Chateau diniert hatten, machten sie sich in der Abendkühle auf den Weg nach Epourville, wohin sie Monsieur und Madame St. Aubert dringend einluden, wahrscheinlich mehr aus Eitelkeit, um ihre Herrlichkeit vor ihnen auszukramen, als aus dem Wunsche heraus, ihren Freunden Vergnügen zu bereiten.
Emily kehrte mit großer Freude wieder zu der Freiheit, welche die Gegenwart dieser Gäste eingeschränkt hatte, zu ihren Büchern, Spaziergängen und zu der verständigen Unterhaltung mit ihren Eltern zurück, die sich nicht minder zu freuen schienen, von den Fesseln befreit zu sein, welche Hochmut und Frivolität ihnen aufgelegt hatten.
Madame St. Aubert klagte, daß sie sich nicht wohl genug befände, an dem gewöhnlichen Abendspaziergang teilzunehmen, und St. Aubert ging mit Emily allein.
Sie wählten einen Spaziergang nach den Gebirgen, um einige arme Alte zu besuchen, die St. Aubert von seinem sehr geringen Einkommen zu unterstützen vermochte, wiewohl es wahrscheinlich ist, daß Monsieur Quesnel dies von seinem sehr großen Vermögen nicht hätte leisten können.
Nachdem er seinen Armen ihr kleines Wochengeld ausgezahlt, geduldig die Klagen von einigen angehört, den Beschwerden anderer abgeholfen und das Leiden aller durch den Blick des zärtlichen Mitleids und das Lächeln des Wohlwollens gemildert hatte, kehrte er durch den Wald zurück,
Wo,
Wenn der Abend herabfällt,
Das Feenvolk sich versammelt,
Um in Spielen und Schwärmereien
Die Sommernacht zuzubringen,
Thomson.
„Die Abenddämmerung des Waldes war mir stets angenehm“, sagte St. Aubert, dessen Seele nun die süße Ruhe erfuhr, die aus dem Bewußtsein guter Handlungen entsteht, und uns geneigt macht, aus jedem Gegenstande um uns her Freude zu schöpfen. „Ich erinnere mich, daß diese Düsternis in meiner Jugend in meiner Phantasie tausend Märchenvisionen und romantische Bilder beschwor. Und ich gebe zu, ich bin noch nicht ganz unempfindlich gegen diese hohe Verzückung, die den Traum des Dichters weckt. Ich kann mit feierlichen Schritten unter den tiefen Schatten wandeln, ein veränderndes Auge in die ferne Dunkelheit schicken und mit gespannter Freude dem geheimnisvollen Murmeln des Waldes lauschen.“
„O mein lieber Vater“, sagte Emily, während eine plötzliche Träne in ihr Auge stieg, „wie genau Sie beschreiben, was ich so oft gefühlt habe und wovon ich dachte, daß niemand außer mir je so gefühlt habe! Doch still! hier kommt der rauschende Ton über die Baumkronen; – nun erstirbt er; – wie feierlich die folgende Stille ist! Jetzt rollt die Brise wieder heran. Es ist wie die Stimme eines übernatürlichen Wesens – die Stimme des Geistes der Wälder, der nachts über sie wacht. Ach! welches Licht ist dort? Aber es ist fort. Und nun erglänzt es wieder, nahe der Wurzel dieser großen Kastanie: sehen Sie, Vater!“
„Bist du eine solche Verehrerin der Natur“, sagte St. Aubert, „und so wenig mit ihren Erscheinungen vertraut, daß du nicht weißt, daß dies ein Glühwürmchen ist? Aber komm“, fügte er fröhlich hinzu, „ein wenig weiter, und wir werden vielleicht Feen sehen. Sie sind oft Gefährten. Das Glühwürmchen verleiht sein Licht, und sie betören ihn im Gegenzug mit Musik und Tanz. Siehst du dort nichts trippeln?“
Emily lachte. „Nun, mein lieber Herr“, sagte sie, „da Sie dieses Bündnis zulassen, kann ich zu gestehen wagen, daß ich Ihnen zuvorgekommen bin, und beinahe getraue ich mich, einige Verse zu wiederholen, die ich eines Abends in diesen Wäldern gereimt habe.“
„Nein“, antwortete St. Aubert, „laß das beinahe und wage es ganz. Laß uns hören, welche Einfälle die Phantasie in deinem Kopfe gespielt hat. Wenn sie dir einen ihrer Zaubersprüche eingegeben hat, sollst du nicht die der Feen beneiden.“
„Wenn es stark genug ist, um Ihr Urteil zu bezaubern, Vater“, sagte Emily, „während ich ihre Bilder enthülle, muß ich sie nicht beneiden. Die Verse sind in einer Art trippelndem Maße, welches ich für das Thema passend gehalten habe, aber ich fürchte, sie sind zu unregelmäßig.“
DAS GLÜHWÜRMCHEN.
Wie angenehm ist des grünen Waldes tief verworr‘ner Schatten
An einem Mittsommerabend, wenn der frische Regen vorüber;
Wenn das Gelb schräg durch die Lichtung funkelt,
Und rasch die leichten Schwalben in der dünnen Luft empor sich heben!
Aber süßer, süßer noch ist es, wenn die Sonne sich zur Ruhe senkt,
Und die Dämmerung herankommt, und die Feen so fröhlich
Trippeln durch den Waldweg, wo Blumen ungebeugt
Ihre hohen Köpfe unter ihrem lustigen Spiele nicht senken.
Zu den sanftesten Klängen der Musik tanzen sie die Stunde fort,
Bis das Mondlicht sich unter die zitternden Blätter stiehlt,
Die ganze Erde beglitzert, und sie in den Schatten leitet,
Dem lange ruhelosen Schatten, in dem die Nachtigall klagt.
Dann tanzen sie nicht mehr, bis ihr traurig Lied vorüber ist,
Doch still wie die Nacht verharren sie in ihrer Trauer;
Und oft, wenn ihre verklingenden Töne ihr Mitleid gewonnen,
Schwören sie, all ihre heiligen Schlupfwinkel vor Sterblichen zu verteidigen.
Wenn hinter den Bergen der Abendstern sinkt,
Und der wandernde Mond diese schattige Sphäre verläßt,
Wie fröhlich würden sie sein, da sie Feen sind,
Wenn ich mit meinem bleichen Licht nicht nahe käme!
Doch als ob sie freudlos wären, sind sie für meine Freundlichkeit undankbar!
Denn oft, wenn der Reisende auf seinem Weg von der Nacht eingeholt wird,
Und ich auf seinem Weg schimmere, und ihn durch den Hain führe,
Binden sie mich mit ihren Zaubersprüchen, um ihn weit in die Irre zu führen;
Und ins Moor, um ihn dort zu lassen, bis alle Sterne erloschen sind,
Während sie in seltsam aussehenden Formen über die Erde hüpfen,
Und tief in den Wäldern erheben sie einen trostlosen Schrei,
Bis ich in meine Zelle zurückfahre, aus Schrecken vor dem Klang!
Doch sieh, wie alle kleinen Elfen in einem Kreise zum Tanze kommen,
Mit der lustigen, lustigen Flöte und der Pauke und dem Horn,
Und dem Tambourin so klar, und der Laute mit süßem Klang;
Um die Eiche gehen sie dann bis zum Morgengrauen.
Dort unten in die Lichtung schleichen sich zwei Liebende,
um die Feenkönigin zu meiden,
Die stirnrunzelnd auf ihre feierlichen Gelübde blickt, und ergrimmt ist auf mich,
Daß ich ihnen gestern Nacht leuchtete, durch das taufeuchte Grün,
Um die Purpurblume zu suchen, deren Saft von all ihren Zaubern befreien kann.
Und jetzt, um mich zu bestrafen, hält sie fern ihre heitere Truppe,
Mit der lustigen, lustigen Flöte und der Pauke und der Laute;
Wenn ich in die Nähe jener Eiche krieche, wird sie ihren Feenstab schwingen,
Und für mich wird der Tanz enden, und die Musik verstummen.
O! Hätte ich nur diese Purpurblume, deren Blätter ihre Zauber vereiteln können,
Und wüßte wie Feen den Saft zu ziehen und ihn in den Wind zu werfen,
Ich würde ihr Sklave nicht länger sein, noch der Reisende betört,
Ich würde allen treuen Liebenden helfen, und dabei die Feen nicht fürchten!
Doch bald wird der Hauch des Waldes von dannen wandern,
Und der wankelmütige Mond wird verblassen, und die Sterne verschwinden,
Dann werden sie fröhlich sein, obgleich sie Feen sind,
Wenn ich, mit meinem blassen Licht, nicht nahe komme!
Was immer St. Aubert von den Strophen denken mochte, so würde er seiner Tochter nicht die Freude verwehren, zu glauben, daß er sie billigte. Und nachdem er sein Lob ausgesprochen hatte, sank er in eine Träumerei, und sie gingen schweigend weiter.
Ein ungewisses Zweifelbild
Glänzt von der unvollkommnen Fläche der Dinge,
Ein Auge sieht nur Spuren von halbgeformten Figuren;
Inzwischen, daß die regen Wälder und Dörfer, Ströme,
Und Felsen und Berggipfel, die den sich stets
Erhöhenden Schein auf eine lange Zeit behalten
Nichts als ein schwimmend Schauspiel sein,
Das man nicht weiß, ob man es sieht.
Thomson.
St. Aubert schwieg fort, bis er das Chateau erreichte, wo seine Frau sich in ihre Kammer zurückgezogen hatte. Die Ermattung und Schwermut, welche sie zeither niedergedrückt hatte, war nach der Anstrengung, welche durch die Ankunft der Gäste hervorgerufen, jetzt mit doppelter Gewalt wieder zurückgekehrt. Den Tag darauf ließen sich Zeichen von Fieber sehen, und St. Aubert hörte von dem Arzt, den er rufen ließ, daß sie dasselbe Fieber hätte, wovon er erst kürzlich genesen war. Wahrscheinlich hatte er sie angesteckt, während sie ihn in seiner Krankheit pflegte, und da ihre Verfassung zu schwach war, um sie sogleich zu überwinden, war sie in ihren Adern umhergeschlichen und hatte die starke Mattigkeit hervorgerufen, über die sie klagte. St. Aubert, dessen ängstliche Besorgnis für seine Gattin keinen anderen Gedanken zuließ, behielt den Arzt im Hause. Er erinnerte sich an die Gefühle und Betrachtungen, die sein Gemüt für einen Augenblick beschatteten, als er das letztemal in Begleitung seiner Frau und Tochter die Fischerhütte besuchte, und konnte eine bange Vorahnung nicht unterdrücken, daß diese Krankheit von gefährlichen Folgen sein würde. Doch gab er sich alle Mühe, diese Gedanken vor ihr selbst und vor seiner Tochter zu verbergen, die er mit der Hoffnung, daß die angewandte Sorgfalt nicht vergebens sein würde, aufzurichten suchte. Der Arzt antwortete auf St. Auberts Frage, was er von der Krankheit hielte, daß der Ausgang von Umständen abhinge, die er nicht vorausbestimmen könnte. Madame St. Aubert schien besser zu wissen, wie sie daran war, doch sie gab es nur durch Blicke zu verstehen. Sie sah oft ihre bekümmerten Freunde mit einem Ausdruck von Mitleid und Zärtlichkeit an, als ahnte sie den Kummer voraus, der ihrer wartete, und als wollte sie sagen, daß sie nur um ihretwillen das Leben ungern verließe. Am siebenten Tage hatte die Krankheit den entscheidenden Punkt erreicht. Der Arzt nahm eine ernsthafte Miene an; sie bemerkte es, und sagte ihm heimlich, als ihre Familie einmal das Zimmer verlassen hatte, sie fühlte, daß ihr Tod nahe wäre. „Geben Sie sich nicht die Mühe, mich zu täuschen“, sagte sie, „ich fühle, daß ich nicht länger leben kann. Ich bin auf diesen Ausgang gefaßt, und war schon lange darauf vorbereitet. Da ich nicht lange mehr zu leben habe, so lassen Sie sich durch kein falsches Mitleid verleiten, meiner Familie mit leeren Hoffnungen zu schmeicheln; ihr Schmerz würde am Ende nur noch heftiger sein. Ich will mich bemühen, sie durch mein Beispiel Ergebung zu lehren.“
Der Arzt versprach voll Rührung ihr zu folgen, und sagte ihrem Manne etwas brüsk, daß es keine Hoffnung mehr gebe. Dieser war nicht Philosoph genug, um seine Empfindungen bei einer solchen Nachricht zu unterdrücken, doch die Betrachtung, wie sehr der Anblick seines Kummers die Leiden seiner Frau vermehren müßte, befähigten ihn nach einer Weile, sich in ihrer Gegenwart zu fassen. Emily wurde anfangs von der Nachricht überwältigt, bald aber belebten ihre heißen Wünsche die Hoffnung in ihrem Herzen, daß ihre Mutter doch noch genesen würde, und an dieser Hoffnung hing sie hartnäckig beinahe bis auf die letzte Stunde.
Bei Madame St. Aubert zeigte sich der Fortschritt der Krankheit durch geduldiges Ausharren und unterdrückte Wünsche. Die Fassung, womit sie ihrem Tode entgegensah, konnte nur aus dem Rückblick auf ein Leben entstehen, das, soweit die menschliche Schwäche es zuläßt, durch das Bewußtsein stets in der Gegenwart Gottes zu sein, und durch Hoffnung auf eine bessere Welt geleitet wurde. Aber ganz konnte ihre Frömmigkeit nicht den Schmerz besiegen, sich von denen zu trennen, die sie so zärtlich liebte. Sie sprach in ihren letzten Stunden viel mit St. Aubert und Emily über die Aussicht auf die Zukunft und über andere religiöse Gegenstände. Ihre Ergebung, ihre feste Hoffnung, in einer zukünftigen Welt die Freunde wiederzutreffen, die sie in dieser verlassen mußte, und die sichtliche Anstrengung, womit sie ihren Schmerz über die bevorstehende kurze Trennung zu unterdrücken suchte, rührten ihren Mann oft so sehr, daß er das Zimmer verlassen mußte. Wenn er eine Zeitlang seinen Tränen Luft gemacht hatte, trocknete er sie, und kehrte mit einem Gesicht, dem er gewaltsam eine Fassung zu geben suchte, die seinen Schmerz nur vermehrte, in das Krankenzimmer zurück.
Nie hatte Emily so tief als in diesen Augenblicken die Wichtigkeit der Lehre empfunden, ihre Empfindsamkeit zu unterdrücken, und nie hatte sie sie mit so vollständigem Siege ausgeübt. Als aber der letzte Augenblick vorüber war, sank sie sogleich unter der Last ihres Schmerzes zu Boden, und fühlte dann, daß sie ihre bisherige Fassung mehr der Hoffnung, die sie noch immer insgeheim genährt hatte, als ihrer Seelenstärke verdankt hatte. St. Aubert war für eine Zeitlang selbst zu trostlos, um seiner Tochter Trost spenden zu können.
—
2. Kapitel.
So höb' ich eine Kunde an, von der
Das kleinste Wort die Seele dir zermalmte.
Shakespeare.
MADAME St. Aubert wurde in der benachbarten Dorfkirche begraben. Ihr Mann und ihre Tochter begleiteten sie zum Grabe, wohin ein langer Zug von Bauern ihnen folgte, die aufrichtig diese vortreffliche Frau beklagten.
St. Aubert verschloß sich nach seiner Rückkehr von dem Leichenbegängnis in seinem Zimmer. Als er wieder hervorkam, war sein Gesicht heiter, obgleich blaß von Kummer. Er ließ sein ganzes Hausgesinde zusammenrufen. Emily hatte, überwältigt von der eben angesehenen Szene sich in ihr Kabinett zurückgezogen, um ungestört zu weinen. St. Aubert folgte ihr dahin; er ergriff schweigend ihre Hand, während sie fortfuhr zu weinen, und es verstrichen einige Augenblicke, ehe er Herr genug über seine Stimme ward, um zu sprechen. Mit bebenden Lippen sagte er ihr: „Meine Emily, ich werde mit meinen Leuten beten. Wir müssen Hilfe von oben herabflehen, wo sollen wir sonst sie suchen, wo anders sie finden?“
Emily hielt ihre Tränen zurück und folgte ihrem Vater in den Saal, wo die Diener bereits versammelt waren. St. Aubert las mit leiser feierlicher Stimme die Abendandacht und fügte ein Gebet für die Seele der Abgeschiedenen hinzu. Oft bebte seine Stimme, Tränen fielen auf das Buch und schließlich hielt er inne. Allmählich aber erhoben die seligen Gefühle reiner Andacht seine Seele über diese Welt und brachten endlich Trost in sein Herz.
Nachdem er den Gottesdienst beendet und die Bediensteten fortgeschickt hatte, küßte er zärtlich Emily und sagte: „Ich habe mich von deiner frühsten Jugend an bemüht, dir die Pflicht der Selbstbeherrschung zu lehren. Ich habe dich darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig sie uns durchs ganze Leben ist, da sie uns nicht nur bei den mancherlei und gefährlichen Versuchungen, die uns von Rechtschaffenheit und Tugend ableiten, aufrechterhält, sondern auch der weichen Nachsicht entgegenarbeitet, welche Tugend genannt wird, aber über eine gewisse Grenze hinausgetrieben, in Laster ausartet, und traurige Folgen nach sich zieht. Alles Übermaß ist Fehler; selbst der in seinem Ursprung liebenswürdige Schmerz wird zur selbstsüchtigen ungerechten Leidenschaft, wenn wir ihm auf Kosten unserer Pflichten nachhängen; unter Pflichten verstehe ich, was wir uns selbst sowohl als anderen schuldig sind. Die Nachsicht gegen den übermäßigen Schmerz entnervt die Seele und macht sie unempfänglich für den mannigfaltigen unschuldigen Genuß, den ein wohltätiger Gott zum Sonnenschein unseres Lebens bestimmte. Erinnere dich, meine liebe Emily, der Lehren, die ich dir so oft gegeben habe, und die deine eigene Erfahrung dir so oft schon als weise gezeigt haben. Dein Grämen ist unnütz. Nimm dies nicht bloß als eine Alltagsbemerkung auf, sondern laß wirklich deine Vernunft den Gram unterdrücken. Ich wünsche nicht, deine Gefühle zu töten, mein Kind, sondern bloß dich sie beherrschen zu lehren. Denn was für Übel auch aus einem zu empfänglichen Herzen entspringen mögen, so läßt sich doch von einem unempfindlichen nichts hoffen; ein solches ist ganz Laster; und zwar Laster, dessen Häßlichkeit durch keinen Schein oder Möglichkeit des Guten gemildert wird. Du kennst mein Leiden, und bist also gewiß überzeugt, daß dies nicht leere Worte sind, die bei solchen Gelegenheiten so oft wiederholt werden, um selbst die Quellen eines rühmlichen Gefühls zu vernichten oder, die oft bloß dazu dienen, die selbstsüchtige Prahlerei einer falschen Philosophie auszukramen. Ich will meiner Emily zeigen, daß ich ausüben kann, was ich lehre. Ich habe so viel gesagt, denn ich kann es nicht ansehen, daß du dich in fruchtlosem Kummer verzehrst, weil dir die Kraft zum Widerstande mangelt, die man von der Seele fordern muß; und ich habe es erst jetzt gesagt, weil es einen Zeitpunkt gibt, wo alles Vernünfteln der Natur weichen muß. Dieser ist vorüber; ein anderer aber, wo übertriebene, zur Gewohnheit gewordene Nachsicht alle Spannkraft so niederdrückt, daß der Sieg beinahe unmöglich wird, naht heran: Du, meine Emily, wirst zeigen, daß du ihn zu vermeiden bereit bist.“
Emily lächelte ihren Vater durch ihre Tränen hindurch an. „Bester Vater“, sagte sie, und ihre Stimme bebte – „ich werde mich Ihrer würdig zeigen“ – wollte sie sagen, aber ein Gemisch von Dankbarkeit, Zärtlichkeit und Schmerz überwältigte sie. St. Aubert ließ sie ungestört ausweinen und fing dann von anderen Gegenständen zu reden an.
Die erste Person, welche kam, um St. Aubert ihr Beileid zu bezeugen, war ein gewisser Monsieur Barreaux, ein harter und dem Anschein nach gefühlloser Mann. Ein Geschmack an Botanik, der sie oft bei ihren Wanderungen in den Bergen zusammenführte, hatte sie zuerst miteinander bekanntgemacht. Monsieur Barreaux hatte sich von der Welt, und beinahe von der Gesellschaft zurückgezogen, um in einem angenehmen Chateau, am Saume der Wälder, nahe bei La Vallée zu leben. Auch er hatte sich in seiner Meinung vom Menschengeschlechte betrogen gefühlt, aber er vergoß nicht Tränen um selbiges, wie St. Aubert; er fühlte mehr Unwillen über ihre Laster, als Mitleid mit ihrer Schwäche.
St. Aubert wunderte sich beinahe, ihn zu sehen, denn sooft er ihn auch auf sein Chateau eingeladen hatte, war er doch nie gekommen, und jetzt trat er auf einmal ohne alle Umstände wie ein alter Freund ins Zimmer. Die Ansprüche des Unglücks schienen alle Rauhigkeit und Vorurteile seines Herzens besiegt zu haben. Der unglückliche St. Aubert war der einzige Gegenstand, der seine Gedanken beschäftigte. Mehr durch sein Wesen als durch Worte bezeugte er sein Mitgefühl für seine Freunde. Er sprach wenig über den Gegenstand ihres Schmerzes, doch die sorgsame Aufmerksamkeit, die er ihnen widmete, der Ton seiner Stimme und der sanfte Blick, der sie begleitete, kamen aus seinem Herzen und sprachen zu dem ihrigen.
In dieser traurigen Zeit erhielt St. Aubert auch einen Besuch von Madame Cheron, seiner einzigen noch lebenden Schwester, die seit einem Jahre Witwe war, und jetzt auf ihrem Gute nahe bei Toulouse wohnte. Er hatte nie häufigen Umgang mit ihr gehabt. Sie ließ es nicht an Worten fehlen, ihm ihr Beileid zu bezeugen; aber die Zauberkraft des Blicks, der zur Seele spricht und der Stimme, die wie Balsam zum Herzen dringt, beherrschte sie nicht – doch versicherte sie St. Aubert, daß sie aufrichtig mit ihm sympathisiere, pries die Tugenden seiner verstorbenen Frau und bot ihm dar, was sie für Trost hielt. Emily weinte unaufhörlich, während sie sprach. St. Aubert blieb ruhig, hörte sie stillschweigend an, und lenkte dann die Unterredung auf einen anderen Gegenstand.
Beim Abschiede lud sie ihn und ihre Nichte dringend ein, sie bald zu besuchen. „Veränderung des Orts wird euch zerstreuen“, sagte sie, „und es ist nicht recht, dem Kummer zu viel einzuräumen.“ So abgedroschen auch diese Worte waren, erkannte doch St. Aubert ihre Wahrheit; nur fühlte er sich weniger denn je geneigt, den Ort zu verlassen, den seine verschwundene Glückseligkeit geheiligt hatte. Die Gegenwart seiner Frau hatte jeden Gegenstand um ihn her geweiht, und jeder neue Tag verstärkte, in eben dem Maße, wie er die Schärfe seines Leidens milderte, den zärtlichen Zauber, der ihn an seine Heimat band.
Es gab jedoch Aufforderungen, die er nicht ablehnen konnte, und der Besuch, den er seinem Schwager Quesnel machte, gehörte darunter. Eine Sache von Wichtigkeit nötigte ihn, diesen Besuch nicht länger zu verschieben, und um Emily aus ihrer Niedergeschlagenheit zu reißen, nahm er sie nach Epourville mit.
Als der Wagen in den Wald fuhr, der an sein väterliches Gebiet grenzte, fielen seine Augen noch einmal auf die betürmten Ecken des Chateaus. Er seufzte bei dem Gedanken an die Veränderungen, die sich seit seinem letzten Aufenthalte an diesem Orte zugetragen hatten, der nunmehr das Eigentum eines Mannes war, der seinen Wert weder ehrte noch schätzte. Endlich betrat er die Zufahrt, deren hohe Bäume ihn so oft entzückten, als er noch Knabe war, und deren melancholischer Schatten jetzt so ganz mit der Stimmung seiner Seele harmonierte. Jeder Teil des Gebäudes, das sich durch eine gewisse schwerfällige Größe auszeichnete, trat nach und nach zwischen den Bäumen hervor – der breite Turm, der Gewölbegang, der in die Innenhöfe führte, die Zugbrücke und der ausgetrocknete Graben, der das Ganze umringte.
Das Geräusch des Wagens brachte einen Haufen Bediensteter an das große Tor. Hier stieg St. Aubert aus und führte Emily in den gotischen Saal, den jetzt nicht mehr die Waffen und alten Banner der Familie schmückten. Sie waren längst aus dem Wege geräumt und die eichene Täfelung und die Balken, welche quer über die Decke hinliefen, waren weiß überstrichen. Auch der große Tisch, der ehemals die obere Ecke des Saales einnahm, an welchem der Herr des Hauses seine Gastfreundlichkeit so gerne zeigen mochte, und wo der Schall fröhlichen Gelächters und der Gesang geselliger Freude so oft ertönten, war fortgeschafft; selbst die Bänke, die ringsum den Saal einfaßten, standen nicht mehr. Die hohen Mauern waren mit frivolem Schmuck behangen, und alles was man sah, verriet den falschen, verderbten Geschmack des gegenwärtigen Besitzers.
St. Aubert folgte einem leichtfüßigen Pariser Diener in einen Salon, wo er Monsieur und Madame Quesnel fand, die ihn mit steifer Höflichkeit empfingen und nach einigen wenigen Beileidskomplimenten ganz zu vergessen schienen, daß sie je eine Schwester hatten.
Emily fühlte Tränen in ihre Augen steigen, die bald Ärger wieder zurücktrieb. St. Aubert, ruhig und besonnen, behielt seine Würde bei, ohne Wichtigkeit vorzugeben, und Quesnel fühlte sich durch ihre Gegenwart bedrückt, ohne deutlich sagen zu können, warum.
Nach einigen allgemeinen Gesprächen bat St. Aubert darum, mit ihm allein zu reden, und Emily, die bei Madame Quesnel zurückblieb, hörte bald, daß eine große Gesellschaft zu Mittag aufs Chateau eingeladen war, und mußte erfahren, daß nichts, was geschehen und unwiederbringlich verloren war, die laute Freude der gegenwärtigen Stunde stören konnte.
Quesnels Taktlosigkeit, an diesem Tage eine große Gesellschaft einzuladen, empörte St. Aubert so sehr, daß er unverzüglich wieder nach Hause zurückkehren wollte. Doch er erfuhr, daß Madame Cheron eingeladen war, um hier mit ihm zusammenzukommen; und wenn er Emily ansah und bedachte, daß die Zeit vielleicht nicht mehr fern war, wo ihres Onkels Feindschaft ihr schaden konnte, beschloß er, ihn nicht durch ein Betragen zu erbittern, welches dieselben Personen, die jetzt so wenig Sinn für Schicklichkeit zeigten, als höchst unschicklich tadeln würden.
Unter den versammelten Gästen befanden sich zwei Italiener; von denen der eine, namens Montoni, in Mann von ungefähr vierzig Jahren, ein weitläufiger Verwandter von Madame Quesnel war. Er war ungewöhnlich gutaussehend, doch seine männlichen und ausdrucksvollen Gesichtszüge verrieten ebenso viel gebieterischen Stolz als Scharfsinn und schnelle Geisteskraft.
Signor Cavigni, sein Freund, mochte etwa dreißig Jahre alt sein. An Würde stand er ihm nach, an Scharfsinn schien er ihm gleich, an Gefälligkeit des Betragens aber übertraf er ihn weit.
Emily erschrak über die Begrüßung, die Madame Cheron ihrem Vater zuteil werden ließ: „Lieber Bruder“, sagte sie, „ich bin bekümmert, daß du so krank aussiehst; bitte ziehe doch einen Arzt zurate!“
St. Aubert antwortete mit wehmütigem Lächeln, daß er sich wie gewöhnlich befände, aber Emilys ängstliche Besorgnis glaubte eine Veränderung in seinen Zügen zu sehen, die sie alles ärgste fürchten ließ.
Emily würde sich an den neuen Charakteren, die sie kennenlernte, und an der Mannigfaltigkeit der Unterhaltung bei der Tafel, die an Glanz und Pracht alles, was sie noch von der Art gesehen hatte, übertraf, ergötzt haben, wäre ihre Seele weniger bekümmert gewesen. Signor Montoni war erst kürzlich aus Italien zurückgekommen, und sprach von den Unruhen, welche damals dieses Land zerrütteten: er sprach feurig von den Streitigkeiten der Parteien und beklagte die wahrscheinlichen Folgen dieser Gärung. Sein Freund Cavigni sprach mit gleicher Glut von den politischen Angelegenheiten seines Landes, pries die Regierungsform und den Wohlstand von Venedig, und rühmte seine entschiedenen Vorzüge über alle anderen italienischen Staaten. Er wandte sich darauf an die Damen und sprach mit derselben Beredsamkeit von Pariser Moden, von der französischen Oper und französischen Gebräuchen, wobei er nichts einzumischen vergaß, was dem französischen Geschmack so vorzüglich angenehm ist. Diejenigen, denen diese Schmeichelei galt, fühlten sie nicht, obgleich die Wirkung davon sich in einer demütigen Aufmerksamkeit zeigte, die seiner Aufmerksamkeit nicht entging. Sooft er sich von der Zudringlichkeit der anderen Damen losmachen konnte, richtete er das Gespräch an Emily; doch sie verstand nichts von Pariser Moden und Pariser Opern, und ihre Bescheidenheit, Einfachheit und sittsames Betragen stachen sehr gegen die freien Sitten ihrer Gesellschafterinnen ab.