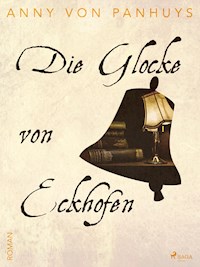
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bewundernd durchläuft Elisabeth von Valberg als neue Herrin durch die Räume von Schloss Eckhofen. Schwierige Jahre liegen hinter der schnell verwitweten jungen Frau und ihrem kleinen Sohn. Die überraschende Erbschaft als einzige Nachkommin befreit sie von allen Sorgen. Nur der alte Diener Valentin ist ihr unheimlich: Bedeutungsvoll erzählt er ihr von einer unsichtbaren Glocke, die immer dann läutet, wenn Unheil auf Schloss Eckhofen droht. Es sei die schöne Polin Brunislawa, deren Sarkophag in der Kapelle stehe und die mit dem Läuten alle Bewohner warne. Diese Geschichte verfolgt die sensible und herzschwache Elisabeth bis in den Schlaf. Nach einem schweren Albtraum hört sie die Glocke tatsächlich schlagen. Und wie zur Bestätigung der Sage wäre der kleine Herbert beinahe ertrunken, wenn nicht das Kindermädchen Ilse beherzt hinterhergesprungen wäre. Sie wird Elisabeths engste Vertraute und Freundin. Dem schönen Mädchen steigt die Beachtung allerdings zu Kopf. Bald ist sie sich nicht mehr sicher, ob die Liebe des Doktor Kurschmann, der Elisabeths krankes Herz behandelt, überhaupt standesgemäß ist. Eines Tages betritt der Maler Brunkendorff das Schloss. Er soll Ilse, die der Polin zum Verwechseln ähnlich sieht, malen. Überraschend entdeckt er in der Bibliothek, dass es eine Verbindung von Schloss Eckhofen zu ihm gibt und bald kennt er das Geheimnis der Glocke.Liebe und Leidenschaft, falscher Hochmut und Stolz und die Familiengeschichte eines alten Adelsgeschlechts: Dieser in seiner Dramatik hochspannende Roman ist einer der schönsten von Anny Panhuys!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Die Glocke von Eckhofen
Frauen-roman
Die Glocke von Eckhofen
© 1931 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570401
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Elisabeth von Valberg besichtigte ihr neues Heim. Sie hatte die Begleitung des Schloßverwalters, der sich ihr dienstbeflissen zur Verfügung gestellt, mit einem kühl-freundlichen Lächeln zurückgewiesen. Nun ging sie langsam durch die endlosen Gänge und betrat die weiten Säle, in denen ihr Schritt fast aufrührerisch erklang.
Sie stand vor den Ahnenbildern und ihre Augenbrauen zogen sich beinahe ein wenig hochmütig empor. Jetzt war sie Schloßherrin, war den Männern und Frauen, deren gemalte Gesichter sie starr und fremd anblickten, ebenbürtig. Ihr kluges, blasses Antlitz rötete sich leicht in dem Ansturm des stolzen Gedankens. Jetzt war sie Majoratserbin, war die Nachfolgerin ihres Onkels Christian, des letzten männlichen Fideikommißbesitzers von Eckhofen.
Er war der Bruder ihrer seligen Mutter gewesen.
Ihr Blick schweifte die Reihe der Bilder entlang und blieb dann an einem besonders lange hängen.
„Christian Sigismund, Baron von Gaudenz.“ Elisabeth sagte es leise vor sich hin, und wie in scharfem Beobachten erforschte sie jeden Zug in dem Männergesicht, über dem ein glattes gefrorenes Lächeln gleich einer dünnen und dennoch undurchdringlichen Maske lag. Kalte Augen voll spöttischer Überlegenheit schienen den Blick der jungen Frau zu erwidern, und Elisabeth meinte deutlich zu sehen, wie sich die schmalen Lippen auf dem Bilde des vor drei Jahren verstorbenen Onkels höhnisch verzogen.
Ein Schauer ging durch die schlanke Frauengestalt.
Erinnerungen eilten herbei, drängten sich heran und machten ihr das Herz schwer. Beschworen Stunden herauf, da der Tote noch der reiche Fideikommißherr von Eckhofen gewesen und ihre Mutter die arme Witwe des unverschuldet in Not geratenen Gutspächters.
Elisabeths Stirn zeigte eine kleine scharfe Falte, und etwas wie Haß leuchtete in ihren braunen Augen auf, da sie das Bild des Barons Christian so ansah. Ein harter Mann war er gewesen, welcher der armen Mutter ein paarmal ein Almosen gegeben und ihr dazu Vorwürfe über ihre törichte Heirat gemacht hatte, sich aber zum Schluße gar nicht mehr um sie kümmerte. Als die Mutter starb, schickte er einen Kranz und einen Hundertmarkschein.
Elisabeth gedachte jenes Tages mit zornigem Groll, und noch heute war sie froh, das Geld, von einigen kurzen Zeilen begleitet, zurückgesandt zu haben. Daß sie selbst inzwischen einen armen Mann geheiratet hatte, darüber war Onkel Christian von Gaudenz einfach so hinweggegangen, als bedeute es ihm gar nichts, und als ihr dann ihr Mann, Hans von Valberg, der junge, begabte Ingenieur, an dessen Seite sie ein kurzes zufriedenes Jahr dahingelebt, entrissen wurde und sie dem Onkel diese Todesstunde pflichtgemäß mitteilte, war kein Wörtlein des Beileids aus Schloß Eckhofen in ihre Witweneinsamkeit geflogen, und alles blieb still, bis er, der stolze Baron Christian, selbst den Weg in die Ewigkeit antreten mußte.
Und da war es zu ihr gekommen, das „Glück“, da war der Reichtum über die Schwelle ihres einfachen, kleinen Heims getreten und hatte ihr die mit Gold gefüllten Hände entgegengestreckt.
Fideikommiß Eckhofen-Gaudenz war Kunkellehen und ging, falls keine Männer der Familie mehr lebten, auf die weiblichen Nachkommen der Barone Gaudenz über.
Christian Gaudenz hatte zwei Schwestern besessen, Sibylle und Herta. Sibylle war in ganz jungen Jahren, um einer kleinen törichten Liebschaft willen, wie es hieß, mit einem jungen Maler geflohen. Bis weit übers Wasser sollte sie mit ihm gezogen sein. Trotz mancherlei Nachforschungen war und blieb sie verschollen; Herta aber war Elisabeths Mutter gewesen, und Elisabeth demnach die einzige Erbin des reichen Fideikommisses.
Onkel Christians Tod bedeutete für sie einen schroffen Übergang von Armut zum Reichtum, und nun stand sie hier auf dem Boden, den Familienüberlieferung geheiligt.
Die schmalen Schultern Elisabeths hoben sich. Reichtum ist Macht, dachte sie lächelnd und sie wollte diese Macht ein wenig auskosten. Wollte auf bequemen Pfaden die Schönheiten und Genüsse des Lebens suchen und vergessen, wie eintönig und grau die Vergangenheit gewesen. Schade, das sie der Mutter keinen einzigen Sonnenstrahl ihres jetzigen Daseins mehr spenden konnte. Aber die Toten haben ja keine Wünsche und keine Sehnsucht mehr.
Die breite Flügeltür öffnete sich.
Elisabeth drehte sich, von dem Geräusch aus ihren Gedanken gerissen, um.
Der alte Diener Valentin verneigte sich.
„Verzeihung, gnädige Frau, aber ich wußte nicht, daß gnädige Frau sich hier befanden, ich wollte nur einen neuen Haken einschlagen, weil letzthin das Bild der Baronin Brunislawa beinahe heruntergefallen wäre.“
Elisabeth sagte ein bißchen nebenher:
„So, so“, aber dann fiel ihr ein, daß der Diener Valentin schon beinahe seit einem Menschenalter im Schlosse lebte und gewiß ein freundliches Wort verdiente. So meinte sie denn mit einem kleinen, warmen Lächeln, das ihr schmales Gesicht unendlich reizvoll erscheinen ließ: „Lassen Sie sich nur, bitte, durch meine Gegenwart nicht stören, Valentin, bringen Sie also einen festeren Halt für das Bild an.“ Dann setzte sie fragend hinzu, wer die Baronin Brunislawa gewesen und um welches Bild es sich handele.
Der Diener zog die Flügeltür geräuschlos hinter sich zu und trat mit dem sicheren Schritt des guten Dieners, der es gewohnt ist, sich auf dem glatten Parkettboden zu bewegen, näher. Aus einem Wandschrank nahm er ein nicht allzu großes, goldrahmenumgebenes Bild und hielt es der jungen Herrin in angemessener Entfernung entgegen.
„Das ist die Baronin Brunislawa Gaudenz, geborene Gräfin Lipska“, sagte er mit gedämpfter Stimme und sein altes Faltengesicht war feierlich ernst. Erklärend fuhr er fort: „Baronin Brunislawa war Polin und eine Frau von hervorragender Schönheit und Klugheit. Sie lebte Ende des achtzehnten Jahrhunderts und ließ die Schloßkapelle sehr kostbar einrichten.“
Valentin sagte das wie einer jener Führer, die den Fremden das Innere alter Schlösser zeigen.
Elisabeth schenkte dem Bilde ungeteilte Aufmerksamkeit. Die blonde, zartrosige Frau mit den schwarzen, samtenen Augen tat es ihr sofort an, und leise bestätigte sie:
„Ja, sie muß sehrschön gewesen sein, die Polin.“
„Auch gut war sie, heißt es“, sagte der alte Diener, und in geheimnisvoll gefärbtem Ton setzte er hinzu: „Man erzählt, sie sei so gut gewesen, daß sie allen Menschen und auch dem kleinsten Tier half, wenn Hilfe vonnöten war, und man sagt sogar …“
Hier brach der Alte ab und ein fragender, etwas zweifelhafter Blick traf das Gesicht seiner Herrin.
„Sprechen Sie doch weiter, Valentin“, ermunterte Elisabeth.
Der Diener stellte das Bild vorsichtig in einen breiten Sessel, und ein mattes Verlegenheitslächeln irrte um seinen Mund.
„Ach, gnädige Frau werden mich auslachen“, sagte er, und doch sah ihm Elisabeth an, er hätte gar zu gern weitergesprochen.
Sie nickte ihm zu.
„Ich möchte gern wissen, was man über die schöne Polin spricht.“
Der Diener verneigte sich.
„Wenn gnädige Frau es wünschen.“ Er hüstelte. Man sagt, die Güte der Baronin Brunislawa habe noch Kraft über das Grab hinaus, und sie warne ihre Nachkommen immer, wenn ein böses Geschick über Eckhofen heranziehe. Dann klinge eine Glocke auf, und der Ton käme aus der Tiefe, vielleicht aus der Gruft her, wo ihr steinerner Sarkophag steht.“
Elisabeth von Valbergs Mundwinkel zuckten ein wenig.
Valentin bemerkte es nicht, seine Blicke hafteten an dem Bilde der schönen Polin.
„Wenn den Besitzern von Eckhofen irgendeine Gefahr droht, dann klingt die Glocke, die niemand zu finden weiß, deren Läuten aber schon so viele hörten. Auch ich — —“
Er brach abermals ab, ein kleines, unvorsichtiges Lachen seiner Herrin hatte ihn erschreckt schweigen lassen.
Beinahe vorwurfsvoll war sein Gesicht, da er mit deutlichem Nachdruck sagte:
„Ja, auch ich hörte schon zweimal, seitdem ich auf Eckhofen bin, die Glocke läuten. Es hörte sich seltsam an, wirklich so wie aus der Tiefe.“
Elisabeth unterdrückte ihre Heiterkeit.
„Sie werden irgendeine Glocke aus der Nachbarschaft gehört haben“, sagte sie ruhig.
Er schüttelte bestimmt den Kopf.
„Die Kirchenglocke im Dorf klingt anders, und die nächsten Dörfer liegen weit ab von Eckhofen und dann — ich sagte ja, der Glockenklang kam aus der Tiefe.“
Die junge Frau lächelte nun doch.
„Und vor welchen Gelegenheiten hörten Sie denn diese geheimnisvolle Glocke?“ fragte sie.
Der Diener neigte sich ein wenig vor, als lausche er in sich hinein.
„Das erstemal hörte ich es eines Nachts vor dem schrecklichen Hochwasser vor zwanzig Jahren. Wie in ersticktem Wimmern klang da die Glocke und das zweitemal hörte ich sie nachts, einige Tage bevor der einzige Sohn des Barons Christian nämlich am Herzschlag starb. Beide Male klang sie nachts, und man sagt, sie soll auch am Tage klingen, man sagt —“
Jäh riß seine Rede ab und ein starres Entsetzen malte sich in seinen müden Augen.
Elisabeth wollte etwas zu ihm sagen, wollte fragen, was ihm fehle, doch erstarb ihr die erste Silbe auf den Lippen, denn aus der Tiefe scholl ein Glockengeläut auf, wiederholte sich und sang dumpf und klagend eine einförmige Melodie. Sang und sang wie eine Warnung und erstarb in einem gurgelnd matten Schrei.
Elisabeth vermochte zuerst den lähmenden Bann, der sie befallen, von sich abzuschütteln.
„Irgend jemand macht sich einen dummen Witz“, sagte sie ärgerlich.
Der alte Valentin hob abwehrend die runzelige Rechte.
„Solchen Scherz erlaubt sich niemand auf Eckhofen“, sagte er ernst und überzeugt, „kein Sterblicher hat die Glocke geläutet, es weiß doch niemand, wo sie hängt. Es war die Baronin Brunislawa.“
Elisabeth winkte dem Diener, zu schweigen.
„Seien Sie doch nicht so abergläubisch, Valentin. Im übrigen können Sie fest überzeugt sein, ich werde bald herausbringen, wo die Glocke angebracht ist, und wer es für nötig gehalten, mich, nachdem ich erst wenige Tage auf Eckhofen weile, so liebenswürdig zu warnen. Ich werde auch herausbringen, was man mit diesem Unfug beabsichtigt.“
Ein aufkeimendes Mißtrauen gegen den alten Mann regte sich plötzlich in ihr.
Jahrelang war Eckhofen bis zur Erledigung der Erbschaftsregelung ohne Herrn gewesen, das hatte der Dienerschaft natürlich behagt. Vielleicht gedachte man ihr eine kleine Spukkomödie vorzuspielen, sie dadurch hier fortzuscheuchen. Derartige Sachen kamen vor.
Nun, sie wollte zeigen, daß sie eine aufgeklärte Frau war, die den Dingen auf den Grund ging.
Ihr Gesicht wurde eisig.
„Hängen Sie das Bild der Baronin Brunislawa nur recht fest auf, Valentin“, sagte sie spöttisch, denn sie meinte jetzt zu wissen, daß der Alte das Bild absichtlich vorher von der Wand genommen hatte, um sie bei erster Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen und ihr zugleich die Geschichte von der Warnerin zu erzählen. Ein Bundesgenosse des Alten läutete inzwischen irgendein vorher besorgtes Glöckchen.
Ein Theaterstück, einstudiert, um sie von Eckhofen zu verjagen. Man wußte genau, daß immer, auch wenn die Herrschaft es nicht bewohnte, etwas Dienerschaft auf Eckhofen sein mußte; eine Herrin, noch dazu eine junge, die nicht alles durchgehen ließ, war unbequem.
Ohne Valentin noch zu beachten, verließ Elisabeth von Valberg den Saal. An der Tür wandte sie sich noch einmal flüchtig zurück.
Da sah sie den alten Mann mit schlaffhängenden Armen stehen, und seine Mienen trugen noch immer den Stempel eines jähen, großen Erschrekkens.
Sollte sie ihm doch unrecht getan haben mit ihrem Mißtrauen?
Leise Zweifel beschlichen sie. Aber die Wahrheit mußte sich herausstellen, dafür wollte sie Sorge tragen. Ihre Augen streiften die Ahnenbilder und ihr war es, als blickten ihr alle die Herren und Damen feindselig nach.
Hastigen Schrittes suchte sie ihre Zimmer auf. Ein unbehagliches Gefühl war in ihr und wollte sich durch keine Vernunftgründe vertreiben lassen.
Wunderschön und lauschig war das Zimmer, das sie sich als Wohngemach gewählt. Dunkelrote Damasttapeten überzogen die Wände und dunkelroter Damast floß in schweren, tiefeingegrabenen Falten vor den breiten Fenstern nieder. Auch die Bezüge der Sessel und Sofas waren aus dem gleichen kostbaren Stoff und nachgedunkelte alte Stiche hingen in beinahe verschwenderischer Menge an den Wänden.
Elisabeth trat an das Fenster und schaute in die beginnende Dämmerung hinaus. Der Himmel war grau und goß Milliarden von Regenstrahlen nieder auf die Erde, die sich dem Frühling entgegensehnte. Leise rauschte der Regen und von dem Dache stürzte es nieder wie wütende Bächlein.
Vom Fenster aus konnte Elisabeth den Bergwald sehen, der auch zu ihrem Besitztum gehörte, und sie sann, wie hübsch das wohl sein würde, wenn sie an schönen sonnendurchlachten Frühlings- und Sommertagen darin mit ihrem kleinen Jungen spazieren gehen konnte.
Sehnsucht nach ihrem Kinde faßte sie plötzlich wie mit starken Armen an.
Sie klingelte.
Ein Mädchen erschien.
„Bitten Sie Fräulein Haldow, mir Herbert zu bringen“, sagte sie.
Wenige Minuten später drückte eine kleine unsichere Hand die Klinke nieder und ein vierjähriger hübscher Junge stürmte ins Zimmer.
„Muttel, ich war mit Fräulein unten in der Kirche und sie hat mir das liebe Jesuskindchen gezeigt“, jubelte er.
Elisabeth lächelte.
„Das war recht von dem Fräulein, aber nun bleibst du ein bißchen bei mir und erzählst mir von der Kirche und dem lieben Jesuskindlein.“ Sie wandte sich dem schlanken, auffallend schönen blonden Mädchen zu, das wie abwartend in der Nähe der Tür stand. „Sie können jetzt gehen, Fräulein Haldow, ich lasse Ihnen sagen, wenn Sie Herbert wieder zu sich holen können.“
Das blonde Mädchen ging mit einem „Jawohl, gnädige Frau.“
Elisabeth zog die dunklen Vorhänge zu, die graue Dämmerung, der Regen verstimmten sie; dann knipste sie die in einer Ecke stehende hohe Stehlampe an. Durch den roten Schirm gab es ein glutfarbenes Licht und ein roter Flammenkreis lag nun auf dem Teppich und auf der Wand.
Einförmig rauschte der Regen.
Elisabeth ließ sich in einen der Sessel fallen, dann nahm sie ihren Jungen auf den Schoß.
„So, nun erzähle mir von dem Jesuskindlein, Herbert, ich höre gern davon.“
Der Kleine machte ein wichtiges Gesicht und sein Mündchen wollte eben das erste Wort sprechen, da hob er den Finger und flüsterte leise:
„Horch, Muttel, eine Glocke läutet!“
Elisabeth nickte nur, zu sprechen vermochte sie nicht gleich. Klagend und warnend klang eine Glockenstimme aus der Tiefe, genau wie vorhin, als ihr der alte Diener von der schönen Polin berichtet hatte, die vor länger als hundert Jahren gelebt hatte und die es noch jetzt nicht ließ, die Besitzer Eckhofens zu warnen, wenn ihnen eine Gefahr drohte.
Elisabeth sah in den roten Flammenkreis, den die Lampe auf die Wand und den Teppich malte. Sie lauschte mit einem kleinen Herzklopfen hinaus in den Regen und zugleich auf die dumpfe schwache Glockenstimme, die eben müde und heiser verhallte.
Drohte ihr eine Gefahr, ihr oder ihrem Kinde? Wollte die schöne Polin sie warnen, und wovor?
In Elisabeth erwachte plötzlich eine Angst vor etwas Fremdem, Unbekanntem und Geheimnisvollem. Sie preßte den kleinen Burschen eng an sich und mit gequältem Lächeln sagte sie nur:
„So, nun ist die Glocke still, nun erzähle mir vom Jesuskindchen.“
Der Kleine nickte.
„Ja, nun ist die Glocke still, Muttel. Aber sage, wo hängt denn die Glocke?“
Die junge Frau streichelte über das weiche Haar des Kindes.
„Ich weiß nicht, Herbert, aber wenn wir erst länger hier wohnen, dann kann ich es dir wohl sagen, denn ich will danach fragen oder selbst suchen.“
Den Kleinen befriedigte die Antwort vollkommen.
Die Glocke dünkte ihn nicht besonders wichtig.
Langsam und betont begann er dann:
„Also unten in der Kapelle ist das Jesuskindchen, und es hat einen goldenen Stern auf dem Kopfe und ist so groß wie ich.“
Elisabeth streichelte weiter über das Haar ihres Jungen, ihr war es, als höre sie noch immer die heisere Glocke, deren Stimme nicht aus der Höhe kam wie sonst Glockenstimmen, sondern aus der Tiefe.
Fast schämte sie sich, daß sie, die aufgeklärte, gesunde Frau, sich abermals bei dem Gedanken ertappte, wovor sie die schöne Baronin Brunislawa wohl warnen wollte.
*
Mitten in der Nacht erwachte Elisabeth von Valberg mit schmerzendem Kopf.
Sie richtete sich ein wenig im Bett auf und ihre Hand fuhr ein paarmal mit leichtem Druck über die Stirn, hinter der es pochte und hämmerte, als trieben dort böse Geisterchen ein tolles Spiel. Noch war sie sich nicht klar, ob sie nur schwer geträumt oder ob sie wirklich gesehen; was ihr noch immer so deutlich vorschwebte, daß ihr die Erregung darüber noch jetzt die Glieder zittern machte.
O, wie ihr Kopf schmerzte!
Sie knipste die kleine elektrische Lampe auf dem Nachttisch an und trank fast gierig das Glas Wasser leer, das neben der Lampe stand.
Sie fühlte sich etwas frischer, und in der Helle ordneten sich ihre Gedanken, wurden klarer, nüchterner.
Ein kleines Lächeln flog über ihr Gesicht, da sie nun ihres seltsamen Traumes gedachte, ihn noch einmal im Geiste vollständig an sich vorüberziehen ließ.
Der Traum kam von dem gestrigen Erleben, von der Erzählung des alten Dieners und dem Glockengeläute, dessen Ursprung sie nicht kannte.
Wie sie das alles bis in den Schlaf verfolgt hatte.
Ein sonderbarer Traum, der sonderbarste, der je ihr Lager umschwebt.
Sie hatte geträumt, sie hätte die Glocke gehört. Laut und lauter war der einförmige blecherne Klang an ihr Ohr gedrungen, und sie wäre dem Klange nachgegangen, weil sie erforschen wollte, wo die Glocke hing. Überall im Schlosse hatte sie herumgesucht, war durch lange Zimmerreihen gewandert und treppauf, treppab gestiegen. Bis in die abgelegensten Bodenräume hinauf, trotzdem sie doch genau wußte, der Klang rief aus der Tiefe zu ihr. Dann hatte sie die Schloßkapelle durchsucht und war hinabgestiegen in die Familiengruft, aber nirgends fand sie die Glocke, trotzdem diese immer und immer fortklang. Und endlich stand sie vor einem steinernen Sarkophag. Brunislawa von Gaudenz, die eine geborene polnische Gräfin gewesen, sollte darunter ruhen. Sie aber gebot plötzlich über eine so starke Sehkraft, daß sie durch den steinernen Sarkophag hindurchzublicken vermochte. Da sah sie denn, daß niemand unter den schweren, künstlerisch behauenen Steinen schlief, und von Grauen erfaßt war sie in wilder Hast geflohen. Ohne sich umzuschauen, war sie gerannt, so weit sie ihre Füße trugen. Sie hatte dabei nicht darauf geachtet, wohin sie floh, bis der Glockenklang mit einem Male überlaut wurde und sie zitternd still stehen mußte. Da sah sie die Glocke in nächster Nähe vor sich und neben der Glocke eine mädchenhaft schlanke Gestalt. Ein süßes, weißes Gesicht mit dunklen Augen war ihr zugewandt. Die zarten, nur von weiten Ärmeln umgebenen Arme aber zogen an einem starken Seil und läuteten die Glocke.
Die schöne Polin war es, die das Seil der Glocke zog und ihr weißes Gewand wehte dabei leise wie windbewegt. Lichtblond lag das Haar um die schmale Stirn und in den Augen war ein Ausdruck himmlicher Güte.
Elisabeth dachte weiter an den Traum, und ganz deutlich meinte sie den Raum vor sich zu sehen, darin die Glocke hing. Wie in ein graues Dämmern war er gehüllt und von allen Seiten wuchsen Schatten heran, als wollten sie vollkommene Dunkelheit erzeugen. Eine matte Helle herrschte nur an einer Seite des Raumes, von dem man nicht erkennen konnte, ob er groß oder klein war. Die Helle lag um die Glocke herum und um die Gestalt des jungen läutenden Weibes. Die Glocke aber hing merkwürdigerweise nicht von der Decke herab, sondern an einem ziemlich hohen, schräg im Boden eingerammten Pfahl. Unfern davon bewegte sich etwas wie ein Mühlrad und ein Plätschern von Wasser schien durch das Glockenläuten zu klingen.
Elisabeth sann dem eigenartigen Traume weiter nach.
Ganz deutlich glaubte sie alles noch vor sich zu erblicken, das süße, feine Antlitz der schönen Polin und die schwingende Glocke. Und dann hatte die schöne Brunislawa die Lippen bewegt, sie sagte etwas, doch die Worte wurden nicht laut, ihr Sprechen wurde übertönt von dem Schall der Glocke, die ein Rufen anhub, als müsse sie eine Feuersbrunst melden.
An dieser Stelle des Traumes war Elisabeth dann aufgewacht.
Sie drehte das Licht aus; sie wollte versuchen wieder einzuschlafen, was ihr auch nicht schwer ward, denn eine bleierne Müdigkeit lähmte ihr plötzlich die Glieder.
Erst spät am Morgen erwachte sie abermals. Die Sonne drängte sich durch die Läden und verriet, daß heute auf lange trübe Regenwochen ein heiterer Frühlingstag gefolgt war.
Schon neun Uhr! Elisabeth schalt sich eine Langschläferin und sprang aus dem Bett.
So schnell es ihr nur möglich war, kleidete sie sich an. In dem schmalen dunkelgetäfelten Speisezimmer wartete Fräulein Haldow schon auf sie mit dem kleinen Herbert, der seiner Mutter mit stolzem Lächeln entgegenrief, er sei schon lange auf und bereits mit dem Fräulein draußen im Park spazieren gegangen.
„Nun hat Herbert großen Hunger!“ schloß er seine Begrüßungsrede.
Elisabeth lachte und nahm am bereits gedeckten Tisch Platz. Herbert saß zwischen ihr und Ilse Haldow, die einen kleinen genußsüchtigen Blick auf die mit Marmelade und Honig gefüllten Schälchen warf. Auch die kleinen braunen Kuchen reizten sie.
Ilse Haldow beglückwünschte sich im stillen zu der angenehmen Stellung bei Frau von Valberg; so gut wie hier war es ihr lange nicht ergangen.
Ein Mädchen brachte Kaffee und Schokolade, gleichzeitig übergab sie die Post, die Elisabeth sofort nach dem Frühstück durchlas. Es handelte sich in den Briefen meist um Dinge, die sich auf das Schloß bezogen. Allerlei Lieferanten empfahlen sich der Herrin von Eckhofen.
Auch eine junge Dame, von der Elisabeth früher immer von oben herab behandelt worden war, wußte plötzlich nicht beredt genug von ihrer gegenseitigen innigen Freundschaft zu schreiben und Elisabeth empfand ein leises Ekelgefühl. So sind die Menschen, rennen dem Golde nach und preisen und rühmen die Reichen. Käufliche Freundschaft!
Elisabeth zerriß den Brief in kleine Fetzen. Dabei aber kroch die Sehnsucht in ihr hoch, ein Wesen zu besitzen, dem sie sich rückhaltlos vertrauen durfte. Seit Mutter und Gatte gestorben, war sie immer allein auf sich angewiesen gewesen. Sie hatte freilich genug damit zu tun genabt, den Unterhalt für sich und ihr Kind herbeizuschaffen, und wer kümmert sich um die Einsamkeit einer Frau, die sich ihr Brot durch Übersetzungen und Sprachunterricht verdienen mußte.
Aber diese Zeit war ja endgültig vorbei, die Fideikommißinhaberin von Eckhofen konnte jene Zeit, da Sorge und Not sie in Alltagsfrone gezwungen, vergessen, konnte sie völlig aus ihrem Gedächtnis löschen.
O, wie gut es die Sonne heute meinte. Gleich riesengroßen goldenen Segenshänden breiteten sich ihre Strahlen über die keimende, pochende Frühlingswelt. Das Wetter lockte zum Hinausgehen.
Doch gleich ließ Elisabeth diesen Gedanken wieder fallen, vorerst galt es, anderes zu tun. Sie mußte erkunden, wie die gestrige geheimnisvolle Geschichte mit der Glocke zusammenhing. Irgendwo im Schloß mußte die Glocke hängen, die Glocke, deren Klang ihren Traum in so seltsame Bahnen gelenkt.
Auf den alten Valentin aber wollte sie ein wachsames Auge haben, ihr Mißtrauen gegen ihn sollte fortan auf der Lauer liegen. Wenn sie nur erst herausgebracht hatte, ob auch andere außer ihr im Schloße den Glockenklang aus der Tiefe vernommen hatten, und ob er ihnen aufgefallen war. Ilse Haldow war die einzige Person, der sie hier nicht völlig fremd gegenüberstand. Sie hatte das junge Mädchen schon vor einigen Wochen für Herbert angenommen, gleich nachdem ihr die Gewißheit geworden, daß sie das Fideikommiß antreten durfte.
Ilse Haldow spielte mit dem Jungchen herum.
Elisabeth sah den beiden ein Weilchen zu, dann fragte sie unvermittelt:
„Sagen Sie, Fräulein Haldow, hörten Sie gestern gegen Abend auch so ein halblautes Glokkenläuten? Es muß eine alte Kirche in der Nähe sein.“
Ilse Haldows Wangen färbten sich rosiger und ein lebhaftes: „Ja, natürlich hörte ich das Läuten, gnädige Frau“, kam so überhastig über ihre Lippen, daß es fast den Anschein hatte, als sei ihr diese Frage sehr angenehm.
Etwas verblüfft meinte Elisabeth:
„Aber weshalb ist denn das so natürlich, liebes Fräulein?“
Ilse Haldow lächelte ein wenig verlegen.
„Sie haben recht, gnädige Frau, so natürlich ist das eigentlich nicht, aber ich dachte nur, weil es doch alle hörten und weil es allen auffiel — und“ — sie stockte flüchtig. Doch schnell sprach sie weiter: „Ach, Sie werden ja wohl wissen, gnädige Frau, daß die Leute auf Eckhofen behaupten, es sei gar keine wirkliche Glocke gewesen, die geläutet hat, sondern so eine Art ‚Geisterglocke‘, und eine sehr schöne Polin, die vor länger als hundert Jahren hier auf Eckhofen wohnte, soll diese Geisterglocke läuten. Und wenn man die Glocke höre, dann nahe Eckhofen ein Unheil und —“
„Halten Sie ein, bitte“, Elisabeth sagte es ruhig und freundlich, „den Unsinn trug man mir auch schon zu. Wer aber teilte Ihnen das alles mit?“
„Die Wirtschafterin Frau Berger, die schon seit mehr als dreißig Jahren ihre Stellung im Schlosse inne hat“, erwiderte Ilse Haldow. Wie entschuldigend setzte sie hinzu: „Ich plauderte gestern ein bißchen mit ihr, und da wir so beisammen standen, fing eine Glocke an zu läuten. Ich achtete kaum darauf, aber ich bemerkte, daß Frau Berger kreidebleich wurde, und als ich mich teilnehmend erkundigte, was ihr sei, berichtete sie mir, was man sich im Schlosse und in der hiesigen Gegend von der Glocke erzähle. Sie war sehr erregt und flog an allen Gliedern, und als ich sie wegen ihres Aberglaubens auslachte, wurde sie ganz zornig, so daß ich mich entschuldigen mußte, weil ich es doch nicht mit der netten freundlichen Frau verderben wollte.“
„Führte Frau Berger denn irgendeinen Beweis für die von ihr gemachte abergläubische Behauptung an?“
Ilse Haldow neigte den Blondkopf und Elisabeth fiel es auf, wie prachtvoll das üppige Haar des jungen Mädchens leuchtete, wenn die Sonnenstrahlen so wie eben jetzt darüberhin spielten.
Wirklich, wie reich und prächtig dieses Haar war! Elisabeth vermochte den Blick gar nicht von dem von Flimmerstrahlen verklärten Mädchenhaupte zu lösen.
Ilse Haldow gab Antwort auf die letzte Frage der Herrin.
Eine kleine Wichtigkeit blähte sich dabei in ihrer Stimme.
„Gewiß führte Frau Berger Beweise an, und das machte mich auch ein wenig stutzig. Sie erklärte mir nämlich allen Ernstes, als sie zum ersten Male die Glocke gehört, wäre ein großes Hochwasser hereingebrochen, das auch Eckhofen stark heimgesucht, und das zweitemal sei wenige Tage nach dem Läuten der Glocke der Sohn des Barons Christian von Gaudenz am Herzschlag gestorben, und er hätte sich doch noch kurz zuvor gesund und vergnügt seines Lebens gefreut.“
Elisabeth dachte: Aha, dieselbe Geschichte, die mir der alte Valentin auftischte.
Sie erwiderte nichts, aber sie war nun überzeugt: Valentin und die Wirtschafterin spielten gemeinsam vorher verabredete Rollen. Wahrscheinlich, um ihr Eckhofen verleiden, doch verfolgten sie möglicherweise auch einen anderen Zweck.
„Herbert möchte auch Glocke suchen“, schrie ihr Junge entzückt auf.
Elisabeth mußte lachen, sie beruhigte den lebhaften Kleinen und lenkte seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge.
Ein Stündlein danach machten sich Frau Elisabeth und Ilse Haldow auf die Suche. Herbert spielte indes im Kinderzimmer unter der Obhut eines Mädchens.
Als die junge Witwe so neben ihrer Begleiterin durch die langen Gänge schritt, fiel ihr der Traum der letzten Nacht ein, mit geradezu plastischer Deutlichkeit sah sie alles im Traume Erlebte vor sich.
Sie weilte erst wenig über eine Woche im Schlosse, kannte die darin enthaltenen Räumlichkeiten nur flüchtig und doch hatte sie jetzt das Empfinden, ganz genau Bescheid zu wissen. Ihr war es, als sei der Weg aufs genaueste vorgeschrieben. Heute nacht im Traume hatte sie all diese Gänge und Treppen so deutlich gesehen, daß sie ihr jetzt wie etwas lange Vertrautes vorkamen.
Ilse Haldow zeigte auf ein großes, so stark nachgedunkeltes Bild, daß die Umriße des Gemalten fast verschwammen. Es hing an der Wand, wo der Gang mit einer scharfen Biegung auf eine Steintreppe einmündete.
Elisabeth beachtete das Bild kaum, sie wußte, sie hatte es niemals vordem betrachtet, es war ihr fremd, und doch konnte sie dem jungen Mädchen erklären, das Gemälde stelle eine mittelalterliche Jagd dar. Sie beschrieb einige Einzelheiten genau, Einzelheiten, die erst bei ganz eingehender Betrachtung hervortraten.
„Wenn Sie mir die Figuren nicht erklären würden, gnädige Frau, wäre mir ein Erkennen beinahe nicht möglich, nun sehe ich freilich alles ganz deutlich“, sagte Ilse Haldow im Weiterschreiten.
Elisabeth dachte staunend, daß sie das Bild ja nur aus ihrem Traume so genau kannte.
Wie ein Bann überfiel es sie.
Man stieg die Steintreppe hinab und Elisabeth erinnerte sich, im Traume eine geschnitzte Engelsfigur am Ende der Treppe aufgestellt gesehen zu haben. Der eine Flügel war abgebrochen. Im gleichen Augenblick machte Ilse Haldow sie darauf aufmerksam.
Elisabeth stutzte, wahrlich, der Traum war noch seltsamer gewesen, als er ihr schon am Morgen erschienen.
Aber gleich rief sie sich selbst zur Ordnung.
Es war wohl alles Unsinn, sie hatte wahrscheinlich in den ersten Tagen ihres Schloßaufenthalts sowohl das alte Bild wie den hölzernen Engel gesehen. Vielleicht hatte ihr sogar jemand das Bild erklärt; in den ersten Eckhofener Tagen hatte sie so viele neue Eindrücke in sich aufnehmen müssen, daß sie jetzt nur wie in einem Unterbewußtsein wach waren.
Darum verwechselte sie Traum und Wirklichkeit.
Natürlich verhielt es sich so.
Sie sah jetzt nicht, wovon sie in dieser Nacht geträumt hatte, sondern sie hatte einfach geträumt, was sie schon vorher gesehen. Wie klar das lag.
Und doch so ganz heimlich widerstritt ein Etwas in ihr und raunte: Du willst nur dem Übersinnlichen keine Zugeständnisse machen, aber diesen Gang, auf dem das nachgedunkelte Bild hängt, und diese Treppe, an deren Fuß der hölzerne Engel wacht, hat dein Fuß niemals vordem betreten!
Sie wußte nicht, wohin sie nun gelangte, ein schmaler Gang führte ein Stückchen nach rechts, dort bog er ein.
Elisabeth hätte dennoch darauf schwören mögen, es befinde sich gleich um die Ecke herum eine niedrige eisenbeschlagene Tür.
Im Traume war sie durch diesen Gang und eine derartige Tür geschritten. Eine schier übermächtige Spannung nahm von ihr Besitz, ob sich wirklich um die Biegung des Ganges eine solche Tür fand.
Ihr Schritt war eiliger. Einen Augenblick später mußte sie sich gewaltsam zusammennehmen, damit kein Laut des Staunens, der Verwunderung ihrem Munde entschlüpfte, denn sie stand vor einer niedrigen, mit eisernem Schnörkelwerk beschlagenen Tür. Das war die Tür, die sie schon im Traum gesehen, aber niemals in Wirklichkeit, jeden Eid hätte sie darauf ablegen mögen.
Ilse Haldow verhielt ebenfalls den Schritt.
„Das sieht ja wie eine Kirchentür aus“, sagte sie halblaut, unwillkürlich in den gedämpften Ton verfallend.
Elisabeth nickte.
„Es wird ein Nebeneingang zur Kapelle sein“, erwiderte sie im gleichen Tone und drückte die leicht vom Rost angefressene Klinke nieder.
Die Tür öffnete sich mit schwachem unangenehmem Kreischlaut. Nach dem Durchschreiten eines kleinen dämmerigen Gemachs, der Sakristei, tat sich der Blick in die von strahlender Morgensonne erfüllte Schloßkapelle auf.
Die beiden Frauen traten ein.
Wunderbar stimmungsvoll war die kleine Kapelle. Altar und Kanzel zeigten auffallend schöne Schnitzerei und die Wände waren mit lebendig wirkenden Darstellungen aus der biblischen Geschichte bemalt. Köstliche breite Spitze umrandete die Altardecke und schwere Silberleuchter standen darauf.
Elisabeth war schon einige Male in der Kapelle gewesen, hatte sich über die reiche harmonische Ausschmückung gefreut, heute aber fiel ihr alles viel schärfer ins Auge. Kam das daher, weil ihr der alte Valentin erzählt hatte, die Polin Brunislawa habe besonders viel für die Kapelle getan? Kam es daher, weil sie das Bild der schönen Polin gesehen und weil man deren Person, die doch nun schon so lange tot war, mit der geheimnisvollen Glocke in Verbindung brachte?
Die junge Frau machte ihre Begleiterin auf die alten Kirchenstühle aufmerksam, auf deren hohen Lehnen je zwei geschnitzte Eulen hockten.
„Die Eule ist das Wappentier der Familie Gaudenz“, erklärte Elisabeth dem jungen Mädchen und ihre Hand wies, dabei die Worte dadurch zugleich noch näher erläuternd, auf ein links vom Altar angebrachtes, in Stein gehauenes großes Wappen. Da saßen die zwei Eulen auf einem schrägen Ast und unter dem Ast war eine geballte Reiterfaust zu sehen.
Ilse Haldow fühlte einen kleinen Ehrfurchtsschauer an sich niederrieseln. Wie hübsch das sein mußte, sich so ein vornehmes Wappen in die Wäsche sticken, es auf die Briefbogen prägen zu dürfen.
Ein schwaches Fünkchen Neid entglomm in ihr.
Weshalb war sie als das Kind eines „kleinen“ Beamten geboren; schön genug war sie wahrlich, ein Wappen ihr eigen zu nennen und ein Krönlein darüber.
Elisabeth war der Schatten, der das rosige feine Gesicht Ilse Haldows wie eine rasche Wolke überzog, nicht entgangen.
„Fehlt Ihnen etwas, liebes Fräulein?“ fragte sie gütig.
Die Angeredete erschrak leicht. Zu dumm, daß man ihr die Gedanken beinahe von der Stirn zu lesen vermochte. Sie mußte also besser Obacht geben.
Sie lächelte ihr ruhig bescheidenes Lächeln, ein Lächeln, das alle stolzen, hochfahrenden Wünsche und Gedanken nach außen hin gleich einer festen Schutzwand hinter sich barg.
„Nein, gnädige Frau, mir fehlt nichts, ich dachte nur eben, wo wir wohl am besten nach der Glocke fahnden können, denn hier in der Kapelle befindet sie sich sicher nicht.“
Elisabeth schüttelte den Kopf.
„Nein, in der Kapelle befindet sie sich nicht; damit rechnete ich natürlich; denn was allen Augen sichtbar ist, gibt selten Anlaß zu abergläubischen Redereien.“ Sie machte eine kurze Pause des Nachdenkens. „Wenn die Glocke sich überhaupt im Schlosse befindet, so müssen wir uns darauf gefaßt machen, daß wir sie keineswegs so schnell finden. Ich schlage vor, wir steigen zuerst einmal in die Gruft hinab; ich bin noch nicht darin gewesen, weiß also nicht, ob das Hinuntersteigen so einfach ist. Dort unter dem kleineren Wappen hinter dem breiten Gobelin verbirgt sich die Tür, die zur Gruft führt.“
Elisabeth wußte das von dem Schloßverwalter, der ihr am Tage ihrer Ankunft alles Wissenswerte gezeigt und erklärt hatte.
In Elisabeth wurde wieder das Traumbild dieser Nacht lebendig und eine mit einem kleinen prikkelnden Schauer gepaarte Neugier war in ihr, da sie den Wandteppich, der in warm und leuchtend erhaltenen Farben die Kreuzigungsgruppe zeigte, zurückzog. Eine sehr breite, doch niedrige Tür ward den Blicken frei: sie öffnete sie lautlos, die Riegel und Scharniere mußten erst vor kurzem gründlich geölt worden sein. Man sah eine steinerne Wendeltreppe, über die ein feines Dämmern seine hellgrauen Netze hinspann, die sich nach unten zu einer immer dunkleren Färbung verdichteten.
Elisabeth wiegte den Kopf nachdenklich hin und her.
„In der Gruft scheint es sehr finster zu sein, ohne Licht können wir nicht hinuntersteigen.“
Ilse Haldow bückte sich schnell und hob Elisabeth triumphierend eine Laterne entgegen, in der sich auch eine Schachtel Streichhölzer befand. Die Laterne hatte in einer schmalen Mauernische gestanden und stand dort wohl immer bereit, falls jemand beabsichtigte, den Toten von Schloß Eckhofen einen Besuch abzustatten. Ilses scharfe Jungmädchenaugen hatten entdeckt, was Frau von Valberg übersehen.
Schon strich Ilse ein Streichhölzchen an und gleich darauf brannte die dicke Wachskerze in dem gläsernen Behälter. Die Laterne in der erhobenen Rechten, ging das junge Mädchen voran und leuchtete der ihr folgenden Herrin. Schweigsam stiegen beide die Treppe hinab.
Bald befanden sie sich in einem großen kellerartigen Raum, dessen weißgetünchte Wände sich ausnahmen wie schneeige, straffgespannte Leinentücher. Ein paar welke Kränze hingen dort.
Das waren die ersten Eindrücke der beiden Frauen; dann aber hoben sich aus dem Dunkel die Umrisse von Särgen, die in ordentlicher, schnurgerader Linie nebeneinander standen.
Wie verirrt und ängstlich flog der Laternenschein darüber hin, und das Kerzenflämmchen wand sich wie in heimlicher Furcht. Ein großer steinerner Sarkophag schälte sich aus dem Dunkel und Elisabeths Hand zuckte unwillkürlich nach dem Herzen. Auch diesen Sarkophag hatte ihr der Traum der vergangenen Nacht gezeigt.
Sie strich mit leise bebenden Fingern über die Augen. Sie fürchtete beinahe, nun auch wie im Traume durch den festen Stein hindurchschauen zu können.
Endlich wagte sie, mit zwinkernden Lidern hinzusehen — dann stahl sich ein Lächeln um ihre Lippen. Stein war Stein, kein Menschenauge vermochte ihn zu durchdringen. Über dergleichen wunderbare Kräfte verfügt man höchstens im Traume.
Nun wagte sie es auch, dicht an den Sarkophag heranzutreten. Über die ganze Oberfläche hin zogen sich tief eingemeißelte lateinische Worte.
Elisabeth Valberg beschwor im Geiste das Bild der schönen Frau herauf, deren Sarg man einstens unter der steinernen Hülle geborgen. Blondes Haar glänzte, dunkle Augen, yon dem warmen Strahl inniger aufrichtiger Menschenliebe erwärmt, leuchteten wie stille heilige Flammen.
„Ich habe ein Bild der Brunislawa gesehen“, sagte sie flüsternd zu Ilse Haldow, „und denken Sie, nun fällt es mir eben auf, daß Sie ihr sehr ähneln.“ Elisabeth wunderte sich selbst über die Entdeckung, die sie in diesem Augenblick gemacht.
Ilse hob den Kopf mit einer kleinen, gefallsüchtigen Bewegung, sie hatte ja schon vernommen, die Polin sollte schön gewesen sein.
„Hier in der Gruft finden wir auch sicher keine Spur von der Glocke“, meinte die junge Witwe nach einer Weile halb zu sich selbst. Es mußte aber noch viele Keller im Schlosse geben, in irgendeinem davon hing wohl die Glocke.
Fast komisch kam ihr mit einem Male das Suchen vor.
Das beste und einfachste war es, zunächst dem alten Valentin und der Haushälterin scharf auf die Finger zu sehen und die Entdeckung der Zeit und dem Zufall zu überlassen. Planten diese beiden im Dienste des Schlosses altgewordenen Dienstboten irgendeinen Streich gegen die neue Herrin, so würden sie sich selber verraten. Es galt nur, gut Obacht zu geben.
Die dumpfe Luft in dem Gruftgewölbe verursachte Elisabeth Kopfschmerz. Sie wandte sich an ihre Begleiterin.
„Wir wollen wieder zur Oberwelt hinaufsteigen“, sagte sie und schritt auf die Treppe zu.





























