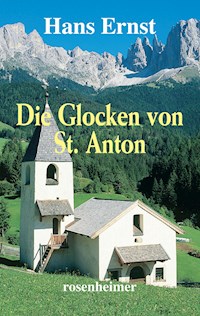
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach nur wenigen glücklichen Ehejahren verliert Lena durch einen tragischen Unfall den geliebten Mann. Tapfer schlägt sie sich durch, verzichtet um ihrer fünf Kinder willen auf eine neue Liebe und muss dennoch erleben, dass diese, kaum erwachsen, ihr Lebensglück allein suchen und dabei manchen Irrweg gehen, bis schließlich alle – mit einer Ausnahme – geläutert und gereift heimfinden zum Herzen ihrer Mutter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2000
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelbild: Michael Wolf, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54736-2 (epub)
Worum geht es im Buch?
Hans Ernst
Die Glocken von St. Anton
Nach nur wenigen glücklichen Ehejahren verliert Lena durch einen tragischen Unfall den geliebten Mann. Tapfer schlägt sie sich durch, verzichtet um ihrer fünf Kinder willen auf eine neue Liebe und muss dennoch erleben, dass diese, kaum erwachsen, ihr Lebensglück allein suchen und dabei manchen Irrweg gehen, bis schließlich alle – mit einer Ausnahme – geläutert und gereift heimfinden zum Herzen ihrer Mutter.
Es war ein Abend im Spätherbst. Über dem kleinen See in der Tiefe kam schon Nebel auf. Aber auf allen Hügeln lag noch warmes Licht. Vor einer Weile noch hatte Lena mit den Kindern hinter dem kleinen Häusl am Grottenberg gesessen. Sie hatten zugesehen, wie langsam hinter den Bergen die Sonne verschwand. Dann war etwas Wind aufgekommen und sie hatten sich auf die Hausbank gesetzt, wo es geschützt war.
Der Garten stand im Schmuck seiner Blätter da wie ein flammendes Wunder. Zuweilen fiel ein vergessener Apfel klatschend ins Gras. Dann machte die Ziege ein paar erschrockene Sprünge, sodass das Glöcklein an ihrem Hals lustig bimmelte.
Die Lena hob die kleine Franziska vom Boden auf und nahm sie auf den Schoß. Sie wollte nun ins Haus gehen, aber die Kinder bettelten, dass sie noch weitererzähle. Das vom Paradies hatten sie heute noch nicht gehört. Da war doch noch diese Sache mit dem Apfel.
»Ja, also, von allen Bäumen des Gartens hätten die ersten beiden Menschen essen dürfen, nur von einem Baum nicht. Trotzdem taten sie es. Die Frau gab dem Mann einen Apfel vom verbotenen Baum und er aß ihn.«
»Er wird halt Hunger gehabt haben«, meint die fünf Jahre alte Johanna und der Thomas, ein paar Jahre älter, wollte wissen, um was für einen Apfel es sich dabei gehandelt habe. Um einen Klarapfel oder um einen Boskop?
»Es war ein rosenroter Apfel«, behauptete Maximilian, der im April des Jahres acht Jahre geworden war. Niemand bestritt das, denn der Maximilian kannte sich mit den Apfelsorten am besten aus. Nur Ludwig, der am Türrahmen lehnte, verzog hochmütig den Mund.
Nun wäre noch vom flammenden Schwert zu erzählen gewesen und von der Austreibung aus dem Paradies, aber da kam der Vater die Treppe herauf und die Kinder liefen ihm entgegen.
Christian Erler war ein großer, beinahe hünenhafter Mann voll Kraft und Saft wie ein Baum im Wald. Niemand hatte es seinerzeit recht begreifen können, dass er die arme Lena Prechtl geheiratet hatte. Aber er hat es bis zum heutigen Tag noch nicht bereut. Das Glück war in dem kleinen Häusl am Grottenberg ein ständiger Gast. Die Lena war tüchtig wie keine zweite und die Kinder wuchsen alle gesund und verlässlich heran.
Nur hatten sie wenig von ihrem Vater, denn Christian Erler war Bierfahrer in der Adlerbrauerei und verließ jeden Tag schon gegen vier Uhr morgens das Haus. Seine Heimkehr am Abend war dann jedesmal ein Fest für die Kinder. Da hatten sie ihn ein paar Stunden ganz für sich allein, und er wurde nicht müde, ihre vielen Fragen zu beantworten. Das dauerte so lange, bis der Vater aufstand und behutsam die beiden Gewichte der Kuckucksuhr hochzog. Für die Kinder war das ein Zeichen, dass sie zu verschwinden hatten, ohne jeden Widerspruch, denn trotz aller Freundlichkeit war der Vater streng. Lagen sie dann im Bett, trat er nochmals an jedes heran und strich mit seiner schweren Hand behutsam über ihre Köpfe. Dann geschah es zuweilen, dass die Johanna die streichelnde Hand einfing und an den Fingern zog, bis es im Knöchel knackte. Darüber konnte sie dann herzlich lachen. Heute aber lag ihr etwas anderes auf dem Herzen.
»Vater, der Maximilian sagt, es sei ein rosenroter Apfel gewesen.«
»Was für ein Apfel?«
»Der, den die Eva im Paradies dem Adam geschenkt hat. Ist es wirklich ein roter gewesen – und ein süßer vielleicht?«
»Süß wird er wohl gewesen sein«, meint der Vater.
»Wenn es ein Mostapfel gewesen wäre, dann hätte der Mann vielleicht nicht hineingebissen, und sie hätten im Paradies bleiben dürfen«, stellt Johanna fest.
Nun löschte der Vater das Licht und ging wieder in die Wohnstube. »Das Dirndl«, sagte er und griff dabei nach seiner Pfeife, die auf der Kommode lag, »das Dirndl hat eine wache Phantasie. Was die alles wissen will!« Er zündete sich die Pfeife an, riss dann ein Blatt vom Kalender ab und starrte das Datum an. Es war der 28. Oktober. Sehr lange schaute er darauf und seine Stirn krauste sich.
Da erhob sich die Frau, trat neben ihn und legte ihre Hand auf seine Schulter. Lena war sehr groß und doch reichte sie diesem Hünen nur bis an die Schulter.
»Mach dir doch nicht immer Gedanken, Christian! Wer weiß, vielleicht überlegt es sich der Adlerbräu doch noch anders.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Er hat mir erst heute wieder gesagt, es ist ganz sicher, dass am 1. Januar ein Lastwagen da sein wird.«
»Na ja, wenn schon, deswegen wirst auch noch Arbeit haben in der Brauerei. Hast du nicht gefragt, ob du dann Mitfahrer werden kannst?«
Christian nickte schwer und schaute seiner Frau in die Augen. Ja, seine Lena fand immer das rechte Wort, das ihn tröstete. Vielleicht verstand sie auch nicht ganz, worum es ging. Fünfzehn Jahre fuhr er nun schon mit dem schweren Bierwagen über Land. Hier in der Berglandschaft erschien es ratsam an diesem Transportmittel länger festzuhalten als anderswo. Außerdem hing Christians Herz an den Pferden. Und nun sollte das alles bald nicht mehr sein. Die fortschreitende Technik schluckte alle alten Bräuche auf. Zuerst war der Postillion drangekommen. Ein breiter, gelber Kasten fuhr jetzt mit viel Motorengeräusch dreimal täglich um den See herum und dann weiter zur Kreisstadt, die an der Bahn lag. Und nun sollte er mit seinem Bierfuhrwerk drankommen.
Aber – die Frau hatte Recht, es hatte keinen Zweck, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Das Leben ging weiter. Es war ja ein Glück, dass er diese tapfere, nie pessimistische Lena hatte. Sie lehnte sich jetzt an ihn; es sollte für ihn ein Trost sein; sie wollte ihm zeigen, wie sehr sie ihm verbunden war. Vielleicht war aber auch der Wunsch nach einer kleinen Zärtlichkeit in ihr, und darum legte Christian jetzt seine Pfeife weg und nahm die Frau fester in die Arme. Das geschah nicht oft. Aber immer in solchen Stunden erkannten sie neu, was sie einander waren und dass ihre Liebe wie ein still glühendes Feuer war, das nie erlosch.
Draußen stand die Nacht vor den Fenstern und der Wind fuhr um die Ecken des Hauses. Einmal hörte man das Glöcklein der Ziege vom Stall hereinbimmeln. Dann war es wieder still.
Der Winter war streng in diesem Jahr. Selbst die ältesten Leute von St. Anton konnten sich nicht erinnern, dass der See einmal zugefroren war. In diesem Jahr aber geschah es und nach dem Dreikönigstag war die Eisschicht auf dem See so dick, dass die schwersten Fuhrwerke darüber fahren konnten. Das war eine große Zeitersparnis, vor allem für die Langholzfuhrwerke, die die schweren Stämme aus dem Bergwald zur Bahnstation zu bringen hatten. Sie mussten nun nicht mehr um den See herumfahren.
Um vier Uhr in der Früh stand Christian Erler fertig angezogen in der Haustür. Hell funkelten die Sterne über den Bergen. Er wollte die Haustür schon hinter sich zuziehen, da besann er sich nochmals und trat zurück in die Schlafkammer.
»Hast du was vergessen, Christian?«, fragte Lena im Halbschlaf. Er sagte nichts, sondern legte nur seine Wange an ihre Stirn. Es war ein wenig seltsam, denn – hatte er nicht vorhin schon gesagt: »Mach’s gut, Lena! Bis um drei Uhr nachmittags bin ich heut zurück.« Und dabei hatte er sie geküsst wie jeden Morgen. Und er hatte auch die schlafenden Kinder gestreichelt, ganz behutsam, damit sie nicht erwachten. Jetzt tat er es wieder.
Dann aber ging er endgültig und schritt hinaus in die klare Nacht. Lena hörte, wie sein Schritt knirschte, dann fielen ihr wieder die Lider zu.
Der Mann hatte es nun eilig. Etwa hundert Meter vom Haus weg führten eingehackte Stufen mit einem Holzgeländer den Steilhang hinunter ins Städtchen. Wo dann die Bäume plötzlich aufhörten und der Weg sich scharf nach links wand, blieb Christian Erler stehen und hob das Gesicht. War es nicht, als hätte ihn aus der Tiefe ein warmer Wind gestreift? Aber nein, das mochte wohl eine Täuschung gewesen sein. Ringsum war klirrender Frost. Ich bin zu warm angezogen, dachte er und ging weiter.
Der Weg wand sich jetzt in Serpentinen abwärts. Ruhig und verschlafen lag das Städtchen St. Anton da. Nur hin und wieder sah man in dieser frühen Stunde einen Lichtschein hinter einem Fenster. Dick und steif lag der Schnee auf den Dächern, die aussahen, als trügen sie weiße Pelzkappen. Nur der Brauereischornstein und der Kirchturm ragten aus dieser weißen Decke heraus und bohrten sich in den Nachthimmel.
Als Christian Erler den Stall betrat, wandten die beiden Rotschimmel die Köpfe und wieherten ihm entgegen. Da blieb er wie angewurzelt stehen, und es war ihm, als greife etwas Schmerzliches an sein Herz. Es war heute das letzte Mal, dass die beiden schweren Rotschimmel die Bierfuhre aus dem Brauereihof und über Land ziehen sollten. Der neue Lastwagen stand bereits in der Garage und sollte morgen das erste Mal ausfahren. Die Pferde waren bereits verkauft.
Das alles legte sich jetzt Erler schwer aufs Herz. Die Pferde rieben ihre rosigen Nüstern an der Schulter des Mannes, als er jetzt in den Stand trat und das Futter vorwarf. Viel Hafer tat er diesen Morgen hinein. Zur Henkersmahlzeit wollte er seinen beiden Kameraden noch reichlich geben. Er bürstete sie, dass ihr Fell wie Seide glänzte. Dann holte er die besten Geschirre aus der Kammer, steckte an jeden Halfter ein paar zarte Papierröschen und etwas Grünes, weil diese letzte Fahrt doch nicht so alltäglich sein sollte.
Kurz vor sechs Uhr spannte Christian die Rotschimmel vor den Bierwagen, auf den schon pyramidenförmig die schweren Fässer geladen waren. Über dem Bräuhaus lag der süßliche Geruch von Hopfen und Malz. Die große Bogenlampe brannte und erhellte den Hofraum fast taghell. Die Rotschimmel scharrten mit ihren schweren Hufen ungeduldig auf dem Pflaster, aber Christian Erler überprüfte nochmals an Hand des Lieferzettels die Ladung auf Vollständigkeit; dann nahm er die Zügel, knallte mit der Peitsche und fuhr aus dem Hof.
Durch diesen Knall erwachte Margaret Schweikert, die Adlerbräuin, wie jeden Morgen. Sie sagte immer, so ein Peitschenknallen sei ihr lieber als das Rattern eines Weckers. Auf alle Fälle sei es verlässlicher, denn in den zwanzig Jahren ihres Hierseins sei es noch nie vorgekommen, dass ein Fuhrknecht später als um sechs Uhr aus dem Hof gefahren wäre.
Margaret Schweikert gähnte herzhaft und blinzelte gegen die Helligkeit ihrer Nachttischlampe. Ihr Mann, der Adlerbräu, stand am Fenster und sah dem Gefährt nach, das sich ächzend durch das gewölbte Tor bewegte, auf dem als Wahrzeichen des Bräuhauses ein Adler mit gespreizten Flügeln in Stein geschlagen war.
»Komm her, Margaret«, sagte Michael Schweikert. »Sieh dir das noch einmal an, es ist das letzte Mal, dass du es erlebst.«
Margaret sprang aus dem Bett und stellte sich neben ihren Mann ans Fenster. Das Schellengeläute klingelte fröhlich über den Hof, die hellen Mähnen der Pferde flatterten im Morgenwind. Christian knallte mit der Peitsche, aber es klang heute beinahe wie eine zornige Auflehnung. Nun verschwand das Fuhrwerk hinter der Mauer des Sudhofes.
»Ja«, meinte Margaret, »es tut einem fast Leid, dies nun nicht mehr zu sehen. Aber man kann es nicht ändern.«
»Wir haben sowieso schon lange gewartet«, antwortete der Adlerbräu. »Der Kreidererbräu hat schon seit zwei Jahren Lastwagen laufen.«
Währenddessen fuhr Christian Erler durch das schlafende Städtchen. Lautlos glitt das schwere Gefährt auf den Schlittenkufen durch die Hauptstraße und über den Marktplatz. Nur die Schellen an den Geschirren hörte man. Für einen Augenblick sah Christian aus der geöffneten Kirchentür den rötlichen Schein des Ewigen Lichtes schimmern. Der Mesner war gerade eingetreten, um den Morgengruß zu läuten. Beim Kotter-Bäcker trat der Altgeselle aus der Backstube und steckte dem Bierfuhrmann drei frische Semmeln zu, die Christian hinter den Latz seines Lederschurzes schob. Meist brachte er sie am Abend den Kindern mit heim.
»Was ist, bricht die Kälte?«, fragte Christian den Bäcker. Der hob fröstelnd die Schultern. Ihn fror es in der dünnen Bäckerbluse. An ein Brechen der Kälte sei nach seiner Meinung noch nicht zu denken.
Dann fuhr Christian weiter und bog hinterm Seiler Arnstätter in das schmale Gässchen ein, das zum See hinunterführte. Am Ufer hielt er das Gefährt erneut an.
Vom Turm der Pfarrkirche von St. Anton läutete es den Morgensegen. Christian Erler hob lauschend den Kopf. Schwangen die Töne nicht direkt auf ihn zu? Hatte sich der Wind gedreht?
Er blies seinen Atem in die Luft, aber er sah nicht, wohin er sich bewegte, weil völlige Dunkelheit um ihn war. Vielleicht ging überhaupt kein Wind? Das Schilfrohr stand unbeweglich.
Christian Erler ließ das Fuhrwerk stehen und betrat das Eis auf dem See. Die Eisdecke war dick und fest wie in den Tagen zuvor. Undeutlich sah man im Dunkeln die Spur der Gespanne, die am Abend vorher noch herübergekommen waren.
Die Morgenglocke läutete aus, es ächzte noch ein wenig im Turm, dann wurde es still. Da nahm Christian Erler den Sattelgaul am Halfter und fuhr auf das Eis hinaus.
Das Eis war kristallklar und klang unter den Hufen der Pferde. In den Bauernhöfen ringsum brannten jetzt überall die Lichter. Auch jenseits des Sees, im Dorf Tiefental, wurden immer mehr Fenster hell.
Aber auf einmal, mitten auf dem See, wurde Christian von einer warmen Windwelle gestreift. Durch den offenen Taleinschnitt strömte sie nun ungehindert von den Bergen nieder.
Heimwärts werde ich nicht mehr über den See fahren können, dachte Christian noch und hatte unmittelbar darauf einen solchen Schreck, dass er glaubte, sein Herz stünde still. Was war das? Hatte sich die Eisdecke bewegt? Hatte es nicht dicht vor ihm einen kurzen, scharfen Knall gegeben?
Das Gesicht des Mannes verfärbte sich, seine Augen starrten schreckgeweitet in die Dunkelheit. Hastig griff seine Hand in die Zügel. Das Gefährt stand mit einem Ruck. Aber nun hatte auch schon die Pferde eine ängstliche Unruhe ergriffen. Als ob sie eine bevorstehende Gefahr ahnten, stießen sie erregt den Atem aus den geblähten Nüstern.
Es gab jetzt keinen Zweifel mehr. Die Eisdecke bewegte sich. Da – nun krachte es wieder, laut und scharf, wie wenn ein Baum stürzt. Eine unheimliche Ruhe überkam jetzt den Mann. Mit kalter Entschlossenheit versuchte er, das Gefährt nach hinten zu drücken. Aber die Eisdecke senkte sich – senkte sich unerbittlich.
Vielleicht hätte Christian Erler sich selbst noch mit ein paar Sprüngen retten können. Wer weiß es? Für einen Augenblick hatte er sich mit seiner Jacke am Geschirrzeug verheddert.
Da brach das Eis ein.
Im letzten Zurückschauen sah Christian noch auf dem Grottenberg einen Lichtschein aufleuchten. Nun war Lena aufgestanden.
»Lena …! Lena …!«, schrie er. Dann ließ das eiskalte Wasser seinen Mund für immer verstummen. Kurz läuteten noch einmal die Schellenglocken an den Pferdegeschirren auf, dann sank das ganze Gespann mit seinem Fahrer in die unbarmherzige Tiefe. Weit und breit herrschte eine unheimliche Stille.
Um diese Zeit begann es zaghaft zu dämmern. Die Sterne erloschen, und als der alte Seiler von St. Anton aus dem Haus trat, um in die Frühmesse zu gehen, sah er weit draußen auf dem See einen kleinen dunklen Fleck im Eis.
Immer heller wurde es. Die Lichter von St. Anton erloschen, die Läden wurden geöffnet, der Kaufmann Bernhard Holzweber trat in die Ladentür und grüßte den Notar, der gerade in sein Amt ging.
»Wünsch recht guten Morgen, Herr Notar! Es scheint, die Kälte will brechen?«
»Allerdings, das Barometer fällt noch immer. Aber bis man in unserem Eiswinkel hier etwas merkt, wird es Mittag. Zwar – auf dem See draußen sah ich vorhin einen dunklen Fleck.«
Holzweber ging in seinen nach hinten gelegten Garten und schaute auf den See hinaus. Wirklich, in der Mitte war das Eis schon gebrochen. Nur gut so, die Kälte war auf die Dauer gar nicht gemütlich.
Das Leben im Städtchen erwachte vollends, aber man war noch ganz ahnungslos von dem, was sich zwischen Nacht und Morgendämmerung auf dem See draußen abgespielt hatte.
Ahnungslos stand auch Michael Schweikert, der Adlerbräu, vom Frühstückstisch auf, zündete sich seine Morgenzigarette an und trat an das große Fenster. Die Kinder gingen gerade zur Schule; der Sparkassenangestellte Eberl kam mit einer Mappe unterm Arm aus dem Schützengässchen heraus.
»Was ich sagen will, Margret«, sagte der Bräu und ließ den Rauch seiner Zigarette kunstvoll gegen die Decke wandern. »Dem Eberl müsst ihr mittags größere Portionen hinstellen. Der wird ja jeden Tag dürrer. Oder isst er so wenig?« Dann wurden seine Augen plötzlich schmal und er nahm einen Zug von der Zigarette. »Margret, komm schnell her! Was ist denn da draußen? Ist das Eis gebrochen?«
Margaret stellte sich neben ihn ans Fenster.
»Es scheint so zu sein. Natürlich, man sieht ja den schwarzen Fleck in der Mitte des Sees. Nun ist es wieder vorbei mit dem Schlittenfahren auf dem See.«
»Ja, das ist für heuer wohl vorbei. Der Erler wird doch hoffentlich –« Schweikert verstummte jäh und wechselte die Farbe. »Mein Gott, der Erler wird doch nicht –?«
»Was meinst du, Michael?«
Er gab keine Antwort mehr, sondern stürzte ans Telefon und rief den Postwirt von Tiefental an.
»Hör mal, Andreas – um welche Zeit ist heut mein Bierfuhrwerk bei dir gewesen? Nein – der Lastwagen fährt doch erst ab morgen. Den Erler meine ich. Waaas? Bis jetzt noch nicht –? Allmächtiger Gott! Dann muss etwas passiert sein. Das Eis auf dem See ist nämlich gebrochen.«
Margaret kam auf ihren Mann zugestürzt.
»Michael! Um Gottes willen! Du willst doch nicht sagen –«
»Ich will gar nichts sagen, aber ich mache mich auf das Schlimmste gefasst. Ich brauche sofort meine festen Winterstiefel!«
Wenige Minuten später stand Michael Schweikert unten am Seeufer. Bei ihm stand der Fischer Gabriel, und auf einmal kamen immer mehr Leute zusammen. Es war eigentlich noch kein Wort gefallen, aber die Demmel-Kramerin sagte plötzlich vernehmlich:
»Sünd und schad um die schönen Pferde!«
Da drehte der Adlerbräu das bleiche Gesicht über die Schulter.
»Halt ’s Maul! Mir geht es jetzt nicht um die Pferde, sondern um ein Menschenleben.«
Darauf sahen sie alle mit scheuen Blicken hinauf zum Grottenberg, zum Häusl der Familie Erler, während der Adlerbräu mit energischen Handbewegungen dem Fischer erklärte, was nun geschehen müsse. Ein paar beherzte Burschen trugen bereits den Kahn aus dem Schuppen. Sie befestigten ihn auf zwei kleinen Rodelschlitten. Herr Schweikert stieg mit einem Burschen ein. Ein dritter schob hinten nach; dieser sollte sich sofort in den Kahn schwingen, wenn das Eis bräche. Aber hier auf der Schattenseite war das Eis noch stark.
Verhältnismäßig schnell schob sich das eigentümliche Gefährt immer weiter in den See hinaus. Stumm und scheu standen die Menschen am Ufer. Nur die Demmel-Kramerin konnte es nicht lassen, ihre Prognosen zu stellen. Sie habe das geahnt, sagte sie, weil am gestrigen Abend, kurz vor dem Achtuhrläuten, zwei schwarze Raben um den Kirchturm gekreist seien, und dies könne niemals etwas Gutes bedeuten.
»Schwarze Raben?«, fragte boshaft der Schuster Heimerl. »Ich habe noch nie gehört, dass es auch blaue Raben gäbe oder rote.«
Niemand wollte darüber lachen. Alle Augen waren auf den See gerichtet. Das Boot schob sich immer näher auf die kreisrunde Stelle zu.
Erst nach einer Stunde kamen sie zurück. Die Menschen am Ufer drängten sich neugierig heran. Der Adlerbräu sah in die gespannten Gesichter ringsum, hob dann die Achseln, ließ sie wieder sinken und nickte schwer vor sich hin.
»Das ist furchtbar!«
Es gab keinen Zweifel mehr. Man hatte draußen einen einzelnen wollenen Fäustling gefunden, eine aufgeweichte blassgelbe Semmel und ein abgerissenes Stück Pferdehalfter mit einer rosaroten Papierrose daran.
Sonst nichts. Aber das war Beweis genug.
»Er war so ein ruhiger und guter Mensch«, jammerte die Kramerin. »Mir tun bloß die armen Kinder Leid.«
Da hob der Adlerbräu den Kopf. Seine Lippen waren schmal und grau.
»Ich werde es seiner Frau sagen müssen.«
Dann bahnte er sich den Weg durch die stumme Menge. Beim Schusterbergl begegnete ihm der Pfarrer. Mit ein paar Worten erzählte ihm Michael Schweikert das entsetzliche Geschehen und schloss: »Ich bitt Sie recht schön, Herr Pfarrer, gehn Sie mit mir. Allein wird mir der Weg zu schwer, und – die rechten Worte muss halt da einer finden.«
Dann gingen sie zum Grottenberg hinauf. Sie wählten nicht den Weg durch den Wald, sondern gingen außen herum, gerade als ob sie es ein wenig hinauszögern wollten. Und je näher sie dem Haus kamen, desto langsamer gingen sie. Ja, selbst dem Pfarrer, dem das Leid so vertraut war wie sonst keinem, wurde dieser Weg unendlich schwer.
Da stand Lena in der Tür. Das Jüngste hatte sie auf dem Arm. Sie hatte die beiden zögernd durch den Apfelgarten daherkommen sehen und war, von einer dunklen Ahnung getrieben, herausgekommen. Jung, kraftvoll und schön stand sie da.
Die Männer traten vor sie hin.
Der Adlerbräu rückte an seinem Hut und sah an ihren fragenden Augen vorbei. Er überließ nun alles dem Pfarrer. Und dieser gütige Mann legte seine Hand auf Lenas Arm und sagte:
»Liebe Frau Eber. Es ist etwas Schreckliches geschehen –«
Lena unterbrach ihn mit zitternder Stimme:
»Was ist mit Christian? Ist er –« Ihr Atem stockte und ihr Gesicht wurde starr, versteinert. Der Adlerbräu griff schnell nach dem Kind auf ihrem Arm. Sie hatte vergessen, dass sie es trug, und musste sich an den Türstock lehnen. Unbeweglich lehnte sie da und ließ alles Weitere über sich ergehen.
»Und er kommt nie mehr wieder?«, flüsterte sie.
»Nein, Frau Erler, er kommt nicht wieder.«
Dann wurde sie ohnmächtig und erwachte erst, als eine Stunde später der Arzt sich um sie bemühte.
In St. Anton war von diesem Tag an von nichts anderem mehr die Rede. Lena rückte damals mit ihren Kindern in den Mittelpunkt der Gespräche und es wurde dabei mit Respekt und Mitgefühl von der jungen Frau gesprochen.
Dabei konnte Lena nicht abwägen, wie viel von dem Gerede ehrliches Mitempfinden oder nur für den Tag zurechtgelegte Pose war. Darum empfand sie in ihrem einfachen Sinn nur die Worte des greisen Pfarrers beim Trauergottesdienst als einen wirklichen Trost, weil sie mit keinerlei Versprechungen verbunden waren. Und vielleicht war auch dies der Ausdruck ehrlichen Mitgefühls, dass die Bräuhausarbeiter einen einfachen schlichten Kranz aus Tannenreisern an der Tumba in der Kirche niederlegten, weil dies an einem offenen Grab nicht möglich war; denn Christian Erler hatte sein Grab mit den beiden Rotschimmeln auf dem Grund des Sees gefunden.
Am dritten Tag nach diesem Trauergottesdienst aber ließ sich Lena mit den Kindern vom Fischer Gabriel in einem Kahn auf den inzwischen völlig eisfreien See hinausrudern und legte in der Mitte des Sees, dort, wo es gewesen sein könnte, einen Latschenkranz mit einer blütenweißen Seidenschleife auf das Wasser. »Letzter Gruß von deiner Lena und den Kindern« stand auf der Schleife.
Eine kleine Weile hielt sich der Kranz auf der Oberfläche, bis sich die Latschen vollgesogen hatten. Dann drehte er sich im Kreis und zog die Seidenschleife hinter sich her langsam in die Tiefe.
Lena hatte sich doch ein wenig getäuscht. Das Mitleid hielt an, es wollte nur keinen rechten Weg zu ihrem Herzen finden, weil sie trotz allem ein stolzes und tapferes Herz hatte, das dieses Mitleid als etwas Erniedrigendes empfand.
Etwa acht Tage später kam der Adlerbräu Michael Schweikert in das Haus am Grottenberg. Heute fühlte er sich viel freier, heute musste er wohl auch selber reden, weil er den Pfarrer nicht mitgenommen hatte, obwohl dies gut gewesen wäre, für Lena wenigstens.
Herr Schweikert fragte, wie sie nun zurechtkomme, sah sich in der Stube um, nickte vor sich hin und meinte: »Sauber haben Sie alles beieinander.« Er setzte sich und zog dann eine Zigarre hervor. »Tja, was ich sagen wollte: Sie wissen wohl schon, dass man im Gemeinderat beschlossen hat, Ihnen weitgehendst behilflich zu sein und die Kinder in einem Waisenhaus oder bei Pflegefamilien unterzubringen.«
Lena verlor alle Farbe. Aber in ihrem Blick brannten Zorn und Stolz.
»Wer gibt Ihnen das Recht, über meinen Kopf hinweg über meine Kinder zu bestimmen?«
»Niemand. Das ist doch ganz natürlich, dass –«
»Ich will Ihnen einmal etwas sagen, Herr Schweikert«, unterbrach Lena ihn. »Sehen Sie sich einmal meine Hände an und meine Arme. Sind das vielleicht Hände, die sich ausruhen? Ich werde arbeiten für meine Kinder von früh bis spät und selber für sie sorgen.«
»Respekt, Respekt«, sagte der Adlerbräu verblüfft und wollte nicht zeigen, dass er in seinem Stolz ein wenig verletzt worden war. Dann nahm er plötzlich mit einem heftigen Ruck den Kopf zurück. »Gut, gut, Frau Erler. Nun ein anderes Thema. Ich habe da ein Gästepaar im Haus, sie kamen zum Wintersport, reisen aber in den nächsten Tagen wieder ab, weil ja nun dieses Tauwetter eingesetzt hat. Reiche Leute, ohne Kinder. Der Herr ist höherer Beamter bei der Regierung, die Frau ist noch sehr jung, aber wie gesagt: keine Kinder. Vielleicht kommen sie morgen einmal bei Ihnen vorbei. Ihren Ältesten, den Ludwig, oder wie er heißt, möchten sie gerne annehmen.«
Lena schüttelte sofort den Kopf. »Ich gebe doch kein Kind her.«
»Sie sollten nicht gleich nein sagen, bevor Sie nicht gründlich Für und Wider erwogen haben. Warum sie gerade auf den Ludwig kommen? Sie waren beim Lehrer und haben sich von seinen geistigen Fähigkeiten erzählen lassen. Der Bub ist sehr begabt, er sollte einmal studieren. Jedenfalls, ich als Vormund bin dafür. Sie verlieren ja auch nichts dabei, denn seine Mutter bleiben Sie immer.«
»Das hört sich an, als ob ihr das schon längst unter euch festgemacht hättet.«
»Naja, ich fühle mich verantwortlich für die Kinder meines ehemaligen Fahrers. Ich habe den Leuten gesagt, dass sie damit rechnen können, dass Sie einverstanden sind. Ich sehe in die Zukunft, Sie können doch dem Buben nie bieten, was ihm dort geboten wird. Der Zufall gibt Ihnen hier einen Vorteil Frau Erler, den Sie nicht übersehen sollten. Ich bin fest überzeugt, dass ich mit dieser Zusage ganz im Sinn Ihres verstorbenen Mannes gehandelt habe.«
Lena wollte etwas darauf erwidern, aber Schweikert ließ sie nicht zu Wort kommen und meinte, sie solle jetzt nichts Unüberlegtes antworten, sondern die ganze Sache einmal überschlafen. Dann ging er, und Lena starrte auf die Sonnenstrahlen auf dem Fußboden, die durch die halb geöffnete Tür hereinfielen.
Ein Kind hergeben? Dieser Gedanke fiel sie zunächst wie etwas Heimtückisches an. War sie denn so arm und machtlos, dass sie sich dagegen nicht wehren konnte? Aber so weit sie diesen Gedanken zunächst von sich schob, im Laufe des Tages überlegte sie aber doch das Für und Wider. Durfte sie, wenn der Bub wirklich das Talent hatte, das ihm zugesprochen wurde, seiner Entwicklung hinderlich sein, auch wenn sie sich deswegen zunächst von ihm trennen müsste? Hatte sie nicht noch vier weitere Kinder? Hatte sie nicht vor allem die Fränzi, an der ihr Herz am meisten hing?
Schließlich machte sie sich gegen Abend auf den Weg ins Pfarrhaus und holte sich dort Rat. Und siehe, der Pfarrer war auch der Meinung, dass man so eine Gelegenheit nicht ohne weiteres von der Hand weisen solle. Ob es zum Glück oder Unglück ausschlage, dies allein liege nicht in der Menschen, sondern in Gottes Hand. Wie es auch sei, sie würde den Jungen ja nicht wirklich verlieren. Ob sie denn den Ludwig selber schon gefragt habe? Weigere er sich, hätte es ohnehin keinen Zweck, ihn zu zwingen.
Nun war Lena entschieden ruhiger geworden. Auf dem Heimweg dachte sie immer noch, dass Ludwig sich auf keinen Fall von ihr würde trennen wollen. Darum traf sie es hart und schmerzlich, als der Bub bei dem Vorschlag gleich ganz leuchtende Augen bekam und nur mehr von der großen Stadt redete, in die ihn sein Glück verschlagen sollte.
So leicht geht er fort von mir, dachte sie, und zum ersten Mal fühlte sie das Alleinsein mit aller Schwere. Und es war nun schon so etwas wie eine große Angst in ihr, als sie ihm die Frage stellte:
»Und willst du dann nie mehr zu uns zurückkommen, Ludwig?«
Aber natürlich wollte er das. In den Ferien und so. »Und denke doch, Mutter«, sagte er eifrig, »wenn ich mit dem Studium fertig bin, kann ich dir immer viel Geld geben und du musst dann nicht mehr so schwer arbeiten.«
Da lächelte Lena, strich ihm über das Haar und schickte sich drein.
Ludwig hielt Wort. Er kam mit seinen Pflegeeltern nach St. Anton in die Sommerfrische. Durch eine Karte hatte er dies mitgeteilt, und Lena richtete eigens für ihn das Stübchen unterm Dach sauber her, überzog das Bett mit blütenweißer Bettwäsche und stellte einen Schrank in den freundlichen Raum. Dann stand sie mit den Kindern auf dem Grottenberg und schaute freudig bewegt auf jedes Boot hinunter, das den See überquerte. Aber vielleicht kamen sie mit dem Bus. Ganz sicher würde es so sein. Dass ihr dies nicht früher eingefallen war!
Fränzi hatte einen Blumenstrauß gepflückt und Johanna ihr bestes Kleid angezogen. Nur die beiden Brüder sahen dem Ereignis des Wiedersehens gelassen entgegen. Thomas war der Meinung, dass der Bruder ihm sicher aus der Stadt etwas mitbringen werde, und Maximilian freute sich nur deshalb, weil die Mutter zur Feier des Tages einen Kuchen backen wollte.
Aber es kam die Dämmerung und es kam die Nacht. Nur Ludwig kam an diesem Tag nicht. Sie kamen erst am anderen Vormittag zu einem kurzen Besuch auf den Grottenberg. Lena schwenkte gerade Wäsche, als sie Stimmen vom Waldweg heraufkommen hörte. Sie spürte, wie ihr Herz für einen Augenblick den Schlag aussetzte vor Aufregung und Freude. Aber im nächsten Augenblick legte sich etwas Schweres auf ihre Seele.
Zwischen dem Ehepaar Sodau ging nicht mehr Ludwig Erler, der Fuhrmannssohn aus dem Häuslein am Grottenberg, sondern ein fremder Knabe mit kurz geschnittenem Haar und einer weißen Hose und einem bunt karierten Hemd. Er sah weder rechts noch links, noch zeigte er sonst irgendeine Regung. Nein, es kam kein Lächeln in sein schmales Gesicht, als er jetzt seine Mutter sah. Und er wusste nicht recht viel anzufangen mit der Frau, die ihn lachend und weinend in die Arme schloss und ihn auf Mund und Augen küsste. Als Lena ihn losließ, reichte er ihr förmlich die Hand und sagte: »Guten Tag, Mutter.«
Das hörte sich angelernt an und war genauso, als wenn er noch hinzufügen wollte: »Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.« Zu allem Überfluss nahm er jetzt noch das Taschentuch und wischte sich Mund und Augen ab. Das gab Lena einen Stoß mitten ins Herz. Sie wurde grau im Gesicht vor Schrecken. Dies mussten auch die Pflegeeltern merken, denn Frau Sodau beschäftigte sich mit ihrer Handtasche, und Herr Sodau nahm seine Brille ab und putzte sie umständlich.
»Tja –«, sagte er dann und sah sich ein wenig um. »Schön haben Sie es hier. Ein bisschen einsam, aber recht nett und gemütlich.«
Lena ging ihnen voran in die Stube, wo die anderen Kinder auf den Bruder warteten. Er reichte auch ihnen die Hand, lächelte und wollte den Maximilian sogar umarmen, aber der trat verstockt zurück und sagte etwas für die Ohren Frau Sodaus Unerhörtes.
»Möchtest mir Läus anhängen?«, sagte er und drückte sich auf die Seite, bohrte die Hände in die Taschen seiner Lederhose und war nicht zu bewegen, Herrn und Frau Sodau die Hand zu geben.
Die Frau war noch jung, am Alter des Mannes gemessen. Sie hatte schöne wellige Haare, geschminkte Lippen und lange dichte Wimpern. Herr Sodau war etwa fünfzig Jahre alt, mit einem glatten, nichts sagenden Gesicht. Die goldene Brille gab ihm etwas von einer blasierten Vornehmheit. In Wirklichkeit war er ein von einem eisernen Pflichtgefühl durchdrungener Mensch, der stark zur Pedanterie neigte.
Ludwig saß artig zwischen den Pflegeeltern und wusste nicht viel anzufangen. Er hatte die feinen weißen Hände auf den Knien liegen und verzog den Mund, als das Hannerl ihn einlud, mit ihrer Puppe zu spielen. Was war das schon? Eine Puppe, der, wenn man sie genau betrachtete, die Wimpern an beiden Augen fehlten, weil Maximilian einen Pinsel daraus gemacht hatte. Er hatte zu Hause eine elektrische Eisenbahn mit Bahnwärterhaus und Stellwerk. Außerdem ein Paar Rollschuhe. Das sollten die hier einmal sehen.
Lena stellte auf einmal eine Frage an ihn. »Willst du nicht lieber hier bleiben, Ludwig?«
»Nein!« Ohne jedes Nachdenken kam die Antwort.
Lena bekam einen schmalen Mund. So weit war es also schon. Aber sie hatte nichts unterschrieben, sie hatte keine Rechte abgegeben. Das sollte er nur wissen.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























